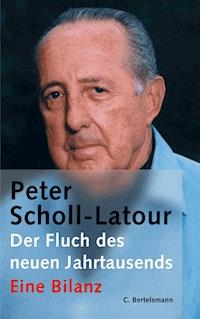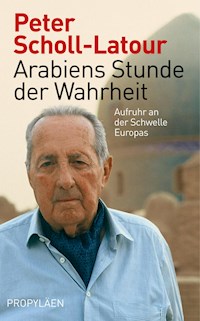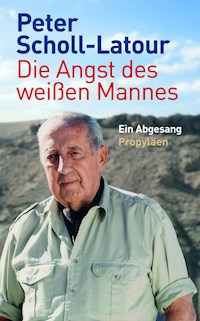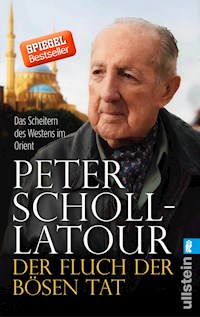19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Niemand hat die internationalen Krisenregionen so oft bereist und die Situationen vor Ort so kenntnisreich beurteilt wie der große Journalist Peter Scholl-Latour. Seine hellsichtigen Analysen bieten auch heute noch Orientierung. Wie sein gesamtes Werk, so schildert auch diese Auswahl seiner Reportagen die fundamentalen Verwerfungen an den politischen und militärischen Brennpunkten der vergangenen sechs Jahrzehnte. Scholl-Latours Beobachtungen erklären noch heute, warum sich die Weltgemeinschaft in manchen Regionen immer wieder geradezu unlösbaren Konflikten gegenübersieht. Seine Reportagen von den Brennpunkten unserer Welt sind eine so fesselnde und erhellende Tour d'Horizon durch die jüngste Weltgeschichte, von den Zeiten des Kalten Krieges bis hin zur neuen Weltunordnung unserer Gegenwart. Der erste Indochinakrieg und die Entzauberung der Kolonialmacht Frankreich in Algerien, der Vietnamkrieg und die Feldzüge in Afghanistan, wo die USA und die Sowjetunion ihr Waterloo erlebten, der von innen- wie außenpolitischen Krisen geplagte Iran, das dramatische Versagen des Westens in beiden Irak-Kriegen oder die Irrungen und Wirrungen des "Arabischen Frühlings" ‒ immer hatte Scholl-Latour fundierte Analysen und zutreffende Prognosen parat. Sie fußten auf einer ausgeprägten Kenntnis des jeweiligen Landes und seiner Bewohner sowie der hinter den Konflikten stehenden historischen Wurzeln, politischen Interessen und religiösen Zwänge. Bis heute sind Scholl-Latours Texte ein Quell der Erkenntnis für all jene, die versuchen, die neue Weltunordnung zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Betrachtungen eines Weltreisenden
Der Autor
Peter Scholl-Latour (1924–2014) arbeitete seit 1950 als Journalist, unter anderem als ARD-Korrespondent in Afrika und Indochina, ARD-Studioleiter in Paris, Fernsehdirektor des WDR, Sonderkorrespondent des ZDF und Herausgeber des STERN. Seine TV-Sendungen erreichten höchste Einschaltquoten, seine Bücher machten ihn zu Deutschlands erfolgreichstem Sachbuchautor und erreichten eine Gesamtauflage in Millionenhöhe.
Das Buch
Peter Scholl-Latours Reportagen von den Brennpunkten unserer Welt sind eine so fesselnde und erhellende Tour d‘Horizon durch sechs Jahrzehnte Weltgeschichte. Seine Beobachtungen spannen den Bogen von den Zeiten des Kalten Krieges bis hin zur neuen Weltunordnung unserer Gegenwart. Der erste Indochinakrieg und die Entzauberung der Kolonialmacht Frankreich in Algerien, der Vietnamkrieg und die Feldzüge in Afghanistan, wo die USA und die Sowjetunion ihr Waterloo erlebten, der von innen- wie außenpolitischen Krisen geplagte Iran, das dramatische Versagen des Westens in beiden Irak-Kriegen oder die Irrungen und Wirrungen des „Arabischen Frühlings“ ‒ immer hatte Scholl-Latour fundierte Analysen und zutreffende Prognosen parat. Sie fußten auf einer ausgeprägten Kenntnis des jeweiligen Landes und seiner Bewohner sowie der hinter den Konflikten stehenden historischen Wurzeln, politischen Interessen und religiösen Zwänge. Bis heute sind Scholl-Latours Texte ein Quell der Erkenntnis für all jene, die versuchen, die neue Weltunordnung zu verstehen.
„Peter Scholl-Latour wollte immer wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält und äußerlich zerreißt.“ Jörg Seewald, ZEIT online
Peter Scholl-Latour
Betrachtungen eines Weltreisenden
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Die Texte dieses Buches erschienen bereits in Peter-Scholl-Latours früherenBüchern Der Tod im Reisfeld (DVA, Stuttgart 1979), Allah ist mit den Standhaften (DVA, Stuttgart 1983), Kampf dem Terror – Kampf dem Islam? (Propyläen, Berlin 2002), Weltmacht im Treibsand (Propyläen, Berlin 2004), Koloss auf tönernen Füßen (Propyläen, Berlin 2005), Die Angst des weißen Mannes (Propyläen, Berlin 2009), Arabiens Stunde der Wahrheit (Propyläen, Berlin 2011) und Der Fluch der bösen Tat (Propyläen, Berlin 2014).Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbHISBN978-3-8437-2213-1© für diese Zusammenstellung Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Lektorat: Cornelia Laqua und Christian SeegerTitelbild: ©akg-images/Doris Poklekowski Gestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Peter Scholl-Latour – Vorbild als Journalist und Welterklärer
Vietnam – Die unverheilte Wunde
Gefangener des VietcongSüdvietnam, im August 1973
Ein asiatischer NapoleonHanoi, im Februar 2004
Atombomben für Dien Bien Phu?Dien Bien Phu, im Februar 2004
Der Elefant und die AmeisenSaigon, im Februar 2004
»The unquiet Americans«Saigon, im Februar 2004
Ein heroischer SuppenhändlerSaigon, im Februar 2004
Vietnamisierung der SärgeHue, im Februar 2004
Die Krallen des Großen DrachenHalong-Bucht, im Februar 2004
Die letzten Tage von SaigonSaigon, im April 1975
Vabanquespiel zwischen Golf und Maghreb
Kein Frühling in ArabienTunis, im Herbst 2011
Piraten und DerwischeTripolis, im Juli 1958
Afrikanische AmbitionenTripolis, im Herbst 2011
Die Abgründe des AtlasTunis, im August 1958
Unruhe bei den KabylenAlgier, im Mai 2011
Befehlshaber der GläubigenMarokko, im Mai 2011
Das Ende eines SchurkenstaatesLibyen, im Herbst 2011
Leere Drohungen an der »roten Linie« Damaskus, im Dezember 2011
Bomben auf TeheranBetrachtungen im Dezember 2011
Der lange Schatten der AssassinenWohin treibt Syrien?
Iran – Ein von der Geschichte ausgelaugtes Land
Zwischen Erzurum und TeheranPersien, im Sommer 1951
Der »Urknall«: Die CIA stürzt MossadeqTeheran, im Sommer 2010 – ein Rückblick
Glanz und Elend der PahleviTeheran, im Sommer 2010
Rotköpfe und JanitscharenArdabil, im Sommer 1995
Das Scheitern des Persischen FrühlingsTeheran, im Sommer 2010
Heimkehr des AyatollahZwischen Paris und Teheran, Februar 1979
Die Last der GeiselnahmeTeheran, im Sommer 1979
Die Botschaft des ErwähltenQom, im Sommer 2010
Khomeini und die JudenTeheran, im Sommer 2010
Ein Becher voll GiftTeheran, im Sommer 2010
Irak ‒ Teufelsaustreibung am Tigris
Am Anfang stand AbrahamUr in Chaldäa, im Februar 2002
Zum Abschuß freigegebenBagdad, im Februar 2002
Die Löwengrube von BabylonBabylon, im Februar 2002
Die zerstörte AtomschmiedeKtesiphon, Oktober 2003
Von den Kurden hängt alles abBagdad, im Februar 2005
»Nach Kerbela, so Gott will!«Kerbela, im März 2005
Alpträume am EuphratNedjef, im März 2005
Elend und »Schwarzes Gold«Basra, im März 2005
Betonmauern und BodyguardsBagdad, im Oktober 2010
Gemetzel am TigrisEin Rückblick
Zweifel am persischen GottesstaatBagdad, im Herbst 2010
Die weinenden Pilger von KerbelaKerbela, Oktober 2010
Afghanistan ‒ Auf den Routen der Mudjahidin
Märtyrer im Kampf gegen die »Schuwari«Befreites Gebiet, Juli 1981
Der Tod des MudjahidPaschtun-Zarghun, im April 1990
Panzerwracks im Pandschir-TalPandschir-Tal, im September 2002
Ländliche Idylle in YaghestanProvinz Wardak, im September 2002
Russisches RouletteMazar-e-Scharif, im September 2002
Zentralasien – Zwischen »Great Game« und Entsowjetisierung
Kasachstan: Triumph des Groß-KhansAstana, im Juli 2009
»Laboratorium der Völkerfreundschaft«Alma Ata, im Sommer 1980
»Demokratie ist Ordnung«Almaty, im Dezember 1992
Die Prophezeiung des Hodscha YassaviAlmaty, im Herbst 1995
Das »Große Spiel« am Kaspischen MeerAktau, im Juli 2009
Kriegsspiele der Shanghai-UnionAktau, im Juli 2009
Kirgistan: Ein Sowjetgeneral hoch zu RoßBischkek, im Sommer 2009
»Rußland wird am Hindukusch verteidigt«Bischkek, im Sommer 2009
Exorzismus auf dem Berg SalomonsOsch, im Sommer 2009
Die Flucht des »Großen Pferdes«Im kirgisisch-chinesischen Grenzgebiet, Sommer 2009
Freitagsgebet bei den UigurenUrumqi, im Sommer 1995
Usbekistan: Vom Parteisekretär zum Groß-KhanTaschkent, im Juni 2002
»Die Kanzeln weinen in Samarkand«Samarkand, im Dezember 1958
»Tod wünsche ich dem Mullah!«Taschkent, im Juni 2002
»Frontier School of Character«Pamir-Gebirge, Tadschikistan, im Sommer 1991
Quellennachweis
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Peter Scholl-Latour – Vorbild als Journalist und Welterklärer
Peter Scholl-Latour – Vorbild als Journalist und Welterklärer
Vorwort von Ulrich Wickert
Peter Scholl-Latour, Jahrgang 1924, gestorben 2014, ist auch heute noch jungen Journalisten ein Vorbild. Einmal im Jahr wird der nach ihm benannte Preis verliehen, und stets bewerben sich hervorragende Journalisten der bekanntesten Medien um diese Auszeichnung, seien sie von der ZEIT, vom Spiegel, von der SZ oder von ARD und ZDF. Und allein schon in die Endauswahl zu kommen und zu den drei Nominierten zu gehören, so schrieb die weltweit angesehene Fotoreporterin Julia Leeb, »ist eine Ehre für mich«, denn Peter Scholl-Latour war seit frühester Jugend ihr Vorbild. Vom Alter her könnte sie Scholls Enkelin sein. So hat sie – wie einst Scholl-Latour – Arabisch studiert und berichtet heute auch aus Gebieten, in denen Menschen unter Krieg und politischen Unruhen leiden. Der Peter-Scholl-Latour-Preis, so meint sie, sei ein wichtiges Signal für ihre Kollegen und sie selbst, da ihre Themen in der breiten Öffentlichkeit unverhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit erhielten.
Schon vor fünfzig Jahren war »Scholl«, wie er nur genannt wurde, jungen Journalisten ein Vorbild. Auch mir. Ich habe ihn 1969 in Paris kennengelernt, da war er längst für deutsche Fernsehzuschauer wegen seiner Berichte aus Vietnam, aber besonders von den Studentenunruhen im Mai 1968 in Saint Germain, ein Symbol.
Sein Büro an den Champs-Élysées war klein und düster. Von den Räumen des Frankreich-Studios der ARD gingen kaum Fenster zum Tageslicht. Aber Peter Scholl-Latour war nicht der Mann, sich damit zufriedenzugeben. Er kaufte für den WDR um die Ecke zwei Etagen in einem neuen, modernen Bürohaus, heute noch eine der besten Dependancen des Senders. Fünfzehn Jahre später sollte ich davon profitieren, als ich in seine Fußstapfen als ARD-Studioleiter in Paris trat. Selber zog er nicht mehr in die hellen neuen Räume ein. Denn er war Fernsehdirektor des WDR in Köln geworden. Für eine kurze Zeit.
Als kleiner Redaktionsassistent lernte ich 1969 sein Bürokabuff kennen. Weil ich Französisch sprach, hatte der WDR mich als Hilfskraft nach Paris geschickt. General Charles de Gaulle war gerade vom Amt des Staatspräsidenten zurückgetreten. Neuwahlen standen an, Senatspräsident Alain Poher gegen den ehemaligen Premierminister Georges Pompidou. Mit wenigen Worten erklärte mir Scholl, weshalb Pompidou gewinnen würde. Klar. War dann auch so. Abends lud er mich nach Hause ein. Es gab Erbsensuppe. Ich hing an seinen Lippen und versuchte diesen Mann, der für uns Jüngere das Urbild des großen Journalisten verkörperte, zu verstehen.
Er bewunderte Charles de Gaulle. Aber er war kein Gaullist. Zunächst dachte ich, Scholl sei ein Konservativer. Aber dann lobte er den Studentenaufstand vom Mai ’68 mit den Worten, das sei doch ein schönes, romantisches Erlebnis gewesen. Dabei war er während der Unruhen in Paris verletzt worden, ein Splitter hatte sich in seinen Derrière verirrt. Übrigens die einzige Verletzung, die er je bei seinen Einsätzen erlitt.
De Gaulle zu bewundern und gleichzeitig die Studentenrevolte zu romantisieren, dazu gehört ein besonders unabhängiger Geist. Den verkörperte Peter Scholl-Latour zeit seines Lebens. In seiner Gedankenwelt hatte political correctness keinen Platz. Ihm ging es auch nie darum, Gefälligkeiten auszutauschen. Er bezog seine Positionen aus Überzeugung.
Als er den Text zu seinem ersten Fernsehfilm selber sprechen wollte, kam ein Fernsehgewaltiger und sagte, da nehmen wir einen ausgebildeten Sprecher, denn mit solch einer Stimme könne man nicht sprechen. Wer hat wohl die Sprachaufnahme gemacht? Er, Peter Scholl-Latour. Selbst sein Nuscheln wurde zum Markenzeichen. In einem Internet-Forum schrieb allerdings selbst Jahrzehnte später ein User mit dem Namen »Schißhase«: »Außerdem soll er mal richtig sprechen lernen: Ansonsten aber interessant.«
Fernsehen bedeutet ja auch Äußerliches. Was viele Männer selbst im Studio nicht schaffen, das verkörperte Peter Scholl-Latour sogar in der Wüste: einfach gut und elegant auszusehen. Wer die Bilder kennt, als Scholl mit seinem Kamerateam vom Vietcong gefangengenommen worden war, der sieht ihn im Reisfeld genauso gepflegt wie sonst in den Straßen von Saigon.
Eine Reihe von Schlüsselerlebnissen erklärt diesen Mann. So kannte er fast alle Schurken dieser Welt. Das Interesse dafür hatte den Ursprung in seiner Jugend. Als er Kind war, beschäftigte die Familie einen Chauffeur aus Polen. Diesen Mann hat Scholl über alles geliebt. Später hat sich dann herausgestellt, daß der Fahrer seine Frau umgebracht hatte.
In Bochum als Sohn eines aus dem Elsaß stammenden Arztes und einer ebenfalls elsäßischen Mutter geboren, wuchs er zweisprachig auf. Seine Eltern steckten ihn auf Grund ihrer Schwierigkeiten mit den Nationalsozialisten (die Mutter hatte jüdische Vorfahren, ihr Bruder wurde im KZ Sachsenhausen ermordet) 1936 in das streng katholische Jesuitenkolleg St. Michel in Fribourg in der Schweiz. Und die Jesuiten haben seinen Geist geschärft. Den Eltern wurde schließlich verboten, Geld in die Schweiz zu schicken, so daß Scholl-Latour sein Abitur 1943 in Kassel machte. Ich kann mir vorstellen, daß der französische Abenteurer und Journalist Joseph Kessel ihm das Muster für ein spannendes Leben vorgespiegelt hat. Im Januar 1945 will Scholl-Latour sich zu den alliierten Truppen in Frankreich durchschlagen, was ihm nicht gelingt. Er will »in jugendlichem Übermut und sträflichem Leichtsinn« (so schreibt er in Leben mit Frankreich, 1988) aus Nazi-Deutschland fliehen, gerät aber bei Graz in Gestapo-Haft, in der er trotz Flecktyphus überlebt.
Der Krieg ist zu Ende, aber nicht das Abenteuer für Scholl, ein Mann mit zwei Nationalitäten und Pässen. Eine seiner Lieblingsgestalten aus der Sagenwelt war Odysseus. Doch der Listige wollte sich in Frauenkleidern vor dem Krieg drücken, was Scholl-Latour, ganz ein Mann wie Joseph Kessel, Kampfflieger im Ersten Weltkrieg, nie in den Sinn gekommen wäre. Als Franzose verdingt er sich bei den Fallschirmjägern und kämpft zwei Jahre für die Grande Nation im Indochinakrieg. Da hat er auch mal Opium geraucht. Es hat ihn beruhigt. Aber er erlebte dabei keine erotischen Phantasien, wie er mir erzählte, deshalb gab es für ihn auch keinen Grund, weiterzurauchen.
Der Einsatz im Indochinakrieg wird kein Zuckerschlecken gewesen sein. In meinem Kriminalroman Die Wüstenkönigin erwähne ich einen Colonel Roger Trinquier als Autor eines Handbuchs des Folterns. Es ist ein grausames Buch, dessen detailliert geschilderte Methoden die französische Armee später im Algerienkrieg anwandte, das an der École militaire in Paris als Lehrmaterial diente und das später in Südamerika und während des Vietnamkriegs in den USA zu Rate gezogen wurde.
Scholl lachte laut, als er mein Buch las, und sagte mir: »Trinquier war als Oberleutnant mein Chef beim Fallschirmkommando im Indochina-Krieg.«
Nach dem Krieg hat Peter Scholl-Latour in Paris studiert, promoviert und dann zwei Jahre im Libanon die arabische Hochsprache erlernt. Hier liegt die Wurzel für seine spätere Fähigkeit, uns die Welt des Islam zu erklären. Er wird Journalist durch Zufall, sein erster Artikel erscheint gleich auf der ersten Seite von Le Monde.
Als Reisekorrespondent ist er viel in Afrika unterwegs. Kurz steigt er in das Umfeld der Politik ein, als Regierungssprecher des saarländischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann. Die beginnende Entkolonialisierung Afrikas begleitet er als Hörfunk-Korrespondent der ARD mit Sitz in Leopoldville und Brazzaville, bevor er 1963 das ARD-Studio in Paris gründet. Aber Paris-Korrespondent zu sein reichte ihm nicht, und so reiste er als Sonderkorrespondent für die ARD nach Vietnam und in den Nahen Osten, sobald es von dort zu berichten galt.
In der kurzen Zeit als WDR-Fernsehdirektor 1969 bis 1971 stärkte er den journalistischen Sinn für Informationssendungen. Aber Reiseanträge der anderen zu unterschreiben, daran hatte er wenig Freude. Und so ging er wieder als Sonderkorrespondent und Studioleiter nach Paris, diesmal für das ZDF.
Mit großen Abenteurern möchte ich ihn vergleichen. Denn er reiste auf dem Kamel wie Sven Hedin durch die Wüste. Er suchte das Herz der Finsternis wie Joseph Conrad. Er schrieb ein klares Wort wie Ernest Hemingway. Er bewunderte Ibn Battuta, der im 14. Jahrhundert der bedeutendste Reisende Arabiens war und in Büchern über seine Erlebnisse berichtete. Und Scholl-Latour ähnelte seinem Lieblingsintellektuellen Ibn Chaldun, der einer spanisch-arabischen Familie entstammte und als erster Gelehrter vor bald siebenhundert Jahren eine Soziologie der islamischen Welt entwickelte und eine Weltgeschichte schrieb.
Als im Herbst 1978 Ayatollah Khomeini für drei Monate in Neauphle-le-Chateau unterschlüpfte, nahm Scholl-Latour Kontakt zu dem Schiitenführer auf, weil er ahnte, wohin dieser Mann Persien führen würde. So kam es, daß Scholl auch in der Maschine saß, die Khomeini am 1. Februar 1979 nach Teheran brachte. Seitdem trug er immer ein Foto mit sich, auf dem er halb im Schneidersitz neben dem Ayatollah hockt. Das war der beste Ausweis, sollte es in islamischen Ländern einmal Probleme geben.
Scholl blieb bis 1983 in Paris. Da widerfuhr dem Stern das Mißgeschick mit Hitlers Tagebüchern. Gruner+Jahr brauchte also flugs einen neuen Kopf für das Magazin, einen Kopf, der die journalistische Katastrophe möglichst vergessen ließ. So kam Peter Scholl-Latour nach Hamburg. Aber er blieb nur ganz kurz. Wöchentlich ein Magazin zu stemmen, das entsprach nicht seinem journalistischen Drang. Bald reiste er wieder für das ZDF, filmte in aller Welt Reportagen. Vor allem aber widmete er sich dem Schreiben von Büchern. Seinen größten Erfolg hatte er 1980 mit Der Tod im Reisfeld, in dem er die Grundzüge von dreißig Jahren Krieg in Indochina analysierte. Das Buch erreichte eine Auflage von mehr als 1,3 Millionen Exemplaren. Dutzende von Büchern folgten.
Scholl-Latour hatte in Deutschland inzwischen eine Sonderstellung als Publizist eingenommen, die manchem zu bedeutend erschien. Manch einer übte sich im »Scholl-bashing«. Dieses Neidverhalten gehört ja leider zu den Unarten im deutschen Journalismus. Besonders das Bild des Islam, das er vermittelte, brachte Scholl zunächst Kritik ein. Schon 1983 hatte er in dem Buch Allah ist mit den Standhaften auch die strengen Seiten des Islam dargestellt. Er warnte vor dem wachsenden politischen Einfluß der Religionen, was einige Orientalisten und Journalisten in Deutschland zu dem Vorwurf veranlaßte, er bausche durch holzschnittartige Vereinfachungen ein Feindbild auf.
Es mag ihn verletzt haben. Auf die Frage der Süddeutschen Zeitung: »Wie gehen Sie mit Kritik um?«, sagte er jedoch in seiner abgeklärten Art: »Mich läßt das kalt. Wo käme ich da hin.« Spätestens nach den Attentaten vom 11. September 2001 konnte Scholl sich bestätigt fühlen. Und wenn Peter Scholl-Latour schließlich durch seine vielen Bücher und Auftritte im Fernsehen zu dem wurde, was manche einen »Welterklärer« nennen, dann lag es an seinem fundierten Wissen, das er in so einfache Worte kleidete.
Tabus kannte Scholl nicht. Er hat schon vor Ausbruch des Irakkriegs gleich erklärt, weshalb dieser scheitern würde. Recht hat er gehabt, obwohl das damals im emotionsgeladenen Umfeld keiner hören wollte. Weil er Tabus für Denkhemmungen hielt, scheute er sich auch nicht, den von US-Präsident Bush inszenierten Irakkrieg genauso zu kritisieren, wie er einst das amerikanische Vorgehen in Vietnam auseinandergenommen hatte. Und trotzdem war er kein Anti-Amerikaner.
Im September 2001 sagte er in der BILD-Zeitung, George W. Bush sei der dümmste Präsident, den die USA je hatten – in der Zeit vor Trump. Eine klare Aussage, wohlbegründet. Aber außer ihm traute sich in Deutschland niemand zu solch einer Beurteilung. Heute, wo wir das Chaos im Nahen Osten sehen, nicken alle bestätigend. Ja, recht hatte er. Recht hatte er auch, als er vorhersah, daß der Westen in Afghanistan scheitern werde.
Peter Scholl-Latour war in seiner Art einzigartig. Er ließ sich niemandem zurechnen und hing von niemandem ab. Seine Statur erwuchs aus seinem Werk, nicht aus einem Netzwerk, wie es heute leider gang und gäbe ist. Er konnte seine Ansichten nicht nur mit genauer Kenntnis der Geschichte begründen, sondern er kannte auch die Politiker, Rebellenchefs, Diktatoren, Generäle und Stammesführer, die das politische Geschehen beeinflußten. Er hatte sie auf seinen Reisen getroffen.
Als wir uns einst in Südfrankreich zum Abendessen trafen, wir wohnten dort in benachbarten Dörfern, klagte Scholl, ihm gingen die Gesprächspartner aus. Und voller Verachtung sprach er über die Tendenz im deutschen Journalismus, zu viel aus dem Archiv zu schreiben. Oder gar hämische Texte mit kritischem Journalismus zu verwechseln.
Peter Scholl-Latour war ein außergewöhnlicher Journalist, aber als Mensch ist er einfach geblieben. Seine liebe Frau Eva scherzte nur, sollte Peter beim abendlichen Mahl in seinem Haus in Südfrankreich nicht deutsche Fleischwurst auf dem Tisch vorfinden, schmecke ihm die Butterstulle nicht. So war er. Und auf seinen Reisen führte er stets die französische saucisson sec mit. Nur nicht im Irak. Wegen des Schweinefleischs in der saucisson. Und zum Schneiden der harten Wurst benutzte er ein Opinel, das scharfe Klappmesser französischer Bauern.
Fünf Jahre nach Peter Scholl-Latours Tod vereint das vorliegende Buch noch einmal ausgewählte Reiseberichte aus jenen Weltregionen, die ihm am meisten am Herzen lagen – neben dem Maghreb und Vietnam waren dies vor allem die Länder Zentralasiens sowie der Iran und der Irak. Es sind Länder und Regionen, die er im Laufe seines mehr als sechzigjährigen Reporterlebens immer wieder bereist hat. Auch wenn sich das politische Umfeld hier und da verändert hat, haben Scholl-Latours Schilderungen von Land und Leuten, von den Landschaften, die er bereist hat, von den Menschen, denen er begegnet ist, Bestand. Scholls tiefe Kenntnis der kulturellen und religiösen Vielfalt dieser Welt und seine unersättliche Neugier auf ebendiese Welt, die in ihrer Vielfalt zu verschwinden droht, sprechen aus jeder Zeile.
Hamburg, im Juli 2019
Vietnam – Die unverheilte Wunde
Gefangener des VietcongSüdvietnam, im August 1973
Wir trauten unseren Augen nicht. Wie das Tor zu einer Geisterwelt ragte ein riesiges Portal in der verwüsteten Landschaft. Die rote vietnamesische Inschrift auf dem oberen Querbalken ließen wir uns von unseren Fahrern übersetzen. Es war darin von Volksbefreiung, von Sozialismus und Wiedervereinigung die Rede. Über dem Seitenpfosten wehte das Fanal der Revolution, die blau-rote Fahne des Vietcong mit dem gelben Stern in der Mitte. Eine Friedenstaube aus Blech klapperte im Wind. Die Straße 13 war unter dem Torbogen durch einen Lehmwall von etwa fünfzig Zentimetern Höhe gesperrt. Viel später erfuhren wir, daß darin Antitank-Minen verbuddelt waren.
Bis dahin war es eine ereignisarme Fahrt gewesen. Ich hatte erkunden wollen, wo nördlich von Saigon auf der im Vorjahr heiß umkämpften Straße 13, auch Road to Peace genannt, die Waffenstillstandslinie oder – besser gesagt – die neue Front verlief. Niemand hatte in Saigon genaue Angaben gemacht. Den südvietnamesischen Divisionsgefechtsstand von Lai Khe, vierzig Kilometer nördlich der Hauptstadt, wo normalerweise alle Unbefugten angehalten und zurückgeschickt wurden, hatten wir in einer großen Schleife passiert. Wir wunderten uns über eine Gruppe von vietnamesischen Zivilisten, die mit vollgepackten Honda-Motorrollern an einer Straßensperre warteten und von Soldaten der Saigoner Regierung kontrolliert wurden. Uns winkten sie durch, angeblich – wie uns nachträglich berichtet wurde –, weil man uns für Mitglieder der Internationalen Kontrollkommission gehalten hatte.
Ein paar letzte südvietnamesische Sandsackbunker, über denen die gelbe Fahne mit den roten Streifen wehte, ein Wachtturm, und dann waren wir allein in einer Landschaft des Todes. Zu beiden Seiten des beschädigten Asphaltbandes häuften sich die Trümmer des Krieges, verrostete Panzer, zerschmetterte Lastwagen, zerbombte Stellungen und Batterien. Das Gras wucherte bereits hoch über dem Unrat der Vernichtung. Der Monsunhimmel hing niedrig und bleischwer. Die Stimmung in dieser feindseligen Einsamkeit war beklemmend. Jean-Louis Arnaud, der Saigoner Korrespondent der französischen Nachrichtenagentur AFP, den ich am Vorabend bei einem Pressecocktail zu dieser Informationsfahrt überredet hatte, legte mir die Hand auf die Schulter. »Du weißt, daß ich um 16 Uhr eine Verabredung mit Botschafter Mérillon in Saigon habe«, mahnte er. Ich erwiderte, daß auch wir bis spätestens 17 Uhr Filmmaterial verschicken müßten. Wir waren ja höchstens fünfzig bis sechzig Kilometer von Saigon entfernt, und es war noch nicht Mittag.
Da hatten wir unvermittelt dieses Portal erreicht, das eindeutig die Grenze des Vietcong-Territoriums war. Eine wirkliche Demarkationslinie zwischen den Bürgerkriegsparteien gab es nicht, und trotz des Pariser Waffenstillstandsabkommens waren die Schießereien nie zur Ruhe gekommen. Die Stellungen der Gegner waren eng ineinander verzahnt. Man sprach vom sogenannten Leopardenfell, so gescheckt boten sich die von der roten Partei beherrschten Gebiete dar. Man hätte sie besser mit Tintenklecksen auf einem Löschblatt verglichen, deren Ränder immer mehr ausliefen. Vor dem Torbogen ließ ich unsere beiden Limousinen wenden, um unverzüglich die Rückfahrt antreten zu können. In Eile wollte ich vor diesen Emblemen der vietnamesischen Revolution einen On-Kommentar sprechen. Während wir das Stativ der Kamera aufrichteten, raschelte es ringsum in den hohen Grasbüscheln, und mit vorgehaltenen Schnellfeuergewehren kamen etwa zwanzig grünuniformierte Soldaten konzentrisch und lautlos auf uns zu. Es bestand kein Zweifel: Der grüne runde Dschungelhut, die Waffen vom Modell AK-47, die flatternden Hosen, die Ho-Chi-Minh-Sandalen wiesen die kleine Truppe als Partisanen des Vietcong oder als nordvietnamesische Reguläre aus.
Die sehr jungen Männer, die uns umzingelten, hatten offene, bäuerliche Gesichter. Ich ging auf den vordersten zu und schüttelte ihm die Hand. Das entsprach einer alten Erfahrung aus den Kongo- und Katanga-Wirren. Der meuternden schwarzen Soldateska, die stets den nervösen Finger am Abzug hatte, flößte man damals durch diese uralte Geste der Verständigung ein wenig Vertrauen ein. Im Übrigen konnte ein händeschüttelnder Bewaffneter nicht schießen. Beim Vietcong schienen solche Befürchtungen überflüssig. Die Truppe war diszipliniert. Die Partisanen wiesen uns ohne jede Aufregung an, im Straßengraben Deckung zu suchen. Offenbar erwarteten sie Störfeuer der Südvietnamesen. Unsere schwerfälligen Limousinen dirigierten sie um das Portal herum nach Norden. In zweihundert Meter Entfernung wurden die Fahrzeuge mit Laub getarnt. Dann führten sie uns in eine Holzbaracke, die als offizieller Kontrollpunkt diente. Das Kameramaterial wurde beschlagnahmt, aber auf heftigen Protest unseres Kameramanns wurde ihm eine Quittung mit dem Stempel der Befreiungsfront ausgestellt. Die Verständigung war schwierig, und wir wußten nicht, wer der diensthabende Offizier war. Rangabzeichen gab es beim Vietcong nicht. Ich hatte meine Begleiter angewiesen, mit unseren Wächtern lediglich französisch und auf keinen Fall englisch zu sprechen.
Der Dolmetscher Thanh, ein Neffe unseres vietnamesischen Mitarbeiters Tran Van Tin, der mit viel List und mit Hilfe seines Onkels der Einberufung in die südvietnamesische Armee bisher entgangen war, schien völlig eingeschüchtert. Er war blaß und brachte kaum ein Wort heraus. Für unsere Pässe interessierten sich die Partisanen nicht sonderlich, auch nicht für die französischen Identitätspapiere Jean-Louis Arnauds. Sie hatten Thanh mitgeteilt, daß ihnen unsere Eigenschaft als Journalisten sehr fragwürdig vorkomme, und niemand könne garantieren, daß wir nicht CIA-Agenten seien. Wir setzten uns auf eine Bank und warteten. Die Blicke der jungen kommunistischen Soldaten waren eher neugierig als feindlich.
Auf der Straße entstand plötzlich Bewegung. Die Honda-Kolonne, die wir am südvietnamesischen Kontrollposten Lai Khe überholt hatten, staute sich vor dem Vietcong-Portal. Hier war mitten im Spannungsgebiet zwischen den Fronten eine Art kleiner Grenzverkehr erhalten geblieben. Die Ortschaft Chon Tanh war kurz vor der offiziellen Feuereinstellung von den Nordvietnamesen umzingelt, aber nicht erobert worden. Die Bürgerkriegsparteien hatten einen Modus vivendi vereinbart und den Einwohnern von Chon Tanh erlaubt, jeden Morgen in südlicher Richtung nach Lai Khe zu fahren, um dort Lebensmittel einzukaufen. Am frühen Nachmittag kehrten sie wieder zurück. Natürlich profitierte auch die kommunistische Seite von diesem Arrangement, sonst hätte sie sich schwerlich darauf eingelassen. Die dreißig Kilometer weiter im Norden gelegene Festung An Loc, die immer noch von südvietnamesischen Fallschirmjägern gehalten wurde, konnte von Saigon aus nur durch Hubschrauber versorgt werden.
Gegen Abend tauchte ein junger Politischer Kommissar auf, musterte uns bärbeißig und sprach kein Wort. Er war von sechs Bewaffneten begleitet. Er gab uns zu verstehen, daß wir zu einer Unterkunft im Wald abgeführt werden sollten. Die Wegstrecke dehnte sich über sieben Kilometer in nordwestlicher Richtung. Unsere Bewacher trugen ihre AK-47 im Anschlag, um jeden Fluchtversuch zu vereiteln. Der Kommissar hielt eine Handgranate abzugsbereit. Das Gelände, durch das wir marschierten, war von B-52-Bombardierungen der Amerikaner verwüstet worden. Die gewaltigen Trichter hatten sich mit Wasser gefüllt und trugen am Rande bereits wieder eine hellgrüne Grasnarbe. Im Westen verschwand die Abendsonne mit tropischer Eile hinter einer bizarren schwarzen Wolkenwand. Wir gingen ohne Gepäck, denn wir hatten für unseren kurzen Tagesausflug nicht einmal eine Zahnbürste oder Anti-Malaria-Pillen, geschweige denn ein Hemd zum Wechseln mitgenommen. Arnaud und die Teammitglieder trugen Stadtschuhe oder Sandalen. Ich hatte als einziger hohe Pataugas-Stiefel angezogen, weil ich seit meinem ersten Indochina-Aufenthalt nur mit festem Schuhwerk ins Reisfeld ging.
Wir drangen in ein modriges Dickicht ein, als die Dämmerung uns einholte. Plötzlich stießen wir auf ein paar Bambushütten und Erdbunker. Der kleine Vietcong-Stützpunkt war durch Stacheldraht und Bambusspitzen abgesichert. Ein ernster Offizier, der im Rang eines Hauptmanns stehen mochte, nahm uns in Empfang. »Versuchen Sie nicht zu fliehen«, ließ er uns übersetzen, »rings um das Lager haben wir Minen gelegt, auf die Sie unweigerlich treten würden.« Die Soldaten, die uns keine Sekunde allein ließen, waren wachsam, aber korrekt. Sie trugen grüne Dschungelhüte und grüne Uniformen. Unsere Fahrer, die im Laufe des Abends von uns getrennt wurden, flüsterten uns zu, daß diese jungen Krieger an ihrem Akzent deutlich als Nordvietnamesen auszumachen seien. Wir waren also nicht bei Partisanen des südvietnamesischen Vietcong, sondern bei einer regulären Einheit aus dem Norden.
Nachdem ich mehrere Male Durchfall vorgetäuscht hatte, um eventuell noch eine Möglichkeit zur Flucht auszukundschaften, ließ mich der Hauptmann in seine Hütte rufen. Die Nacht war hereingebrochen. Die Soldaten sangen schwermütige Lieder. Er mache sich Sorgen um meine Gesundheit, meinte der Kommandeur. In Erwartung einer besseren Medizin rate er mir, Tiger Balm auf meinen Bauch zu schmieren, und er gab mir tatsächlich das kleine Salbendöschen, dem die Ostasiaten eine fast magische Heilwirkung zuschreiben. »Sie täten besser daran, meinen Begleitern etwas zu essen und uns eine Schlafstatt anzubieten«, erwiderte ich. Tatsächlich hockten wir alle noch höchst unbequem auf einer Bretterstange, während die Soldaten ihre grünen Plastik-Hängematten aufspannten. Man brachte uns daraufhin Reis, heißes Wasser und ein paar Halme undefinierbaren Gemüses. Die Nordvietnamesen aßen die gleiche kärgliche Mahlzeit. Der Hauptmann wies uns eine große Pritsche zu. Meine Gefährten nahmen das unerwartete Mißgeschick mit erstaunlicher Gelassenheit hin.
Am nächsten Morgen wurden wir durch das Gegacker der Hühner und die Rufe der Posten geweckt. Über Nacht hatte unsere Bewachung wohl in Funkverbindung mit dem Hauptquartier der Revolutionsstreitkräfte in Loc Ninh gestanden. Eine blutjunge Krankenschwester mit Rotkreuz-Binde nahm sich unser an. Jeder von uns mußte zum heißen Wasser, das uns in Ermangelung von Tee gereicht wurde, eine Chinintablette schlucken. Wie wir später erfuhren, waren die meisten Ausfälle unter den Nordvietnamesen auf Malaria zurückzuführen. In der Reissuppe schwamm sogar ein winziges Stück Fleisch. Der Hauptmann sagte uns, daß unser Gewahrsam bei der Befreiungsfront mindestens ein paar Tage dauern würde. Da wir weder Seife, Rasierzeug, Handtuch, Kopfbedeckung noch Proviant besaßen, biete er sich gern an, das Nötige besorgen zu lassen. Der tägliche Konvoi nach Lai Khe werde in etwa drei Stunden starten. Er wolle unseren Dolmetscher Thanh an die Straße 13 schicken, und wir sollten ihm aufschreiben, was wir brauchten, und Geld dazugeben. Am Nachmittag komme Thanh dann mit dem Gegenkonvoi zurück.
Ich nahm eine Visitenkarte heraus, aber statt die benötigten Gebrauchsartikel zu notieren, schrieb ich auf die Rückseite: »We are prisoners of the Vietcong near Road 13. Please inform immediately German Embassy in Saigon for liberation. Help!« Als ich Jean-Louis den Text zuflüsterte, amüsierte er sich vor allem über das Schlußwort. »Du hast zu viele Beatles-Filme gesehen«, meinte er. Thanh schärfte ich ein, sofort nach Saigon zu fahren und dort die deutsche und französische Botschaft zu alarmieren. Ich warnte ihn vor der südvietnamesischen Polizei. Auf keinen Fall solle er zum Vietcong zurückkommen. Die List klappte. Eine kleine Genugtuung war es schon, die berufsmäßigen Verschwörer des vietnamesischen Untergrunds zu übertölpeln.
Gegen Mittag wurden wir in eine neue Unterkunft verlegt. Wir kampierten jetzt in einem umfangreichen Waldlager, wo ein Bataillon Nordvietnamesen vorgeschobene Etappen- und Erholungspositionen bezogen hatte. Sie wechselten sich dort wöchentlich ab. Die eigentliche Frontlinie war höchstens fünf Kilometer entfernt, und bei Nacht hörten wir Artilleriefeuer. Die Vietcong waren Meister der Tarnung. Aus der Luft war unser Camp mit Sicherheit nicht zu erkennen. Die Laubhütten leiteten zu unterirdischen Höhlen über, wo wir im Ernstfall Schutz vor Granateinschlägen suchen sollten. Unsere Hängematten aus grünem Nylon und die Moskitonetze knoteten wir im überdachten Splittergraben fest. Die Kost bei der Revolutionsarmee sei spärlich, hatte uns der Hauptmann übersetzen lassen. Aber es solle uns nach Möglichkeit das Beste geboten werden. Das Wasser, das man uns reiche, sei abgekocht und keimfrei. »Wir werden uns mit wenig zufriedengeben«, antwortete ich, »wir essen gern Reis, und wenn wir dazu wie die vietnamesischen Bauern etwas Nuoc Mam, die landesübliche Soße aus gefaultem Fisch, bekämen, wären wir hochzufrieden.« Der Hauptmann wurde verlegen: »Reis haben wir ja, aber Nuoc Mam ist für uns ein unerschwinglicher Luxus. Zum Würzen des Reises begnügen wir uns mit salzigem Wasser.«
Wir durften den Umkreis der Hütten nicht verlassen. Der Posten ließ uns nicht aus den Augen. Aber einen Transistor hatte man uns zur Verfügung gestellt, und ein junger Soldat aus Tonking erzählte einem unserer Fahrer, daß er und seine Kameraden regelmäßig BBC hörten. »Die BBC lügt nicht«, hieß es beim Vietcong. Unsere Stimmung war nicht auf dem Höhepunkt. Die Erregung der ersten Stunden machte einer gewissen Depression Platz. Am Nachmittag näherte sich ein streng blickender, hagerer Offizier. Er teilte uns vorwurfsvoll mit, daß der Dolmetscher Thanh, statt unsere Versorgungsgüter zu kaufen und zurückzukommen, wohl zu den »Marionetten« von Saigon geeilt sei, um dort Bericht zu erstatten. Das spreche nicht zu unseren Gunsten. Wir beteuerten unsere Unschuld, aber die beiden vietnamesischen Chauffeure wurden von nun an streng abgesondert, und wir verfügten über keinerlei Verständigungsmöglichkeit mehr. Gegen Abend fand unser Kameramann Josef Kaufmann die Wellenlänge der BBC, und plötzlich hörten wir sein Jubelgeheul. Der Nachrichtensprecher hatte mitgeteilt, daß ein deutsches Fernsehteam und ein französischer AFP-Korrespondent vom Vietcong gefangengenommen worden seien. Der Beauftragte der Befreiungsfront habe erklärt, die Festgenommenen befänden sich bei guter Gesundheit. Damit waren wir die schlimmste Sorge los, unser Verschwinden sei in Saigon gar nicht bemerkt worden. Wir segneten Thanh und wußten zu dem Zeitpunkt nicht, daß der arme Kerl, in Lai Khe von der südvietnamesischen Militärpolizei geschnappt, in einer feuchten Zelle inhaftiert saß und vor Angst fast umkam.
Am dritten Morgen führten uns zwei Soldaten zu einem riesigen B-52-Trichter, der sich mit klarem Regenwasser gefüllt hatte. Wir streiften unsere verschwitzte Kleidung ab und badeten, während die Wachen ihre AK-47 schußbereit hielten. Während der schwülen Mittagsstunde kam die große Wende. Im Urwald knatterte ein Motor, ein völlig ungewohntes Geräusch. Vor unserer Hütte hielt ein schlammverkrusteter Honda. Der Fahrer mochte fünfzig Jahre alt sein und wirkte trotz seiner grünen Uniform wie ein Zivilist. Er schüttelte uns die Hand und hieß uns im Namen der »Nationalen Befreiungsfront von Südvietnam« in den »befreiten Gebieten« willkommen. Er sprach ein fast elegantes Französisch mit stark vietnamesischem Akzent. »Entschuldigen Sie meine Verspätung«, sagte Kommissar Huyn Ba Tang und stellte sich vor. »Die Pisten zwischen Loc Ninh und diesem Lager sind in der Regenzeit kaum befahrbar. Aber ich bringe gute Nachricht. Sie sind von unseren Verbindungsstäben in Saigon eindeutig als Journalisten identifiziert worden. Sie sind nicht länger unsere Gefangenen, sondern dürfen sich als unsere Gäste betrachten. Wenn Sie nach Saigon zurückwollen, werden wir Sie möglichst bald auf den Weg schicken. Falls Sie jedoch den Wunsch haben, in der befreiten Zone zu filmen und über uns zu berichten, steht Ihnen das frei.«
Er wies auf eine Kolonne von Soldaten, die aus dem Busch kam und unsere gesamte Kameraausrüstung – fein säuberlich in Nylon verpackt – bei uns ablieferte. Sogar die Batterien waren noch aufgeladen und brauchbar. Die Wendung unseres Schicksals grenzte ans Wunderbare. Die mißtrauischen Bewacher verwandelten sich in lächelnde Betreuer, die uns in leeren Granathülsen wäßrigen Tee servierten. »Sie werden auf manches verzichten müssen«, meinte Huyn Ba Tang mit einem scheuen Lächeln, »aber wir werden unser Bestes tun, damit Sie sich bei uns wohl fühlen.« Wir hatten ihn gleich liebgewonnen, diesen stillen kleinen Mann, der uns später schilderte, wie er seit mehr als zwanzig Jahren im Untergrund, erst gegen die Franzosen, dann gegen den Diktator Diem, schließlich gegen die Amerikaner und Präsident Thieu gekämpft hatte. Er war vom Tod immer wieder gestreift worden, war zweimal in Flächenbombardements der B 52 geraten und hatte mit der Zähigkeit einer Katze überlebt. Kommissar Huyn Ba Tang war ein Außenseiter und Sonderling unter seinen Revolutionskameraden. Er stammte aus einer kleinbürgerlichen Familie in Saigon. Sein Vater hatte als Beamter früher in der französischen Administration gedient. Zu hohen Ehren und Rängen hatte Huyn Ba Tang es wohl bei den Partisanen nicht gebracht. Wir merkten bald, daß in dieser Armee die harten »Pro’s« aus dem Norden, die Apparatschiks der Partei und die Techniker des Krieges nunmehr das Sagen hatten. Daran gemessen, war Huyn Ba Tang ein frommer Idealist, ein einfältiger Träumer, kurzum ein viel zu guter Mensch.
Von nun an durften wir mit Kamera und Tonbandgerät durch das Lager streifen. Die Soldaten, kräftige Bauernburschen zwischen achtzehn und achtundzwanzig Jahren, lächelten uns freundlich zu. Sie zeigten uns ihre Kochstelle, deren Rauchabzug durch einen hundert Meter langen Tunnel geleitet wurde, um die feindliche Luftaufklärung zu täuschen. Das Feldlazarett verschwand unter Laub und grünen Netzen. Es war so angelegt, daß es binnen zwei Stunden abgebrochen werden konnte. Die Beleuchtung über dem Operationstisch wurde durch ein Fahrrad betrieben. In mancher Hinsicht glich dieses Dschungellager einem Pfadfinder-Camp. Ununterbrochen war für Beschäftigung der Soldaten gesorgt. Sie führten immer noch eine kärgliche Existenz in ihren Laubhütten und den darunter eingegrabenen Schutzstollen, aber gemessen an der Hölle, durch die sie gegangen waren, an den Fuchsbauten und Rattenlöchern, in denen sie vor Napalm und Bomben jahrelang Zuflucht gesucht hatten, lebten sie jetzt unter fast paradiesischen Bedingungen.
Sie stammten fast alle aus dem Norden, diese Krieger der Revolution. Die meisten kamen aus dem übervölkerten Delta des Roten Flusses, und wenn ich ihnen erzählte, daß ich aus dem Ersten Indochinakrieg Hanoi, Haiphong, Nam Dinh und Tanh Hoa kannte, dann leuchteten ihre Augen.
Dies war die Armee des Generals Vo Nguyen Giap. Kaum mehr als zwei Autostunden von Saigon entfernt, richteten sie ihre Uhren nach der Ortszeit Hanois, die um sechzig Minuten differierte. Die einzigen Porträts, die sie entfalteten, waren die Ho Chi Minhs. Am Fahnenmast flatterte zwar offiziell die blau-rote Fahne des Vietcong, aber ihr eigentliches Emblem war die blutrote Flagge Ho Chi Minhs mit dem gelben Stern der asiatischen Volkserhebung. Die Fiktion von Nord- und Südvietnam hatten die Militärs aus Hanoi längst beiseite geschoben. Die Wiedervereinigung Vietnams war knappe siebzig Kilometer von Saigon entfernt bereits vorweggenommen.
Die Dschungelkrieger waren stets auf der Hut. Sie wurden damals schon von der internationalen Presse als »Bo Doi« bezeichnet. Bei Tag und bei Nacht schickten sie selbst aus dieser Etappenstellung Patrouillen aus. Zur Entspannung spielten sie Volleyball, oder sie verfaßten unter Leitung ihrer Politoffiziere Aufsätze über den revolutionären Krieg. Sie mußten auch kriegerische Erlebnisse, natürlich in höchst patriotischem Stil, niederschreiben. Unter einer Bambushütte gab es Zeichenunterricht. Die Bo Doi griffelten in betrüblicher Einförmigkeit und im plattesten Stil des sozialistischen Realismus die Züge eines heldischen Kämpfers gegen den Imperialismus auf das Papier.
Wir wurden zu den ideologischen Schulungskursen eingeladen, die mindestens zwei Stunden pro Tag in Anspruch nahmen. Dabei wurde Selbstkritik geübt, gute Vorsätze wurden gefaßt. Die Zehn Gebote des Revolutionssoldaten wurden durchgesprochen und meditiert. Die ideologische Inbrunst wirkte fast religiös. Das war mehr als eine Lehrstunde in politischem Katechismus, hier wurde die marxistisch-leninistische Doktrin mit der Methodik geistlicher Exerzitien vertieft. Irgendwie schien der heilige Ignatius von Loyola Pate gestanden zu haben.
Wenn die Dämmerung hereinbrach, gingen wir zu den Soldaten, stolperten in der Dunkelheit über die Salat- und Gemüsebeete, die sie angelegt hatten, und suchten im Qualm des Lagerfeuers Schutz vor den Moskitos. Die Verständigung war schwierig. Die Nordvietnamesen waren eine keusche Gemeinschaft. Zum Teil standen sie seit sieben Jahren im Feld. Ihre besten Freunde hatten sie im Krieg verloren. Rangabzeichen trugen sie im Kampfgebiet nicht, obwohl in Hanoi das Offizierscorps mit breiten russischen Epauletten paradierte. Viele Angehörige dieser Eliteeinheit waren mit Tapferkeitsorden ausgezeichnet worden. Der Kontakt zu ihren Familien war spärlich. Eine Postkarte alle sechs Monate sei ein großer Glücksfall. Ihre Freundinnen und Bräute hätten sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Welchen Beruf sie denn nach ihrer Entlassung aus dem Wehrdienst ausüben wollten, fragten wir diese jugendlichen Veteranen, die teilweise schon bei der Neujahrsoffensive von 1968 oder bei den Schlachten von Khe Sanh, von Tay Ninh und Kontum sowie längs der Straße 13 im vordersten Dreck gelegen hatten. Die Antwort lautete stereotyp: »Wir werden das tun, was die Partei von uns erwartet.« Natürlich hatten sie persönliche Wünsche. Und immer wieder kam das Gespräch auf die fernen Mädchen zu Hause. Wie lange sie noch die grüne Uniform des Revolutionssoldaten tragen würden? Die Antwort war einstimmig: »Bis ganz Vietnam wiedervereinigt und das Testament Ho Chi Minhs erfüllt ist.« Dabei klang dieses eingepaukte und fast unmenschliche Pathos spontan und ehrlich. Es waren beklemmende und ergreifende Stunden.
Am folgenden Morgen wurden wir eingeladen, einen Streifen der »befreiten Gebiete« zu besichtigen und zu filmen. Vor dem Aufbruch war sogar ein Armeeschneider erschienen, um unsere Maße zu nehmen. Etwa dreißig Kilometer fuhren wir in russischen Lastwagen und chinesischen Jeeps nach Nordwesten in Richtung auf An Loc. Die Fahrzeuge quälten sich durch ein menschenleeres, von Bomben verwüstetes Gebiet, über das die tropische Natur schon wieder einen gnädigen Vegetationsmantel gebreitet hatte. Das Ziel unserer Reise war das Dorf Minh Hoa, in dem einst französische Plantagenbesitzer ihre Kautschuk-Kulis angesiedelt hatten. Unsere Betreuer wollten uns nach den ersten militärischen Impressionen, die wir bei der Befreiungsarmee gesammelt hatten, auch den zivilen Sektor der Revolution vorführen. Wir bewegten uns in Richtung auf die kambodschanische Grenze, in einem jener seltenen Gebiete, wo ein halbwegs normales Verwaltungsleben auf kommunistischer Seite in Gang gekommen war. Hier war der Osterangriff der Nordvietnamesen vor einem Jahr so überraschend vorgetragen worden, daß die lokale Zivilbevölkerung überrollt worden war. Zur Zeit unserer Festnahme kontrollierten die Kommunisten schon umfangreiche Gebietsteile Südvietnams. Aber nur fünf Prozent der Bevölkerung – etwa eine Million Menschen – siedelten in diesen peripheren und unwirtlichen »befreiten Zonen«. Auf der Fahrt begegneten wir den ersten Zivilisten. Sie waren von den Entbehrungen des Krieges viel härter gezeichnet als die Soldaten. Die Brücken waren zerbombt und durch notdürftige Übergänge oder betonierte Furten ersetzt. Autos sahen wir keine. Dagegen begegneten wir häufig Soldaten und Bauern, die schwer bepackte Fahrräder neben sich herschoben. Im niedrigen Monsunhimmel zuckten Blitze und Wetterleuchten.
Für die rund achthundert Einwohner des Dorfes Minh Hoa war unsere Ankunft eine Sensation. Seit Einmarsch der Revolutionstruppen hatten sie keine Weißen mehr gesehen. Die ehemaligen Kautschuk-Arbeiter machten einen verhärmten und abgerissenen Eindruck. Die grünen Militärs aus dem Norden gaben den Ton an, und über die Lautsprecher dröhnten Kampflieder und heroische Parolen durch die leere Hauptstraße. Vor einer Bambushütte, die speziell für uns hergerichtet worden war, wurden wir von den Partei- und Armee-Kadern offiziell begrüßt. Wir lächelten uns freundlich zu. Major Quoc war der Beauftragte für Propaganda, Major Hoang Befehlshaber des in Minh Hoa stationierten Bataillons. Hauptmann Thien war Reporter bei der Truppenzeitung. Zwischen dem Kameramann Oberleutnant Diet und unserem Team entstand sofort kollegiale Sympathie. »Wir möchten Sie als Freunde aus dem Ausland, aus Europa begrüßen«, beendete Major Quoc seine kurze Ansprache, und wir beklatschten uns gegenseitig. Ich sagte ebenfalls ein paar Sätze auf Englisch, die auf Tonband aufgenommen und – wie ich später erfuhr – vom Radiosender der Befreiungsfront am gleichen Abend ausgestrahlt wurden. Ich sprach von der Bewunderung, die der Tapferkeit der vietnamesischen Partisanen und Revolutionäre auch im Westen gezollt werde, und wünschte dem vom Krieg verwüsteten Land Frieden und Wiederaufbau. Für die Forderung der Vietnamesen nach Wiedervereinigung hätten wir als Deutsche und Angehörige einer zwangsweise gespaltenen Nation tiefes Verständnis. Wiederum klatschten wir alle und lächelten uns zu. Der Satz über die Wiedervereinigung wurde allerdings aus der abendlichen Rundfunksendung herausgeschnitten, wohl mit Rücksicht auf die Freunde und Gönner aus der DDR.
Am folgenden Morgen wohnten wir einer politischen Kundgebung bei. Jede Familie hatte mindestens einen Angehörigen entsandt. Der Chef der revolutionären Verwaltung war ein bewährter Untergrundkämpfer mit bulligem Gesicht. Er rief auf zur Erhöhung der Landwirtschaftsproduktion und zum Aufbau »aus eigener Kraft«. Die Atmosphäre dieses Meetings war gedrückt und verkrampft. Die obligaten Hochrufe wurden mit starren Mienen ausgebracht. Ein weißhaariger alter Mann verkündete wie ein Roboter die einstimmige Bereitschaft des Dorfes, am sozialistischen Aufbau mitzuwirken. Von revolutionärer Begeisterung war keine Spur vorhanden.
Das erste Lachen hörten wir am Rande der Kautschukplantage. Die Frauen und Mädchen ritzten die Gummibäume an und überprüften die Holznäpfe, in denen sich langsam der milchige Latex-Saft sammelte. Die französischen Pflanzer hatten sich rechtzeitig nach Saigon absetzen können. Jetzt wußten die Behörden der Befreiungsfront wohl kaum, was sie mit dem spärlichen Gummi-Ertrag anfangen sollten. Exportmöglichkeiten gab es nicht. Die jungen Plantagenarbeiterinnen aus dem Süden beobachteten kichernd, wie die Revolutionssoldaten sich um die Anpflanzung von Gemüse und Maniok in diesem unfruchtbaren Lateritboden mühten. Diese weibliche Heiterkeit schien die Bo Doi zu verunsichern.
In einem geräumigen Lagerschuppen, der als Schule diente, warteten die Kinder von Minh Hoa auf unseren Besuch. Es war eine aufgeweckte und vergnügte Klasse.
Die Kinder faßten schneller Tritt im sozialistischen Rhythmus der neuen Zeit. Wir ließen uns den Text eines ihrer Lieder übersetzen. »In der vergangenen Nacht haben wir im Traum den Onkel Ho Chi Minh gesehen«, so sangen sie, »den guten Onkel Ho mit dem langen Bart und den weißen Haaren. Er hat uns zugelächelt und uns ermuntert, brav und strebsam zu sein. Wir lieben den Onkel Ho, wir lernen fleißig, und am Ende wird uns der Onkel Ho das rote Halstuch der Jungen Pioniere verleihen.«
Neben den Kindern betrachteten die Kommunisten vor allem die jungen Frauen in den »befreiten Gebieten« als potentielle Träger der Revolution. In einer Erwachsenenschule wurde den jungen Arbeiterinnen Lesen und Schreiben beigebracht. Neben marxistischen Schnellkursen gehörte die Glorifizierung des vietnamesischen Nationalgedankens zur beherrschenden Thematik. Die Mädchen schrieben zum Diktat die legendäre Entstehungsgeschichte des vietnamesischen Volkes in ihre Notizblöcke, die Sage vom König Hung und der Königin Au-Cho, denen in grauer Vorzeit aus hundert Eiern – ähnlich der Drachensaat des Kadmos – fünfzig Söhne und fünfzig Töchter, die ersten Vietnamesen, entsprossen.
Gegen Abend bemächtigte sich unserer Begleiter eine leichte Nervosität. Irgendetwas Feierliches stand bevor. Wir hatten bereits eine Woche beim Vietcong verbracht, und unser unfreiwilliger Ausflug näherte sich dem Ende. Wir hatten den letzten Meter Film verdreht. Hauptmann Tac und Oberleutnant Trung hatten uns ein besonders reichhaltiges Nachtmahl gebracht: Hühnersuppe mit Fleischstückchen, Reis, Sardinen aus marokkanischen Konserven und einen Laib Brot, in dem es allerdings von Maden wimmelte. Zur großen Überraschung hatte Trung plötzlich zwei Flaschen Wodka hervorgezaubert. Er stammte aus Hanoi, war aus Reis gebrannt und trug neben dem vietnamesischen Markenzeichen ein Etikett in kyrillischer Schrift.
Der ungewohnte Alkohol beflügelte unsere Stimmung. Wir hatten in den vergangenen Wochen warmes, abgekochtes Wasser, bestenfalls bitteren Tee getrunken, der uns am Schlafen hinderte. Tac blickte jetzt angespannt in die Dunkelheit des Dschungels. Die Glühwürmchen hatten ihren Reigen aufgenommen. In der Ferne dröhnten wieder Kanonen. Da ratterte plötzlich ein Motor. Ein Jeep tauchte aus der Finsternis auf. Zwei ältere Offiziere der Partisanenarmee kletterten aus dem Fahrzeug und kamen in unsere Hütte.
Ihren Dienstgrad haben wir nie erfahren. Vermutlich standen sie im Rang von Obersten, der eine war mit ziemlicher Sicherheit ein Politischer Kommissar in hoher Position. Sie traten beide sehr selbstsicher auf und stellten sich als Tung und Hung vor. Wir hatten ein hochpolitisches Informationsgespräch erhofft, wurden jedoch enttäuscht. Die Geheimniskrämerei blieb oberstes Gebot auch dieser hochgestellten Bo Doi. Nicht einmal über die administrativen Strukturen der provisorischen Revolutionsregierung in den »befreiten Zonen« wollten sie sich äußern, aus guten Gründen, wie wir später entdeckten. Sehr bereitwillig hingegen erzählten Hung und Tung aus ihrem Leben. Der eine stand seit siebenundzwanzig Jahren im Untergrundkampf – er war jetzt siebenundvierzig Jahre alt –, der Jüngere hatte sich auch schon vor zwanzig Jahren dem Widerstand angeschlossen. Offensichtlich hatte diese schreckliche Zeit sie nicht zermürbt. Sie sprachen mit auffällig leiser Stimme, und das Lächeln wich nie von ihren Lippen. Das Schlimmste sei überstanden, bestätigten sie, seit die Partisanen nicht mehr bei Tag und Nacht wie Ratten unter der Erde leben müßten. Dennoch hätte der Krieg sie furchtbar geprüft. Von ihren Familien, die aus den südvietnamesischen Städten Camau und Can Tho stammten, waren sie seit vielen Jahren getrennt. Hung wußte nicht, was aus seinen beiden Töchtern geworden war. Tung hatte einen Sohn im Krieg verloren; ein zweiter war schwer verwundet. »It is a dignity and a glory.« Dann verschwanden die beiden Obersten so plötzlich, wie sie gekommen waren. Sie fanden zurück in ihr wahres Lebenselement der letzten zwanzig Jahre, in die Nacht und in den Dschungel.
Wir waren in unsere ursprüngliche Etappenstellung im Umkreis der Straße 13 zurückgekehrt und rüsteten uns für das Überschreiten der Linien. Es war noch Nacht, als wir die sieben Kilometer zwischen dem Camp und der Straße 13 zurückmarschierten. Schwerbewaffnete Soldaten begleiteten uns. Aber dieses Mal waren sie zu unserem Schutz erschienen. Der Morgen kam fahl und grau. Wir hatten bereits das ominöse Vietcong-Portal an der Straße 13 erreicht und versteckten uns im Gestrüpp der Böschung. Mit mysteriöser Präzision waren auch unsere beiden Limousinen zur Stelle mitsamt den Chauffeuren, die wir seit sieben Tagen nicht mehr gesehen hatten. Die Fahrer machten einen wohlgenährten Eindruck. Die Autos waren teilweise noch mit Tarnzweigen bedeckt. Im Morgendunst über uns knatterten südvietnamesische Hubschrauber nach Norden und versorgten die eingeschlossene Garnison von An Loc. Hauptmann Tac sprang auf den Asphalt. Er zeigte mit dem Gewehr auf den Konvoi von Motorrollern, der auch an diesem Morgen, aus der Ortschaft Chon Tanh kommend, pünktlich auf uns zufuhr. »Diese Honda-Fahrer sind Ihr bester Schutz, wenn Sie jetzt durch die Linien zu den Saigon-Truppen fahren«, flüsterte er; »wären Sie mit Ihren beiden Limousinen allein auf der Straße, liefen Sie Gefahr, von der Gegenseite beschossen zu werden. Keilen Sie sich mit Ihren Wagen zwischen diese Grenzgänger ein!« Wir umarmten uns wie alte Freunde. Es war ein Moment ehrlicher Ergriffenheit.
Tac riß die Autotüren auf und spornte unsere Chauffeure an. Wir machten eine Kurve um den Lehmwall unter dem Portal, in dem die Panzerminen steckten, und rumpelten durch einen Graben in Richtung auf die südvietnamesischen Vorposten. Rechts und links von uns knatterten die Hondas aus Chon Tanh, deren Fahrer uns verdutzt beobachteten. Wir hatten die Grenze des Vietcong-Gebiets und die Ehrenpforte noch keinen Kilometer hinter uns, da wurden wir durch wild schreiende Soldaten der Armee von Saigon gestoppt. Sie trugen amerikanische Stahlhelme und kugelsichere Westen. Das A-16-Gewehr hielten sie im Anschlag und feuerten in die Luft, als unsere Fahrer nicht sofort bremsten. Drei Soldaten zwängten sich neben uns auf die Sitze. Sie waren aufgeregt und richteten ihre Waffen auf uns. Nach und nach entspannte sich die Atmosphäre. Wir waren jetzt von Jeeps der Militärpolizei eskortiert und bogen in eine befestigte Regimentsstellung ein, über der die Fahne Südvietnams wehte. Ein Fallschirmmajor in elegant geschnittener Uniform erwartete uns. Er war schlank wie eine Wespe und trug ein hellblaues Seidentuch im Ausschnitt seiner Tarnbluse. »Seien Sie trotzdem bei uns willkommen«, grüßte der Major. »Sie sind es wahrscheinlich auch leid, mit Rattenfleisch abgefüttert zu werden, denn was Besseres gab es bei den Kommunisten wohl nicht.« Er reichte jedem von uns eine eiskalte Flasche Coca-Cola. Eine Woche lang hatten wir von eisgekühlter Coca-Cola geträumt, während wir unser warmes Wasser schlürften – ja, dieses US-Getränk, an dem uns normalerweise gar nichts lag, war zu einer Zwangsvorstellung geworden. Jetzt tranken wir die Flasche gierig aus, aber der braune Saft schmeckte schal.
Ein asiatischer NapoleonHanoi, im Februar 2004
Die vergilbte Fotografie hängt in einem billigen Holzrahmen an der Wand des altmodischen Salons. Aber sie beherrscht den Raum wie ein Altarbild. Die beiden jungen Asiaten, die dort im Jahr 1946 von einem Amateur abgelichtet wurden, könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der rechten Seite steht der vietnamesische Revolutionär und Staatsgründer Ho Chi Minh. Der ziegenbärtige, hagere Volksheld, dessen sehnige Beine in Sandalen stecken, trägt ein schlichtes Hemd und zerknautschte Shorts. Neben ihm, in Habachtstellung, reckt sich sein jüngerer Landsmann und Gefährte Vo Nguyen Giap, der in weißem Kolonialanzug, dunklem Schlips und schwarzen Schuhen sichtlich auf Eleganz bedacht ist. Giap hatte es unter der französischen Kolonialverwaltung Indochinas zum Geschichtslehrer an einem Gymnasium Hanois gebracht, ehe er sich 1944 der kleinen kommunistischen Widerstandsgruppe Ho Chi Minhs anschloß.
Giap war dreiunddreißig Jahre alt, als er von dem »Übervater« Ho beauftragt wurde, die Streitkräfte eines noch gar nicht existierenden Staates Vietnam aus dem Nichts aufzubauen. Als »asiatischer Bonaparte« hat er Geschichte gemacht. Er gelangte zu höchstem Ruhm, als seine Bauernkrieger nach der Erstürmung der Dschungelfestung Dien Bien Phu die französische Republik im Juli 1954 zur Preisgabe ihrer fernöstlichen Besitzungen zwangen.
Zwanzig Jahre später wurde Giap zum »stupor mundi« – er verblüffte die Weltöffentlichkeit, als seine »barfüßigen Soldaten« nach zehnjährigem mörderischen Abnutzungskampf die Supermacht USA aus Indochina vertrieben.
Heute ist Vo Nguyen Giap zweiundneunzig Jahre alt. Aus den Führungsgremien von Armee, Regierung und Partei ist er ausgeschieden. Aber von seinen Landsleuten und den Veteranen wird er weiterhin als eine Art nationaler Kriegsgott verehrt. Wir sind an diesem warmen Februartag in seine ockerfarbene Villa in der Hoang-Dieu-Straße bestellt worden. Das Haus war einst für hohe französische Kolonialbeamte gebaut worden. Seit deren Auszug hat sich wenig verändert. Die Möbel sind bescheiden, die Sofas und der Sessel durchgesessen. Ein mächtiger Ventilator ist immer noch nicht durch eine moderne Klimaanlage ersetzt worden.
Der Anwesenden bemächtigt sich feierliche Erwartung, als Vo Nguyen Giap den Raum betritt. Ich bin mir des Vorzugs dieser Begegnung voll bewußt, denn um die Gesundheit des Feldherrn, der lange Jahre in Dschungel und Wildnis verbrachte, ist es nicht gut bestellt. Der kleingewachsene Mann, den Alter und Entbehrung ausgezehrt haben, beeindruckt dennoch auf den ersten Blick. Er hat für unser Interview seine Uniform mit den breiten goldenen Epauletten angelegt, die noch in Schnitt und Farbe dem sowjetischen Modell entspricht. Ich begrüße Giap mit einer Anrede, deren ich mich in meinem Leben nur einmal zuvor bedient hatte, als ich General de Gaulle vorgestellt wurde. »Je vous présente mes respects, mon Général«, und diese Höflichkeit scheint Giap zu gefallen.
Das Gespräch kommt zwanglos in Gang. Der General formuliert seine Sätze in vorzüglichem Französisch. Wir unterhalten uns über seinen Werdegang, und ich vergleiche den Greis mit dem Bild an der Wand. So sehr hat sich sein breites, energisches Gesicht gar nicht verändert. Vor allem die Augen haben jene amüsierte Lebhaftigkeit bewahrt, die schon in frühen Jahren den jovialen Oberkommandierenden von den puritanischen, bärbeißigen Mitgliedern des vietnamesischen Politbüros vorteilhaft unterschied.
Wir wenden uns schnell militärischen Dingen zu. Mir geht es vor allem darum, seine Meinung zur amerikanischen Verstrickung in den Irakkonflikt zu vernehmen, der so oft und oberflächlich mit dem unglückseligen US-Engagement in Vietnam verglichen wird. Die Antwort kommt zögerlich und knapp. In Mesopotamien fände ein ungerechter Aggressionskrieg statt, und dazu enthalte er sich überflüssiger Kommentare. Viel bereitwilliger als mit dieser problematischen Gegenwart beschäftigt sich Giap mit der glorreichen Vergangenheit. Die Feiern zum 50. Jahrestag der Schlacht von Dien Bien Phu stehen unmittelbar bevor.
»Rückblickend muß ich immer wieder betonen«, so beginnt Giap, »daß allein unser Volk mit seinem unbändigen Freiheitswillen und seiner grenzenlosen Opferbereitschaft uns zum Triumph über die französische Kolonialmacht und über die Amerikaner verholfen hat. In Dien Bien Phu wollte uns der französische Oberkommandierende, General Navarre, zur Entscheidungsschlacht zwingen. Er wollte uns ausbluten. Er hatte sich zu weit vorgewagt, aber auch wir hatten uns damals auf fünfhundert Kilometern halsbrecherischer Fels- und Dschungelwege von unseren Versorgungsbasen entfernt.«
Schon damals waren die Fahrräder – mit bis zu zweihundert Kilogramm Munition und Proviant beladen – das unentbehrliche Transportmittel. Zweihunderttausend waren im Einsatz. Zweihunderttausend Hilfskräfte, Männer und Frauen, wurden aufgeboten, um diese einzigartige logistische Leistung zu erbringen. Die schweren Geschütze wurden in qualvollem Hauruckverfahren Zentimeter um Zentimeter über die von den Regengüssen des Monsuns aufgeweichten Steilhänge gehievt. Die französischen Stäbe hatten dem Vietminh allenfalls zugetraut, ein paar Granatwerfer bis in die Umgebung ihres Réduits zu befördern.
»Ich habe nie eine Offiziersschule oder gar eine Militärakademie besucht«, berichtet Giap mit amüsiertem Lächeln. »Vielleicht bestand darin meine Überlegenheit gegenüber jenen Absolventen der ›École Militaire‹, die nicht fähig waren, sich aus den Routinevorstellungen ihrer strategischen Ausbildung zu lösen.« Seinen militärischen Ruhm hat Giap, der sich stolz als militärischer Autodidakt präsentiert, als Meister der »revolutionären Kriegführung« erworben, und darin liegt seine immer noch beispielhafte Aktualität. Das Studium der Geschichte hat ihn inspiriert. Napoleon Bonaparte war sein oberstes Vorbild. Nicht etwa der Kaiser, der die strahlenden Siege von Wagram und Austerlitz errang, sondern der unbekannte Truppenführer Bonaparte. Der frühe Italienfeldzug war richtungweisend, als der noch junge Korse seinen Soldaten die Bewältigung der steilen Gebirgspässe mit den Worten befahl: »Wo eine Ziege ihren Weg findet, kann auch ein Mensch durchkommen. Dort, wo nur ein einzelner Soldat seinen Weg findet, passiert auch ein Bataillon.« Eine seltsame Faszination hat der »Empereur des Francais« auf den jungen Intellektuellen ausgeübt, der ansonsten viele Gründe hatte, die Kolonialmacht zu verabscheuen, war doch seine erste Frau, eine glühende Patriotin, in deren Kerkern umgekommen.
Von Clausewitz ließ sich Giap angeblich in dem Maße leiten, wie dieser das Erreichen politischer Zwecke als Meßlatte für den militärischen Erfolg definierte. Er griff auch auf die Anweisungen des chinesischen Philosophen Sun Tzu zurück, der schon im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine Partisanentaktik beschrieb, an der auch Mao Zedong sich orientieren sollte. »Der Feind rückt vor«, so heißt es bei Sun Tzu, »dann weichen wir zurück. Der Feind schlägt ein Lager auf, dann setzen wir ihm zu. Der Feind ist ermattet, dann greifen wir an. Zieht der Feind sich zurück, dann verfolgen wir ihn.«
Der vietnamesische Autodidakt hatte bei seinem Studium auch auf ein Vorbild zurückgegriffen, das zwar in einem ganz anderen geographischen Umfeld agiert hatte, im Zeichen der Globalisierung jedoch als Parallele zitiert werden sollte. Giap bezog sich auf den britischen Orienthelden T.E. Lawrence, den Organisator des arabischen Aufstandes gegen das Osmanische Reich und auf dessen Buch Die sieben Säulen der Weisheit. Die Chancen einer Volkserhebung gegen einen weit überlegenen Gegner werden dort wie folgt beschrieben: »In der Regel stehen die Freischärler einer konventionellen Armee gegenüber, einer disziplinierten Besatzungstruppe, deren Mannschaftsstärke für den ihr vorgegebenen Raum nicht ausreicht und die unfähig ist, von ihren befestigten Stützpunkten aus die gesamte Region zu beherrschen. ... Eine Rebellion bedarf allenfalls der aktiven Beteiligung von zwei Prozent der Bevölkerung unter der Voraussetzung, daß sie sich auf eine Vielzahl passiver Sympathisanten stützen kann.«
Diese Guerilla-Maxime, die sich in den frühen fünfziger Jahren als erfolgreiches Rezept gegen die überlegene französische Kolonialtruppe bewährte und zehn Jahre später der amerikanischen Supermacht zum Verhängnis wurde, findet seit März 2003 beim heillosen Engagement der US Army zwischen Bagdad und Mossul, zwischen Faluja und Nedjef eine späte, sensationelle Bestätigung. Im Sommer 1946 war allerdings der Begriff »asymmetrischer Krieg« noch nicht geläufig.
Während einer Gesprächspause serviert uns ein Soldat ungesüßten grünen Tee. Dann wenden wir uns wieder dem Thema Dien Bien Phu zu. Welches denn seine schwierigste Entscheidung bei der Erstürmung dieses französischen Bollwerks gewesen sei? Giap zögert nicht. »Sie wissen, daß die Chinesen, die uns mit Material belieferten, mir auch hochrangige Militärberater zur Seite gestellt hatten.« Diese seien natürlich auf die Theorien Mao Zedongs eingeschworen gewesen und hätten auf die Anwendung jener Methode der »vagues humaines«, der menschlichen Sturmflut, gedrängt, die sich im Koreakrieg bewährt hatte.
Vergleichbare Mannschaftsreserven standen Giap im Frühjahr 1954 nicht zur Verfügung. Ein erster geballter Ansturm war überaus blutig abgeschlagen worden. Also ging der vietnamesische Oberkommandierende zum maulwurf-ähnlichen Ausbau endloser Laufgräben, Stollen und Tunnelsysteme über. Auf diese Weise wurden die verstreuten Hügelfestungen des Gegners in unermüdlicher, erschöpfender Sappen-Arbeit umklammert und erstickt. »Eine solche Leistung kann nur erzielt werden, wenn Sie sich auf das totale Engagement des Volkes verlassen können, wenn Ihre todesverachtenden Soldaten die Parole beherzigen: Sieg um jeden Preis.« Als der erbitterte Kampf nach fünfundfünfzig Tagen zu Ende ging und die rote Fahne mit dem gelben Stern über dem Befehlsbunker der Franzosen gehißt wurde, stand Vo Nguyen Giap seinem eigenen Erfolg noch mit einem solchen Staunen gegenüber, daß er von dem sich ergebenden General Castries verlangte, er solle sich förmlich ausweisen.
Giap hat sich während der Konversation zusehends entspannt. Eine gewisse Herzlichkeit kommt zwischen uns auf, obwohl er wissen muß, daß ich in der ersten Phase des französischen Indochinakrieges auf der anderen Seite gekämpft hatte. Die Höflichkeit gebietet, daß wir die Gastlichkeit des alten Feldherrn nicht überstrapazieren. Bevor wir uns erheben, vertraut er mir eine bislang unbekannte Anekdote an: »Nach unserem Sieg von Dien Bien Phu hat Ho Chi Minh mich in die Arme geschlossen und beglückwünscht. Dann hat er mir befohlen: ›Von nun an mußt du dich auf unseren nächsten Feldzug vorbereiten – gegen die Amerikaner.‹« Ganz anders hätten sich die großen kommunistischen Verbündeten verhalten. Nachdem die Pariser Regierung im Genfer Abkommen am 21. Juli 1954 endgültig ihre Ansprüche auf Indochina preisgegeben hatte, seien Peking und Moskau bei ihm vorstellig geworden und hätten ihn eindringlich davor gewarnt, sich jemals mit den Amerikanern anzulegen und mit diesem übermächtigen Gegner in einen Krieg verwickeln zu lassen.
Wie es so manchen Soldaten geschieht, die unendliches Blutvergießen und fürchterliche Zerstörungen in Kauf nahmen, gibt sich auch General Vo Nguyen Giap beim Abschied einer irenischen Wunschvorstellung hin: »Wir sollten mit dem Kriegführen ein für allemal Schluß machen. Ce qui compte pour l’humanité, c’est la paix – Worauf es für die Menschheit wirklich ankommt, das ist der Frieden. La paix, la paix«, wiederholt er eindringlich.
Atombomben für Dien Bien Phu?Dien Bien Phu, im Februar 2004
Der Flug der Vietnam-Airlines-Maschine nach Dien Bien Phu verläuft auf enttäuschende Weise banal. Die zerklüftete Gebirgslandschaft Westtonkings ist durch Wolken verhüllt. Bei Erreichen des langgezogenen Beckens, in dem sich die Schlacht abspielte, klart das Wetter auf. Über eine Länge von neunzehn Kilometern und eine Breite von zehn Kilometern dehnt sich die Mulde des Nam-Yom-Flusses in Richtung Laos. Die Höhen, die den Kessel beherrschen, erscheinen relativ flach. Auf den ersten Blick erkennt man nicht, daß diese von dichtem Dschungel überwucherten Felsen dem Belagerer perfekte Tarnungsmöglichkeiten verschafften, während sie den Verteidigern eine undurchdringliche Mauer entgegensetzten.
Den Piloten der französischen Luftwaffe, die im April und Mai 1954 bei nächtlichem Himmel über Dien Bien Phu kreisten, hatte sich ein ganz anderes Schauspiel geboten. Ihnen muß mulmig zumute gewesen sein, wenn sie Munition, Verpflegung und ganze Bataillone von Fallschirmjägern in die grauenvolle, von Monsunregen durchpeitschte Dunkelheit auskippten. Am Boden zuckten damals die Mündungsfeuer der Vietminh-Artillerie wie die Grablichter eines riesigen Friedhofs. Was hatte den General Henri Navarre bewogen, im Hochland von Tonking, in diesem unscheinbaren Dorf, wo ein paar hundert Reisbauern vom Volk der Weißen Thai ihr Leben fristeten, die Entscheidung gegen die Revolutionsarmee Vo Nguyen Giaps zu suchen? Von Hanoi ist diese Festung zweihundertsiebzig Kilometer Luftlinie entfernt. Die steilen Schluchten und die grüne Wildnis dazwischen waren für eine europäische Truppe unpassierbar. Von Anfang an war Dien Bien Phu auf die Versorgung durch die begrenzten Mittel der französischen Luftwaffe angewiesen, und deshalb waren die Erfolgschancen minimal.