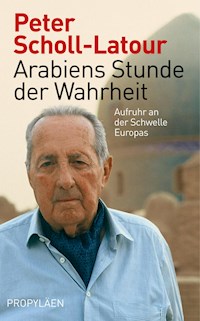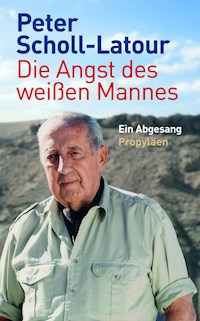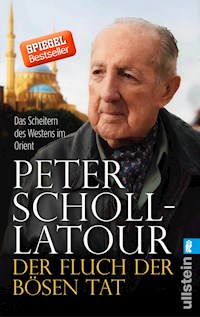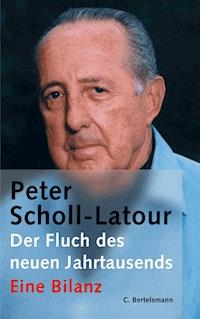
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Peter Scholl-Latour in einer Kolumne den "Steinzeit-Islam" der Taliban anklagte und die CIA beschuldigte, diesen menschenverachtenden "Horden" die Herrschaft über Afghanistan zugesprochen zu haben, schrieb man den 4. Juli 2000. Aus heutiger Sicht liest sich nicht nur dieser Artikel des weltbekannten Journalisten geradezu visionär. Scholl-Latour, der nach dem Anschlag am 11. September 2001 wieder einmal zu einem der begehrtesten Gesprächspartner nicht nur der deutschen Medien avancierte, warnt aus seiner intimen Kenntnis des Islam bereits seit vielen Jahren davor, dass die "Angst vor der moslemischen Kultur übertrieben und gefährlich" und dass auch der Westen vor Gewaltexzessen nicht gefeit sei. Im Gegenteil, speziell die USA würden mit ihrer kurzsichtigen Politik im Stile eines Wildwest-Kapitalismus "bluttriefenden Heilslehren" Vorschub leisten. Die Themen seiner hier versammelten Beiträge reichen von der Globalisierung des Terrors, von den Krisenherden in Asien und Afrika über den "modernen Indianerkrieg" im Kosovo bis zu "Putin dem Großen". Dabei schreibt Scholl-Latour nie aus der Abgeschiedenheit der Redaktionsstube, er berichtet vor Ort aus den zerstörten Kriegsstädten des Balkans und aus den Bergen Afghanistans. Wohlfeile Politikerreden entlarvt er als schamlose Heuchelei, die von einer Globalisierung politischer Kultur weit entfernt ist. Sein immenses Wissen verbindet er mit exakter Recherche und einem geradezu prophetischen Urteil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Peter Scholl-Latour
Der Fluch des neuen Jahrtausends
Eine Bilanz
Copyright
Redaktion: Cornelia Laqua
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2002 by C. Bertelsmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Design Team München
Umschlagfoto: Dieter Bauer
ISBN 3-89480-747-4
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
VorwortErfahrungen im KriegBosnien: Die Schaffung von »Absurdistan«Kosovo: Die Nato in der Balkan-FalleEin neuer Tyrann für ZaireIranischer FrühlingMassenmörderKeine Hoffnung im OrientGespensterwahlWaffenstillstand, aber kein FriedeSignale aus dem »Reich des Bösen«Die Türkei in der EUOperation »Wüstensturm«Schwerkranker ZarDie Zukunft IndonesiensAmerika und ChinaSchamlose HeucheleiErschütterte amerikanische AllmachtDie Gier nach ErdölDroht nach einem Hauch von Frühling eine neue Eiszeit im Iran?Amerika bläst zum HalaliWer spricht offen mit den Türken?Im Land der SkipetarenIntrigen am Hof des kranken KönigsScharnier zwischen Israel und Irak»Heilige Kuh« IndienEindrücke aus KurdistanWas wollte Khatami wirklich vom Papst?Wie sieht Europa am Tag danach aus?Der Kosovo-Krieg kann zum Flächenbrand werdenWas bleibt von der Nato nach dem Krieg?Ein moderner IndianerkriegDie Russen sind wieder im SpielJelzin kämpft wie Boris GodunowDas türkische Volk will den Tod ÖcalansMit List und Härte für mehr FriedenHat die Nato den Kriegwirklich gewonnen?Werden aus Befreiern bald Besatzer?Irans Regime läßt sich nicht so leicht aus den Angeln hebenCharismatischer Despot und politischer JongleurDer chinesische Drache zeigt Taiwan seine KrallenEhud Barak, der WunderknabeReise durch das Kosovo (I)Reise durch das Kosovo (II)Wird Dagestan zum neuen Afghanistan?Der dreckige Diamanten-KriegGaddhafis Show im WüstensandUnabhängigkeit Ost-Timors wird legitimiertZerbricht Indonesien nach der Abspaltung Ost-Timors?Was im Kaukasus für Jelzin auf dem Spiel stehtPakistan jubelt, die Welt bangtKann ein Blinder Indonesien führen?Ist die Türkei nicht reif für einen Panzer?Der Kreml zeigt dem Westen, wie mächtig Rußland noch istPekings Drohung aus dem AllMalaysias zäher PatriarchIsrael und Syrien wollen sich die Hand reichenFeindbild IslamSchafft Assad Frieden mit Israel?Putin wie einst Peter der GroßeReise nach AbsurdistanAlte BlutfehdenDer neue Streit mit Taiwan ist keine Peking-OperIsraels »Vietnam«Die Stunde der PartisanenDie USA nähern sich dem Iran anAm Pulverfaß Kosovo glimmt die LunteGlobalisierung – ohne AfrikaRückblick: Die letzten Tage von SaigonPiratenstück und Heiliger KriegDie Tragödie des Schwarzen KontinentsStrohfeuer oder neue Intifada?Wofür werden deutsche Soldaten in Zukunft gebraucht?In Simbabwe haben Europäer keine ZukunftStets Neues aus AfrikaKoreas feindliche Brüder suchen den Weg zum FriedenClintons »Maginot-Linie«Die diplomatische »Leichtigkeit des Seins«Worum es beim Gipfel in Camp David wirklich gehtWladimir Putins Parallelen zu Peter dem GroßenDer verlorene SiegPutin kann die Fessel Tschetschenien nicht abstreifenMerkwürdige Zufälle in Putins RußlandPutin lebt im kalten KriegEin Rücktritt aus Furcht vor dem Zerfall FrankreichsEine Riesen-Zirkusnummer namens Millenniums-GipfelDie totale Abhängigkeit des Homo sapiensArafat in Nahost isoliert»Jerusalem will ich zum Laststein machen für alle Völker«Der Königsmacher von BelgradAn der Grenze zum Heiligen KriegEine amerikanische PosseHoher Blutzoll am Horn von AfrikaClintons Nahost-Plan hat kaum ChancenDas Ende der Ära ClintonKongos Ausverkauf nach Kabilas TodMit Sharon ist nicht gut Kirschen essenDie Gefahren für die deutsche Kosovo-TruppeDer Schwarze Kontinent brenntBushs weltpolitischer LernprozeßRatlosigkeit im Heiligen LandIn Mazedonien haben Nato und EU versagtAids in Afrika: Massensterben ohne GrenzenDer Zweifel des Westens an sich selbstÜber Krieg und Frieden richten in Mazedonien UCK-Kämpfer»Ein einziger Krieger zu Fuß...«Ungewisser »Kreuzzug«gegen das »Böse«Mit der »Nordallianz«über die Taliban siegenFrankreichs diskreter Beitrag zum KampfDie Rache der HydraDie Demokratie schlägt in Afghanistan keine WurzelnNach Afghanistan nimmt Bush den Irak und Somalia ins Visier»Ein krasser Niedergang«. Ein epd-Interview mit Peter Scholl-LatourÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Vorwort
»Wir haben das dritte Jahrtausend durch ein Feuertor betreten«; der Satz stammt von Kofi Annan, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen anläßlich der Verleihung des Friedens-Nobelpreises. Es hätte dieses Bezugs auf die New Yorker Tragödie vom 11. September gar nicht bedurft, um die psychische Wandlung anzudeuten, die sich unserer Gesellschaft zu bemächtigen scheint. Vergänglichkeit der meisten politischen Projekte und so vieler wirtschaftlicher Heilserwartungen – das ist der Eindruck, der sich dem Autor aufdrängt, wenn er auf die Sammlung seiner Tagesnotizen seit 1997 zurückblickt. Welche Hoffnungen sind doch zerbrochen, seit die Menschheit sich festlich gestimmt versammelte, um den Beginn des neuen Jahrtausends zu begehen! Es läßt sich sogar der Vergleich anstellen zwischen der prallen Zuversicht des 1. Januar 2000 und der Euphorie des 1. Januar 1900. »Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen«, hatte es vor hundert Jahren im Wilhelminischen Reich geheißen. An das bevorstehende Massensterben in den Schützengräben von Flandern oder vor Verdun hätte damals niemand gedacht.
Lassen wir uns vielleicht durch die Aktualität in die Irre führen? Wie oft ist beteuert worden, die Vernichtung des World Trade Center stelle einen historischen Wendepunkt dar. In Wirklichkeit ist dort lediglich der westlichen, vor allem der amerikanischen Öffentlichkeit auf spektakuläre Weise vor Augen geführt worden, daß dem Wunschdenken Grenzen gesetzt sind, daß die Welt nicht gut und die Menschheit nicht lieb ist. Ob die Zahl der Opfer fünftausend oder dreitausend beträgt, soll gar nicht diskutiert werden. Das Ereignis war grauenhaft genug. Aber das Massenmorden hat ja viel früher begonnen. In den vergangenen Jahren sind in Zentral-Afrika mindestens zwei Millionen Menschen eines gewaltsamen Todes gestorben. Doch niemand hat diesen Völkermord zur Kenntnis genommen. In dieser Hinsicht hat sich die Botschaft der Globalisierung mitsamt ihrer aufklärerischen Behauptung, alle Menschen seien gleich, als faustdicke Lüge erwiesen. Es ist eben nicht das Gleiche – auch für jeden einzelnen von uns –, ob die Opfer eines Massakers US-Amerikaner oder Kongolesen sind.
Die wütende Entrüstung des Präsidenten George W. Bush und seine Forderungen nach Vergeltung sind nur allzu verständlich. Aber man erzähle uns nicht, der weltweite Terrorismus habe erst mit den arabischen Selbstmord-Attentätern von New York und Washington seine Fratze enthüllt. Der Terrorismus existiert seit Kain und Abel und hat seitdem nicht aufgehört, in dieser oder jener Form – religiös, ideologisch, nationalistisch oder ganz einfach verbrecherisch motiviert – seine blutige Beute anzufordern. Der Blick richtet sich dabei auf Nord-Irland, das Basken-Land, Algerien, Schwarz-Afrika, Kaschmir, die Philippinen etc., etc. und heftet sich schließlich auf das »Heilige Land«. Selbst die USA wurden ja vor ein paar Jahren durch die mörderische Explosion von Oklahoma erschüttert. Nur war dieser Terrorismus – wie auch die Ermordnung diverser Präsidenten –»home made«, wie man auf Neu-Deutsch zu sagen pflegt.
In diesem Buch handelt es sich um ein Kaleidoskop von Kommentaren, Fernseh-Dokumentations-Texten, Reportagen und Interviews. Sie sind in chronologischer Reihenfolge und ohne jede nachträgliche Berichtigung abgedruckt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist die hedonistische Grundstimmung, in der sich die westliche Industriegesellschaft sonnte, düsteren Vorahnungen eines langsamen, aber unaufhaltsamen Verfalls gewichen. Unter dem Schlagwort »Globalisierung« triumphierte bisland die Überzeugung, dass die Prädominanz von Wirtschaft und High-Technology den Primat der Politik abgelöst habe. Das Denken in strategischen Kategorien – so hörte man – sei vollends zum Anachronismus geworden. Waren wir nicht am »Ende der Geschichte« angelangt, wie Francis Fukuyama seinen Jüngern verkündete?
Es ist ja gar nicht so lange her, da wurde die Profit-Explosion der »new economy« als Verheißung unermesslichen Wohlstandes gefeiert. Die überlieferten Normen des ständigen Pendelns zwischen Aufstieg und Abstieg schienen außer Kraft, der Kurve der Börsengewinne keine Grenze nach oben gesetzt. Die Finanz-Spekulation wurde zum Lebenselement einer ganzen Generation. Der Begriff des »share holders« drohte die staatsbürgerliche Idee des »Citoyen« zu verdrängen, auf die wir uns seit der Französischen Revolution so viel eingebildet hatten. Allen Ernstes wurde in Deutschland die Vorstellung erwogen, man könne den Rentnern und Pensionären von morgen, deren Bezüge durch die schrumpfende Demographie nicht mehr zu decken wären, über die Not des Alters hinweghelfen, indem man sie rechtzeitig zum Kauf von Aktien anhielt. An ein Schrumpfen der Dividende wollte doch niemand mehr glauben. Das Wort Rezession war aus dem ökonomischen Vokabular verbannt.
»Regieren macht Spaß«, hatte es beim Amtsantritt der Koalition Schröder–Fischer geheißen, und somit erhielt die »Spaßgesellschaft« ihre regierungsamtliche Konsekration. Jedermann sprach von jener Globalisierung, die ja auf dem Feld der rasanten Kommunikations- und Informationstechnik tatsächlich alle Erwartungen übertraf. Wer nahm zur Kenntnis, daß im »Herzen der Finsternis«, in den verwüsteten Städten Afrikas, zwar gewaltiger Werbe-Aufwand für Mobil-Telefon, E-Mail und Internet betrieben wurde, daß sich jedoch zwanzig Kilometer davon entfernt im Dschungel der Rückfall in die Steinzeit und ihre düsteren Zauber-Riten vollzog. Nie wirkte Europa provinzieller als in dieser euphorischen Zwischenphase des Tanzes um das Goldene Kalb. Der kommerzialisierte Exhibitionismus der »Love Parade« zum Beispiel sollte Fröhlichkeit vortäuschen, und wer ahnte schon am Rande des Berliner Tiergartens, daß die permissive Überflussgesellschaft, die dort zelebriert wurde, sich auf einer schrumpfenden Insel materiell Begünstigter austobte, daß die weitaus größte Fläche des Globus weiterhin von Elend und Gewalt beherrscht blieb.
Schon die Balkan-Konflikte passten nicht mehr in dieses Bild krampfhafter Harmlosigkeit. Vor allem die Deutschen wurden im Kosovo daran erinnert, dass man nicht »in Unschuld regieren kann«, wie die Franzosen sagen, dass man der Tragik der »conditio humana« nicht entrinnt. Gleichzeitig gab sich die neue Plutokratie in den Ländern der sogenannten »Dritten Welt«– stimuliert durch die Profitneurose der großen multinationalen Konzerne – als »RaubtierKapitalismus«, zu erkennen, wie Helmut Schmidt feststellte. Die Amüsier-Industrie, die durch die Omnipräsenz des Fernsehens einen so ungeheuerlichen Auftrieb erhielt, gefiel sich immer mehr in »Hanswurstiaden«. Wer es nicht verstand, »happy and beautiful« zu erscheinen, war auf der falschen Seite gelandet, galt als »Loser«. Nur noch finstere Kulturpessimisten mochten an Nietzsche und sein Zarathustra-Wort erinnern: »Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln.« Selbst die Jugend Israels stand ja im Begriff, das mythische Staatskonzept der zionistischen Gründerväter in eine Art befestigten Club Méditerrannée umzufunktionieren. Erst durch die Selbstmordattentäter der El-Aqsa-Intifada wurden sie sich wieder bewußt, daß der Judenstaat dazu verurteilt ist, wie Daniel in der Löwengrube zu leben.
Wird die Verwüstung von »Ground Zero« sich dauerhaft in das kollektive Gedächtnis eingraben? Mit dem Abstand von wenigen Monaten können wir folgende grundlegende Veränderungen festhalten, die durch den Schock des World Trade Center bewirkt wurden. Amerika legt in der Abwehr des Terrorismus eine grimmige, quasi religiöse Form der patriotischen Entschlossenheit an den Tag. Die USA scheinen gewillt, ihre Rolle als imperiale Hegemonie voll auszuspielen. Das frühere Prinzip amerikanischer Kriegführung unter Bill Clinton: »no dead – keine eigenen Toten« gilt heute nicht mehr. Präsident George W. Bush fühlt sich offenbar in der Rolle des Welt-Sheriffs und hat einen gnadenlosen Kampf gegen das »Böse« angesagt, der sich eventuell über Jahre und weite Regionen des Erdballs erstrecken soll. Nach der Katastrophe von New York sei sein Land – in einer Reaktion der Selbsterhaltung –»less innocent – weniger unschuldig« geworden, verkündete er.
Alle Spekulationen, die verschwörerischen Kräfte des militanten Islamismus zwischen Nord-Afrika und Indonesien könnten der geballten Macht der US-Streitkräfte die Stirn bieten, haben sich zunächst als Anmaßung und Illusion erwiesen. Es gibt keine islamische Großmacht, sondern nur Gruppierungen religiöser Extremisten, die zwar zum Äußersten, zur Selbstaufopferung bereit sind, aber in offener Feldschlacht keine Chance haben, wie das Beispiel Afghanistan lehrt. In Washington weiß man, daß diese Konfrontation längst nicht gewonnen ist. Auch die Vernichtung Osama bin Ladens und seiner Organisation El Qaida böte keine Gewähr dafür, daß aus der Masse von 1,3 Milliarden Muslimen nicht immer neue Scharen von Gewalttätern und »Märtyrern« hervorgehen werden. Schon kommt Furcht auf, künftige Anschläge gegen die verhaßten Industrie-Nationen des Westens könnten auf Massenvernichtungswaffen zurückgreifen.
Am Rande des schicksalhaften Konfliktes zwischen dem globalen Zivilisationsanspruch Amerikas und dem konspirativen Aufbäumen einer unberechenbaren islamischen Revolution kündigen sich seit dem 11. September schicksalhafte Kräfteverschiebungen an. Bei aller Rivalität zwischen Moskau und Washington in Zentral-Asien zeichnet sich dennoch das Zusammenrücken dieser ehemaligen Gegner des Kalten Krieges ab, ja eine überraschende Interessengemeinschaft gegenüber dem subversiven Islamismus. In der Volksrepublik China ist unterdessen alles im Fluß. Peking könnte sich am Ende als wahrer Nutznießer eines unabsehbaren militärischen Engagements, einer Kräfteverzettelung der USA im Kampf gegen den Halbmond herausstellen. Schon entdecken die beiden »weißen« Mächte – Russland und Amerika – eine heimliche Solidarität angesichts der neuen »gelben Gefahr«, angesichts des unaufhaltsamen Aufschwungs im Reich der Mitte. Was nun die Europäer betrifft, so bieten ihre kleinlichen Rivalitäten, ihre widersprüchlichen Solidaritätsbeteuerungen gegenüber Washington ein klägliches Bild der Schwäche und Abhängigkeit. Die NATO ist ihrer ursprünglichen Sinngebung beraubt und sucht verzweifelt nach neuen Perspektiven. Auf die Europäische Union wirft der 11. September 2001 düstere Schatten der Dekadenz. Die Europäer, so scheint es, begnügen sich bereits mit der Rolle der »Graeculi« der Antike in ihrer Beziehung zum transatlantischen Rom unserer Tage.
Paris, im Dezember 2001
Peter Scholl-Latour
Erfahrungen im Krieg
27. Juni 1999
Der französische Indochina-Krieg, der bei den Linksparteien im Mutterland als »sale guerre«– als schmutziger Krieg – verschrien war, steckte für das Häuflein Korrespondenten, die damals von Hanoi ausschwärmten, voller Tücken. Aber irgendwie nahmen wir diese Gefahren nicht so recht wahr. Viele französische Reporter hatten vorher selbst in der Fernost-Armee gedient und setzten sich den gleichen Risiken aus wie die kämpfende Truppe. Man fuhr im Jeep über unsägliche Schlammpisten in die Gefechtszone bei Vinh Yen und schob sich zum Schutz gegen Minenexplosionen einen Sandsack unter den Hintern. Im Fall von Verwundungen im Dschungel stand damals kein einziger Hubschrauber zum Abtransport zur Verfügung. Ich war nicht einmal in irgendeiner Form versichert.
Ab 1951 kamen auch amerikanische Kollegen hinzu, und wir wußten ohnehin, daß der Krieg, der sich noch bis 1954 hinschleppen sollte, verloren war. Die Volksbefreiungs-Armee Mao Tse-tungs hatte nämlich die Nordgrenze von Französisch-Indochina erreicht. Mir war es damals vergönnt, den äußersten verbliebenen Außenposten unter der Trikolore am Rande von Yünan an Bord einer Ju 52 zu erreichen und von dort aus in Begleitung eines französischen Oberst und eines Trupps Thai-Partisanen nach Norden zu reiten. »Wenn Sie wollen, können Sie ein Stück nach China vordringen«, hatte der Colonel gesagt; »dort drüben gibt es noch ein paar Kuomintang-Partisanen, die wir unterstützen.« In Wirklichkeit waren sie mehr Banditen als Freiheitskämpfer, und ich war froh, als ich mit meinem Thai-Dolmetscher im Galopp wieder den Grenzfluß Nam Kum erreichte. Das war das einzige journalistische Unternehmen, bei dem ich eine Waffe getragen habe.
Die Nacht des französischen Waffenstillstandes habe ich im Reisfeld etwa 100 Kilometer südlich von Hanoi verbracht. Die Soldaten des dortigen Regiments der Kolonial-Infanterie hatten zu meinem Schutz eine rechteckige Grube ausgehoben, wo ich auf einem Feldbett wie in einem Grab schlief, soweit das die Artillerie des Vietminh erlaubte. Die Partisanen Ho Tschi Minhs schossen aus allen Richtungen, feierten ihren Sieg in Erwartung der nahen Feuereinstellung. Am nächsten Morgen verabschiedete mich der französische Kommandant mit den Worten: »In Nord-Afrika sehen wir uns demnächst wieder.« Auf der Rückfahrt nach Hanoi passierten wir mehrere brennende Lastwagen, die auf Minen gefahren waren.
Der Algerien-Feldzug der Franzosen war ein wenig rühmliches Kapitel der auslaufenden Kolonial-Epoche. Das Land war weitgehend »pazifiziert«, und man konnte sich über weite Strecken ohne Geleitschutz bewegen. Der Terror beschränkte sich im wesentlichen auf Bombenanschläge in den Städten oder auf blutige Gemetzel in der Kabylei und im Aures-Gebirge, wo die Algerier der Befreiungsfront und die auf französischer Seite kämpfenden »Harki« sich wie beim Schlachten von Hammeln die Gurgeln aufschnitten zum sogenannten »sourire berbère«, zum »Lächeln der Berber«, wie man damals etwas zynisch sagte. Mit zwei Zügen Fallschirmjägern und Fremdenlegionären habe ich im Akfadu-Wald, im Herzen der Kabylei, aus dem Hubschrauber springend, die Vernichtung einer algerischen »Katiba« aus unmittelbarer Nähe miterlebt, und ich entzifferte auf der grünen Uniformjacke des getöteten Unterführers der »Befreiungsfront« jenen Koran-Spruch, der für mich fortan zum Leitmotiv wurde: »Allah ist mit den Standhaften.« Der wirkliche Totentanz für die Europäer von Algier begann erst, als die Generäle gegen de Gaulle putschten und die Terror-Organisation OAS neben dem wahllosen Mord vermutlicher Gegner auch zur Geiselnahme von Journalisten überging.
Dem außer Rand und Band geratenen Kongo der frühen 60er Jahre blieb es vorbehalten, den Romantitel Joseph Conrads, »Das Herz der Finsternis«, mit aktuellem Inhalt auszufüllen. Den Stammeskriegen Afrikas war die multinationale »Ordnungsmacht« der Blauhelme Dag Hammarskjölds in keiner Weise gewachsen. Italienische Piloten der Uno, die für verhaßte belgische Kolonialisten gehalten wurden, fielen in Kindu, der Heimat der »Leopardenmenschen«, dem Kannibalismus zum Opfer. Persönlich habe ich am Ufer des Tanganjika-Sees – bei einem Abstecher zu den »Simbas«, den Löwen, wie sie sich selbst nannten – das größte Entsetzen meiner Karriere empfunden. Ich sah mich plötzlich wie auf der »Zeitmaschine« H. G. Wells' in eine andere Phase der Menschheit, in den Horror der Steinzeit zurückversetzt, und mitsamt dem Kamera-Team waren wir einer Horde von Speerträgern ausgeliefert, die Tierfelle trugen und sich durch den Wassersegen ihrer Zauberer gegen Kugeln gefeit wähnten.
Der amerikanische Vietnam-Feldzug zwischen 1965 und 1975 mit seinem enormen Material-Aufwand hatte mit dem französischen Indochina-Krieg sehr wenig gemeinsam. Die akkreditierten Journalisten genossen während dieser Kampagne alle nur denkbaren Privilegien. Es genügte, einen Flecken auf der Landkarte anzugeben – auch wenn es sich um den bedrängtesten Stützpunkt der U.S. Army handelte –, und man wurde per Hubschrauber dorthin transportiert. Bedenklich waren vor allem die Explosiv-Fallen und die »Booby-Traps« des Vietcong. Zahlreiche Verluste entstanden auch durch sogenanntes »friendly fire«. Zu Füßen der Höhe 875, die später in einem Film als »Hamburger Hill« glorifiziert wurde, war ich im laotischen Grenzgebiet bei Dak-To Augenzeuge, wie die Bomben der U.S. Air Force in den eigenen Stellungen einschlugen und schwere Verluste verursachten. Zur Entschuldigung der Piloten muß gesagt werden, daß die Nord-Vietnamesen ihre Sappen und Tunnel so nahe an die Amerikaner herangetrieben hatten, daß eine Unterscheidung kaum noch möglich war. In Erinnerung bleibt mir auch die kuriose Praxis des »Body-Counts«, der »Leichen-Zählung« beim Presse-Briefing in Saigon. Jeden Tag wurden horrende Zahlen von getöteten Vietcong gemeldet, denen zufolge längst kein Partisane Ho Tschi Minhs mehr hätte leben dürfen. Wie diese Ziffern zustande kamen, habe ich bei einer Patrouille in Zentral-Annam entdecken können. Ich hatte mich einer Kompanie der First Cav, einer Traditions-Division der Indianer-Kriege, angeschlossen. Von Zeit zu Zeit ließ der Captain Granatwerferfeuer auf die umliegenden Dschungelhöhen eröffnen und meldete per Sprechfunk jedesmal eine willkürliche Zahl getöteter Vietcong. Die Angaben waren frei erfunden, aber der Offizier hielt eine plausible Erwiderung parat. »Wenn ich keine Erfolge melde, stehe ich gegenüber den anderen Einheiten, die ähnlich wie ich operieren, ja dann steht die First Cav gegenüber der Nachbar-Division, die vor keiner Übertreibung zurückschreckt, ziemlich dumm da, und wir werden von unseren Vorgesetzten gerügt.« Meine Gefangennahme durch den Vietcong, die 1973 nur 60 Kilometer nördlich von Saigon erfolgte, hat mich in meiner Erfahrung bestätigt, daß die Vietnamesen sehr disziplinierte und ideologisch motivierte Gegner waren, durchaus keine Wilden. Wäre ich den »Roten Khmer« in Kambodscha hingegen in die Hände gefallen, wäre ich auf der Stelle gefoltert und zu Tode geprügelt worden.
Der erste Golfkrieg, der zwischen Iran und Irak, zwischen dem Ayatollah Khomeini und dem Diktator Saddam Hussein acht Jahre lang andauerte und der etwa eine Million Tote gefordert hat, war viel dramatischer als die nachfolgende amerikanische Operation »Wüstensturm«, von der die Presse weitgehend ausgeschlossen blieb und die beim TV-Publikum als Computerspiel ankam. Meine persönliche Beziehung zu Khomeini öffnete mir hier viele Wege, und das Ufer des Schatt-el-Arab nach der Zurückeroberung des Hafen Khorramshahr durch die iranischen Revolutionswächter und das Halbwüchsigen-Aufgebot der »Bassidji«– mit Hunderten von in der Sonne verwesenden Leichen toter Iraker – bot ein Bild des Grauens. In jener Stunde wäre ein siegreicher Vorstoß der Iraner auf Basra möglich gewesen. Der scheiterte am Einspruch der Mullahs. Der grausigsten Gefahr, die den Kriegsschauplatz in den Sümpfen Mesopotamiens heimsuchte, dem systematischen Gas-Krieg gegen die todesmutigen, aber völlig ungeschützten Angriffswellen der Iraner, bin ich durch ein glückliches Geschick nicht ausgesetzt gewesen. Der völkerrechtswidrige Einsatz hochentwickelter toxischer Stoffe durch Saddam Hussein, das sollte dennoch festgehalten werden, ist von der westlichen Berichterstattung verschwiegen worden. Er war ja durch die USA, durch die Sowjetunion und mehrere europäische Staaten unter flagranter Verletzung aller Menschenrechtskonventionen abgesegnet und beliefert worden.
Der endlose Bürgerkrieg im Libanon ist mir als Vabanque-Spiel, als eine Art russisches Roulette in Erinnerung. Wenn wir als Reporter die feindlichen Linien am Museum von Beirut und an der Karantina passierten, dann hieß es, an den offenen Schneisen Vollgas zu geben, um den Scharfschützen beider Seiten zu entgehen. Im April 1986 fand meine Ankunft in Beirut in Begleitung eines Geo-Fotografen per purem Zufall präzis an einem Tag statt, als die U.S. Air Force versuchte, den libyschen Staatschef Gaddhafi mit ihren Bomben auszulöschen. Mit meinen Kollegen verbrachten wir als einzige Gäste eine beklemmende Nacht im Hotel »Commodore«, nachdem wir erfahren hatten, daß der britische Journalist MacCarthy bei seinem verzweifelten Fluchtversuch in Richtung Flugplatz als Geisel verhaftet wurde. Er sollte mehrere Jahre in qualvollen Kellerverliesen verbringen. Am nächsten Morgen erreichten wir auf Schleichwegen das sichere Drusen-Gebirge, wo unsere Gastgeber uns mit konsternierten Mienen die Leichen von drei eben ermordeten angelsächsischen Geiseln vorführten, die sie am Straßenrand entdeckt hatten. Im Hotel »Summerland«, von schwerbewaffneten Drusen geschützt, fühlten wir uns in Sicherheit und konnten nicht ahnen, daß genau an dieser Stelle wenige Wochen später zwei deutsche Ingenieure von Siemens von Terroristen verschleppt würden, die sich dem Hotel über das Meer genähert hatten. Ich bezweifle, ob mir bei einer Entführung durch die schiitische Hisbollah mein Vorzeige-Foto mit dem Ayatollah Khomeini viel genutzt hätte.
Hingegen kam mir bei meinem Ausflug ins afghanische Kampfgebiet der Umstand zugute, daß ich in angemessener Situation eine Reihe von Koran-Versen zitieren konnte. Bei den Mudschahedin der »Hezb-e-Islami«, die den Ruf von Fanatikern genossen, fühlte ich mich in voller Sicherheit, und mein mongolischer Leibwächter schützte mich, als ruhe der Segen des Propheten auf mir. Unsere gemeinsame Furcht galt den sowjetischen Kampfhubschraubern vom Typ MI-24, denen die Afghanen damals noch wehrlos ausgeliefert waren. Erst die Lieferung von Boden-Luft-Raketen vom Modell Stinger sollte den Mudschahedin Entlastung verschaffen und am Ende den Abzug der Sowjet-Armee erzwingen. Ich habe bei dieser Expedition nie gezögert, in den ständig wiederholten Kampfruf »Allahu akbar« einzustimmen, denn warum sollte ich nicht die Größe Gottes preisen?
Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Aber kommen wir zum Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, der mir – weil er sich auf altem europäischen Kulturboden abspielt – besonders skandalös und abscheulich erscheint. Ich habe dort sämtliche Bürgerkriegsparteien in ziemlich schlimmer Erinnerung: die »Tschetniks« des serbischen Verbrechers Arkan, die am Wochenende von Belgrad heranreisten, sich mit Slibowitz vollaufen ließen und von den Höhen südlich Sarajevos wahllos Passanten abknallten, wie auch jene kroatischen Milizionäre, die beim Passieren ihrer Kontrollposten in der Herzegowina unser mit »D« gekennzeichnetes Auto mit »Heil Hitler« begrüßten. Den muslimischen Partisanen, die im zerschossenen »Holiday Inn« in Begleitung von leichten Mädchen und riesigen Doggen ihre Gelage feierten, bevor sie mit unglaublicher Kühnheit ihre fast unhaltbaren Stellungen gegen die Serben bezogen, hätte man ebensowenig im Bösen begegnen mögen. Den Sadismus, die bestialische Grausamkeit, die sich auf dem Balkan auch heute noch austoben, habe ich weder am Libanon noch in Tschetschenien registriert. Sie bleiben eine Schande für unseren angeblich zivilisierten Kontinent.
Den Kosovo habe ich zur Zeit der serbischen Besetzung – zwischen Pec und Pristina, zwischen Prizren und Novipazar – gründlich inspiziert. Ich werde demnächst in diese Gegend zurückkehren – nicht um den Helden oder den Abenteurer zu spielen, was meinem Alter auch gar nicht mehr anstände, sondern weil mich eine lange Erfahrung gelehrt hat, daß die eigene Anschauung vor Ort durch nichts zu ersetzen ist. Bei ihrem Balkan-Engagement sollten sich die deutschen Politiker, denen die Fürsorgepflicht für die Bundeswehr-Soldaten am Amselfeld obliegt, folgendes einprägen: Das vielgerühmte G-8-Abkommen, das die fiktive Erhaltung einer jugoslawischen Föderation vorsah, ist heute nur noch ein Papierfetzen, und die Entwaffnung bzw. die »Demilitarisierung« der ominösen UCK – eine unerträgliche Wortklauberei – ist bestenfalls punktuell zu erreichen. Die Nato-Truppe droht dort in einen heimtückischen Partisanenkrieg mit wechselnden Fronten und Gegnern verstrickt zu werden. Die Guerilla und deren Bekämpfung gehen stets mit besonderer Brutalität einher. Die französischen Paras, die während der Schlacht von Algier den Bombenlegern der Algerischen Befreiungsfront nachstellten, sind bei den Verhören von Verdächtigen auch vor Folterungen nicht zurückgeschreckt, genausowenig wie die Amerikaner bei der Operation »Phoenix« in Vietnam. Nachträglich hat General Massu, ein durchaus ehrenwerter Offizier, der diese Aktion befehligte, seine bittere Erfahrung in drastischer Form resümiert: »In Algier sind wir hineingeschlittert in Blut und in Scheiße – dans le sang et dans la merde.«
Bosnien: Die Schaffung von »Absurdistan«
ZDF-Film am 24. Mai 2000
Trügerischer Triumph. Berlin, 9. November 1999. Am Brandenburger Tor wurde der zehnte Jahrestag des Falls der Mauer gefeiert und weit mehr. Hier wurde das Signal zum Ende des kalten Krieges gegeben und zur Beseitigung der Teilung Europas. Drei Männer ließen sich hier zujubeln, aber auf jedem von ihnen lastete bereits die Tragödie des Niedergangs. Da stand Michail Gorbatschow, Liebling der Deutschen, denen er die nationale Einheit ermöglicht hatte. Aber in seiner eigenen Heimat ist Gorbatschow als Zerstörer des sowjetischen Imperiums und als gescheiterter Reformer verpönt, ja verhaßt. Während die Deutschen »Gorbi, Gorbi« riefen, brachen die ersten Kämpfe im Kaukasus aus. Wladimir Putin, damals noch Regierungschef, holte zum Gegenschlag aus. Er trat in Tschetschenien in die Fußstapfen der Zaren und der Sowjetmacht.
Als Ehrengast kam dem ehemaligen US-Präsidenten George Bush besondere Huldigung zu. Im Gegensatz zu den europäischen Verbündeten hatte Amerika die deutsche Wiedervereinigung rückhaltlos unterstützt. Bush hatte seine große Stunde im Golfkrieg genossen. Aber es war ein Pyrrhussieg geblieben. Der verhaßte Todfeind Saddam Hussein behauptet sich stärker denn je als neuer Herrscher von Babylon. Die Luftwaffe der Amerikaner und Engländer setzt dort einen unsinnigen Krieg an Euphrat und Tigris fort.
Die zentrale Figur dieses Abends war natürlich Helmut Kohl. Zwar war er ein Jahr zuvor abgewählt worden, aber zum Zeitpunkt der Mauerfeier lastete seine massive Figur noch wie der steinerne Gast auf der verunsicherten Regierungsmannschaft um Schröder und Fischer. Niemand ahnte an jenem Tag, daß dieser neue »eiserne Kanzler« demnächst im Strudel einer obskuren Spendenaffäre unwiederbringlichen Schaden nehmen würde. Am 9. November 1999 blickte Kohl wohl fasziniert auf die erste kriegerische Entfaltung der Bundeswehr am Balkan. Daß dieser Kampfeinsatz ausgerechnet von einer rot-grünen Koalition früherer Pazifisten durchgeführt wurde, mochte ihm als nachträgliche Bestätigung erscheinen.
Beim Triumphfest des Mauerfalls war für Europa Frieden und Freundschaft angesagt. Doch über dem Amselfeld, im deutschen Sektor von Prizren, loderten bereits die Flammen neuer Konflikte und kontinentaler Feindschaften hoch.
In der Geschichte des Balkans und auch heute noch besitzen die Brücken eine hohe symbolische Bedeutung. Wer hat nicht von der Brücke über die Drina gehört, die der Nobelpreisträger Ivo Andric besungen hat? Sie wurde in Bosnien als Symbol ethnischer und konfessioneller Versöhnung dargestellt. Aber die Drina wirkte stets wie eine düstere, gefährliche Trennungslinie. In ferner Vorzeit, vor 1500 Jahren, hatte sich hier die Spaltung des römischen Reiches in Ost und West vollzogen. Diese imperiale Aufteilung dauert bis in die Gegenwart an, verewigt sich im Gegensatz zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. Die Ortschaft Visegrad ist im Bosnien-Krieg ethnisch gesäubert worden. Nur noch Serben leben hier. Die Muslime wurden vertrieben, ihre Moscheen gesprengt. Angst und Mißtrauen herrschen im Umkreis der Drina.
Blicken wir auf Mostar. Hier, am Fluß Neretva, zerbrach in wütenden Schlachten die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben zwischen den »Muslimani« und den kroatischen Katholiken von Bosnien-Herzegowina. Die Sprengung der herrlichen Bogenbrücke aus der osmanischen Epoche wurde von den Kroaten als nachträglicher Akt der Befreiung vom früheren muslimischen Joch vollzogen. Wie soll in dieser Trümmerlandschaft wieder Normalität einkehren?
Eine dritte Brücke: In Sarajevo wiederum war es das Flüßchen Milijacka, das während der Einkreisung der bosnischen Hauptstadt zur Frontlinie geworden war. Heute sind die serbischen Scharfschützen, die aus den Hochhäusern südlich der Brücke ihre Ziele suchten, mitsamt der dortigen serbischen Bevölkerung vertrieben worden. Die Wunde bleibt offen.
Und dann die Brücke übe die Save, die Kroatisch-Slawonien mit dem Norden Bosniens verbindet. Südlich davon, in der Ortschaft Brcko, in dem engen Korridor zwischen den beiden Gebietsfetzen der »Republika Srpska«, verwirren sich alle Gegensätze der artifiziellen bosnischen Staatskonstruktion zu einem gordischen Knoten.
Kosovo-Krieg 1999: Den Nato-Strategen ist nichts Besseres eingefallen, als in Serbien und vor allem bei Novi Sad die Donaubrücken zu bombardieren. Seitdem ist dieser wichtige Wasserweg Europas für den balkanischen Handel und Güteraustausch gesperrt. Militärischer Nutzen war mit der willkürlichen Zerstörung nicht verbunden.
Im äußersten Norden des Kosovo wiederum ist die Brücke über den Ibar, im Herzen der Stadt Mitrovica, zum Schauplatz rabiater Auseinandersetzungen zwischen Kosovo-Albanern und Kosovo-Serben geworden. Hier klafft eine unversöhnliche Feindschaft, die sich ständig neu anheizt. Noch verhindern die dort stationierten Franzosen der Kfor-Truppe und ihre Verbündeten einen neuen Bürgerkrieg.
Schließlich ein Blick auf den Vardar, den breiten Strom Mazedoniens. Die Brücke über den Vardar teilt die Hauptstadt Skopje in zwei ethnisch und konfessionell unterschiedliche Sektoren. Zwar herrscht hier bislang kein Krieg zwischen den christlichen Südslawen auf dem linken und den muslimischen Albanern auf dem rechten Ufer. Aber wie schnell eine zerbrechliche Koexistenz auf dem Balkan in Blutvergießen und Vertreibung umschlägt, haben die grausamen Präzedenzfälle von Bosnien und Kosovo hinreichend bewiesen. Am Vardar, so behaupten nicht nur Pessimisten, zeichnet sich die nächste Balkankatastrophe ab.
Aus den Schlagzeilen ist Bosnien weitgehend verschwunden. Heute schlägt die Stunde der Globalisierung, man redet von Jolo auf den Philippinen, von Simbabwe, von Sierra Leone – aber Bosnien liegt in unserer Nachbarschaft, ist Teil unseres Schicksals. Ich will zunächst auf ein paar Landkarten verweisen, denn diese Landkarten sind oft wahrhaftiger als die Schönfärberei der Politiker. Da haben wir als erstes das Gebilde des ehemaligen Jugoslawien, und es wird sichtbar, daß es in eine Vielfalt von Ministaaten, von absurden Territorien zerfallen ist, die nur eines gemeinsam haben: Sie sind nicht lebensfähig.
Und etwas sehr viel Bedenklicheres kommt hinzu: Die USA, die Nato, die Europäer haben dort Protektorate geschaffen, Schutzgebiete, fast Kolonien, wie wir sie früher aus der Dritten Welt kannten. Das betrifft insbesondere Bosnien-Herzegowina, die Republik Bosnien. Das betrifft in noch stärkerem Maße das Kosovo, aber das gilt auch für Montenegro, das gilt ebenso für diese chaotische albanische Republik von Tirana und das gilt gleichfalls für die artifizielle Republik Mazedonien, die vielleicht den nächsten Krisenherd darstellen sollte. Aus alledem spricht eine große Ohnmacht der Gestaltung von seiten der Europäer, aber auch im Hinblick auf diese Quasi-Kolonien eine gewaltige Anmaßung.
Aber gehen wir zur nächsten Karte über. Sie stammt aus dem Beginn des Bürgerkrieges, als Milosevic noch glaubte, seinen großserbischen Traum verwirklichen zu können. Er hatte bereits weitgehende Territorien in Bosnien an sich gerissen, sogar das serbische Gebiet auf Kroatien ausgedehnt, auf die sogenannte »Serbische Republik Krajina«. Und mit dieser Krajina hat es eine besondere historische Bedeutung. Vor mehr als 300 Jahren waren zahlreiche Serben, vor allem aus dem Kosovo, unter Führung ihres Patriarchen nach Norden abgewandert, um dem osmanischen Joch zu entgehen. Sie hatten dort, mit Zustimmung der Österreicher, eine Art Militärgrenze, die »Krajina«, gebildet. Sie schützten dort Habsburgerreich, aber auch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. 200 Jahre lang haben sie diese Position gehalten, heute sind sie von dort durch den Krieg vertrieben worden. Ihre Standhaftigkeit wurde schlecht gelohnt.
Schließlich zur dritten Karte, der Aufteilung Bosniens, die im Vertrag von Dayton, vor etwa fünf Jahren, vorgenommen wurde, und hier wird die wirkliche Natur von Absurdistan ersichtlich. Denn auf der einen Seite gibt es dort die »Republika Srpska«, die serbische Republik, zwei Fetzen, die voneinander getrennt sind. Sie waren einst vereint durch den schmalen Schlauch von Brcko, fünf Kilometer breit, aber der »High Representative« Petritsch hat dort eine multi-ethnische Zone gebildet. Jetzt hängt der serbische Teil von Banja Luka, militärisch gesehen wenigstens, völlig in der Luft.
Da ist auf der anderen Seite die Föderation von Muslimen und Kroaten, die untereinander noch verfeindet sind. Das sieht aus wie ein Leopardenfell, stellt keine Einheit dar. Und da ist beispielsweise die muslimische Stadt Gorazde – und auf der Karte tut man so, als sei Gorazde mit der Föderation verbunden. In Wirklichkeit existiert hier gar keine Straße, man mußüber serbisches Territorium gehen. Das Ganze wirkt sehr irreal, sehr verworren, unklar, unlogisch. Aber wer zu dieser Ansicht gelangt, hat wahrscheinlich die Realität des heutigen Balkans begriffen.
Für flüchtige Besucher – die europäischen Politiker gehören dazu – mag in Sarajevo friedliche Normalität eingekehrt sein. Längs der früheren Kampflinie am Milijacka-Fluß kann man wieder ohne Gefahr jenes Rathaus besichtigen, in dessen Nähe im Juni 1914 der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand den Kugeln eines serbischen Attentäters erlag. Kein Mahnmal erinnert mehr an diesen Auftakt zum Ersten Weltkrieg. Die weltfremde Vorstellung vom multi-ethnischen Staat ist allen anderslautenden Beteuerungen zum Trotz jedoch in der früheren Vielvölkerstadt Sarajevo zerstoben. Zu 90 Prozent ist die Hauptstadt jetzt von »Muslimani« oder, wie es offiziell und unpräzis heißt, von Bosniaken bewohnt. Zwar sind die Kirchen der beiden christlichen Konfessionen noch im österreichisch geprägten Stadtkern präsent. Doch das Herz Sarajevos, so scheint es, schlägt im Umkreis der Moscheen und des osmanischen Marktes, die längst aufgehört haben, eine folkloristische Attraktion zu sein.
Niemand hat in Sarajevo die Tage des Terrors und der Verzweiflung vergessen, als die Belagerung der Serben sich immer enger zusammenschnürte, als auf die muslimischen Zivilisten wie bei einer Treibjagd geknallt wurde. Die Organisation der Vereinten Nationen, deren weiß gestrichene Panzerspähwagen wie Ambulanzen wirkten, bot höchst unzureichenden Schutz vor der Willkür eines mörderischen Feindes. Die Uno, das muß heute festgehalten werden, hat in der ersten endlosen Phase des Bosnien-Krieges auf erbärmliche Weise versagt.
Der ganze Horror der damaligen Situation kulminierte in dem überwiegend muslimisch besiedelten Städtchen Srebrenica, unweit der Drina. Dort hatte der serbische General Mladic eine isolierte Enklave verhaßter Korangläubiger ein für allemal auslöschen wollen. Frauen und Kinder wurden in Busse verfrachtet und in die Wälder getrieben. Die holländischen Unprofor-Soldaten regten keine Hand, um diese hilflosen Zivilisten zu schützen, und waren am Ende froh, mit dem eigenen Leben davonzukommen. Viele wehrfähige muslimische Männer von Srebrenica wurden in Reichweite der Blauhelme erschossen.
Nur auf den Friedhöfen, beim koranischen Ritual der Totenbestattung, sei der Islam der Bosniaken noch zu erkennen, so meinten die Skeptiker. Für die Ideologen der Aufklärung, die in der Uno, in den Nato-Stäben, in den Kommissionen der EU den Ton angeben, läßt sich diese muslimisch religiös determinierte Nationalität in keine ihrer Schablonen pressen. Zwar füllen sich heute wieder allmählich die Moscheen in den überwiegend von Muslimen bevölkerten Regionen der kroatisch-bosnischen Föderation. Aber den meisten Korangläubigen ist jede präzise Kenntnis der Botschaft des Propheten Mohammed abhanden gekommen.
Die »Muslimani« Bosniens sind entgegen der geläufigen Berichterstattung keine gesonderte Völkerschaft, keine Ethnie, sondern reine Süd-Slawen. Im Mittelalter waren sie als bogumilische Ketzer von den christlichen Kirchen verfolgt worden. Bei Ankunft der erobernden Türken bekehrten sie sich massiv zum Islam. Ihre Marmorgräber mit den kunstvollen Turbanen bekunden, daß sie unter dem Sultan und Kalifen herrschende Positionen bekleideten, daß sie den christlichen Serben oder Kroaten, der sogenannten »Herde des Sultans«, oft als Feudalherren vorstanden.
Im Straßenbild von Sarajevo, von Tuzla, von Zenica, sind wenig verschleierte Frauen zu entdecken. Und dennoch: Wenn der muslimische Präsident Alja Izetbegovic seine anfangs noch bunt gescheckte Truppe besuchte, behauptete sich trotz der weitgehenden Entfremdung gegenüber jeder religiösen Praxis das profunde Identitätsbewußtsein dieser slawischen Muslime. Izetbegovic war als eifernder Muslim von Tito verfolgt worden. Dennoch verdankten seine Glaubensbrüder es dem verstorbenen Marschall, dem Kommunisten und Atheisten Tito, daß ihrer muslimischen Konfessionsgruppe der Status einer gesonderten Nationalität innerhalb der jugoslawischen Föderation eingeräumt wurde. Während des Bürgerkrieges hatten die Serben und Kroaten daraus die grausame Konsequenz gezogen. Um als Mohammedaner identifiziert und eventuell ermordet zu werden, war es nicht notwendig, daß der Betreffende jemals eine Moschee betreten hatte. Sein Name allein wies den Muslim als Erben jener bevorzugten Oberschicht der endlosen osmanischen Herrschaft aus.
Im katholischen, im kroatischen Stadtteil von Mostar, westlich der Neretva, zelebrieren die Franziskaner ein feierliches Hochamt in ihrer Kathedrale, die einer Trutzburg ähnelt. Auch hier vermengen sich Religion und Geschichte. Bis zum Bürgerkrieg sprach man in Bosnien nie von »kroatischen«, sondern stets von »katholischen« Dörfern. Der Franziskaner-Orden blickt am Balkan auf ein altes Privileg zurück. Der türkische Eroberer von Konstantinopel, Mehmet II. Fatih, der auch Bosnien dem Halbmond unterwarf, übertrug dem Franziskaner-Provinzial die Betreuung der katholischen Christen seines Reiches, während für die Orthodoxen, gemäß dem osmanischen Millet-System, der Patriarch von Konstantinopel zuständig war. Der heilige Franz von Assisi, der Prediger der Liebe unter den Menschen, der sogar die Tiere in seinen Lobgesang der Schöpfung einschloß, hatte wohl nicht geahnt, daß seine barfüßigen Jünger eine sehr militante Vorhut der römischen Kirche und des Papstes auf dem Balkan stellen würden. Im Jahr 1993 bewiesen die Kroaten der Herzegowina, unterstützt durch die Republik von Zagreb, daß sie in der Lage waren, den Serben und »Muslimani« standzuhalten und mit ihnen in Greueltaten und Verwüstungen zu wetteifern.
Als Verkörperung allen Übels in der ehemals jugoslawischen Föderation wurde vom westlichen Ausland jedoch der serbische Präsident Slobodan Milosevic wahrgenommen. Er strahlte damals noch Siegesgewißheit aus. Dieser skrupellose Drahtzieher einer unerbittlichen serbischen Machterweiterung wollte auf den Trümmern Bosniens ein großserbisches Reich errichten. Mit den Eliteverbänden der jugoslawischen Armee schien er auch über das Instrument dieser ehrgeizigen Politik zu verfügen. In Bosnien stützte er sich auf den lokalen Serbenführer Radovan Karadzic, der sich als Kriegsverbrecher einen fürchterlichen Namen gemacht hatte. Beklemmend war in diesem Zusammenspiel, daß auch die serbisch-orthodoxe Kirche mit ihrem Patriarchen Pavle an der Spitze die Schachzüge des Präsidenten Milosevic absegnete. Schon seit der osmanischen Zeit bestand für die Serben eine profunde Identität zwischen ihrer prawo-slawischen Kirche und ihrer stets existenzbedrohten Nation.
Im Westen wuchs die Ungeduld über die Unfähigkeit der Uno, dem Morden ein Ende zu setzen. Der Zorn Washingtons richtete sich gegen den ägyptischen UN-Generalsekretär Boutros-Ghali, der sich zwar in kriegerischer Verkleidung zeigte, aber mit seiner bunt zusammengewürfelten Unprofor-Truppe aus allen Teilen der Welt, die über keinen Schießbefehl verfügte, zur Ohnmacht verurteilt war.
Was wiederum Europa und seine politisch zerstrittene Union betraf, so erbrachte es die Demonstration seiner selbstverschuldeten Lähmung. Die Reise des französischen Staatschef François Mitterrand nach Sarajevo im Sommer 1992 und seine theatralische Geste zugunsten der Opfer entbehrte jeder politischen Substanz. Dieser Besuch wurde an Ort und Stelle sogar als Effekthascherei verurteilt. Ungleich tragischer endete der Versuch des französischen Generals Philippe Morillon, der im März 1993 als Oberbefehlshaber der Unprofor mit einer kleinen Eskorte zu der damals noch muslimisch bevölkerten Enklave von Srebrenica durchbrach. Er wurde dort als Retter begrüßt. Seine leichtfertigen Sicherheitszusagen konnte er jedoch nicht einhalten. Am Ende stand die Katastrophe, das Massaker von Srebrenica, nur zwei Jahre später.
Das Gemetzel dauerte schon vier Jahre, da war die Republik Kroatien mitsamt dem beanspruchten Landesteil Herzeg-Bosna nicht mehr auf die Beharrungskraft ihrer Bettelmönche angewiesen. Mit amerikanischer Unterstützung war Präsident Franjo Tudjman, ein früherer Partisanengeneral Titos, zur Verkörperung des autoritären kroatischen Nationalismus geworden. Seine Truppe wurde zu einer Streitmacht aufgerüstet, die der bisherigen serbischen Übermacht gewachsen war. Die Militärparade in Zagreb, nicht frei von Panduren-Romantik und k. u. k. Nostalgie, war das Signal einer strategischen Wende.
In Wirklichkeit war es um die Ambitionen Slobodan Milosevics nicht sonderlich gut bestellt. Er hatte – gestützt auf seine bosnische Landbesetzung – eine Serbische Republik Krajina auf kroatischem Territorium ins Leben gerufen. Aber dieses Hufeisen besaß im Fall eines dezidierten Gegenangriffs keine ernsthafte Verteidigungschance. Von pensionierten amerikanischen Offizieren beraten, mit amerikanischem Material ausgestattet, brach im Juli 1995 überraschend die kroatisch-muslimische Offensive über die Krajina herein. Diese vermeintliche Bastion serbischen Widerstandes wurde beinahe kampflos preisgegeben. Nun waren es 200000 Serben, die ihr Heil in der Flucht suchen mußten und der Drangsalierung durch die Sieger ausgesetzt waren. Der kroatische Staatschef Tudjman genoß seinen Erfolg und hißte die rot-weiß-blaue Fahne mit dem Schachbrett über der Zitadelle von Knin. Der Traum vom großserbischen Reich war zerronnen.
War es der Racheakt eines verzweifelten serbischen Kommandeurs, war es die Selbstüberschätzung des starken Mannes von Belgrad? Auf dem Marktplatz von Sarajevo explodierten am 28. August 1995 jene serbischen Granaten, die 37 Menschen töteten und die weltweite Empörung gegen den serbischen Staatschef Milosevic auf den Höhepunkt trieben. Die Stunde gezielter amerikanischer Luftangriffe gegen die jugoslawischen Versorgungswege hatte geschlagen. Der Regierung von Belgrad wurde bedeutet, daß sie sich einem von Washington diktierten Teilungsplan Bosniens unterwerfen müsse. Damals entstand bei der Nato der irrige und für den Kosovo-Krieg verhängnisvolle Eindruck, ein kurzes Bombardement würde ausreichen, um Serbien in die Knie zu zwingen. In Wirklichkeit hatte Milosevic 1995 nachgegeben, weil sonst auch das serbisch-bosnische Siedlungsgebiet bei Banja Luka an die Kroaten gefallen wäre.
In der amerikanischen Militärbasis von Dayton, Ohio, wurden die drei verfeindeten Kriegsherren an den Verhandlungstisch gezwungen. Der hemdsärmelige Krisenmanager Richard Holbrooke setzte sich durch. Die Waffen schwiegen in Bosnien. Aber bis auf den heutigen Tag stellt sich die Frage, ob es sich dabei um eine brüchige Feuerpause oder um den Ansatz zu einer friedlichen Lösung handelt.
Wer dächte im Zusammenhang mit dem Abkommen von Dayton nicht an jenen Berliner Kongreß, der im Jahr 1878 zur Regelung der Balkan-Fragen angetreten war. Der Kongreß stand unter der Patronage von Otto von Bismarck, und er wollte ein »ehrlicher Makler« sein. Er vertrat auch die Ansicht, daß die ganzen Balkan-Affären nicht die Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert seien. Aber immerhin hat dieses Vertragswerk von 1878 ungefähr dreißig Jahre lang gehalten. Es scheiterte schließlich an dem Gegensatz um Bosnien-Herzegowina, das von Österreich annektiert worden war und das auch von Serbien beansprucht wurde.
Serbien, das wissen die wenigsten, war ja ursprünglich, unter der Dynastie Obrenovic, nach Wien ausgerichtet gewesen, und die Serben sympathisierten mit der deutschen Kultur. Das änderte sich dann, als die Dynastie Karadjordjevic gewaltsam an die Macht kam und König Peter I. ein Südslawien verlangte, von Graz bis Saloniki. Und es gab damals auch genügend katholische Intellektuelle in Kroatien, die eine ähnliche Idee vertraten. Da muß man an die heimliche Komplizenschaft denken, die während des ganzen Bürgerkrieges doch wohl Bestand hatte, zwischen dem Staatschef von Zagreb, zwischen Franjo Tudjman, der jetzt gestorben ist, und Slobodan Milosevic in Belgrad. Sie beide dachten daran, sich den muslimischen Teil von Bosnien untereinander aufzuteilen. Da kommt man letztlich zu dem Schluß, daß es auf dem Balkan keine Guten und keine Schlechten gibt, »no good guys and no bad guys«, wie die Amerikaner sagen würden, sondern nur Starke und Schwache. Wehe den Schwachen!
Eine Disco in Sarajevo. Der Name dieses Tanzschuppens, »Labirint«, klingt wie ein Programm. Hier ist von muslimischer Prüderie wirklich nichts zu merken. Die Jungen richten sich auf die modischen Trends aus New York, Paris oder Berlin aus. Diese junge Generation, die bisher nur die Schrecken des Krieges kennenlernte, möchte krampfhaft zu einer europäisch gefärbten Normalität zurückfinden. Was haben sie noch mit Istanbul oder gar mit Mekka zu tun? Sie werden jetzt als Bosniaken und nicht mehr als »Muslimani« in den offiziellen Registern geführt. Und dennoch bleibt ihr politischer Status und damit ihre kulturelle Identität in jener koranischen Überlieferung verhaftet, die sie gegenüber ihren Nachbarn und sogar gegenüber sich selbst am liebsten abstreifen möchten.
Beim Blick auf Sarajevo und den Bau immer neuer Minarette, die aus dem Häusergewirr herausragen, kommt der Vergleich mit der heutigen Türkei auf. Die verschleierten Mädchen der Gazi-Husrefbegova-Medrese, die den Koran rezitieren, gehören – zumindest in den Städten – einer verschwindenden Minderheit an. Die Gelder für den Bau neuer Moscheen und Koranschulen sollen überwiegend aus den missionierenden Staaten des Orients, aus Saudi-Arabien, aus Kuweit, aus den Emiraten fließen. Immerhin wird der theologische Streit um die wahre Gestaltung islamischen Lebens jetzt auch auf europäischem Boden ausgetragen.
Im Stadion von Sarajevo ist die bosnisch-muslimische »Armija« zum Vorbeimarsch an Alja Izetbegovic angetreten. Innerhalb der Föderation von Kroaten und sogenannten Bosniaken existieren paradoxerweise zwei streng getrennte Truppenkörper. Zwar versuchen die internationalen Verwaltungsstäbe, die unter der irreführenden Bezeichnung »international community« zugegen sind, eine allmähliche Verschmelzung dieser katholischen und muslimischen Kämpfer zu erreichen, stoßen dabei jedoch bei beiden Parteien auf heftigen Widerstand. Der bisherige Oberbefehlshaber der bosnischen »Muslimani«, General Rasim Delic, bezahlte seinen mangelnden Integrationswillen mit vorzeitiger Abberufung.
Am 13. Dezember 1999 wurde in Zagreb der allmächtige Staatsgründer Franjo Tudjman zu Grabe getragen. Kroatien, so kommentierte der Westen, löste sich aus der Zwangsherrschaft eines Tyrannen und erblühte plötzlich zu Meinungsfreiheit und Demokratie. Stipe Mesic, der letzte Staatschef eines geeinten Jugoslawien, später auch ein eingeschworener Gefolgsmann des Diktators Tudjman, wurde zum Liebling der europäischen Medien. Sein erster Staatsbesuch führte ihn nach Sarajevo. Dort versprach er offiziell, auf die früheren Annexionspläne seines kämpferischen Vorgängers in Bosnien und vor allem der Herzegowina zu verzichten. Aber schon kam es zu heftigen Unruhen in der kroatisch-bosnischen Ortschaft Kiseljac, als der Tudjman-Anhänger General Blaskic von einem Greifkommando der Sfor verhaftet, vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gestellt und dort zu 45 Jahre Haft verurteilt wurde.
Von dieser Burg – einem Schloß, einer Festung gleich –, auf den Höhen von Sarajevo gelegen, verwalteten einst die hohen Beamten des Habsburgerreiches ihr Territorium Bosnien-Herzegowina. Auf dem Berliner Kongreß von 1878 hatten die Österreicher das Protektorat über diese bislang osmanische Domäne übernommen. 1908 fand sang- und klanglos die Annexion durch Wien statt, die nur bis 1918 dauerte, aber das architektonische Zentrum dieser einst türkischen Metropole nachhaltig gestaltet hat.
Ein seltsamer Zufall der Geschichte hat es gefügt, daß der Österreicher Wolfgang Petritsch heute im Auftrag einer diffusen internationalen Kontaktgruppe über Bosnien-Herzegowina Vollmachten ausübt, wie sie vermutlich kein k. u. k. Gouverneur, ja nicht einmal der zuständige Pascha des Sultans besaß. Petritsch hat binnen kurzer Zeit eine Vielzahl gewählter Bürgermeister, diverse Abgeordnete, sogar Gouverneure abberufen. Dem »High Representative« steht eine international gemischte, aber überwiegend Nato-orientierte Einsatztruppe, erst Ifor, »Implementation Force«, dann Sfor, »Stabilization Force« genannt, zur Verfügung.
Das schwierigste Problem dieses eigenartigen Protektorats auf europäischem Boden wirft die »Republika Srpska« auf, jene serbischverwalteten Teilgebiete, wo in der ersten Phase nach dem Dayton-Abkommen heftige Proteste gegen die Allmacht des von außen ernannten Statthalters aufkamen. Es ist bezeichnend, daß jeder Fetzen serbischen Territoriums mit einem Willkommensplakat ausgeschildert ist, das einer Grenzziehung gleichkommen soll.
Die Armee der Republika Srpska ist auf 20000 Mann beschränkt. Ihre Stärke und Bewaffnung werden ständig von den internationalen Kontrollmächten überprüft. Sie ist im Gegensatz zu den Soldaten der muslimisch-kroatischen Föderation weiterhin mit jugoslawischen Waffen, das heißt mit Kriegsmaterial aus dem Ostblock, ausgerüstet. Zumindest in ihrem nördlichen Stationierungsgebiet von Banja Luka ist diese Truppe nun von jeglicher Versorgung durch das serbische Mutterland abgeschnitten. Im Falle neuer Feindseligkeiten mit Kroaten und Muslimen droht ihnen die Annexion. Kein Wunder, daß sie ihre Stellungen für den Überlebenskampf ausbauen.
Längs der Straßen von Bosnien-Herzegowina fallen die naiven Propagandaplakate der internationalen Kontrollbehörde auf: Hund und Katze sitzen dort einträchtig nebeneinander unter dem Motto »Tolerancija«. Ein anderes Poster besagt: »Der Weg nach Europa hängt von Euch ab.« Zwar wird in Bosnien-Herzegowina in geheimer Wahl und relativ demokratisch gewählt. Aber die ethnischen Säuberungen haben dazu geführt, daß meist nicht die tatsächlichen heutigen Einwohner das Sagen haben bei der Bestimmung ihrer jeweiligen Kommunal- und Parlamentsvertreter, sondern Hunderttausende weitverstreuter Vertriebener, die oft noch im ausländischen Exil leben und nur per Briefwahl votieren können.
Durch das Beharren der internationalen Gemeinschaft auf der Rückkehr der Flüchtlinge in ihre ursprünglichen Heimatortschaften, durch das utopische Festhalten an der Vorstellung einer multi-ethnischen Koexistenz zögert sich jede Normalisierung in Bosnien und vor allem auch jede planmäßige Wiederaufbautätigkeit hinaus.
Alexander Karageorgevic, der Thronanwärter der letzten serbischen Dynastie, hat sich in der Stadt Banja Luka eingefunden. Es ist eine pathetische, aber ziemlich bedeutungslose Geste. Der gewählte Staatschef der Republika Srpska, Poplasen, war noch von dem Vorgänger des »High Representative« Petritsch, dem Spanier Westendorp, kurzerhand geschaßt worden. In Begleitung einer anderen ehemaligen Präsidentin der Republik Srpska, Biljana Plavcic, die inzwischen auch wegen angeblicher Halsstarrigkeit abgesetzt wurde, trifft sich Thronfolger Alexander nach einer Kranzniederlegung mit den Würdenträgern der serbisch-orthodoxen Kirche. Wieder einmal wird – dieses Mal im Zeichen der byzantinischen Liturgie – die unlösbare Verflechtung zwischen Politik und Religion auf dem Balkan sichtbar.
Brcko an der Save bildet das gefährlichste potentielle Krisenzentrum in diesem zerstückelten Staatswesen Bosnien, das den Namen »Absurdistan« verdient. Bislang war hier die Kommunikation zwischen den beiden serbischen Landesteilen durch einen schmalen Korridor von fünf Kilometern gewährleistet. Amerikanische Patrouillen wachen über die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. In Brcko leitet die Brücke über den Fluß Save zu Kroatisch-Slawonien über. In dieser unscheinbaren Ortschaft findet eine Kraftprobe statt, seit der »High Representative« Petritsch – im Einvernehmen mit den Amerikanern natürlich – den serbischen Behörden die Autorität über diese Nahtstelle ihrer Republik entzogen hat. Wolfgang Petritsch möchte in der Sonderzone Brcko ein autonomes, ein multi-ethnisches Experimentierfeld schaffen. Der vielzitierte Schwarzmarkt und Umtauschplatz »Arizona« soll in dieses neue, erweiterte Territorium, wo Muslime, Kroaten und Serben sich die Verantwortung teilen, einbezogen werden. In aller Naivität hofft wohl auch der US-Bevollmächtigte Robert Farrand, daß man dem Mafia-Treiben in diesem Sektor von »Arizona« ein Ende setzen könnte. Als ob Korruption und Schwarzhandel, die ja zu den unentbehrlichen Überlebenselementen der überwiegend arbeitslosen bosnischen Bevölkerung zählen, per Dekret abgeschafft oder gar ersetzt werden könnten.
Bosnien hat viele Gesichter. Unter Führung Alja Izetbegovics versammelt sich die muslimische Gemeinde von Sarajevo zum Bairam-Fest, das an ferne abrahamitische Mythen anknüpft. Wird es den Bosniaken vergönnt sein, eine eigene europäische Form des Islam zu entwickeln? Geraten sie in einen vergleichbaren Konflikt zwischen Säkularismus und Islamismus, wie die ihnen aus der Geschichte so vertraute Türkei? Werden sie allmählich zerrieben werden zwischen dem katholischen Nationalismus der Kroaten und dem orthodox geprägten Staatsbewußtsein der Serben? Hoffnungen kamen bei der internationalen Gemeinschaft auf, als die Resultate der Kommunalwahlen Bosniens im April 2000 publik wurden. Zwar hatten sich die Einwohner der Republika Srpska dem Druck Wolfgang Petritschs nicht gebeugt. Die unnachgiebigen Nationalisten der SDS-Partei feierten trotzig ihren Triumph und ließen demonstrativ die Frau jenes Durchhaltepolitikers Radovan Karadzic hochleben, der als Kriegsverbrecher gesucht wird.
Weniger auffällig als diese Erben der serbischen Tschetniks hatten die Kroaten der Herzegowina der ehemaligen Tudjman-Partei HDZ zum Sieg verholfen und dem neuen Hoffnungsträger Mesic in Zagreb eine Abfuhr erteilt. Die Überraschung kam aus dem muslimischen Bevölkerungsteil. Dort fanden bei den Sozialisten, den Nachfolgern der kommunistischen Partei Titos, zu den Klängen von »Bandera rossa« Siegesfeiern statt, als ihre Stimmenerfolge in Sarajevo, Tuzla, Zenica und Bihac bekannt wurden. Hatten diese Städte der koranischen Staatsideologie ihres Präsidenten Izetbegovic den Rücken gekehrt, um sich bei den Protektoratsbehörden als vorbildliche Europäer zu empfehlen? Hatten sie den Pressionen der Westmächte opportunistisch nachgegeben? Das Schicksal der bosnischen »Muslimani« ist durch den Stimmzettel-Fetischismus der internationalen Behörden noch längst nicht entschieden.
Schon im Jahr 1994 hatte sich Präsident Suleiman Demirel aus Ankara zum Besuch des türkischen UN-Bataillons in die bosnische Industriestadt Zenica einfliegen lassen. Er brachte keine osmanische, geschweige denn eine islamische Botschaft für seine strammen Kemalisten mit. Doch die alte Metropole Istanbul übt weiterhin eine geheime Faszination aus. In Sarajevo und Bihac sind türkische Gymnasien eröffnet worden. Der Unterricht findet überwiegend in türkischer und englischer Sprache statt. Das Bild Atatürks, des Gründers der modernen Türkei, gibt bis auf weiteres die Richtung an.
Unterschwellig sind andere Einflüsse, sogar aus dem schiitischen Iran, am Werk. In entlegenen Dörfern haben sich Gruppen sogenannter Mudschahedin etabliert, die unbeirrbar bereit sind, gegen die drohende Überfremdung durch den amerikanischen Satan auf dem Pfade Allahs zu streiten.
Der Besuch Papst Johannes Pauls II. in Sarajevo fand im April 1997 statt. An diesem Tag offenbarte sich der Katholizismus als »Ecclesia triumphans«. Sowohl die orthodoxen Serben als auch die religiös desorientierten muslimischen Bosniaken wurden bei dem feierlichen Hochamt im Olympiastadion daran erinnert, daß Rom in diesem Teil Europas durchaus noch gewillt ist, seine Positionen zu halten, daß der Heilige Stuhl hier über ein politisches Gewicht verfügt, das im übrigen Europa längst geschwunden ist. Vielleicht hat der polnische Papst, dessen Landsmann Jan Sobieski die Türken vor Wien besiegte, sich an diesem Tag als der wahre und letzte Vertreter des christlichen Abendlandes empfunden. Seinen Segen erteilte er einer Versammlung ausschließlich kroatischer Gläubiger, die meist aus den Dörfern der Herzegowina in Sarajevo zusammengeströmt waren.
Wir wollen noch einmal auf die Kommunalwahlen in Bosnien zu sprechen kommen, deren Ergebnisse bei den Muslimen im Westen so große Hoffnungen geweckt haben. In Wirklichkeit bleibt dort die Partei des Präsidenten Izetbegovic die bei weitem stärkste Fraktion. Wenn die Sozialisten in den muslimischen Städten solche Gewinne erzielen konnten, so liegt das wohl daran, daß sie die Erben der kommunistischen Partei des Marschalls Tito sind, und Tito hatte den »Muslimani« eine eigene Nationalität, eine eigene Identität verliehen. Dazu kommt natürlich, daß die muslimischen Gebiete verzettelt, also angreifbar und verletzlich sind. Und schließlich auch bei vielen säkularen Muslimen die Befürchtung, daß im Schatten der SDA der islamische Fundamentalismus in den eigenen Reihen stark werden könnte. Bei den Muslimen wie bei den anderen Völkerschaften hat die internationale Verwaltung einen ungeheuren Druck bei den Wahlen ausgeübt, so daß sie in anderen Ländern wahrscheinlich annulliert worden wären.
Was nun die Muslime betrifft und ihre Zukunft, so herrscht doch eine langfristige Zuversicht. Sie machen heute 44 Prozent der gesamtbosnischen Bevölkerung aus und bei der vorherrschenden starken Natalität werden sie in spätestens zehn Jahren mehr als die Hälfte sein, was wiederum bedrohlich sein könnte für die dortigen Kroaten und Serben. Man wird nun fragen: Was gehen uns denn die Kommunalwahlen dort an? Und mit Bismarck, der vom Balkan nicht viel hielt, könnte man die dortigen Völker als »ces gents là«– man sprach damals Französisch –, diese Leute da unten, bezeichnen. Aber Bosnien ist ganz nah an Deutschland, und die Bundesrepublik ist dort politisch und auch militärisch zutiefst engagiert.
Etwa 2000 deutsche Soldaten leisten ihren Dienst innerhalb der Sfor-Truppe. Die Minen am Wegrand stellen die größte Gefahr für deren Patrouillen dar. Auf Feindseligkeit der Bevölkerung stoßen sie fast nie. Neuerdings wurde der deutsche Sektor bis an die montenegrinische Grenze vorgeschoben, in die Nähe eines potentiellen Krisenherdes. Diese bescheidenen Truppenelemente, die sich bis zum Drina-Tal verzetteln, wären gegen Partisanenangriffe nur unzureichend abwehrfähig. Sie könnten in die Situation von Geiseln geraten, falls der vorherrschende trügerische Friede wieder durch chauvinistische Leidenschaften erschüttert würde.
Eine abweisendere Landschaft als die »Schwarzen Berge«, die Montenegro den Namen gaben, läßt sich schwer vorstellen. Nicht einmal die Türken haben diese Festung slawisch-christlichen Widerstandes bezwingen können. Wehe der Nato, der Sfor-Truppe oder dem Eurocorps, wenn sie hier in einen Krieg verwickelt würden.
Wird Montenegro sich, wie die Amerikaner das wünschen, von Serbien und der jugoslawischen Föderation resolut abspalten? Der jugendlich wirkende Präsident Milo Djukanovic genießt die Gunst des Westens als angeblicher Reformer und Demokrat. In Wirklichkeit war er früher ein willfähriger Anhänger Slobodan Milosevics. In dubiosen Geschäften soll er sich bereichert haben. In Montenegro, dieser Zwergrepublik von 600000 Menschen, wird selbst bei Freudenfeiern hemmungslos geballert.
Für die Treue zu Serbien steht der orthodoxe Metropolit von Cetinje, Amfiloje Radovic, der immerhin die Hälfte der Bevölkerung repräsentiert. Ein Referendum über die Unabhängigkeit Montenegros, so sagen alle, würde Bürgerkrieg bedeuten. Dieses Land lebt, wie so viele Balkanstaaten, vom Schwarzhandel. Seit die DM als Landeswährung neben dem Dinar eingeführt wurde, haben sich die Beziehungen zu Belgrad zusätzlich gespannt.
In der Hauptstadt Podgorica, dem früheren Titograd, werden auf offener Straße zahllose Autos, auch teure Luxusmodelle, zum Kauf angeboten. Von 100 Autos, so geben die Montenegriner offen zu, wurden 80 gestohlen und 60 davon in Deutschland. Trotzdem spendet Berlin 40 Millionen DM, um Djukanovic zu stützen.
Die jugoslawische Armee ist noch mit 30000 Soldaten in Montenegro zugegen. Als Gegengewicht wurde mit Hilfe der USA eine paramilitärische Polizeitruppe im Dienste von Präsident Djukanovic mit modernen Waffen aufgebaut. Wenn es in den »Schwarzen Bergen« zum Zusammenprall käme, befände sich das deutsche Sfor-Kontingent von Bosnien in vorderster Linie, ohne auch nur im geringsten auf einen solchen Waffengang vorbereitet zu sein.
Der wahre Schutzherr des Balkans, Präsident Bill Clinton, ließ sich von seinen Soldaten im Militärstützpunkt »eagle base« feiern. In diesem bosnischen Nordsektor von Tuzla ist Amerika sich seiner Macht und Überlegenheit über die europäischen Partner voll bewußt. Verteidigungsminister William Cohen hat das seinen Verbündeten sehr deutlich zu verstehen gegeben, auch wenn sich in »eagle base« ein Stück typischer amerikanischer Folklore entfaltet. Den Nato-Partnern hat er mit Recht ins Gewissen gerufen, daß ihre kombinierten Verteidigungskräfte – auch wenn sie über eine halbe Million Soldaten mehr verfügen als die USA – ein skandalöses Bild der Fehlplanung, Budget-Restriktion und mangelnder Kooperation bieten.
Mag Wolfgang Petritsch mitsamt seiner »international community« sich einbilden, er verwalte den bosnischen Staat als Gouverneur und Protektor Europas. In Wirklichkeit handelt er nur im Auftrag der amerikanischen Führungsmacht und führt deren Weisungen aus. Das weibliche Fronttheater erinnerte allerdings in beklemmender Weise an ähnliche Veranstaltungen, die einst in Vietnam inszeniert wurden.
Zurück nach Visegrad, zur Brücke über die Drina. In diesem Balkanland wurde soviel Blut vergossen, wurden solche Gemetzel verübt, daß die kriegführenden Parteien ermattet, ausgelaugt, ja resigniert erscheinen. Doch die Abgründe sind nicht überbrückt. Zeugnis dafür ist dieser serbische Friedhof, wo die jungen Männer immer noch in der Pose siegreicher Helden dargestellt sind. Fast scheint es in Bosnien, wie seinerzeit auf den Katalaunischen Feldern, als setzten die Toten, die Erschlagenen, ihre unerbittliche Schlacht in den abendlich düsteren Wolken fort.
Kosovo: Die Nato in der Balkan-Falle
ZDF-Film am 25. Mai 2000
Hochstimmung des Sieges. Im Juni 1999 rücken die Kfor-Truppen im Kosovo ein. Insbesondere die deutschen Soldaten werden von der albanischen Bevölkerung in Prizren wie Retter bejubelt. Europa, so heißt es offiziell, hat auf dem Balkan über die Mächte des Bösen gesiegt. Wurde hier tatsächlich ein strahlender militärischer Erfolg verbucht? Die serbische Okkupationsarmee zog sich aus dem Kosovo zurück. Doch sie tat das in perfekter Ordnung. Sie hatte kaum Verluste erlitten, trotz des intensiven Nato-Bombardements. Die Soldaten des Präsidenten Milosevic, die in ihre Heimat zurückrollten, fühlten sich »im Felde unbesiegt«.
In Wirklichkeit hat die atlantische Allianz das Amselfeld in einem brodelnden Zustand politischer Ungewißheit übernommen. 50000 protestierende Albaner setzten sich acht Monate nach der vermeintlichen Krisenbewältigung zum Sturm auf die Brücke von Mitrovica, am Fluß Ibar, in Bewegung, wo die Serben sich in einem separaten Gebietszipfel zu behaupten suchen. Nur mit äußerster Mühe konnten die französische Kfor-Soldaten dem Ansturm standhalten.
20000 Kampfeinsätze hat die Luftwaffe der Nato, im wesentlichen die U.S. Air Force, gegen die Restrepublik Jugoslawien und deren Stellungen im Kosovo durchgeführt. Wieder einmal sprach man von einem Wendepunkt der Strategie. Vor allem die ferngesteuerten Raketen trafen ihre Ziele mit verblüffender Präzision. Das oberste Prinzip der amerikanischen Kriegführung, »no dead«– keine eigenen Verluste, wurde tatsächlich erreicht.
Für den Krieg am Boden war die Kosovo-Befreiungsarmee, die UCK, von amerikanischen Instrukteuren in Nordalbanien ausgebildet worden. Vorher hatte sich der amerikanische Emissär Holbrooke zu einem konspirativen Treffen mit den UCK-Führern bereitgefunden und sie gewissermaßen legitimiert. Im Kosovo spielte sich seit 1998 ein Partisanenkrieg zwischen versprengten Trupps der UCK-Freischärler und den sich zunehmend verstärkenden serbischen Streitkräften ab.
In dem französischen Schlößchen Rambouillet fand im Februar 1999 eine Konferenz zur Beilegung dieses lokalen Balkankonflikts statt. Von vornherein waren die alliierten Bedingungen so konzipiert, daß sie von Belgrad – auch unter einem anderen Staatschef als Milosevic – kaum akzeptiert werden konnten.
Unterdessen brannten die Dörfer im Kosovo. Aber erst mit Beginn des Bombenkrieges der Nato holten die Serben zu jener brutalen Massenvertreibung der albanischen Bevölkerung aus, die – von den westlichen Medien unaufhörlich propagiert – die Stimmung reif machte für den kriegerischen Einsatz.
Im Nato-Hauptquartier hatte General Clark wohl gehofft, Serbien würde nach viertägigem Bombardement in die Knie gehen. Als das nicht zutraf, wurde dort eine Propagandakampagne entfaltet, die dieser demokratischen Allianz unwürdig war. Der Nato-Sprecher Jamie Shea, zum Liebling der westlichen Korrespondenten hochgelobt, überschlug sich in Horrormeldungen. Gleichzeitig bauschte er die militärischen Erfolgsergebnisse der Allianz hemmungslos auf.
Haben die Nato-Truppen, die an den Nordgrenzen Albaniens und Mazedoniens etwa 30000 Mann zusammengezogen hatten, jemals ernsthaft erwogen, das Wagnis eines Bodenkriegs auf sich zu nehmen?
Heute sollte jeder wissen, daß diese Option überhaupt nicht bestanden hat. Es fehlten für den Erdkampf alle logistischen Voraussetzungen und auch die erforderliche Truppenzahl. Im extrem zerklüfteten Gebirge der potentiellen Einmarschzonen wäre die jugoslawische Abwehr in ihrem Element gewesen. Eine Mindestzahl von 5000 eigenen Toten wurde von den alliierten Stäben errechnet, und auch damit wäre der Sieg keineswegs garantiert gewesen.
78 Tage lang hat sich der Luftkrieg hingezogen. Vorsichtshalber wurde aus einer Höhe von 5000 Metern bombardiert. Im Auftrag des Nato-Oberbefehlshabers Wesley Clark holte das westliche Bündnis, das angeblich zur Verhinderung einer humanitären Katastrophe angetreten war, zur Vernichtung der serbischen Industrieanlagen und Infrastruktur aus. Es wurden stellenweise sogar Splitterbomben abgeworfen. Am Ende wäre die Nato wohl auch vor Flächenbombardements nach vietnamesischem Vorbild nicht zurückgeschreckt.
Als die europäischen Regierungschefs sich auf dem Petersberg und in Köln trafen, drohte die Allianz an dieser ratlosen, aber unerbittlichen Strategie zu zerbrechen. Mit einem Gefühl der Erlösung wurde deshalb der finnische Staatspräsident Martti Ahtisaari, der im Auftrag der Europäischen Union verhandelt hatte, von Bundeskanzler Schröder umarmt, als er ein Einlenken Belgrads signalisieren konnte.
Wieder einmal gelang es dem Westen, das Nachgeben Slobodan Milosevics, das mit einschneidenden Vorbedingungen belastet war, als einen Triumph der eigenen Strategie und Diplomatie zu feiern. Die Kölner G8-Erklärung mündete in die UN-Resolution 1244 ein.
Unterdessen preschte an Ort und Stelle ein russisches Vorkommando – aus Bosnien kommend – bis zur Kosovo-Hauptstadt Pristina vor und besetzte dort noch vor Ankunft der Briten den Flugplatz.