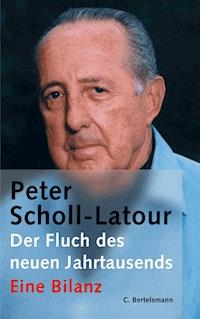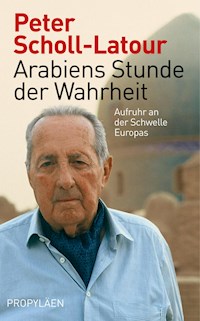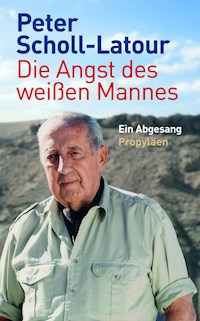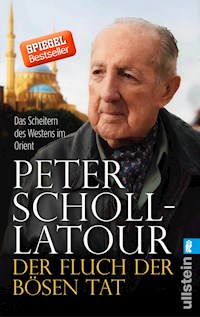9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Weltpolitik gleicht einem aufziehenden Gewittersturm. Ob in Schwarzafrika oder Lateinamerika, in Arabien oder im Mittleren Osten – überall braut sich Unheilvolles zusammen. Und auch Europa und die USA, einst Hort der Stabilität, werden von Krisen heimgesucht wie seit langem nicht. Peter Scholl-Latour kennt die Welt wie kein Zweiter. Vor dem Hintergrund seiner sechzigjährigen Erfahrung als Chronist des Weltgeschehens beleuchtet er in seinem neuen Buch die Brennpunkte der aktuellen Weltpolitik. Der Abzug der USA aus dem Irak und Afghanistan hinterlässt zerrüttete Staaten, die in Bürgerkriegen versinken. Der Konflikt um Irans Atompolitik spitzt sich gefährlich zu. Pakistan ist ein Pulverfass. Die arabische Welt befindet sich in Aufruhr, mit ungewissem Ausgang. Die Zahl der "failed states", Brutstätten des Terrorismus, nimmt beständig zu, vor allem in Afrika. Zu allem Überfluss stolpern Europa und Amerika von einer Finanzkrise in die nächste und erweisen sich international zunehmend als handlungsunfähig. Mit dem ihm eigenen Gespür für weltpolitische Umbrüche begibt sich Peter Scholl-Latour auf eine Tour d'Horizon rund um den Globus und schildert eine Welt aus den Fugen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für die Übersetzung und Deutung der Zitate aus den »Muqaddima« Ibn Khalduns habe ich mich auf den französischen Arabisten Vincent Monteil bezogen. Die nicht mit einer Quelle versehenen, datierten Beiträge aus den Jahren 2008 bis 2012 sind unter dem Kolumnentitel »Notabene« in der Schweizer Illustrierten erschienen.
Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbHwww.propylaeen-verlag.de
ISBN 978-3-8437-0340-6
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012 Lektorat: Cornelia Laqua Alle Rechte vorbehalten Satz und eBook: LVD GmbH, Berlin
EL MUQADDIMA – EINFÜHRUNG
Am Rande des Abgrundes
Ulan Bator (Mongolei), im Sommer 2012
Es mag ein seltsamer Einfall sein, Betrachtungen über die Schicksalswende, der unsere Welt ausgesetzt ist, in der Mongolei beginnen zu lassen. Der zentralasiatische Staat – acht Mal so groß wie Deutschland, aber nur von knapp drei Millionen Menschen bevölkert – ist für die meisten Europäer bedeutungslos. Die Mongolei lebt eingeklemmt zwischen zwei Giganten – Rußland und China. Sie war jahrhundertelang der Einflußnahme dieser beiden expansiven Nachbarn ausgeliefert. Aber von der endlosen Gras- und Wüstenlandschaft ist vor 800 Jahren die Gründung des gewaltigsten Imperiums der Geschichte ausgegangen, das sich – wenn auch zeitlich begrenzt – unter der Herrschaft seines legendären Gründers Dschingis Khan den immensen Raum zwischen Mittelmeer und Pazifischem Ozean unterworfen hatte. Die kriegerischen Horden seiner Steppenreiter, denen keine Streitmacht gewachsen war, haben damals fürchterliche Verwüstungen angerichtet, ganze Völkerschaften ausgelöscht. Der persische und arabische Orient hat sich von den Nachwehen dieser Vernichtung bis auf den heutigen Tag nicht erholt. Dem christlichen Abendland erschienen diese gespenstischen Boten des Unheils als Ausgeburten der Hölle, sie waren »ex tartaro« aufgetaucht, weswegen man sie »Tartaren« nannte.
Ein paar Kilometer von der Hauptstadt Ulan Bator entfernt ragt das kolossale, silbern glänzende Reiterstandbild Dschingis Khans – vierzig Meter hoch, aus 250 Tonnen Edelstahl gegossen – über der Weidelandschaft. Es erinnert die Russen daran, daß die Enkel dieses Gewaltmenschen den ganzen slawischen Siedlungsraum bis zu den Pripjet-Sümpfen Weißrußlands fast drei Jahrhunderte lang unter das Joch der »Goldenen Horde« zwängten. Ein anderer Erbe des in der heutigen Mongolei als Nationalheld verehrten Welteroberers hatte das chinesische Reich der Mitte beherrscht und auf dem Drachenthron von Peking die mongolische Yuan-Dynastie etabliert, über deren Kaiser Kublai Khan und dessen Prachtentfaltung der Venezianer Marco Polo bewundernd und fasziniert berichtete.
Bis an die Schwelle des Heiligen Römischen Reiches waren die unbesiegbaren Bogenschützen vorgedrungen. Im Jahr des Herrn 1241 vernichteten sie nahe der schlesischen Stadt Liegnitz die vereinten Heere der deutschen und polnischen Ritterschaft. Ihr nach Westen vorstürmender Befehlshaber hatte den Feldzug jedoch jäh abgebrochen, um – in Gewaltetappen durch Rußland und Sibirien galoppierend – seine Ansprüche am Hof von Karakorum geltend zu machen, wo ein blutiger Erbfolgestreit ausgetragen wurde. Nur diesen fernen dynastischen Rivalitäten verdankte damals das mittelalterliche Abendland, daß es von der Heimsuchung durch die unheimlichen Krieger verschont blieb, die ihre schamanistischen Kultbräuche sehr bald durch die Bekehrung zum Islam ersetzten.
Es sollte eine lange Frist verstreichen, ehe Europa auf den Karavellen seiner iberischen Conquistadoren zu jener Weltherrschaft des »Weißen Mannes« ausholte, die noch vor wenigen Jahrzehnten mit dem globalen Hegemonialanspruch der Vereinigten Staaten von Amerika einerseits, der weltrevolutionären Sendungsanmaßung der Sowjetunion andererseits ihren triumphalen Gipfel und gleichzeitig ihren Bruchpunkt erreichte.
Vielleicht muß man am Rande der Wüste Gobi vor den Ruinen der Paläste von Karakorum stehen, wo die Großkhane der Mongolen einst ihre Allmacht zelebrierten, um sich des unvermeidlichen Erschöpfungsprozesses, der fatalen Folgen der überdimensionalen Ausdehnung bewußt zu werden, der zunächst die ermatteten europäischen Kolonisatoren, dann die vergreiste Führungsmannschaft der Sowjetunion erlagen, während manche Auguren der USA im Hinblick auf den eigenen Niedergang von bangen Ahnungen heimgesucht werden. Angesichts der sich anbahnenden Verlagerung des globalen Schwerpunktes vom Atlantischen zum Pazifischen Ozean sollten vor allem die Politiker unseres zerstrittenen Kontinents die Bedeutungslosigkeit, die Prekarität der »condition européenne« erkennen. Der Blick auf die Weltkarte, deren fünf Kontinente noch zur Zeit meiner Kindheit in den Farben der europäischen Kolonialmächte koloriert waren, verweist diese erschlafften »Graeculi« der Neuzeit auf die beklemmende Mahnung des französischen Schriftstellers Paul Valéry, daß nämlich Europa nur ein »Kap Asiens« sei.
*
In dem vorliegenden Buch beabsichtige ich nicht, eine ausführliche Schilderung des Schwebezustandes vorzunehmen, in dem sich die heutige Mongolei befindet. Sie sieht sich umringt von der sogenannten Shanghai-Organisation, in der Rußland und China ein opportunistisches Zweckbündnis geschlossen haben. Die Mongolei ist – anders als die zentral-asiatischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion – diesem lockeren Verbund nur als Beobachter beigetreten. Gleichzeitig pflegt sie ihre Beziehungen zu jener amerikanisch dominierten Gruppierung, die als Gegengewicht zur Einflußnahme Moskaus und Pekings eine De-facto-Allianz mit Japan, Südkorea und Taiwan eingegangen ist. Die folgenden Kapitel stellen sich wie ein Kaleidoskop dar und reihen eine Serie von Kommentaren, Fernsehdokumentationen und Interviews aneinander. Sie sind in chronologischer Reihenfolge ohne jede nachfolgende Berichtigung abgedruckt. Beim Blättern in früheren Notizen bin ich auf einen Text gestoßen, der – obwohl seine Niederschrift etwa zwanzig Jahre zurückliegt – überaus aktuell klingt.
»Es geht um nichts weniger als um die Überprüfung der Pauschalbegriffe ›Menschenrechte‹ und ›Parlamentarische Demokratie‹«, schrieb ich damals. »Auf diese Grundwerte zivilisatorischen Zusammenlebens sollte in unserem christlich-abendländischen Kulturkreis niemand verzichten. Aber die Übertragung dieser westlichen Postulate auf die völlig andersgeartete Staatenvielfalt der sogenannten Dritten Welt verkommt meist zum Zerrbild. Die wirtschaftlich oder strategisch motivierte Heuchelei, eine opportunistisch selektive Einforderung dieser hohen Prinzipien würden von den Betroffenen oft und zu Recht als eine neue Form arroganter Überfremdung, ja des Neo-Imperialismus empfunden.«
»Die Debatte ist angebracht«, so fuhr ich fort, »ob die repräsentative Demokratie, eine Tochter des bürgerlichen 19. Jahrhunderts, nicht ihre Glanzzeit – selbst in Europa und Amerika – hinter sich hat, seit die Omnipräsenz der audiovisuellen, aber auch der Printmedien einer betrüblichen Nivellierung der Meinungs- und Informationsvermittlung Vorschub leistet. Unter dem Druck dieser kollektiven Stimmungsmache, die unseren Volksvertretern oft mehr Furcht einflößt als die Gesinnungsschwankungen ihrer Wähler, könnte der klassische Parlamentarismus eines Tages ersticken oder zum Formalismus werden.«
Seitdem hat eine rasante Fortentwicklung der Elektronik eingesetzt, deren Folgen noch unabsehbar sind. In ihrer umwälzenden Bedeutung hat sie die Erfindung der Buchdruckerei weit hinter sich gelassen und das Tor zu einer unberechenbaren Zukunft aufgestoßen. Seinerzeit erlaubte die Technik Guttenbergs, den Wissens- und Bildungskreis, der bislang auf eine geringe Anzahl von Gelehrten, vornehmlich Kleriker, begrenzt war, auch auf die breiten Volksmassen auszudehnen, was zunächst der rapide um sich greifenden Reformation Luthers und Calvins zugute kam. Heute existiert ein System der totalen Transparenz, die die Schreckensvisionen Orwells in seinem Buch »1984« überflügelt. Es gibt neuerdings keine Privatsphäre mehr, in die man sich flüchten könnte. Die Entwicklung zur absoluten Überwachung – befördert durch den eigenen Hang zum Exhibitionismus, dem nicht nur die sogenannten Prominenten verfallen, sondern in dem sich auch die bedeutungslosen Benutzer von Facebook und Internet zu profilieren suchen – wird gesellschaftliche Verlagerungen nach sich ziehen, die zur Stunde noch unsere Vorstellungskraft überfordern. Schon prophezeien kluge Analytiker eine Verdrängung des Menschen durch die Automatik der Maschinen, eine Vision, die sich bereits zur Zeit der Industrialisierung – als Gerhart Hauptmann »Die Weber« schrieb – ankündigte, die jedoch demnächst in eine Ära der Roboter einzumünden droht.
Der französische Autor André Malraux hatte im Hinblick auf den technischen Durchbruch des 19. Jahrhunderts die Meinung vertreten, daß Napoleon Bonaparte noch mit vergleichbaren Methoden und Konzepten seine Verwaltung ausüben und seine Schlachten schlagen konnte wie der ägyptische Pharao Ramses II. Diese Kontinuität sei jedoch durch den Einbruch des Maschinenalters jäh abgebrochen. Seitdem haben sich die Dinge mit unheimlicher Hast beschleunigt. Der englische Historiker Niall Ferguson hat diesen Prozeß, diese Abkehr von allen überlieferten Schablonen, wie folgt hinterfragt: »Was wäre, wenn die Geschichte gar nicht zyklisch und langsam, sondern arrhythmisch verliefe, manchmal fast stillstände, dann aber wieder zu dramatischer Beschleunigung fähig wäre? Was wäre, wenn die historische Zeit weniger dem langsamen und vorhersehbaren Wechsel der Jahreszeiten entspräche, sondern eher wie die elastische Zeit unserer Träume abliefe? Vor allem aber, was wäre, wenn sich der endgültige Zusammenbruch nicht über Jahrhunderte hinziehen würde, sondern eine Zivilisation plötzlich wie ein Dieb in der Nacht überfiele?«
Natürlich ist die Theorie Fergusons, die sich auf eine Erschlaffung der Vereinigten Staaten von Amerika richtet, in New York und Washington heftiger diskutiert worden als in Europa. Seine Studie »The West and the Rest« ist im Jahr 2011 erschienen, also zwei Jahre nach meinem auf persönlicher Erfahrung an Ort und Stelle beruhenden Erlebnisbericht »Die Angst des Weißen Mannes«. Meine eher distanzierte Berichterstattung über die Rückschläge der US Army von Vietnam bis zum Hindukusch hat mir den Ruf des Antiamerikanismus eingebracht, als ob die Warnung vor verhängnisvollen kriegerischen Abenteuern nicht als Freundschaftsdienst gewertet werden müßte. Was den befürchteten »decline and fall« der westlichen Führungsmacht betrifft, so werde ich nicht die Torheit begehen, die Fähigkeit der USA zu unterschätzen, sich in Stunden der Not aufzuraffen und mit ungeheurer Kraft zurückzuschlagen. Da kommt mir jene Prahlerei Hermann Görings in Erinnerung, der beim Eintritt des Dritten Reichs in den Krieg gegen die USA behauptete, er sei sich zwar der industriellen Kraft der Vereinigten Staaten bewußt, aber in einem Punkt seien die Amerikaner den Deutschen hoffnungslos unterlegen, sie verfügten über keine vergleichbare Luftwaffe. Man weiß, was aus dieser Fehleinschätzung geworden ist.
Erwähnen wir nur ein paar Beispiele jener radikalen Wandlung, der wir ausgeliefert sind. Im Zuge stupender wissenschaftlicher Fortschritte hat sich das Erscheinungsbild des Menschen unserer Tage und seiner tradierten gesellschaftlichen Strukturen gründlich verändert. Die Lebensdauer zieht sich in die Länge, bewegt sich auf eine Schwelle von hundert Jahren zu. Dabei entsteht jedoch der Verdacht, daß die durch krampfhafte Forschung erzielte Verzögerung des Todes, diese medizinische Mißachtung der bestehenden Naturgesetze keinen wirklichen Segen bringt. Die zunehmende Vergreisung unserer Gesellschaft wird allzuoft von körperlicher Gebrechlichkeit und geistiger Umnachtung überschattet.
Vor allem die Bedeutung des »deuxième sexe« hat zumindest in unserer Region eine Gewichtung gewonnen, die auf lange Sicht das Aufkommen eines Matriarchats nicht ausschließt. Noch mögen zahllose Frauen sich diskriminiert fühlen, aber in der Beziehung der Geschlechter untereinander ist mit der Erfindung der Pille, mit der weiblichen Selbstbestimmung der Schwangerschaft, ein grundlegender Wendepunkt eingetreten. Dazu kommt die Tatsache, daß die männliche Muskelkraft keine Überlegenheit mehr verleiht. Selbst in kriegerischen Situationen hat sich erwiesen, daß eine Soldatin – falls sie eine gute Schützin ist – ihren männlichen Kameraden überlegen sein kann, zumal Frauen häufig über eine stärkere psychische Belastbarkeit verfügen. Im beruflichen Wettbewerb vermögen die Angehörigen des »schönen Geschlechts« sich zudem auf eine atavistische Veranlagung zu List und Verführung stützen, die sich in Jahrtausenden viriler Überheblichkeit zum Instinkt entwickelte. »La femme est l’avenir de l’homme – die Frau ist die Zukunft des Mannes«, sagte schon der marxistische Dichter Aragon voraus.
Zur Divergenz der großen Zivilisationsmodelle lasse ich den amerikanischen Professor für internationale Beziehungen an der Georgetown-Universität, Charles A. Kupchan, zu Wort kommen: »Das 21. Jahrhundert«, so doziert er, »ist nicht die erste Epoche, in der völlig unterschiedliche Modelle des Regierens und des Handels koexistierten: Während des 17. Jahrhunderts betrieben das Heilige Römische Reich, das Osmanische Reich, das Mogul-Reich, die Qing-Dynastie und die Tokugawa-Shogune ihre Angelegenheiten gemäß unterschiedlichen Konzepten von Sitte und Kultur. Aber diese Mächte lebten weitgehend auf sich selbst bezogen und beschränkten sich auf geringe Kontakte untereinander … Unser Jahrhundert hingegen bringt zum ersten Mal in der Geschichte vielfache Vorstellungen von Ordnung und Modernität in unmittelbaren Kontakt. Es entstand eine ›interconnected world‹. Aus dieser Erkenntnis heraus sollte Washington anerkennen, daß die amerikanische Formel von Kapitalismus und säkularer Demokratie nunmehr auf dem Marktplatz der Ideen mit rivalisierenden Systemen koexistieren muß. Die verantwortlichen Politiker Amerikas erweisen ihrem Land einen schlechten Dienst, wenn sie allzu selbstbewußt ein neues amerikanisches Jahrhundert ankündigen oder fremde Regierungen im Namen einer globalen Ausbreitung westlicher Werte zu Fall bringen.«
Wachablösung in Peking
Das Jahr 2012, das von vielfältigen Phänomenen einer weltweiten Auflösung gezeichnet ist, gilt in Fernost als »Jahr des Drachen«. Das hatte ich im Tischgespräch mit einem hochrangigen Diplomaten der Volksrepublik China in dem weißgekachelten Kolossalbau der Botschaft am Märkischen Ufer in Berlin vernommen. Dieses Fabeltier genießt im Reich der Mitte eine höchst positive Bewertung als Symbol von Kraft und Weisheit, von Harmonie und Macht. Der Kaiser in der Verbotenen Stadt schmückte sich mit dem Titel »Sohn des Drachen«. Als mein freundlicher Gastgeber, ein hochgewachsener, mit perfekter Eleganz gekleideter Mandarin, der in der alten Gründungsmetropole Xian geboren war, mich zu meinem hohen Alter beglückwünschte – in China gilt die Zahl Acht als Glückszahl, und eine doppelte Acht verheiße eine besonders günstige Konstellation –, reagierte ich mit der gebotenen Skepsis.
Es steht mir nicht an, den Inhalt eines vertraulichen Meinungsaustauschs wiederzugeben. Bei allen Kontakten mit ausländischen Gesprächspartnern habe ich bei der Schilderung deutscher und europäischer Verhältnisse – ohne jemals in peinliche Selbstkritik zu verfallen – mich ebenso offen geäußert, wie ich das mit einem deutschen Kollegen täte. So habe ich bei den häufigen Telefonaten aus Teheran, wo sich ein mir wohlbekannter Journalist des staatlichen Rundfunks über die deutsche Reaktion auf aktuelle Ereignisse zu informieren suchte, mit ungeschminkter Auskunftsbereitschaft reagiert, meinen Interviewpartner jedoch stets darauf verwiesen, daß mindestens fünf Geheimdienste unseren Dialog belauschten.
Bei solchen Gelegenheiten habe ich darauf geachtet, nicht in eine Unart deutscher Politiker und Publizisten im Umgang mit Repräsentanten fremder Kulturkreise zu verfallen. Die Pose eines Predigers für Demokratie und Menschenrechte habe ich mir nie angemaßt. Die germanischen Tugendbolde, die sich aufgrund der grauenhaften Last der eigenen Vergangenheit eine gewisse Zurückhaltung auferlegen sollten, formulieren ihre philanthropischen Vorwürfe ja vornehmlich nur gegenüber Vertretern jener Staaten, die sich den strategischen oder wirtschaftlichen Ambitionen der westlichen Welt – zumal des dominanten amerikanischen Verbündeten – entgegenstellen. Was hingegen die gefügigen, positiv bewerteten Regierungen der internationalen »family of nations« – wie die verlogene Floskel lautet – betrifft, mögen sie sich noch so tyrannisch und menschenverachtend gebärden, so bleiben sie in der Regel von diesen heuchlerisch anmutenden Vorwürfen verschont, zumal wenn sie sich als unentbehrliche Rohstofflieferanten empfehlen.
Das Jahr 2012 steht im Zeichen zahlloser Volksbefragungen und Wahlen. Einige haben zum Zeitpunkt dieser Niederschrift bereits stattgefunden, in Rußland, Frankreich und sogar in der abgelegenen Mongolei. Schon wendet sich die Aufmerksamkeit aller Medien und Kanzleien dem Urnengang zu, aus dem ein neuer oder der alte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika als Sieger hervorgehen wird, der »mächtigste Mann der Welt«. Aber auch in der Volksrepublik China, wie ich am Märkischen Ufer in Berlin beiläufig erfuhr, vollzieht sich ein Wechsel der obersten Führungsmannschaft hinter den verschwiegenen Mauern von Zhongnanhai.
Auf welche Weise die personelle Wachablösung im höchsten Gremium der Kommunistischen Partei Chinas erfolgt, läßt sich nur erraten. Zur Stunde geht man davon aus, daß der bislang amtierende Staatspräsident und Generalsekretär Hu Jintao sowie der Regierungschef Wen Jiabao nach schwierigen Beratungen ausgewechselt werden. Innerhalb des Machtmonopols, das die K. P. Chinas ausübt, dürften die Fraktionskämpfe wohl mit ähnlicher Verbissenheit, mit noch gnadenloseren Intrigen ausgetragen werden, als es im pluralen Parteiensystem der westlichen Demokratien der Fall ist. Die höchste Funktion – auch die entscheidende Autorität über die Militärkommission – soll dem eminenten Mitglied des Politbüros Xi Jinping zufallen. Seit dem Tod Mao Zedongs hat der Wechsel in den obersten Führungsgremien im Abstand von vier Jahren ziemlich regelmäßig stattgefunden, was nach dem Ausscheiden des genialen Reformers Deng Xiaoping immerhin eine gewisse Ausbalancierung der Tendenzen zu signalisieren scheint. Jedenfalls wäre hier der Vergleich mit der weltweit verbreiteten Alleinherrschaft von Militärdiktatoren und Despoten, die sich zwanzig, dreißig, sogar vierzig Jahre lang an ihre Willkürherrschaft klammern, völlig unangebracht.
Wer durchschaut schon die Rangordnung an der Spitze eines kolossalen Staatsgebildes von 1,4 Milliarden Menschen? Die Probleme der Volksrepublik lassen sich mit denen keines anderen Landes vergleichen, mit Ausnahme vielleicht des im Westen überbewerteten Indiens, das im Rufe steht, die »größte Demokratie der Welt« zu sein. Die Unions-Regierung von Neu-Delhi kann zweifellos auf eine beachtenswerte Zunahme des Bruttosozialproduktes verweisen. Gestützt auf die hohe Intelligenz der technischen Eliten sind dort Ballungszentren modernster elektronischer Industrie und eine futuristisch anmutende Computertechnologie entstanden. Der Mittelstand hat sich beachtlich ausgeweitet. Aber die wirklichen Nutznießer dieser Bereicherung sind immer noch die traditionellen Finanz- und Industriedynastien, während die Masse der »Unberührbaren«, der Dalit oder der untersten Kasten in grausamem Elend und gesellschaftlicher Ächtung verharrt. Unterdessen bleibt die Infrastruktur dieses riesigen Subkontinents weitgehend auf die inzwischen verrottete Konstruktion von Stromleitungen, Straßen und Eisenbahnen angewiesen, die das britische Empire zur Zeit seiner Glorie hinterlassen hat.
Der maoistische Leitspruch »Dem Volke dienen«, der einzige chinesische Satz, den ich zu lesen vermag, ist zwar immer noch an den Eingang aller Kasernen gepinselt. Aber diese von der proletarischen Revolution inspirierte Parole ist inzwischen einer sehr eigennützigen Realität gewichen. So scheinen die sogenannten »Prinzlinge«, die »Taizi«, Söhne und Enkel der Helden der Volksbefreiungsarmee und Gefährten des legendären »Langen Marsches«, eine unbestreitbare Bevorzugung zu genießen. Doch diese Präferenz schließt den kometenhaften Aufstieg vom einfachen Arbeitersohn zum Mitglied des Politbüros nicht aus, wie sich am Beispiel Wang Yangs erweist, dem verantwortlichen Parteisekretär in der Südprovinz Guangdong, die man früher Kanton nannte. Das dortige Bruttoinlandsprodukt hat dieser Emporkömmling auf das Niveau Neuseelands angehoben. Die Meritokratie, die einst das konfuzianische Auslesesystem der Mandarinats-Prüfungen kennzeichnete und von den europäischen Aufklärern des 18. Jahrhunderts hoch geschätzt wurde, ist offenbar in der postkommunistischen Hierarchie nicht erloschen.
Eine besondere Rolle beim Aufstieg zu prominenten Positionen spielen regionale Seilschaften, die sich ja auch im Regierungssystem westlicher Demokratien wiederfinden. Die Provinzen Szetschuan, Kanton und Jiangsu haben solche Cliquen hervorgebracht, so wie der bisherige Generalsekretär Hu Jintao sich auf seine Gefolgschaft in der Provinz An Huei stützte. Um nicht einer schwärmerischen Voreingenommenheit bezichtigt zu werden, greife ich auf die Mahnung des amerikanischen Zeitzeugen Charles A. Kupchan von der Georgetown-Universität zurück: »Seit den Gründerzeiten haben die amerikanischen Eliten und das amerikanische Volk an die Universalität ihres Modells geglaubt. Das Ende des Kalten Krieges hatte diese Überzeugung noch vertieft. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien es, als sei der demokratische Kapitalismus die einzig akzeptable Formel. Aber ›das Ende der Geschichte‹ – ein Hinweis auf die These Fukuyamas – hat wohl nicht stattgefunden. Die chinesische Entwicklung in den vergangenen dreißig Jahren entspricht in keiner Weise den von Europa und Nordamerika vorgegebenen Normen … Dennoch und vielleicht aus diesem Grunde hat die Wirtschaft dieses autoritären Regimes die westlichen Konkurrenten überholt, ihre Bourgeoisie bereichert, einen beachtlichen Mittelstand geschaffen und Hunderte Millionen Bedürftige ihrem bisherigen Zustand der Armut entrissen.«
*
Ganz bewußt räume ich den Vorgängen in Fernost die Priorität ein. War das 19. Jahrhundert das »Saeculum« Großbritanniens und das 20. von der amerikanischen Machtentfaltung geprägt, so könnte das 21. Jahrhundert – zumindest in seiner zweiten Hälfte – der Volksrepublik China eine hegemoniale Rolle zuweisen. Nicht von ungefähr widmete der in Hawaii geborene und in Indonesien aufgewachsene Barack Hussein Obama seine diplomatische und strategische Aktivität vorrangig dem pazifischen und nicht mehr dem atlantischen Raum. Die Rivalität zwischen Drachen und Adler muß nicht zwangsläufig zu einer kriegerischen Auseinandersetzung führen. Ein militärischer Sieg des einen über den anderen ist ohnehin nicht vorstellbar, aber der Wettstreit um die Abgrenzung der Einflußzonen ist voll entbrannt.
Der Anspruch der Volksrepublik auf die Archipele Spratly und Paracel im Südchinesischen Meer wäre mit einer Ausdehnung ihrer Hoheitsgewässer bis in die Nähe Vietnams, der Philippinen, Malaysias und Indonesiens verbunden. Es geht nicht nur um die Ausbeutung der dort georteten Reserven an Erdöl und Erdgas. Eine Kontrolle Chinas dieser wichtigsten Schiffahrtsroute zwischen Indien und Japan wäre für Washington unerträglich. Kein Wunder, daß das State Department die Länder der ASEAN-Gruppe an sich zu binden sucht und das Pentagon die Vielzahl seiner Basen auf Okinawa, Guam und den Philippinen durch eine zusätzliche Stationierung von US Marines im nordaustralischen Hafen Darwin ergänzt.
Der Ausbau der chinesischen Marine wird von der US Navy als existentielle Gefährdung der Zukunft bewußt aufgebauscht. Der Armada zahlreicher kolossaler Flugzeugträger, über die die amerikanische Admiralität verfügt, hat China nur ein geringes Flottenaufgebot entgegenzusetzen. Aber die Kapitäne der deutschen Marine haben bei gemeinsamen NATO-Manövern erprobt, wie unbemerkt sie sich an diese »Galeeren der Roboter« – der Ausdruck stammt von Adalbert Weinstein – heranpirschen und sie ins Visier nehmen könnten. Sollte es zum Cyber-War kommen, auf den die Großmächte sich fieberhaft vorbereiten, wäre zudem eine Lähmung der extrem empfindlichen Elektroniksysteme dieser Seeungeheuer nicht auszuschließen. Die Entscheidungsschlacht von Midway, die der Flotte des Tenno zum Verhängnis wurde, gehört einer anderen Epoche an.
Was nun – auf einen ganz anderen Sektor abweichend – die angebliche Überlegenheit der amerikanischen Form des Kapitalismus über alle anderen Wirtschaftssysteme betrifft, so habe ich mich – um nicht der ewigen Schwarzmalerei bezichtigt zu werden – wiederum an angelsächsische Experten gehalten. Ich zitiere Michael Ignatieff, einen eminenten kanadischen Intellektuellen und liberalen Politiker, dem zufolge die Geschichte nicht über ein vorverfaßtes Drehbuch verfügt. Der Westen erliege einer trügerischen Interpretation des Zeitgeschehens, wenn er annimmt, China und Rußland würden sich in Richtung auf eine uns verwandte demokratische Freiheitlichkeit zubewegen. Man sollte sich nicht einreden, daß die Welt zwangsläufig auf eine liberale Gesellschaft zusteuert. »Wir gingen davon aus, daß alle anderen Nationen sich an unserem Modell ausrichten würden. Aber was geschähe, wenn diese Hypothese, die den westlichen Business-titanen so attraktiv erscheint, auf einem grundlegenden Irrtum beruhte?«
Im Rückblick erscheint die Vernichtung der babylonischen Türme des World Trade Centers von Manhattan durch eine Handvoll Fanatiker wie ein Menetekel. Das ursprüngliche, von Calvin inspirierte Gebot der persönlichen Bereicherung, die als Zeichen göttlicher Erwähltheit, der »predestination«, gedeutet wurde, setzte eine strenge puritanische Grundhaltung voraus. Die Kreativität dieser Wirtschaftsform, die Max Weber beschrieben hat, ist spätestens im vergangenen Jahrzehnt durch das frivole Spekulationsfieber der Börsen-Jobber und jene betrügerischen Zocker verdrängt worden, die sich als »masters of the universe« aufspielten und die düstere Lehre des Genfer Reformers durch einen ausschweifenden Hedonismus ersetzten.
Wieder lasse ich einen amerikanischen Kommentator zu Wort kommen: »The two M’s – Money and Me – became the loadstone of the Zeitgeist and damn these distant wars« – so schreibt Roger Cohen. Die beiden M’s – Geld und Ich – wurden zum Magnetpol des Zeitgeistes – und zum Teufel mit diesen weit entfernten Kriegen!« Gemeint sind wohl die gescheiterten Feldzüge im Irak und in Afghanistan.
Mit Kompetenz und Erbitterung meldet sich der Banker Greg Smith zu Wort, der seinen Rücktritt von dem höchst einträglichen Job als »executive director« von Goldman Sachs wie folgt erklärt: »Es macht mich krank zu hören, wie verächtlich unsere Banker darüber reden, wie sie ihre Kunden ausplündern. Ich habe fünf führende Direktoren in den vergangenen zwölf Monaten getroffen, die ihre Kunden als ›muppets‹ bezeichneten. Von ›integrity‹ ist keine Rede mehr. In den vergangenen Tagen lautete die häufigste Frage, die von Junior-Analysten über die Bearbeitung von Derivaten an mich gerichtet wurde: Wieviel Geld könnten wir unseren Kunden aus den Taschen ziehen?«
Da mutet es eigenartig an, wenn die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton in Ulan Bator noch im Juli 2012 unverdrossen und überheblich den Lobgesang des »american way of life« anstimmte. Den Erben Dschingis Khans rief sie zu, daß wirtschaftliche Liberalisierung nicht ohne politische Liberalisierung zu haben sei. Sie widersprach energisch der wohlwollenden Despotie des großen Staatsmannes Lee Kwan Yew, der den Einwohnern seines Stadtstaates Singapur mit konfuzianisch anmutender Autorität einen Wohlstand verschaffte, der das Lebensniveau des durchschnittlichen Amerikaners weit hinter sich läßt. Lee Kwan Yew, der von Helmut Schmidt aus guten Gründen geschätzt wird, hatte nämlich behauptet, daß die demokratischen Werte des Westens nur für die westliche Gesellschaft tauglich seien.
Hillary Clinton berief sich bei ihrem Referat im Land des gefürchteten Großkhans auf die dubiose Nichtregierungs-organisation »Freedom House«, als sie behauptete, in den vergangenen fünf Jahren sei Asien die einzige Weltregion gewesen, die ständige Gewinne an politischen Rechten und Bürgerrechten zu verzeichnen hatte. Welche Staaten sie damit gemeint hat, bleibt für den Kenner Ostasiens unerfindlich. Vermutlich wollte sie nicht auf das abscheuliche Beispiel der Philippinen verweisen, wo die Formalien amerikanischer Demokratie getreulich kopiert, besser gesagt, karikiert wurden. Im Gegensatz zu den benachbarten kommunistischen Regimen des Festlandes bleiben die darbenden Massen zwischen Luzon und Mindanao unter der Tarnung eines zynisch manipulierten Wahlzirkus weiterhin der Willkür einer ausbeuterischen »Rosca« ausgeliefert. Daß noch im April 2012 der ehemalige mongolische Staatspräsident Enkhbayar unter Anklage horrender Korruption verhaftet wurde, hat Hillary Clinton wohlweislich nicht erwähnt.
Wenn die heutige Mongolei ihre Hauptstadt zu einem architektonischen Monstrum ausbaut, die Hälfte aller Staatsbürger dort bereits im Schatten der Geschäftshochhäuser aus Glas und Stahl zusammengedrängt sind und in ihren planlosen Jurtensiedlungen dennoch ein halbwegs erträgliches Leben führen können, so ist das dem ungewöhnlichen Reichtum dieses Landes an Kohle, Uranium, Gold, Kupfer und Seltenen Erden zu verdanken. Um die Ausbeutung dieser Bodenschätze stehen die amerikanischen Konzerne bereits in erbittertem Widerstreit mit den chinesischen Investoren, womit sich wohl auch das Loblied der US-Außenministerin auf die demokratischen Tugenden dieser Steppenreiter erklären läßt. Von dem Wettbewerb hat eine Anzahl cleverer einheimischer Spekulanten profitiert und ein System der Oligarchie geschaffen, das die parlamentarische Attrappe finanziert und für ihre Interessen einspannt.
»Bombardiert das Hauptquartier!«
In Deutschland hat man den Aufstieg Chinas zur Weltmacht mit Unbehagen und Mißgunst zur Kenntnis genommen. Zwar erinnert man sich an den Ausruf von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der im Jahr 1969 mit dem Satz »Ich sage nur: China! China! China!« unangebrachte Heiterkeit erregte. Auch Helmut Kohl, der bei einer Staatsvisite vor einem Ausflug nach Tibet nicht zurückschreckte, hatte bei aller Bündnistreue zu Amerika die zwingende Notwendigkeit erkannt, mit dem neuen Giganten in Ostasien freundschaftliche und intensive Beziehungen zu unterhalten, wobei ihm das vertrauensvolle Verhältnis zu dem damaligen Botschafter Mei Zhaorong, den auch ich persönlich schätzen lernte, zugute kam. Aber die breite deutsche Öffentlichkeit – stimuliert durch eine voreingenommene und systematisch desinformierte Presse – hat nicht aufgehört, die chinesische Entfaltung kleinzureden und immer wieder zum »China bashing« auszuholen. Als kommerzieller Partner ist China für die heutige Bundesrepublik unentbehrlich geworden. Doch wann immer die Gelegenheit sich dazu bietet und der transatlantische Allianzpartner das zu erwarten scheint, bricht in den deutschen Medien ein Chor der Verwünschungen gegen die roten Mandarine von Peking aus.
Man will in Germanien die globalen Umschichtungen ignorieren und kann nicht begreifen, daß die aus Not und Unterdrückung auftauchenden Nationen anderer Kontinente den Brecht’schen Grundsatz beherzigen: »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral«, anders gesagt, »dann kommt die Demokratie«. Gewisse deutsche Intellektuelle kommen sich offenbar sehr mutig vor, wenn sie, um die Machthaber der Volksrepublik zu irritieren, dem Dissidenten Liao Yiwu den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verleihen oder dem avantgardistischen Künstler Ai Weiwei eine Berühmtheit einräumen, die er bei seinen Landsleuten in weit geringerem Maße genießt. Gewiß muß man die wackeren Regimekritiker vor der pauschalen Repression durch die Behörden der Volksrepublik zu schützen suchen, aber dabei sollte man die eigene »raison d’état«, die die pragmatisch veranlagte Kanzlerin andernorts sehr wohl zu berücksichtigen weiß, nicht ganz aus den Augen verlieren. Kurzum, die neuen Proportionen einer sich auflösenden Weltordnung bedürfen einer nüchternen Analyse. In der gegenwärtigen Eurokrise, in der unser Kontinent verzweifelt zappelt, wäre eine minimale Rücksichtnahme auf den Staat, der über die weitaus größten Währungsreserven verfügt, ein Gebot elementarer Vernunft und Selbsterhaltung.
Der Justizapparat der chinesischen Kommunisten operiert grausam und bürokratisch. Jede politische Opposition wird brutal unterdrückt. Die Todesstrafe wird oft willkürlich verhängt. Aber – ohne die Vereinigten Staaten schmähen oder eine leichtfertige Parallele herstellen zu wollen – die Perspektive, den Stimmungsschwankungen einer amerikanischen Jury vor Gericht ausgesetzt zu sein, ließe mich auch nicht ruhig schlafen. In den Kerkern Chinas wird gefoltert, doch die Erinnerungen an Abu Ghraib, an Bagram und andere amerikanische Verhörzentren, die Unfähigkeit Obamas, das Straflager von Guantánamo aufzulösen, die Praxis der CIA, verdächtige Terroristen auf dem Weg der »rendition« sadistischen Henkern in orientalischen Vasallenstaaten auszuliefern, gemahnen daran, daß nicht nur das Gute, sondern auch das Böse in jedem Menschen verwurzelt ist. Die Legende von der Erbsünde enthält mehr Wahrheit, als manche Agnostiker eingestehen wollen. Mag der Attentäter Khaled Scheikh Mohammed sich auch schlimmster Terrorakte schuldig gemacht haben, bleibt die Vorstellung unerträglich, daß dieser Mann 183 Mal der Tortur des »waterboarding« unterzogen wurde, einer ausgeklügelten Qual des simulierten Ertrinkens. Eine ähnliche Methode, »la baignoire« genannt, hatte übrigens die Gestapo an französischen Widerstandskämpfern erprobt, was wiederum nicht verhinderte, daß französische Paras – bei der »Pazifizierung« der Kasbah von Algier – auf die gleiche abscheuliche Quälerei zurückgriffen.
Der Europäischen Union unserer Tage steht es schlecht an, sich ihres eigenen Wohlverhaltens zu rühmen. Die Schaffung des Internationalen Gerichtshofs von Den Haag ist alles andere als ein Triumph der Gerechtigkeit. Dort wurden bisher nur mörderische Bandenführer des Balkans oder Anstifter zu Massakern in Afrika verurteilt. Aber es würde doch niemals ein verantwortlicher und schuldiger Kommandeur oder Politiker aus Rußland, den USA, China oder Frankreich dem Urteil eines Gremiums von bunt zusammengewürfelten Juristen ausgesetzt, deren eigene Regierungen allzuoft die Menschenrechte mit Füßen treten. Ein Beweis, wie kontraproduktiv die Einrichtung dieses Tribunals sich erweisen kann, wurde unlängst erbracht, als die deutsche Kanzlerin angeblich Wladimir Putin gefragt hat, ob Rußland nicht dem syrischen Diktator Bashar el-Assad Asyl gewähren könne, um Raum für einen Kompromiß im syrischen Bürgerkrieg zu schaffen. Der russische Außenminister Lawrow hat das ziemlich rüde als einen »Witz« bezeichnet. Aber für Assad existieren vermutlich nur zwei Alternativen: Entweder er wird auf bestialische Weise – wie Muammar el-Qadhafi, den man gepfählt hat – umgebracht, oder er muß den Rest seiner Tage in einer holländischen Haftzelle verbringen. Also dürfte er aller Wahrscheinlichkeit nach Widerstand bis zum letzten leisten und sich dabei erbarmungslos auf den Überlebensinstinkt seines Clans und seiner verschworenen alawitischen Glaubensgemeinschaft verlassen.
Dem Pentagon ist es inzwischen gelungen, die gezielte Tötung von Terroristen auch in fremden Staaten wie Pakistan, Jemen oder Somalia mit Hilfe von unbemannten Flugkörpern, von Drohnen, »Predators« genannt, mit unheimlicher Präzision durchzuführen. Aus einem geheimen Bunker in Kansas oder Nebraska wird die Ortung und die Vernichtung der Ziele vorgenommen. Daß bei diesem Zugriff auch unschuldige Menschen, sogenannte »collateral damages«, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, ums Leben kommen, wird dabei in Kauf genommen. Ich neige nicht zu moralischer Empörung, aber ich empfinde es als unerträglich, wenn in Talkshows und Regierungserklärungen die todesmutigen Mujahidin Afghanistans, die – lediglich mit Kalaschnikow und RPG 7 bewaffnet – den gepanzerten Kolonnen der NATO entgegentreten, als »Feiglinge« beschimpft werden. Wie nennt man dann die Bomberpiloten, die aus 10 000 Meter Höhe und ohne jedes eigene Risiko verdächtige Menschenansammlungen, die nur oberflächlich als Taleban identifiziert wurden, der Vernichtung preisgeben?
Andererseits kann man den Industrienationen des Westens – dazu gehört paradoxerweise auch Japan – nicht übelnehmen, daß sie den Durchbruch der Volksrepublik China zur führenden Exportnation – dabei hat sie auch die Bundesrepublik Deutschland überrundet – durch Gegenmaßnahmen und sogar diskriminierende Sanktionen einzugrenzen suchen. Die Ingenieure und Arbeiterkolonnen aus dem Reich der Mitte sind inzwischen in jedem Erdwinkel anzutreffen. Peking ist darauf angewiesen, die für seinen Aufstieg notwendigen Rohstoffe und Mineralien weltweit aufzukaufen, offeriert jedoch eine bemerkenswerte Gegenleistung durch den Ausbau gewaltiger Infrastrukturprojekte. Beliebt haben sich die Chinesen, die sich strikt von der einheimischen Bevölkerung abkapseln und ihre Leistungen im Rekordtempo erbringen, in den Entwicklungsländern nicht gemacht. Aber sie sind unentbehrlich geworden.
Man hat dem sensationellen Expansionserfolg der chinesischen Machthaber vorgeworfen, sie würden ihre wirtschaftlichen Abschlüsse mit jeder Art von Regimen tätigen und sich nicht im geringsten darum scheren, ob dort die Menschenrechte und ein Minimum an Demokratie gewahrt werden. Peking lehnt jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten seiner Vertragspartner und Klienten ab und beabsichtigt in keiner Weise, durch irgendwelche Ermahnungen oder Pressionen mäßigenden Einfluß selbst auf verbrecherische Systeme zu nehmen. Doch diese an Zynismus grenzende Zurückhaltung und Indifferenz erscheint in mancher Hinsicht achtbarer und weniger hypokritisch als der amerikanische Anspruch, die »Guten« zu belohnen, die »Bösen« zu bestrafen und auf die Einhaltung von Menschenrechten und Demokratie zu pochen. Bei näherem Zusehen erweisen sich nämlich die tugendhaften Forderungen der USA als Instrument hegemonialer Bestrebung. Was »gut« und »böse« ist, wird nicht von den selbstgefälligen Zirkeln humanitärer »Gutmenschen« der sehr unterschiedlichen NGOs entschieden, sondern durch die nüchterne strategische Lagebeurteilung des Pentagons oder durch die Profitorientierung global operierender Konzerne.
Francis Fukuyama, der seiner Utopie vom »Ende der Geschichte« längst abgeschworen hat, steigert sich unter Bezug auf den Vorgänger Obamas zu einer sehr krassen Formulierung: »Die Bush-Administration hat viele Menschen davon überzeugt, daß der Ausdruck ›Demokratie‹ nur ein Codewort geworden ist für militärische Intervention und gewaltsamen Regime-Umsturz.«
*
Der Historiker Leopold von Ranke vertrat die Meinung, daß ein Mensch alt werden müsse, um die geschichtsträchtigen Vorgänge deuten zu können, die sich zu seinen Lebzeiten vollzogen. Im Hinblick auf China hoffe ich – bei aller gebotenen Zurückhaltung –, auf diese Erkenntnis zurückgreifen zu können. Mein erster Kontakt mit dem Reich der Mitte geht auf den März 1946 zurück. Ich war damals mit einem Vortrupp des französischen Expeditionskorps in der Nähe der nordvietnamesischen Hafenstadt Haiphong an Land gegangen. Wir waren dabei vorübergehend unter das Feuer der nationalchinesischen Kuomintang-Armee geraten, die laut internationaler Vereinbarung in die Nordhälfte von Französisch-Indochina eingerückt war, um dort die japanischen Besatzungstruppen nach der Kapitulation des Tenno zu entwaffnen.
Zum gleichen Zeitpunkt erlagen die Divisionen des Marschall Chiang Kai-shek nördlich des Yangtsekiang dem Ansturm der Volksbefreiungsarmee Mao Zedongs und taumelten von Niederlage zu Niederlage. Im Norden Vietnams übte nicht der Generalissimo Chiang den effektiven Oberbefehl über seine Soldateska aus, die die einheimische Bevölkerung drangsalierte, sondern der eigenwillige Warlord der südchinesischen Provinz Yünan. Um den Abzug dieser plündernden Marodeure zu erreichen, hatte der vietnamesische Nationalheld Ho Tschi Minh mit dem französischen General Leclerc einen seltsamen »modus vivendi« vereinbart. Die kommunistischen Revolutionäre stimmten schweren Herzens der Rückkehr der französischen Kolonialarmee nach Tonking zu. In weiser Voraussicht verließ »Onkel Ho« sich darauf, daß das Zeitalter der französischen Präsenz sich dem Ende zuneigte, während eine militärische Okkupation seiner Heimat durch die Chinesen – welcher politischen Couleur sie auch angehörten – sich zu verewigen drohte. Jahrhundertelang hatte der annamitische Hof von Hue dem »Sohn des Drachen« in Peking seinen Vasallentribut entrichten müssen.
Als ich im Frühjahr 1951 – dieses Mal als Kriegsberichterstatter – wieder in Hanoi eintraf, hatte zwei Jahre zuvor der triumphierende Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Gründung der kommunistischen Volksrepublik China proklamiert. Seinem ideologisch gedrillten Massenheer war es in Korea wider Erwarten gelungen, ohne nennenswerte Bewaffnung und unter grauenhaften Verlusten die bis zur Grenze der Mandschurei vorgerückte US Army auf ihre Ausgangsposition am 38. Breitengrad zurückzuwerfen. Inzwischen hatte die Volksbefreiungsarmee auch die Südprovinzen Kwangsi und Yünan weitgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Nunmehr konnten die Partisanen Ho Tschi Minhs – von ihren kommunistischen Verbündeten aufgerüstet – die französischen Schlüsselstellungen von Langson und Caobang überrennen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte die Regierung in Paris erkennen müssen, daß ihr Feldzug in Fernost zum Scheitern verurteilt war. Statt dessen ließ der kommandierende General Navarre den völlig isolierten Talkessel von Dien Bien Phu zur Festung ausbauen in der Absicht, den Vietminh zu einer Entscheidungsschlacht zu zwingen. Trotz aller Bravour der französischen Paras und der Fremdenlegionäre signalisierte der unvermeidliche Fall von Dien Bien Phu das Ende der romantisch verklärten Bindung Frankreichs an seine rebellischen Besitzungen am Mekong und am Roten Fluß.
1972 reiste ich ganz offiziell im Gefolge des damaligen Außenministers Walter Scheel nach Peking. Die maoistische Volksrepublik hatte inzwischen mit äußerster Konsequenz alle Spuren von Kapitalismus und Feudalherrschaft ausgemerzt. Dabei war es zu grauenhaften Phasen ideologischer Verwirrung gekommen. Am verhängnisvollsten wirkte sich der »Große Sprung nach vorn« aus, als Mao Zedong in einer Anwandlung von revolutionärer Verblendung die Agrarproduktion vernachlässigte und statt dessen den Landkommunen befahl, die Selbsterzeugung von Stahl in Kleinsthochöfen vorzunehmen. Diese absurden Maßnahmen sollen angeblich zwanzig Millionen Menschen zum Hungertod verurteilt haben, was eine ganze Reihe von ignoranten Intellektuellen in Europa nicht hinderte, den »Großen Sprung nach vorn« damals als Erfolg zu feiern.
Etwa eine Dekade später holte der »Große Steuermann« zum nächsten vernichtenden Schlag aus. Der vorübergehenden Entmachtung durch seine Umgebung, die seine Extravaganzen zu dämpfen suchte, begegnete er mit einer flammenden Kampagne gegen angebliche Revisionisten und bürgerliche Reformer. Er wiegelte das Volk und vor allem die fanatischen Jugendmassen der Rotgardisten zur »Großen proletarischen Kulturrevolution« auf und gab die Losung aus: »Bombardiert das Hauptquartier!« Gemeint waren die ihm entfremdeten Führungsgremien der eigenen Partei. Die bisherige politische Elite sah sich der rabiaten Verfolgung durch aufgehetzte Horden von Jugendlichen und einer entwürdigenden Umerziehung in Straflagern ausgesetzt. Der Text des kleinen »Roten Buches«, das Mao zur Bibel dieser intellektuellen Entgleisung machte, mußte unaufhörlich studiert und im Ton tiefster Überzeugung nachgebetet werden. Die Zahl der Todesopfer soll dieses Mal etwa fünf Millionen betragen haben.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Peking waren die schlimmsten Auswüchse der Kulturrevolution abgeklungen, aber die Furcht war noch allgegenwärtig. Bei der umfangreichen Reise, die ich mit einem deutschen Kamerateam zwischen Peking und Kanton antreten konnte, meldeten die Jungpioniere mit dem roten Halstuch in schönem Einklang, daß es ihr größter Wunsch sei, heldenhafte Soldaten der Volksbefreiungsarmee zu werden. Vor einer Art Altar, über dem das Bildnis des »Großen Steuermanns« wie ein Götze thronte, führten die Schüler Huldigungstänze auf. Auf sämtlichen Bühnen der Volksrepublik wurden die revolutionären Opern, die die Mao-Gattin Jiang Qing in Szene gesetzt hatte, als exklusives Instrument unduldsamer Indoktrinierung aufgeführt. Gleichzeitig wurde uns jedoch eine erstaunliche Freizügigkeit bei unseren Dreharbeiten gewährt, bei der Darstellung materieller Rückständigkeit, wie sie in den Agrarkommunen auf Schritt und Tritt anzutreffen war.
Die für unsere Begriffe sinnlosen Thesen des Maoismus, die auf so viele aufgeregte Geister der 68er Generation eine groteske Faszination ausübten, habe ich stets abgelehnt, aber es tauchten damals zahlreiche europäische Mitläufer in Peking auf, die sich mit Mao-Mütze und Mao-Abzeichen schmückten. Sie gehören heute zu den eifrigsten Kritikern Chinas. Im Gegensatz zu den im Westen vorherrschenden Beurteilungen, die in dem asiatischen Revolutionär und Despoten lediglich einen Schlächter und tobenden Tyrannen sehen wollen, habe ich dem »Großen Steuermann« eine fundamentale Bedeutung beigemessen bei der brutalen, geradezu explosiven Umgestaltung seines riesigen Landes. Bis dahin hatten ja ein dekadenter Konfuzionismus, die Ausbeutung durch fremde Mächte und in der gehobenen Gesellschaft die Verachtung jeder körperlichen Arbeit vorgeherrscht. Im Grunde läßt sich Mao Zedong nur mit jenem grausamen Gründungskaiser Qin Shi Huangdi vergleichen, einem Giganten, der 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung mit ähnlicher Menschenverachtung den Konfuzionismus auszumerzen suchte, die sich zerfleischenden »fighting kingdoms« zerschlug und zu einem kulturellen Block zusammenschmiedete, der sich bis heute in kontinentalem Ausmaß erhalten hat. Auf den Knochen zahlloser Zwangsarbeiter ließ er die ersten Abschnitte jener Großen Mauer errichten, die den Einfall der Nomaden verhindern sollte. Den Ökonomen Schumpeter paraphrasierend, neige ich dazu, dem Gewaltmenschen Mao Zedong eine »schöpferische Zerstörungskraft« zuzubilligen.
»… it’s a rich man’s world«
Seit dieser ersten Erkundungsfahrt habe ich China immer wieder bereist, fast alle Provinzen des Riesenreichs aufgesucht und auch Tibet, Xinjiang sowie die Innere Mongolei nicht ausgelassen. Mit meinen Betrachtungen habe ich der »political correctness« den Rücken gekehrt und dafür die unvermeidliche Kritik geerntet, mit Ausnahme übrigens der beiden kompetentesten Botschafter der Bundesrepublik in Peking, Erwin Wickert und Konrad Seitz. In den westlichen Medien bleibt die Volksrepublik einer systematischen Desinformationspolitik ausgesetzt, die von gewissen nordamerikanischen Spezialinstituten sehr professionell geschürt wird. Zumal mit meiner Beurteilung der tragischen Ereignisse am Platz des Himmlischen Friedens im Juli 1989 bin ich in Verruf geraten. Unmittelbar nach der Niederschlagung dieses Aufruhrs bin ich in Peking eingetroffen und habe auf dem »Tien An Men« zwar Spuren von Panzerfahrzeugen gesehen, die die dortigen Notunterkünfte und Zelte zermalmt hatten, aber ich habe kein einziges Einschußloch automatischer Waffen oder gewöhnlicher Gewehre entdeckt. Die Schilderung eines wahllosen Massakers durch schießwütige Soldaten entsprach nicht der Wirklichkeit. Die Exekutionen von Demonstranten, deren Zahl für ganz China von Amnesty International auf etwa 900 beziffert wird, haben vermutlich in düsteren Nebengassen oder in irgendwelchen Haftanstalten stattgefunden.
Natürlich gehörte meine Sympathie den jungen idealistischen Aufrührern, die Freiheit und Demokratie, kurzum die Übernahme des westlichen Modells forderten. Die Aufstellung einer plumpen Nachahmung der New Yorker Freiheitsstatue am Eingang der Verbotenen Stadt hatte die Richtung gewiesen. Unter den aufbegehrenden Studenten und Intellektuellen befanden sich übrigens zahlreiche Söhne und Töchter der kommunistischen Oligarchie. Sie verlangten gebieterisch und zunehmend gewalttätig die Einführung eines Multiparteiensystems, unbeschränkte Meinungsfreiheit und eine liberale Marktwirtschaft.
Wenn nach heftigen Disputen im höchsten Parteigremium der Ministerpräsident Li Peng schließlich den Befehl gab, den Tumult, der sich inzwischen auch gegen die zunächst unbewaffneten Soldaten der Volksbefreiungsarmee richtete, mit Gewalt niederzuschlagen, so geschah das zweifellos aus der Befürchtung, daß sich aus dieser Revolte eine neue, eine »weiße Kulturrevolution« entwickeln könnte. Die Exzesse der Rotgardisten des greisen Mao Zedong waren noch in frischer Erinnerung, zumal bei Deng Xiaoping, der mit der Schandkappe durch die Straßen gejagt und mitsamt seiner Familie schlimmsten Demütigungen und Gewaltakten ausgesetzt war.
Vielleicht ahnte Deng auch bereits, daß das Perestroika-Experiment Gorbatschows, das in Europa solche Begeisterung auslöste, zur staatlichen Auflösung der Sowjetunion und einem Massenelend führen würde, wie es die russische Bevölkerung seit Stalins Zeiten nicht mehr gekannt hatte. Die westlich orientierten Aufrührer besaßen weder ein präzises politisches Programm noch eine halbwegs überzeugende Führungsgestalt. Sie drohten, das Reich der Mitte in Chaos und Bürgerkrieg zu stürzen, die – wie das in China bei ähnlichen Umstürzen stets üblich war – Millionen Todesopfer gefordert hätten. Kurzum, der kleine, geniale Parteichef Deng, der einmal gesagt hatte, es sei egal, ob eine Katze weiß oder schwarz sei, Hauptsache sie fange Mäuse, griff nun auf einen anderen chinesischen Leitsatz zurück, nämlich man müsse ein Huhn schlachten, um eine Horde Affen zu verjagen.
*
Was sich seit dem dramatischen Zusammenprall am Platz des Himmlischen Friedens in der Volksrepublik vollzogen hat, muß als Wunder bezeichnet werden. Wer hätte damals geahnt, daß die chinesische Hafenstadt Shanghai mit den futuristischen Türmen von Pudong die amerikanische Metropole New York und ihre »battery« überholen würde? Das Reich der Mitte, das zur Zeit der Kulturrevolution über eine erbärmliche Infrastruktur verfügte, wird heute in allen Himmelsrichtungen von einem Netz sechsspuriger Autobahnen durchzogen. Chinesische Kosmonauten bereiten sich vor, zum Mond zu starten. Die Dynamik dieser Entwicklung zur zweiten, morgen vielleicht zur ersten Weltmacht kann wohl nur jemand ermessen, der ihren Aufstieg aus einem Abgrund von Elend und arroganter Fremdherrschaft persönlich miterlebt hat. Am Rande sei erwähnt, daß in den Spielkasinos der ehemals portugiesischen Kolonie Macao, die weiterhin über einen Sonderstatus verfügt, höhere Summen eingesetzt und verzockt werden als im legendären Las Vegas.
Wie konnte eine solche gesellschaftliche Umkrempelung kolossalen Ausmaßes bewältigt werden? Von der reinen Lehre Mao Zedongs kann heute nicht mehr die Rede sein, wenn sich im Schatten hochragender Wolkenkratzer teuerste Luxuslimousinen die Vorfahrt streitig machen und allzu viele »Söhne des Himmels« auf ihren Karaokebühnen den amerikanischen Song anzustimmen scheinen: »Money, money, money, it’s a rich man’s world«.
Ein solches Staatswesen bedarf einer richtungweisenden Ideologie, zumal wenn der rasante soziologische Umbruch seine phänomenalen Errungenschaften erhalten und weiter ausbauen will. Diese uralte Kulturnation wird sich niemals aus gewissen ererbten Strukturen lösen können, die im Laufe der Jahrtausende zwar vorübergehend erschüttert, sich dann aber immer wieder bestätigt haben. Die Macht des Kaisers, des »Drachensohnes«, war stets gebunden an den »Auftrag des Himmels«, an einen Zustand der friedlichen Ordnung, an eine mythische Vorstellung von Harmonie und an das Wohlergehen des Volkes. Mir kommt da der Sommer 1976 in den Sinn, als ich nach dreitägiger Eisenbahnfahrt, von Hanoi kommend, in Peking eintraf. Es herrschte damals in der chinesischen Hauptstadt die düstere Atmosphäre eines »fin de règne«. Bedrohliche Naturereignisse kündigten das Ende des »Mandats« an, das Mao Zedong bis zu seiner tödlichen Ermattung für sich beansprucht hatte. Schwere Erdbeben hatten die Hauptstadt und diverse Industriereviere des Nordens heimgesucht. Die Schächte der Gruben brachen zusammen, und schwarzes Wasser quoll aus den Tiefen hervor. Die legendären Drachen, die – den Geomantikern und dem Volksglauben zufolge – in der Tiefe schlummern und normalerweise Stabilität und Glück garantieren, schienen ihren Groll über den rechtlosen Zustand, der sich am Sterbebett des großen Tyrannen und unter dem Einfluß der ruchlosen »Viererbande« eingestellt hatte, durch zerstörerische Regungen kundzutun.
Wie steht es heute um die Harmonie zwischen Himmel und Erde, während die höchsten Mandarine der Kommunistischen Partei, die sich zur Beratung im Gästehaus der ehemaligen Mao-Gattin Jiang Qing zurückziehen, mit einer Situation konfrontiert sind, die voller Verheißungen, aber auch voller Widersprüche steckt? Allzu häufig ist behauptet worden, daß der Sitten- und Ritenkodex, daß die Weisheitssprüche des Meisters Kong, der ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung den chaotischen Kriegswirren seiner Epoche durch Vernunft und Gesittung Einhalt gebieten wollte, sich nach dem Tod Mao Zedongs in ihrer strikten Hierarchie von Staat und Familie wieder durchsetzen würden. Der »Große Steuermann« hatte die Lehrer des Konfuzius, die er für die Lähmung und Wehrlosigkeit des chinesischen Reiches seit dem Opiumkrieg verantwortlich machte, zu Tausenden umbringen lassen. Er folgte wiederum dem Vorbild des Reichsgründers Qin Shi Huangdi, der sich auf die Zwangsmethoden seiner »Legalisten« stützte und die konfuzianischen Magister zu Tausenden bei lebendigem Leibe begraben ließ.
Ich habe selber noch erlebt, wie entfesselte Rotgardisten mit dem Kampfschrei »Pi Lin, Pi Kong« an der Geburtsstätte des Mannes, den die Chinesen Kong Zi nennen, ihre Wut gegen dessen zutiefst konservative Thesen ausdrückten. Mit der Schmähung des Namens »Lin« wiederum war jener Oberbefehlshaber der Volksbefreiungsarmee und designierte Nachfolger Maos, Marschall Lin Biao, gemeint, der nach einem Putschversuch auf der Flucht in die Sowjetunion über der Mongolei mit seinem Flugzeug abgestürzt war. Die absurde Assoziation des Marschall Lin Biao, eines fanatischen und verräterischen Kommunisten, mit Konfuzius offenbarte das ganze Ausmaß dieses revolutionären Wahns.
Wenn dennoch die kommunistischen Machthaber unserer Tage zumindest verbal auf die konfuzianische Tradition zurückgreifen und weltweit zur Pflege chinesischer Kultur sogenannte »Konfuzius-Häuser« eröffnen, so dürften sie sich der Grenzen einer solchen Rückbesinnung bewußt sein. Erwähnen wir nur zwei Beispiele der Unvereinbarkeit mit dem heutigen Zustand der Volksrepublik. Konfuzius hatte dem Soldaten die niedrigste Stufe seiner Gesellschaftsstruktur zugewiesen, während in unseren Tagen die Volksbefreiungsarmee – aufs engste mit der Partei verwoben – als unentbehrlicher Faktor der nationalen Einheit gefeiert wird. Die Frau ihrerseits war von Meister Kong zur totalen Unterwerfung unter den »pater familias« verurteilt, während die von Mao und seiner Frau Jiang Qing betriebene Emanzipation ein beachtliches weibliches Selbstbewußtsein gefördert hat. Zudem hat die »Einkindpolitik«, die heute noch gilt, dazu geführt, daß die befohlenen Abtreibungen überwiegend an weiblichen Föten vorgenommen wurden, denn der Ahnenkult erfordert, daß die Bestattungsriten von einem Sohn zelebriert werden. Was sollen die Mandarine von heute zudem mit jener rückwärtsgerichteten Utopie anfangen, der zufolge die perfekte Eintracht zwischen Himmel und Erde nur wiederhergestellt werden könne, wenn man zu den Tugenden des »Goldenen Zeitalters« zurückfände, die sich angeblich unter den mythischen Dynastien Shang und Zhou in grauer Vorzeit entfaltet hatten?
Die maoistischen Epochen des Terrors sind bestimmt nicht dem Vergessen anheim gefallen. Dem »Großen Steuermann«, dessen Leichnam mit rosa gefärbten Bäckchen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in einem ziemlich geschmacklosen Mausoleum aufgebahrt liegt, wird dennoch eine unerklärliche Verehrung zuteil. Laut Meinungsumfragen sollen sechzig bis siebzig Prozent aller Chinesen diese erdrückende Figur überwiegend positiv bewerten. »Ohne große Männer und Vorbilder gibt es keine Tugend und keinen Wohlstand beim Volk«, hatte sogar der von ihm gehaßte Kong Zi gelehrt. So scheint es niemand zu verwundern oder zu schockieren, daß das Porträt Maos weiterhin den Eingang der Verbotenen Stadt beherrscht und die neu gedruckten Geldscheine ziert, daß überall seine Abbildung in Bronze oder Porzellan ausgestellt ist, daß das berüchtigte rote Büchlein in vielfachen Übersetzungen zum Verkauf aussteht. So viel Sinn für Ironie ist offenbar vorhanden, daß ich lange nach der Kulturrevolution eine Vase erwerben konnte, auf der Mao Zedong und der »teuflische« Putschist Lin Biao sich brüderlich zuprosten.
Es wäre müßig, über die mentalen Wandlungen zu meditieren, die sich möglicherweise beim breiten Volk vollziehen, in dem die Überlieferungen des Taoismus und des Buddhismus lebendig geblieben sind. Bemerkenswert ist die Härte, mit der die Parteifunktionäre gegen die Falun-Gong-Sekte vorgehen, deren Gründer in USA lebt und deren bizarre Vorstellungen auf Außenstehende wie Scharlatanerie wirken. Aber das Riesenreich und seine sonst so pragmatischen Einwohner, denen jede Form von Metaphysik fremd bleibt, ist in der Vergangenheit von völlig irrationalen Umsturzbewegungen in seinen Grundfesten erschüttert worden. Noch im 19. Jahrhundert konnte die Taiping-Revolte, deren bäuerlicher Anführer als angeblicher Bruder Jesu Christi im Begriff stand, die Qing-Dynastie zu stürzen, nur mit Unterstützung westlicher »Barbaren« in einem Blutbad ertränkt werden.
Mit zunehmendem Lebensniveau und dem Entstehen einer breiten Mittelschicht dürfte das Aufkommen politischer Mäßigung, der Verzicht auf alltägliche Exzesse wohl auf Dauer nicht verhindert werden, aber die Hinwendung zu europäischen oder amerikanischen Formen parlamentarischer »Streitkultur« ist kaum vorstellbar. Von Churchill stammt das Wort, daß die parlamentarische Demokratie die schlechteste aller Regierungsformen sei – mit Ausnahme aller anderen. Aber die Zeit ist ja nicht so entfernt, als der Zugang zum Rang eines Abgeordneten auch im Abendland nur einer privilegierten Elite offenstand. In Frankreich hatte das zensitäre System den Aufstieg zum »député« auf die Zugehörigkeit besitzender Klassen beschränkt. »Enrichissez-vous – Bereichert euch doch«, hatte der Regierungschef Guizot den Besitzlosen zugerufen, die auf gleichberechtigte Vertretung im Palais Bourbon drängten. In Preußen hat bis zum Ersten Weltkrieg das Dreiklassenwahlrecht gegolten, und in England wird die gesellschaftliche Schichtung der Untertanen ihrer »gracious Majesty« bereits an der sprachlichen Artikulation erkannt.
Die Chinesen selbst werden über ihre politische Zukunftsgestaltung entscheiden. Jede Einmischung von außen wäre nicht nur ungehörig, sondern töricht. Es sind manche Entgleisungen vorstellbar, aber unbestreitbar herrscht bei allen Schichten des Reiches der Mitte ein glühender Nationalismus vor. Das Wort »Staatskapitalismus«, mit dem man das aktuelle System Pekings definieren möchte, entbehrt jeder präzisen Definition. Was nun die Handvoll intellektueller Revisionisten betrifft, die in Europa bewundert werden, so muß selbst eine liberale deutsche Zeitung eingestehen, »daß deren Einfluß sich auf begrenzte Literatenzirkel erstreckt und weniger auf die Gesellschaft als Ganzes«. Wer aber von angeblichen »Minderwertigkeitskomplexen« redet, die den überspannten Ehrgeiz der chinesischen Führung motivieren, hat vom Reich der Mitte und seinem titanischen Erwachen nichts verstanden. Selbst in der Epoche der schlimmsten Erniedrigung hat sich die Han-Rasse allen anderen Völkern überlegen gefühlt und die europäischen Eindringlinge als »red faced barbarians«, als rotgesichtige Barbaren«, verachtet.
Ein Mord in Chongqing
Es traf sich gut, daß ich das Augenmerk meiner letzten Chinareise im Herbst 2010 auf die Provinz Szetschuan im Yangtse-Becken und speziell auf die ungeheuerliche Agglomeration Chongqing mit ihrer Ballung von dreißig Millionen Menschen gerichtet hatte. Ich war bereits im Jahr 1981 zugegen in dieser Region, aus der der große Staatsmann Deng Xiaoping stammte, die er als Parteisekretär später verwaltete und in der er – präzis zum Zeitpunkt meines Aufenthalts – seine erste große Modernisierung, die behutsame Privatisierung der Landwirtschaft, in die Wege leitete. Ähnlich wie bei der Währungsreform von 1949 in Deutschland, konnte ich an Ort und Stelle feststellen, wie die bisher extrem kärglich belieferten Märkte von einem Tag zum anderen mit Lebensmitteln überschwemmt wurden und sich beim Volk das Gefühl einer radikalen Besserung ihrer Existenz einstellte.
Ansonsten bot Chongqing zu jener Zeit ein erbärmliches Schauspiel. Elende, verwahrloste Hütten klebten an den steilen Gassen dieser tristen Metropole. Im Zweiten Weltkrieg – als Chiang Kai-shek hier seine zentrale Bastion gegen die vergeblich durch die Yangtse-Schluchten vorrückenden Japaner behauptete – war die Stadt dem unaufhörlichen Bombardement der Luftwaffe des Tenno ausgeliefert. Vor dreißig Jahren hatte sich in den engen Gassen ein Bild der Verwüstung erhalten. Die Kulturrevolution der sechziger Jahre hatte Chongqing besonders grausam heimgesucht. Am Ende lieferten sich die Arbeiterschaft der Fabriken von Szetschuan und die entfesselten Rotgardisten regelrechte Gefechte, denen erst der Einsatz der Volksbefreiungsarmee mit schweren Waffen ein Ende setzte.
Was sich in der Zwischenzeit im Yangtse-Becken an Veränderungen vollzogen hat, grenzt ans Übermenschliche. Die steilen Ufer des Stroms sind von massiven weißen Baufronten wie von einem Festungsgürtel gesäumt. Die wuchtigen Gebäude, die keine sonderliche architektonische Inspiration verraten, wohl aber einen hemmungslosen Willen zur Macht, ragen als »skyscraper« buchstäblich in die graue, feuchte Wolkendecke, die sich über Chongqing so selten lüftet, daß man sagt, die Hunde begännen zu bellen, wenn die Sonne einmal durchbräche. In den Schluchten reihen sich die Blocks der Geschäftszentren und der Wohnsilos bis ins Unendliche aneinander. Die sich überall stauende Menschenmasse ist dazwischen eingekeilt wie bunte Mosaiksteinchen. Von den »blauen Ameisen« der Mao-Ära ist keine Spur übrig. Früher war die Stadt Chongqing für die Benutzung von Fahrrädern ungeeignet, so steil fielen die Hänge zum gewaltigen Strom ab. Heute hat man durch ein System sich ständig überlagernder Autobahnen Raum geschaffen für den erdrückenden Verkehr. Die Luxuskarossen teuerster ausländischer Marken sind ebenso zahlreich wie die Boutiquen der exklusivsten europäischen Modeschöpfer. Überfüllte Restaurants, Karaoke-Clubs und dröhnende Diskotheken übertönen nach Einbruch der Dunkelheit den rauschenden Lärm des Verkehrs.
In Szetschuan ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Boom der Bauwirtschaft ist mit Spekulation und Korruption einhergegangen. Der oft zitierte »Staatskapitalismus« ist – laut freimütigem Eingeständnis meiner chinesischen Begleiter – in Chongqing wie in so manchen anderen gigantisch expandierenden Metropolen des Reiches der Mitte dem hemmungslosen, oft kriminellen Bereicherungsdrang einer neuen Finanzelite ausgeliefert. Schon redet man vom Entstehen neuer »Triaden«, von verschwörerischen Geheimbünden, die bis in die höchsten Kreise der Einheitspartei reichen. Daneben – das sollte man nicht kleinreden – vollzieht sich jedoch das Entstehen eines soliden Mittelstandes. Die einst erbärmliche Entlohnung der Arbeiter wurde inzwischen so konsequent angehoben, daß gewisse asiatische Newcomer wie Vietnam, Bangladesch, Sri Lanka und sogar Indien westlichen Investoren vorteilhaftere Produktionskosten anbieten können.