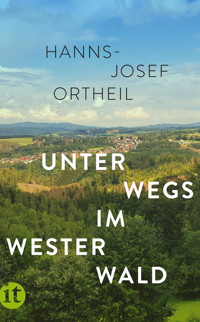9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hemingway in Venedig
Als Ernest Hemingway 1948 nach Venedig reist, ist er in einer schweren Krise. Starke Depressionen haben dazu geführt, dass er lange keinen Roman mehr veröffentlicht hat. In der Einsamkeit eines Landhauses in der Lagune versucht er, wieder zum Schreiben zu finden. Halt gibt ihm die Freundschaft zu einem jungen Fischer, der ihn auf der Entenjagd begleitet. Aber auch die Liebe zu einer achtzehnjährigen Venezianerin führt ihn ins Leben zurück. Langsam entsteht ein Venedig-Roman, während der junge Fischer die Atmosphären einer ganz anderen Geschichte wittert: Die von einem alten Mann und seiner Liebe zum Meer…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Als Ernest Hemingway 1948 nach Venedig reist, ist er in einer schweren Krise. Starke Depressionen haben dazu geführt, dass er lange keinen Roman mehr veröffentlicht hat. In der Einsamkeit eines Landhauses in der Lagune versucht er, wieder zum Schreiben zu finden. Halt gibt ihm die Freundschaft zu einem jungen Fischer, der ihn beim Fischfang begleitet. Aber auch die Liebe zu einer achtzehnjährigen Venezianerin führt ihn ins Leben zurück. Langsam entsteht ein Venedig-Roman, während der junge Fischer die Atmosphären einer ganz anderen Geschichte wittert: Die von einem alten Mann und seiner Liebe zum Meer…
Zum Autor
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Hanns-Josef Ortheil
Der von den Löwen träumte
Roman
Luchterhand
Je connais un pays étrange où les lions volent et marchent les pigeons.
(Jean Cocteau)
1
An einem Herbstnachmittag überquerten sie die Brücke, die vom Festland nach Venedig führte. Als er das weite Meer sah, bat er den neben ihm sitzenden Chauffeur, langsamer zu fahren. Er starrte zur Seite auf das stille Blau, das hier und da zu weißen Schlieren gerann. Einige Möwen tanzten über ihnen, wendeten und segelten in die Ferne. Sein Mund stand leicht offen, und als seine Frau den starren Blick bemerkte, glaubte sie, Züge von starker Rührung zu erkennen.
Sie wollte ihm ein paar Worte zuflüstern, tat es dann aber doch nicht. Abwesend schaute sie aufs Meer, das sich mit jedem zurückgelegten Meter weitete und die schmale Brücke vergessen machte, auf der sich der Wagen fortbewegte. Plötzlich spürte auch sie, wie das Mitgebrachte an Bedeutung verlor und die aufgespannte Wasserfläche alle Aufmerksamkeit an sich zog.
Als er weiter schwieg und mit zusammengekniffenen Augen das große Bild fixierte, redete sie ihn leise mit seinem Vornamen an. Er fand wieder zu sich und reagierte mit einem fragenden Laut, dann fuhr er sich mit der Rechten mehrmals über das Haar und blickte zu ihr, nach hinten. Sie lächelte, und er versuchte es auch, brachte aber nur eine kurze Aufheiterung in seinem Mienenspiel hin.
Im Fond links neben ihr saß die Übersetzerin seiner Werke ins Italienische, die sie erst vor Kurzem kennengelernt hatten. Es war eine ernste, oft etwas irritiert wirkende Frau. Sie schaute nach der anderen Seite, ließ aber nicht das geringste Erstaunen oder sonst eine Regung erkennen.
Als müsste er sich für die baldige Ankunft präparieren, griff er nach seiner Kappe, zog sie auf und richtete sie. Jetzt sah er wieder so aus wie der Mann, den sie liebte, einer, der sich aufs Fischen verstand und viel vom Wasser und Meer wusste. Dieses Wissen hatte er seit der Kindheit bewahrt und vertieft, niemand kannte sich, was Fische, Boote und Wasser betraf, besser aus. ›Seltsam ist‹, beruhigte sie sich, ›dass er mir nie länger von diesen Kindheitszeiten erzählt hat. Wir kennen uns noch nicht lange, daran mag es liegen, wir hatten noch nicht Zeit genug, uns viel zu erzählen.‹
Die Genauigkeit und die Geduld, mit der er die Welt anschaute und dann auch von ihr sprach, mochte sie sehr. Seit den Jugendtagen, als er noch als Journalist gearbeitet und Reportagen geschrieben hatte, war er, dicht an den Dingen und Ereignissen bleibend, jeder kleinen Spur in seiner Umgebung gefolgt. Alles, was ihm auffiel, nahm er ernst, ging ihm nach, notierte seine Eindrücke, ließ sie sich setzen und machte aus ihnen nach einer Zeit der Klärung eine Geschichte, die beschrieb und zusammenfasste, was er herausbekommen hatte.
Sie hatte kein einziges Mal mit ihm darüber gesprochen, denn er sprach nicht gern über das Schreiben. In den nächsten Wochen jedoch hoffte sie mehr davon zu erfahren. Sie würden eine Weile allein sein, fern von den vielen Menschen, die ihm häufig zu nahe kamen. Sie hatte sich vorgenommen, einen einsamen, stillen Ort für ihn zu finden, an dem er wieder genesen konnte. So, wie er jetzt neben ihr saß, angespannt, konzentriert, das Meer nicht mehr aus den Augen lassend, sah er wie ein gesunder, kräftiger und attraktiver Mann um die fünfzig aus. Fünfzig würde er in der Tat bald werden, das stimmte, doch er war nicht gesund.
Der Mann vor ihr, der das Meer nicht mehr aus den Augen ließ, war vielmehr sehr krank, so krank wie noch nie in seinem bisherigen Leben.
2
Sergio Carini stand in der kleinen Bar einer der Garagen, in denen die vom Festland kommenden Wagen in Venedig geparkt wurden. Seit einiger Zeit arbeitete er gelegentlich als Reporter für die venezianische Tageszeitung Il Gazzettino, deren Redaktion eine anonyme Nachricht erhalten hatte. Da niemand wusste, ob an ihr etwas dran war, hatte man Carini zu den Garagen geschickt, wo der große Mann angeblich eintreffen sollte. Der unbekannte Informant hatte behauptet, der Fremde komme in seinem eigenen Wagen, einem Buick, den er aus Cuba auf einem Schiff mit über den Atlantik gebracht habe.
Carini langweilte sich und schaute alle paar Minuten auf seine Uhr. Noch zehn Minuten, dann würde er seinen Posten aufgeben. Er unterhielt sich mit dem schmächtigen Barmann, der von seiner Frau erzählte. Es war ein stiller Oktobernachmittag des Jahres1948, nichts deutete darauf hin, dass etwas Besonderes geschehen würde.
Carini wollte seinen Caffè bezahlen, als er Schreien und Rufen hörte. Aus einer schmalen Straße strömte eine Gruppe von Kindern, denen ein schwerer, amerikanischer Wagen folgte. Er bog auf den Platz vor der Bar ein, die Türen wurden fast alle zugleich geöffnet. Als Erstes sah Carini den Mann, den er schon unzählige Male auf Fotos gesehen und dessen Bücher er fast alle gelesen hatte. Dio, er war es tatsächlich! Er trug eine helle ärmellose Daunenjacke und auf dem Kopf eine Kappe, wie sie auch die Fischer in der Lagune trugen. Als er die kleine Bar erkannte, nickte er kurz, als habe er damit gerechnet, sie geöffnet vorzufinden.
Er wartete aber noch und half der Frau, die hinter ihm gesessen hatte, aus dem Fahrzeug. Längst war auch der Chauffeur zur Stelle, ein junger, blasser Mann in einem dunkelroten Pullover, der den Trupp der schreienden Kinder mit heftigen Gesten verscheuchte. »Que bella macchina! Que bella macchina!« schrien sie immer wieder und beäugten das Innere des Wagens durch die Scheiben.
Carini kam das Ganze vor wie eine Filmszene, so reißerisch und dramatisch empfand er das Erscheinen des überproportionierten Wagens und die elegante Besatzung der beiden Frauen und Männer, die sich nun umschauten und Zeit ließen. Der Barmann war an die Tür geschlichen und schaute sich diesen Auftritt ebenfalls an. »Wer ist das?« fragte er Carini leise, als hätte ihm die Szene Angst eingejagt.
»Ich muss telefonieren«, antwortete Carini, »wo ist das Telefon?« Der Barmann zeigte kurz zur Toilettentür, neben der sich der Apparat in einer dunklen Ecke befand. Carini ging sofort hin und wählte eine Nummer, und der Barmann hörte ihm zu, als die Verbindung hergestellt war: »Ihr werdet es nicht glauben, aber unser Informant hatte recht. Hemingway ist gerade hier eingetroffen, in einem blauen Buick mit roten Ledersitzen. Ein Chauffeur und zwei Frauen begleiten ihn, eine ist, vermute ich, seine Frau, die andere ist erheblich jünger und, ich wette, eine Italienerin. Hübsche, nein, sehr hübsche Erscheinung! Vielleicht die Geliebte?! Wie auch immer, wir werden es herausbekommen. Wie soll ich vorgehen? Soll ich ihn ansprechen? … Ja, ich soll?! Meine Herren, Ihr mutet mir einiges zu. Und weiter? … In Ordnung, ich werde Kontakt mit ihm aufnehmen und melde mich wieder. Wir bringen das alles morgen auf Seite eins!«
Carini legte auf und kam zur Theke zurück. »Es ist ein Amerikaner, habe ich recht?« fragte der Barmann. – »Es ist Ernest Hemingway, der weltweit bekannteste Schriftsteller auf dieser kaputten Erde«, antwortete Carini. – »Den Namen habe ich schon mal gehört«, sagte der Barmann, aber Carini sprach nicht länger mit ihm, sondern ging noch einmal zum Telefon zurück. Er wählte eine zweite Nummer und flüsterte: »Paolo?! Wo bist Du gerade? … Besorg Dir eine gute Kamera und komm mit Deinem Boot hierher, zur Anlegestelle an den Garagen. Ernest Hemingway ist wahrhaftig gerade hier eingetroffen. Sag Onkel Tonio Bescheid, dass er sich mit der Gondel bereithält. Wir werden den großen Mann nicht aus den Augen lassen.«
3
Carini wollte nach draußen und langsam auf die eingetroffenen Fremden zugehen, als er sah, dass Hemingway sich mit dem Chauffeur unterhielt und zur Bar herüberschaute. Anscheinend gab er ihm einige Anweisungen, denn der Fahrer löste sich von der Gruppe und kam geradewegs auf die Eingangstür zu. Drinnen grüßte er und bestellte eine gut gekühlte Flasche Champagner. »Champagner?« lächelte der Barmann, »tut mir leid, den haben wir nicht. Einen gut gekühlten Prosecco aus der Region, den kann ich servieren.« – »Öffnen Sie zwei Flaschen«, sagte der Chauffeur leise, »zwei Flaschen und dazu vier Gläser!«
Carini tat, als hörte er nicht zu, und blätterte in einer Zeitung. Als der Chauffeur darum bat, telefonieren zu dürfen, holte er so versteckt wie möglich einen Block aus der Manteltasche und machte sich erste Notizen: Drei FlaschenProsecco aus der Region, sechs Gläser! Er drehte sich etwas zur Seite und bekam mit, dass der Chauffeur mit dem Hotel Gritti telefonierte. Sie sollten ein Wassertaxi schicken, für drei Personen. Er selbst werde den Wagen abstellen und später mit dem Gepäck ins Hotel nachkommen.
Dann verließ er die Bar und kehrte zu der Gruppe zurück, die hinüber auf die nahen Häuser der Stadt blickte. Die schwarzhaarige hübsche Frau schien sich gut auszukennen, sie sprach ununterbrochen, als hielte sie einen Vortrag. Sie weiß Bescheid, notierte Carini, aber sie ist nicht von hier. Alter? Höchstens dreißig Jahre. Vermutung: Eine Intellektuelle aus dem Norden. Hat zu viel gelesen, auch reichlich Lyrik. ›Venedig als Traumstadt‹ – mit solchen Metaphern geht sie hausieren …
Er schloss den Block und grinste, ja, das gefiel ihm, er war dabei, eine gute Reportage zu schreiben. Sie handelte von einem großen, weltberühmten Schriftsteller, der nach Italien zurückgekehrt war. Vor etwa dreißig Jahren hatte er im Ersten Weltkrieg als Achtzehnjähriger auf der Seite der Italiener gekämpft. Damals war er etwas weiter im Norden schwer verwundet und in einem Mailänder Lazarett lange gepflegt worden. Es hätte nicht viel gefehlt, und er wäre gestorben. Mit achtzehn! Fast noch ein Kind! Zehn Jahre später hatte er darüber einen Roman geschrieben, Carini hatte ihn zweimal gelesen, sein alter Vater und sein Sohn kannten das Buch auch.
Er überlegte, ob er jetzt nach draußen gehen sollte, blieb aber am Fenster der Bar stehen, als er sah, dass die Gruppe auf den Eingang zusteuerte. Die beiden Frauen gingen dicht zur Rechten und Linken Hemingways, sie sahen aus wie zwei Musen, die ältere blond, recht klein und mit Sicherheit Amerikanerin, die jüngere schwarzhaarig und ebenso sicher Italienerin. Der Chauffeur ging einige Schritte hinter dem Trio her, überholte es aber kurz vor der Bar und hielt die Tür auf.
Hemingway ließ die beiden Frauen vorangehen und nickte dem Chauffeur zu. Drinnen warf er einen Blick in die Runde und schaute zu Carini herüber, der die Tageszeitung wie zum Schutz vor sich hingelegt hatte. Die vier versammelten sich schließlich am Tresen, auf dem der Barmann die zwei geöffneten Flaschen Prosecco sowie vier Gläser aufbaute. Hemingway grüßte laut und fragte, ob der Prosecco gut gekühlt und trinkbar sei, und der Barmann antwortete lächelnd, es sei ein ordentlicher Prosecco aus der Region, gut gekühlt.
»Trinken Sie einen Schluck mit uns?« fragte Hemingway, und der Barmann bedankte sich und griff nach einem weiteren Glas. »Und der Gast am Fenster? Gibt auch er uns die Ehre und trinkt einen Schluck mit?«
Carini schaute etwas erschrocken auf, er verstand das Italienisch des berühmten Mannes nicht gut, die Worte kamen erst mit einiger Verzögerung bei ihm an. Er legte die Zeitung beiseite und löste sich vom Fenster. »Ich bedanke mich«, sagte er, »und ich fühle mich sehr geehrt, Mister Hemingway. Nie hätte ich damit gerechnet, Ihnen hier zu begegnen! Sind Sie es wirklich?«
Hemingway lachte und ließ eine weitere Flasche Prosecco öffnen, dann bestellte er noch ein Glas. Er umarmte die blonde Amerikanerin und sagte lachend: »Was meinst Du, Mary? Bin ich es wirklich? Sag dem Gentleman, dass ich es wirklich bin.« Sie lachte mit ihm, antwortete darauf aber nicht, stattdessen mischte sich die Schwarzhaarige ein: »Ja, er ist es wirklich! Trinken wir auf die Ankunft von Ernest Hemingway in Venedig!«
›Mein Gott, wie sie sich anstellt!‹ dachte Carini, ›sie spielt die Zeremonienmeisterin, vielleicht ist sie aber auch eine Art Managerin, die alles für ihn erledigt und regelt.‹ Er lächelte, so gut er eben konnte, und griff nach dem gefüllten Glas, das ihm Hemingway hinhielt. Dann nahmen sie alle einen Schluck, und es war einige Sekunden still, als wartete man auf die nächsten Worte des großen Mannes. Hemingway hatte sein Glas geleert und gab dem Barmann ein Zeichen, es wieder nachzufüllen, während Carini sich im Stillen ermahnte, auf keinen Fall mehr als ein einziges Glas zu trinken. Er wusste nur zu gut, dass er Alkohol nicht vertrug und schon nach der kleinsten Menge durcheinander und ins Plappern geriet.
Er stellte sein Glas außer Reichweite in der Nähe des Fensters ab und tat so, als wollte er sich zurückziehen. Kurz blickte er zur Anlegestelle, wo er Paolo erkannte, der dort gerade sein Boot festmachte. Während er ihn beobachtete, kam ihm ein Gedanke. Er hob die Rechte und winkte Paolo kurz zu, und er bemerkte, dass Hemingway die kleine Geste nicht entgangen war. Er drehte sich um, schaute ebenfalls nach draußen und ging mit seinem Glas an die Tür.
»Ist das Ihr Sohn?«, fragte er Carini. – »Ja, das ist mein Sohn Paolo.« – »Wir haben eine Menge Gepäck«, sagte Hemingway, »könnte Ihr Sohn sich darum kümmern und es in seinem Boot zum Hotel Gritti bringen?« – Carini lächelte, genauso hatte er sich das gedacht. Er beugte sich etwas vor, als machte er eine kurze Verbeugung: »Nichts würde mein Sohn lieber tun. Er verdient sich oft etwas Geld mit solchen Transporten. Dio!, wie verblüfft wird er sein, wenn ich ihm sage, wessen Gepäck er gleich zum Gritti fahren darf! Er hat viele Ihrer Bücher gelesen, so wie ich. Selbst mein alter Vater hat einiges von Ihnen gelesen, den großen Italienroman, der hier ganz in der Nähe spielt, sogar mehrmals. Ich werde hinausgehen und mit meinem Sohn reden!«
4
Paolo balancierte das Boot noch etwas aus, als er seinen Vater auf sich zukommen sah. Sergio Carini wirkte beschwingt und gut gelaunt, als habe er alles im Griff und könne mit lauter Überraschungen aufwarten.
»Was ist los?« fragte Paolo. – »Allerhand«, antwortete Carini, »Hemingway trinkt drüben in der Bar mit zwei Frauen und seinem Chauffeur ein Glas Prosecco nach dem andern. Fürs Erste hat er drei Flaschen bestellt, stell Dir das vor! Gerade hat er Deine Ankunft bemerkt. Du sollst sein Gepäck hinüber zum Gritti fahren. Ich habe gesagt, dass Du sowas häufiger machst.«
»Ich habe so etwas noch nie gemacht, das weißt Du«, antwortete Paolo. – »Behalte es für Dich!« sagte Carini, »der Chauffeur wird Dir helfen, das Gepäck auf Dein Boot zu bringen. Und ich werde mit Dir fahren, hinter den Berühmtheiten her. Sie werden nämlich von einem Taxi des Gritti abgeholt, das gleich eintrifft. Hast Du verstanden?«
Paolo wirkte unschlüssig. Er drehte sich zur Seite und schaute skeptisch auf die nahe Stadt. »Ich weiß nicht«, sagte er, »wie soll ich denn mit ihm reden? Englisch oder Italienisch?« – »Du sprichst sehr gut Englisch, aber er wird kein Englisch hören wollen. Als junger Venezianer sprichst Du Italienisch mit leichtem Dialekt. Du könntest sein jüngster Sohn sein, Du hast etwa das Alter, das wird ihm gefallen.«
Paolo schüttelte den Kopf, erwiderte aber nichts. Er kletterte aus dem Boot und folgte seinem Vater Richtung Bar. Als er genauer hinschaute, sah er, dass in der geöffneten Tür ein Mann stand, der ihm zuwinkte. »Siehst Du, er freut sich«, flüsterte Carini, »sei höflich und entgegenkommend, er beißt nicht!«
Carini ging voraus und stellte seinen Sohn vor: »Das ist Paolo, mein einziger Sohn, er ist Fischer wie alle Männer aus unserer Familie. Wir wohnen in der Lagune, genauer gesagt, auf der Insel Burano. Kennen Sie Burano, Mister Hemingway?« – »Murano, Burano, Torcello – das sind die guten Orte in der Lagune, habe ich recht?« antwortete Hemingway. – »Oh, Sie kennen sich aus! Kommen Sie uns einmal besuchen, wir würden uns freuen.«
Hemingway gab Paolo die Hand und schaute ihn genauer an. »Wie alt bist Du, mein Junge?« – »Ich bin sechzehn, Sir!« – »Dann bist Du fast so alt wie mein Jüngster.« – »Wie heißt denn Ihr Jüngster, Sir?« – »Er heißt Gregory.« – »Und wo ist er? Kommt er auch nach Venedig?« – »Irgendwann wird er auch nach Venedig kommen, jetzt aber nicht, er lebt in Amerika. Komm mit herein, trink ein Glas Prosecco mit uns!« – »Ich trinke keinen Alkohol, Sir.« – »Na sowas! Das werden wir ändern, mein Junge. Wenn Ernest Hemingway Dich einlädt, wirst Du ein Glas mit ihm leeren.«
Paolo war es peinlich, dass ihn in der Bar alle anstarrten. Die beiden Frauen grüßten, während Hemingway aus einer noch vollen Flasche Prosecco ein frisches Glas füllte. Wieder mussten alle anstoßen, doch Carini hielt sich an seine Vorsätze und nippte nur.
»Sir, ich muss Ihnen leider sagen, dass ich keine weitere Flasche mehr auf Lager habe«, sagte der Barmann. – Die beiden Frauen lachten laut auf, als machte er einen Scherz oder als hätten sie mit diesem Satz gerechnet. Sie sprachen miteinander, als wären sie enge Vertraute, während Hemingway seinen Fahrer hinaus bat und ihm neue Anweisungen wegen des Gepäcks und des Wagens erteilte.
»Geh mit hinaus«, sagte Carini leise zu Paolo, »hilf dem Chauffeur beim Verladen, mach Dich nützlich. Ich komme nach, wenn das Gepäck im Boot verstaut ist.«
Er faltete die Zeitung zusammen und legte sie zurück auf den Bartresen. Er betrachtete die Phalanx der Flaschen und Gläser und nahm sich vor, davon ein Foto zu machen, Paolo hatte bestimmt eine Kamera mitgebracht … »Lassen Sie bitte alles so stehen«, sagte er leise zu dem Barmann, »es ist ein zu schönes Bild. Ich fotografiere das später, wenn alle verschwunden sind.«
Er schaute die beiden Frauen an und fragte die blonde, ob sie Hemingways Frau sei. »Ja«, bekam er zu hören, »das bin ich!« – »Und Sie, Signora? Sie sind, lassen Sie mich raten … – Sie sind eine Italienerin hier aus der Region.« – »Nicht ganz«, erwiderte die Schwarzhaarige, »ich bin aus dem Norden und übersetze die Werke von Mister Hemingway.« – »Dass Sie mit Büchern zu tun haben, habe ich gleich geahnt, Signora«, sagte Carini. – »Und dass Signora Hemingway für große Zeitschriften schreibt und eine bekannte Reporterin ist, haben Sie das auch geahnt?«, antwortete die Schwarzhaarige, als legte sie Wert darauf, Carinis Raterei nicht widerspruchslos hinzunehmen. »Fabelhaft«, sagte Carini, »die große literarische Welt hält Einzug in unser verträumtes Venedig!«
Draußen kam Bewegung in die zuvor noch so ausgestorbene Szene. Das Gepäck wurde umgeladen, und an der Anlegestelle traf das Wassertaxi des Hotels Gritti mit gleich drei Angestellten ein, während der Chauffeur sich in den leeren Buick setzte und ihn die breiten Rampen hinauf in einen oberen Stock der Garagen fuhr.
Hemingway ging in die Bar zurück und lud zum Aufbruch ein. »Sehen wir uns später im Hotel?« fragte er Carini. – »Natürlich«, antwortete er, »ich begleite meinen Sohn. Seien Sie unbesorgt.« Er wartete geduldig, bis Hemingway bezahlt und ein anscheinend großes Trinkgeld hinterlassen hatte. Dann verbeugte er sich, öffnete den Fremden die Tür und winkte ihnen nach, als sie zur Anlegestelle verschwanden.
Wenig später kam Paolo in den Raum zurück. »Hast Du die Kamera dabei?« fragte Carini. Paolo griff nach der Ledertasche, die er umgehängt hatte, und holte sie heraus. »Das Foto«, sagte Carini zu dem Barmann, »erscheint morgen auf Seite eins von Il Gazzettino.« – Der Barmann tat etwas besorgt. »Ich weiß nicht, geht das in Ordnung? Sind Sie einer dieser Reporter, die hinter allem und jedem herschnüffeln?« – »Neinnein«, antwortete Carini, »natürlich nicht. Ich bin ein einfacher Mann aus Burano und ein begeisterter Hemingway-Leser. Das ist alles.«
Er fotografierte den Bartresen und zählte im Stillen die leeren Flaschen. Es waren vier. Dann beruhigte er den Barmann mit einem Trinkgeld und verabschiedete sich mit seinem Sohn.
›Fünf Flaschen, fünfzehn Gläser – das werde ich gleich notieren‹, dachte Carini. Kaum eingetroffen, hat er seine erste Fiesta gefeiert und die Garagenarbeiter gleich mit eingeladen. Drei Frauen begleiten ihn – die, mit der er verheiratet ist, die Übersetzerin und eine schöne Unbekannte, die ihr Geheimnis nicht preisgibt. Schöne Unbekannte sind das Feingold von Reportagen, auch wenn sie zunächst gar nicht existieren. Je länger man über sie fantasiert, umso lebendiger werden sie aber, und am Ende tauchen sie wahrhaftig irgendwo auf – als wären sie schon immer vorhanden gewesen. Sergio Carini wird dafür sorgen, Il Gazzettinohatte noch nie einen besseren Reporter.
5
Er stand aufrecht neben dem Steuer, und von Weitem sah es so aus, als führe er selbst das Wassertaxi, das sich langsam durch einen schmalen Kanal bewegte. Die beiden Frauen waren in der Kajüte verschwunden, und er hörte, dass sie sich angeregt unterhielten. Er schaute starr nach vorn und blickte auf die Nebelstreifen, die sich jetzt, am Abend, auf die Wasserfläche legten. Die ersten alten Gebäude tauchten auf, und er sah die grünen Algen, die an ihrem Putz dicht über dem Wasser nagten. Die dunkelroten Backsteine der Mauern spiegelten sich in den Wellen, als wären die Mauern beweglich oder als öffneten sie sich für einen Moment wie ein Vorhang.
Die ruhigen Bilder hinterließen einen schwachen, sich allmählich vertiefenden Nachhall. Er wäre gern allein gewesen und hätte noch lieber am Steuer gestanden, um mit dem Boot durch die Kanäle zu fahren. Er hörte, wie das Wasser an den Seiten entlangfuhr und abrupt wieder davonschnellte. Die Geräusche erinnerten ihn an die Kindheit, als er allein mit seinem Vater auf dem Michigan-See in einem Boot unterwegs gewesen war. Er hatte davon geschrieben und danach versucht, diese Szenen zu vergessen, aber sie waren in seinen Träumen erschienen, als säße er noch immer in dem kleinen Boot, um zu rudern. Sein Vater hatte ihm die Ruder überlassen, und er war stolz darauf gewesen, ihn fahren zu dürfen, doch das alles war über vierzig Jahre her, und er fragte sich, wann ihn diese Erinnerungen nicht mehr verfolgen würden.
Er setzte seine Kappe ab und betrachtete sie kurz. Ganz ähnlich war er als Junge bekleidet gewesen, mit Kappe und einer daunengefütterten Jacke. Er wollte nicht mehr daran denken, und so legte er die Kappe beiseite und konzentrierte sich auf die Fahrt. Der Mann am Steuer neben ihm bewegte sich ebenfalls nicht, er trug eine Livree des Hotels und wirkte wie eine Operettenerscheinung. Zum Glück würde ein Mann wie er weder reden noch sonst einen Laut von sich geben. Männer in mittlerem Alter machten das in Venedig nicht, wo Vielrederei verachtet wurde und höchstens eine Sache für die Älteren war.
Einige Zimmer in den Häusern zu beiden Seiten waren bereits erhellt. Das Licht war tiefgelb und füllte das Netzwerk der Räume wie flüssiger Honig. In den kleinen Nischen neben den Fenstern standen hier und da Heiligenstatuen, und er fragte sich, wer sich um sie kümmerte, wenn das Hochwasser kam. Er schaute weiter starr nach vorn, als wäre er ein Kapitän und dürfte den Details rechts und links keine Aufmerksamkeit schenken.
Am liebsten würde er nicht in einem Hotel wie dem Gritti, sondern in einer dieser versteckten Wohnungen Zuflucht suchen. Drei Zimmer würden genügen, wenn nur der Schreibtisch groß genug wäre! Ein großer Schreibtisch aus festem, beständigem Holz vor einem Fenster, das würde ihm sehr gefallen. Lange Zeit hatte er kein Buch mehr geschrieben, und es war fraglich, ob er je wieder eines schreiben würde. Noch aber hatte er eine Ahnung davon, wie man das machte: täglich schreiben, an einem Roman oder an einer Erzählung arbeiten. Es war eine der besten Sachen gewesen, die er in seinem Leben getan hatte, und er würde alles tun, um zum Schreiben zurückzufinden, koste es, was es wolle.
Er schaute sich um und zog den Kopf etwas ein. Die beiden Frauen nahmen von der Fahrt kaum Notiz und unterhielten sich weiter in der Kajüte. ›Ich verstehe nicht, wie man sich dort aufhalten kann‹, dachte er, ›ich würde nie in so einem Versteck sitzen und der Stadt den Rücken kehren.‹ Dass sie mit ihm unterwegs waren, freute ihn, aber sie hatten ganz andere Vorlieben als er, was irgendwann zu Spannungen führen konnte. ›Ach was‹, dachte er weiter, ›es wird keine Spannungen geben, Mary achtet auf so etwas und lässt mir jede Freiheit, und Fernanda ist die beste Freundin, die ich mir wünschen kann.‹
Das Wassertaxi bog langsam auf den Canal Grande ein, und der Anblick riss ihn so mit, dass er sich einen Moment an der seitlichen Rahmung des Bootes festhielt. Einige kleinere Lastschiffe, mit Holz und Eisenwaren beladen, kamen ihnen entgegen. Jetzt begann zu beiden Seiten der große Tanz der Paläste. ›Mal sehen, ob mir irgendwo der Eintritt gelingt, es wird schwer sein, fast unmöglich, aber ich werde es versuchen. Hat je ein Schriftsteller von ihrem Innenleben erzählt? Henry James, ja, der hat es versucht, aber ich werde mehr zu bieten haben als die sehnsüchtigen Blicke eines früh gealterten Mannes aus den Fenstern von Dachkemenaten‹, dachte er.
Der Fahrer fuhr jetzt etwas schneller, sodass das Taxi fast wie ein Rennboot an den triumphalen Palastfassaden entlangglitt. ›Seit Jahrhunderten sind sie verschlossen‹, dachte er, ›sie rahmen den Canal, und jeder einzelne von ihnen trotzt der Zeit. Sie bestehen einfach unverändert fort, und in ihren hohen Räumen treiben sich von Generation zu Generation dieselben, nur scheinbar verjüngten Menschen herum. Familien, die sich ihre eigene Geschichte erzählen und von nichts anderem hören wollen. Wenn sie ihre Märchengebilde verlassen, schleichen sie durch die Gassen und kommen auf immer denselben Wegen zurück. Sie umkreisen das Zuhause und lassen niemand sonst daran teilnehmen. Ich werde es ganz ähnlich machen wie sie, und das Gritti wird mein Zuhause sein. Frühmorgens werde ich hinausschleichen und mich in den Gassen verlieren, und wenn im Hotel das Frühstück serviert wird, werde ich auftauchen, und keiner wird ahnen, wie meine Wege verlaufen sind und welche Freundschaften ich geschlossen habe.‹
Auf der rechten Seite erkannte er das Gebäude der Accademia. ›Mal sehen, wann sie am Morgen öffnet‹, dachte er, ›ich werde als einer der ersten Besucher hineingehen, um mir nur ein einziges Bild anzuschauen. Etwas von Tintoretto oder von Tizian oder von Veronese, auf jeden Fall aber etwas Venezianisches.‹
Er spürte, dass sich sein Herz plötzlich wie nach einem unerwarteten Sprung auftat und ihn eine merkwürdige Wärme durchströmte. ›In den nächsten Wochen werde ich es hoffentlich besser machen als in den letzten Jahren‹, dachte er und hielt sich wieder an der Rahmung des Bootes fest.
Der schweigsame Mann am Steuer verlangsamte die Fahrt und ließ das Wassertaxi auf die andere Seite des Canals gleiten. Er hielt auf die Anlegestelle des Gritti zu, wo ein schmächtiger Kellner in ebenfalls blauer Livree auf sie zu warten schien. Als er das Boot gewahr wurde, verschwand er eilig nach drinnen, und im nächsten Augenblick strömte ein dunkler Pulk von Menschen ins Freie.
Obwohl längst Herbst war, standen auf der hölzernen Terrasse vor dem Eingang des Hotels noch immer viele Stühle und Tische mit weißen Tischdecken. ›Als wäre das alles für Dich‹, dachte er und machte einen Schritt nach hinten. Da er größer als der Mann am Steuer war, würde man ihn von der Terrasse aus gut erkennen. Er hielt sich noch etwas zurück, bis das Boot nur noch wenige Meter entfernt war.
›Na los‹, dachte er, ›zeig, wie Du Dich freust!‹
Er zog die alte Jacke aus und reckte sich auf. Dann winkte er dem Pulk der Menschen zu, die sich auf der Terrasse drängten. ›Hey, worauf wartet Ihr?‹ dachte er, ›doch nicht auf mich, Ernest Hemingway. Ihr sehnt Euch nach Eurer Geschichte, wie sie Euch noch nie jemand erzählt hat.‹
6
Er half den beiden Frauen beim Aussteigen und begrüßte auf der Terrasse die Angestellten des Hotels, die vor dem neugierigen Rudel der Gäste eine kleine Kette gebildet hatten. Der Empfangschef machte einen Schritt auf ihn zu und stellte die anderen vor, er hörte die Namen und wiederholte sie laut gegenüber den Frauen, die den Angestellten ebenfalls die Hand gaben. Die beiden hielten sich aber nicht länger im Freien auf, sondern gingen gleich weiter ins Foyer, wohin sie der Empfangschef begleitete.
Einen Moment war er allein und drehte sich um, sodass er die gegenüberliegende Seite des Canal Grande genauer betrachten konnte. Er musterte die fließenden Konturen der barocken Kirche Santa Maria della Salute und machte ein paar Schritte zur Seite, um sich der Neugierde der anderen Gäste zu entziehen. Die meisten strömten auch schon wieder ins Hotelgebäude zurück und verteilten sich im Foyer, während sich aus der Ferne das Boot mit den Gepäckstücken näherte. Er erkannte seinen Chauffeur und die beiden Männer aus Burano, die an der Garage zur Stelle gewesen waren und sich nun um den Transport bemühten.
Eine schmalere Tür führte von der Terrasse direkt in die Hotelbar. Er streifte das Innere mit einem kurzen Blick: die bequemen Sessel, die Tische mit den Zeitungen und den Kerzenleuchtern und die leeren Barhocker, dicht aneinandergerückt. In wenigen Minuten würde er dort und nirgendwo anders einkehren und von einem der Hocker am Tresen aus seine ersten Erkundigungen über das Hotel und sein Personal einholen.
Mit dem Barkeeper würde er sich rasch verstehen. So etwas war wichtig und mitentscheidend für einen gelungenen Aufenthalt. Ein Barkeeper wusste mehr als jeder Concierge, denn in einer Bar landeten auch jene Auskünfte, die nicht ans Tageslicht dringen sollten. Spätabends, nachts – da konnte man den Geschichtensud abschöpfen. Für die Erkundung solcher Details war er prädestiniert, denn er hatte ein sehr gutes Gedächtnis und konnte sich Namen schon nach einmaligem Hören noch lange merken. ›Ohne ein präzise arbeitendes Hirn bist Du in Kriegsangelegenheiten verloren‹, dachte er und musste kurz grinsen, als er sich daran erinnerte, wie er andere Menschen mit seinen Gedächtnisleistungen verblüfft hatte.
Das Boot mit den Gepäckstücken legte an, und zwei Hotelangestellte waren sofort behilflich, die Sachen ins Innere zu schaffen. Sergio Carini hüpfte auf die Terrasse, und sein Sohn folgte ihm mit einem einzigen, kurzen Schritt, während der Chauffeur im Boot stehen blieb und sich um das Ausladen kümmerte.
Hemingway war guter Laune und ging auf die beiden zu. »Du heißt also Paolo«, sagte er, »und Du bist sechzehn.« Paolo Carini lächelte verlegen und nickte.
»Und Du wohnst mit Deiner Familie in Burano und bist wie alle Männer Deiner Familie ein Fischer.« – »Ja, Sir.« – »Sind von den Männern wirklich alle Fischer?« – »Mein Großvater ist es, und mein Vater war ein Fischer, bis er begonnen hat, für Il Gazzettino zu schreiben.«
Hemingway wandte sich zur Seite und schaute Sergio Carini an. »Sie schreiben für die Zeitung?« – »Dann und wann, es macht mir Spaß.« – »Wie heißen Sie?« – »Ich heiße Carini, Sir, Sergio Carini.« – »Sie werden über unsere Ankunft in Venedig berichten?« – »Vielleicht, Sir.« – »Haben Sie sich deshalb in der kleinen Bar an den Garagen aufgehalten?« – »Ja, ich habe im Auftrag der Redaktion auf Sie gewartet, aber nicht daran geglaubt, dass Sie wirklich erscheinen würden.«
Hemingway grinste und drehte sich etwas zur Seite, um den Bartresen wieder in den Blick zu bekommen. Die Hocker waren leer, bestimmt waren die meisten Gäste längst in das Restaurant, das anscheinend direkt an die Bar anschloss, übergesiedelt.
»Haben Sie bereits Fotos gemacht?« fragte Hemingway. – »Ja, aber nur solche von der kleinen Bar in der Garage, die taugen nicht viel.« – »Gut, dann gehen wir die Sache lieber professionell an. Ich bitte meine Frau Mary nach draußen, und Sie machen ein gutes Foto von uns beiden. Mister und Misses Hemingway auf der Terrasse des Hotels Gritti – und im Hintergrund dieses barocke Scheusal von Kirche.« – »Aber Sir, Santa Maria della Salute ist doch kein Scheusal, nein, wirklich nicht!« – »Ach nein? Dann schauen Sie einmal genauer hin. Sie sieht aus wie eine in die Jahre gekommene Zwiebel, überlaufen von einem klebrigen Zuckerguss. Aber nun los, beeilen Sie sich, schießen Sie Ihr Foto und bringen Sie es morgen auf Seite eins. Dazu zwei, drei kommentierende Sätze, nicht mehr. Vermeiden Sie, ausufernd oder erfinderisch zu werden.«
Sergio Carini kramte den Apparat aus der Ledertasche, während Hemingway weiter mit Paolo sprach: »Geh ins Foyer und bitte meine Frau für ein Foto nach draußen. Danach begleitest Du Mister Hemingway an die Bar. Du allein bleibst an seiner Seite, und Deinen Vater schicken wir in die Redaktion, damit Foto und Text auch wirklich morgen erscheinen. Machen wir es so, mein Sohn?« – Paolo zögerte einen Moment und schaute nach dem Vater. Dann sagte er: »Ja, Sir, so machen wir es.«
Zusammen mit Mary fotografiert zu werden, war die beste Lösung. Sie wirkte munter, frisch und jugendlich und zog die neugierigen Blicke auf sich. Er selbst stand auf solchen Fotografien meist etwas verdeckt hinter ihr. Als Paar wirkten sie unschlagbar: Der lebenserfahrene Mann in den besten Jahren – und seine vierte Frau, die forsche und neugierige Begleitung für die späten Abenteuer. Dazu im Hintergrund das barocke Motiv, schön abgehangen und kitschig, die Verankerung im venezianischen Kosmos.
Er wies Carini den bestmöglichen Platz für die Aufnahme an und nahm Mary mit einer fast verliebt wirkenden Geste am Arm. »Wir sind wirklich ein schönes Paar«, sagte er leise zu ihr, »Dein Lächeln und mein Altvaterernst, wir gehören in einen Film.« – »Rede nicht so albern!« antwortete sie und streifte vor der Aufnahme noch die Sonnenbrille über. »Perfekt!« rief Sergio Carini ihnen zu, als er in rascher Folge mehrere Fotos gemacht hatte.
»Genug«, rief Hemingway, »ab in die Redaktion, und Ihren Sohn lassen Sie hier. Ich brauche ihn noch.« – »Was haben Sie mit ihm vor?« fragte Carini. – »Das wird sich zeigen«, antwortete Hemingway und redete noch kurz mit seiner Frau. Sie würde den Salon, den sie reserviert hatten, wohnlich herrichten. Er bestand angeblich aus einem großen Eckzimmer mit Bad und pompöser Sitzgarnitur sowie allerhand edlen Truhen und Schränken, so hatte der Empfangschef die Suite jedenfalls am Telefon beschrieben.
Mary würde selbst aus verstaubtem Plunder etwas Ansehnliches machen, das wusste er. Und Fernanda würde ihr beistehen. Er selbst aber wollte sich noch etwas Zeit nehmen, bevor er auf die Zimmer ging. Die Bar mit ihren leeren Hockern wartete, und er spürte den öligen, klaren Geschmack von Gin bereits auf der Zunge.
7
Mary ließ Decken und frische Blumen kommen und gruppierte mit Fernandas Hilfe die Sitzmöbel um.
»Der kleine Tisch ist für seine Zeitungen«, sagte sie, »hier am Fenster wird er morgens nach dem Frühstück sitzen und lesen.« – »Liest er gerne Zeitungen?« – »Oh, Du solltest ihn frühmorgens sehen, er geht zunächst die amerikanischen durch, dann die französischen, dann die aus dieser Region, er frisst Zeitungen.« – »Hört er Radio, während er liest?« – »Wo denkst Du hin?! Niemals.« – »Mag er überhaupt Musik?« – »Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Er spricht fast nie über Musik, und wenn ja, dann über die Lieder, die er als Kind oder während des Krieges gesungen hat. Singt er selbst, wird er entsetzlich sentimental. Seit er krank ist, ist es noch schlimmer geworden.«
Es war einen Moment still. Fernanda legte drei Decken zur Probe auf eine Chaiselongue und prüfte, welche am besten zum Bezug des Möbels passte.
»Hier im Hotel hält ihn niemand für krank«, sagte sie leise, »er macht einen völlig gesunden Eindruck.« – »Er überspielt seine Krise«, antwortete Mary, »und es ist fatal, wie gut er das kann. Er schreibt nur noch kurze Artikel oder Briefe in alle Welt und tut so, als ersetzten sie ihm das richtige Schreiben. Dabei hat er panische Angst, nie mehr richtig schreiben zu können. Wenn seine Ängste heftiger werden, beginnt er zu trinken, manchmal trinkt er den halben Tag.« – »Wie schafft er das nur?«, sagte Fernanda, »ich habe noch nie einen Menschen so viel trinken gesehen. Und man merkt es ihm nicht einmal an. Er spricht konzentriert und redet höchstens ein wenig mehr als die anderen.« – »Ich halte diese Redseligkeit kaum noch aus. Sie ist der Ersatz für das Schreiben. Eine Geschichte nach der andern, und Du kannst nichts dagegen tun.« – »Vielleicht ist es ein Training oder ein Versuch, in Schwung zu kommen. Ich würde ihm nicht dreinreden.« – »Aber das tue ich nicht, ich lasse ihn reden und schwadronieren und seine Märchen auspacken.« – »Schwindelt er manchmal?« – »Ich bin sicher. Seit Neustem behauptet er, er habe Venedig im Ersten Weltkrieg unter Einsatz seines Lebens verteidigt und gerettet.« – »Aber da ist was dran! Als junger Mann kämpfte er auf italienischer Seite, nicht weit von hier wurde er doch schwer verwundet. Wären die Österreicher vorgerückt, gehörte Venedig vielleicht wieder ihnen, so wie zu den Zeiten der Habsburger.« – »Mag sein – warum übertreibt er aber so?! Als hätte er allein im Ersten Weltkrieg ganze Kompanien zum Halten gebracht und im Zweiten die Deutschen aus Paris vertrieben! Auch diese Geschichten erzählt er immer wieder. Wie er sein geliebtes Paris befreit und seine Jugendfreundin Sylvia Beach in ihrer Buchhandlung vor dem Zugriff der deutschen Soldaten bewahrt hat!«
Fernanda sah, dass Marys Hände zitterten. Hemingway hatte ihr während der letzten Monate des Zweiten Weltkriegs viele Briefe geschrieben, damals waren sie noch nicht verheiratet gewesen. Als Kriegsreporter hatte er um sie geworben und das ganze Elend der Schlachten bis in die letzten Details geschildert.
Sie wollte aber nicht daran erinnert werden, sie konnte diese Briefe nicht mehr lesen. Ein Mann, der so viel Schreckliches erlebt hatte, war in der Hölle gewesen. Seither war er in seinen bitteren Stunden resigniert und oft wie gelähmt. »Ich habe allen Glauben verloren«, hatte er einmal gesagt, »das Vertrauen, die Hoffnung, dieser scheußliche Krieg hat mich niedergemacht.«
»Wann war Ernest eigentlich das letzte Mal in Venedig?« fragte Fernanda. – Mary schüttelte den Kopf: »Keine Ahnung. Manchmal erzählt er von der Stadt, als wäre er schon viele Male hier gewesen. Erst als ich mehrmals nachfragte, gab er zu, noch nie in Venedig gewesen zu sein.« – »Noch nie? Er bewegt sich aber so, als kennte er hier viele Menschen und träfe lauter alte Freunde.« – »Das sollte Dich nicht irritieren. Ernest erkennen sehr viele Menschen auf den ersten Blick, und wenn er in all seiner Größe und Breite erscheint, umarmen sie ihn oder fallen ihm um den Hals, als wäre er der Messias. Seit Beginn unserer Reise ist das so, er zieht die Menschen an, sie folgen ihm, und dann sitzen wir mit wildfremden Leuten nächtelang an einem Tisch und trinken ein Glas nach dem andern.« – »Mag er das denn?« – »Oh ja, er mag es sehr. Ein langer Tisch, viele Leute, und er ist der große Erzähler. Wenn wir danach wieder allein sind, verflucht er diese Stunden und behauptet, er wäre viel lieber allein. Um endlich Zeit für das Schreiben zu haben.« – »In Venedig wird er keine Ruhe finden. Schon morgen werden die Zeitungen über seine Ankunft berichten.« – »Du hast recht, aber ich habe nicht vor, schon jetzt mit ihm über dieses Problem zu sprechen. Lass uns abwarten, wie die Stadt ihm bekommt. Die Spaziergänge werden ihm bestimmt guttun. Keine langen Autofahrten, keine ausgedehnten Sitzpausen – und ich werde darauf achten, dass er nicht gleich in die nächste Gondel springt. Solange er viel zu Fuß unterwegs ist, wird er sich besser fühlen.«
Einen Moment war es still. Sie standen nebeneinander vor einem der hohen Fenster und schauten hinaus auf den Canal Grande.
»Wollen wir ein Glas trinken, während wir hier auf ihn warten?« fragte Fernanda. – »Gute Idee«, antwortete Mary, »am besten einen Scotch, vor dem Dinner schmeckt er am besten.« – »Essen wir später mit ihm unten im Restaurant?« – »Ich glaube nicht, dass er das heute mag. Er ist müde von der langen Autofahrt, und wenn seine Kondition nachlässt, zeigt er sich nicht gern.« – »Dann essen wir hier, auf dem Zimmer?« – »Ja, das vermute ich. Aber in seinem Fall weiß man nie. Wir trinken einen Scotch, und Du erzählst mir von Venedig. Ich bin zum ersten Mal hier, und Du kennst diese wunderbare Stadt wie kaum eine andere.«
8
Er berührte Paolo kurz an der Schulter und deutete auf die Hotelbar, deren Tür zur Terrasse inzwischen geöffnet worden war. Der Barmann wartete auf sie, und Hemingway ließ Paolo vorangehen, als wäre der Junge ein ganz besonderer Gast, dem alle Ehre gebührte.
»Was darf ich Ihnen bringen?« fragte der Barmann und zeigte auf zwei pompöse Sessel, zwischen denen ein kleiner Tisch mit Blumen stand. »Wir kommen zu Ihnen«, antwortete Hemingway und setzte sich auf einen Barhocker an die Theke. Paolo blieb etwas unbeholfen neben ihm stehen, als wartete er auf eine Anweisung. »Setz Dich, Junge, trink etwas Gutes mit mir!« – »Ich sagte schon, dass ich keinen Alkohol trinke, Sir!« – »Richtig, das sagtest Du vorhin. Jetzt ist das aber Vergangenheit, und Du bist dabei, eine neue Freundschaft einzugehen.« – »Ich verstehe Sie nicht, Sir.« – »Als ich etwa so alt war wie Du, habe ich zum ersten Mal Alkohol getrunken. Und es gibt bis heute nur wenig, was mir mehr Freude gemacht hat. Ich lade Dich ein, Dein erstes gutes Glas mit mir zu leeren. Und ich versichere Dir, es wird nicht das letzte sein. Bist Du bereit?«
Paolo überlegte einen Moment, dann schaute er den Barmann an. »Was darf ich den beiden Herren servieren?« fragte er, und Paolo musste plötzlich grinsen. Er blickte in die großen Spiegel, die sich an der langen Wand mit den vielen Flaschen hinter der Theke befanden. Dort sah er einen dunkelhaarigen, schmalen, schüchternen Jungen in dickem, schwarzem Pullover, der wie ein Novize vor einem schweren älteren Mann mit breitem Lächeln stand. »Darf ich mich setzen, Sir?« fragte er, und Hemingway klopfte ihm kurz auf die rechte Schulter, als wären sie in der Tat gute Freunde.
»Wir trinken Gordon’s Gin«, sagte Hemingway zu dem Barmann, »pur, ohne Eis.« Der Mann nickte kurz und holte eine Flasche von den Regalen. Dann postierte er zwei Gläser auf der Theke und schenkte sehr langsam ein. »Etwas Zitrone?« – »Nein«, antwortete Hemingway, »nichts anderes als puren Gin.«
Er hob sein Glas etwas an und wartete, bis auch Paolo nach seinem Glas gegriffen hatte. »Gin ist perfekt als eine Überleitung zum Dinner. Es ist eine reine, klare Sache, und er besetzt die Zunge wie schweres, metallisches Öl. Nimm einen sehr kleinen Schluck und später dann mehr.«
Sie tranken fast zugleich, und Paolo kam es so vor, als besuchte er eine Schule. Der Gin hatte nur einen schwachen Eigengeschmack, der ihn seltsamerweise an den Geschmack von Meerwasser erinnerte. Darin war etwas Bitteres, aber auch ein Hauch von dunklen Beeren, den er von den Wiesen in der Lagune her kannte.
Hemingway schaute durch die Glasfronten der Bar nach draußen. Er reckte sich etwas auf, als käme er nach den Anstrengungen der Fahrt endlich zu sich. Er zog seine Jacke aus und gab sie dem Barmann, der hinter einem Vorhang verschwand, um sie dort aufzuhängen. Plötzlich wirkte er jünger, sportlicher, mit leichtem Schuhwerk, das Paolo erst jetzt auffiel.
»Du heißt Paolo, bist sechzehn und ein Fischer von Burano, wie die meisten Männer Deiner Familie«, sagte Hemingway und starrte weiter auf den Canal, wo gerade zwei schwarze Gondeln vorbeitrieben, dicht nebeneinander. »Ja, Sir, das stimmt.« – »Entschuldige, dass ich mich wiederhole, aber ich mache das häufig so. Ich sortiere Deine Geschichte, verstehst Du, ich bringe sie zum Laufen.« – »Nein, Sir, das verstehe ich nicht.« – »In ein paar Tagen wirst Du es verstehen. Machen wir weiter: Du gehst nicht mehr zur Schule?« – »Nein, Sir, ich bin Fischer.« – »Und ein Fischer möchtest Du ein Leben lang bleiben?« – »Mein Onkel Tonio ist Gondoliere, und er hat vor, mir seine Gondel zu vererben, sodass ich in einigen Jahren selbst ein Gondoliere werden könnte.« – »Würde Dir das gefallen?« – »Es wäre eine große Ehre, Sir.« – »Und würde Dir diese große Ehre gefallen?« – »Warum fragen Sie, Sir? Welchem jungen Venezianer in meinem Alter würde eine solche Ehre nicht gefallen?« – »Danach habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, ob sie Dir gefallen würde.« – »Natürlich, Sir.« – »Natürlich? Nun gut, anscheinend bist Du Dir sicher.«
Paolo nahm einen zweiten, größeren Schluck. Ein Getränk wie Gin hatte er noch nie probiert. Manchmal hatte er von dem Weißwein genippt, den die Männer seiner Familie täglich zu den Mahlzeiten tranken. Weißwein setzte sich beim Essen aber nicht durch, er war eine Essensbegleitung, und je mehr man aß, umso weniger Lust hatte man auf den Wein. Jedenfalls war es ihm immer so gegangen.
Gin zu trinken, war etwas ganz anderes. Er war kräftig und besetzte schon nach dem zweiten Schluck den ganzen Kopf. Als enthielte dieses Getränk einen feinen Dunst, der sich in Hals, Nase und Ohren verirrte. Selbst seine Augen schienen bereits davon betroffen, als bekämen die Dinge um ihn herum etwas Weiches, Diffuses.
»Wenn Du die Fremden in einer Gondel durch die Kanäle fährst, wirst Du Englisch oder Französisch sprechen müssen«, sagte Hemingway und leerte sein Glas. – »Ja, Sir, ich weiß. Mein Vater spricht Englisch, wir haben es zusammen gelernt. Ich spreche sogar etwas besser als er.« – »Oh, das ist gescheit, es wird Dir helfen, ein guter Gondoliere zu werden. Momentan aber bist Du noch ein junger Fischer, sechzehn Jahre alt, ein Fischer von der Insel Burano.« – »Sie sagen es, Sir.« – »Ich sage es, ja. Und ich mache weiter: Fährst Du zum Fischen allein in die Lagune?« – »Niemals, Sir. Ich fahre fast immer mit dem Großvater, und wenn der Großvater krank ist, fahre ich mit dem Vater.« – »Ihr geht jetzt im Herbst auch auf Entenjagd?« – »Nein, Sir. Einige Fischer von Burano tun es, wir aber nicht. Fischer sind Fischer, und Jäger sind Jäger. Wir lieben das Meer und seine Fische, und wir fangen sie mit großen Netzen. Die Jäger aber verstecken sich im Grün der Kanäle und erlegen die Wildenten aus ihren Verstecken.« – »Du würdest so etwas nicht tun?« – »Nein, Sir, niemals.«
Hemingway bestellte mit einer kurzen Handbewegung ein zweites Glas, wartete, bis es auf der Theke stand, und nahm sofort einen weiteren Schluck. Er sah die beiden schwarzen Gondeln draußen ruckartig davontreiben, als stocherten ihre Frontschnäbel im Wind. Dann tauchten die alten Bilder wieder vor ihm auf, ganz unerwartet und plötzlich. Vor endlos vielen Jahren war er mit dem Vater in den Ferien zum Fischen hinaus auf den Michigan-See gefahren, Tag für Tag. Schließlich war er geschickter und schneller gewesen, und der Vater hatte stolz notiert, wie viele und welche Fische er gefangen hatte. Sie hatten sich gut verstanden, und er war sehr stolz gewesen, den Vater begleiten zu dürfen.
»Du bist ein ehrlicher Junge, Paolo«, sagte Hemingway und starrte weiter hinaus, »ich bin froh, gleich jemanden wie Dich getroffen zu haben. Ich werde eine Weile in Venedig bleiben, einige Wochen, vielleicht sogar Monate. Ich bin zum ersten Mal hier, und ich freue mich sehr auf diese Zeit. Ich brauche aber jemanden, der mir zur Seite steht, verstehst Du, ich brauche einen jungen Gehilfen, der sich gut auskennt und mir einige Dinge abnimmt. Dieser junge Gehilfe sollte ehrlich sein und vollkommen verschwiegen, darauf muss ich mich verlassen können.«
Paolo leerte sein Glas und schüttelte kurz verneinend mit dem Kopf, als der Barmann nachschenken wollte. Der Gin hatte jetzt den gesamten Raum eingenommen, die Blumen in der Vase auf dem kleinen Tisch waren von einem feinen Pelz überzogen, und das Wasser des Canal Grande floss schwerfällig und langsam, als hätte man seine zaghaften Wellen in durchsichtige Folien gepackt. Wovon war noch die Rede? Was hatte der große amerikanische Schriftsteller gerade zu ihm gesagt? Ehrlich sollte er sein und verschwiegen. Natürlich, das war es gewesen.
»Worin würde meine Tätigkeit bestehen?«, fragte er, »soll ich Sie durch Venedig begleiten und Ihnen die Stadt zeigen? Oder …« – »Neinnein, das nicht«, antwortete Hemingway, »ich werde ganz allein durch Venedig gehen, selbst meine Frau wird mich nicht begleiten. Wenn ich eine Stadt wie Venedig kennenlernen will, muss ich allein sein, das versteht sich von selbst. Ich werde alle paar Tage einen Zettel für Dich an der Rezeption des Hotels hinterlegen. Darauf werde ich notieren, was ich von Dir erwarte. Informationen, Recherchen, kleine Einkäufe – Tätigkeiten, mit denen ein junger Einheimischer mir langes Suchen nach diesem und jenem abnimmt. Darauf wird es hinauslaufen.« – »Ich verstehe, Sir. Aber ich weiß nicht, ob ausgerechnet ich der Richtige bin.« – »Du bist der Richtige, ich bin mir sicher. Lass uns morgen Mittag an genau dieser Theke unser zweites gemeinsames Glas trinken! Dann können wir weiterreden. Vor dem Lunch trinke ich gern einen oder auch zwei Martini.« – »Morgen Mittag, Sir?« – »Ja. Den Vormittag werde ich in der Stadt verbringen, am Mittag kehre ich ins Hotel zurück, um dort mit meiner Frau zu essen. Davor trinken wir beide unser zweites Glas, einverstanden?« – »Einverstanden, Sir. Aber es gibt noch ein Problem.« – »Welches?« – »Ich werde meinem Vater sagen, dass Sie einen Gehilfen brauchen.« – »Das geht in Ordnung, Paolo. Du kannst es ihm erzählen, aber Du wirst ihm später nicht mitteilen, was Du im Einzelnen für mich tust. Das bleibt unsere Sache.« – »Ich verstehe, Sir.« – »Ich kann mich also auf Dich verlassen?« – »Ja, Sir. Sie können sich auf Paolo Carini verlassen.«
Paolo rutschte vom Barhocker. Ihm war, als wäre er auf See gewesen und suchte mit den Füßen wieder nach festem Boden. Was ein Glas Gin anrichten konnte! Er machte eine kleine Verbeugung und versuchte, freundlich zu lächeln. »Paolo Carini, Sie können abtreten!« sagte Hemingway und packte ihn mit beiden Händen an den Schultern. – »Es war mir eine Ehre«, antwortete Paolo und machte sich auf den Weg zur Terrassentür. – »Es ist ihm eine Ehre«, rief Hemingway lachend hinter ihm her und drehte sich nach dem Barmann um: »Geben Sie mir noch ein Glas. Und erzählen Sie: Mit welchen Gästen würden Sie an meiner Stelle zu später Stunde etwas Gescheites in dieser Bar trinken? Heraus mit der Sprache! Und reden Sie nicht drumherum, Sie wissen schon, was ich meine.«
9
Am nächsten Morgen verließ er allein das Hotel und ging die paar Schritte zu der Anlegestelle der Gondeln am Canal Grande. Noch waren die Gondolieri nicht eingetroffen, aber ein Traghetto war bereit, ihn auf die andere Seite zu bringen. In dem schmalen Fährboot standen dicht hintereinander bereits einige Einheimische, niemand sprach ein Wort.
Hemingway zögerte nicht, sondern betrat das Boot über ein paar hölzerne Treppenstufen. Während des Wartens auf die Abfahrt nahm er eine Brille aus seiner Jackentasche und säuberte sie. Direkt vor ihm stand ein älterer Venezianer und las die Tageszeitung. Hemingway blickte ihm von hinten über die Schulter und erkannte sofort das Foto, das Sergio Carini gestern von seiner Frau und ihm gemacht hatte. Er hatte die Aktion schon fast wieder vergessen, jetzt aber wurde ihm bewusst, dass alle Welt von seiner Ankunft in Venedig wusste.
Gut, dass er die Fotografie gleich zu Beginn seines Gangs durch die Stadt gesehen hatte. Ihr Anblick ließ ihn vorsichtig werden, und er nahm sich vor, Wegen zu folgen, die nicht sehr belebt waren. Er nahm seine Kappe aus der linken Jackentasche und zog sie über, dann schaute er den Canal entlang, der hinter der Kirche Santa Maria della Salute endete und den Blick auf den Dogenpalast freigab. Einige Gebäude an den Ufern leuchteten in der Morgensonne und wirkten wie Spielzeugpaläste, in denen nie ein Mensch wirklich gewohnt hatte. Wohnen würde man in ihnen nicht, eher schon feiern, ja, diesen Eindruck machten die Szenen: als würde Nacht für Nacht heftig und lange gefeiert und als verschwänden die Besitzer danach wieder in einem Nirgendwo auf dem Festland.
Als der Traghetto voll war, legte der Gondoliere von der Stazione ab und überquerte langsam den Canal. Die meisten Fahrgäste nahmen von der Umgebung keine Notiz, sie waren in eine Zeitung vertieft oder blickten abwesend auf das jenseitige Ufer, wo sich ein kleiner Platz mit einem Kiosk auftat. Du wirst Dir ein paar Zeitungen kaufen und einem der kleineren Kanäle folgen, dachte er. Bloß keine touristischen Verrenkungen, keine Kirchenstudien, am besten überhaupt keine Besichtigungen – das erledigt Mary für Dich. Nach dem Frühstück im Gritti wird sie mit Fernanda unterwegs sein und ein Monument nach dem anderen aufsuchen. Zwischendurch wird sie die Juwelier- und Stoffläden durchgrasen, der Vormittag wird mit diesem Hin und Her von Shopping und Viewing vergehen. Das aber ist nicht Deine Sache. Du wirst den Menschen hier folgen und Dich unter sie mischen, Du wirst die Stadt in Dich aufnehmen und schauen, ob Du ihr ein paar Geschichten abtrotzen kannst.
Auf der anderen Seite des Canal ging er betont langsam durch die schmalen Gassen, in die noch kaum ein Sonnenstrahl fiel. Es roch nach einem feinen Moder, der von den teilweise feuchten Häuserwänden ausging. Die kleinen Läden waren noch geschlossen, der Kioskbesitzer aber stand im Innern seines kreisrunden Gehäuses und sprach ein paar Worte mit jedem Kunden.
Hemingway bat um Il Gazzettino und kaufte noch weitere Zeitungen, amerikanische, französische, spanische. »So früh schon auf den Beinen, Mister Hemingway?« fragte der Kioskbesitzer, doch Hemingway reagierte nicht. »Rollen Sie die Zeitungen bitte zusammen und tun Sie ein Gummi um die Meute«, antwortete er. Normalerweise hätte er nicht so freundlich geantwortet, aber er war guter Laune. Er zahlte, grüßte kurz und setzte seinen Weg fort.
Seltsam, dass Du so guter Laune bist, dachte er, woher kommt das? Weil Du Dich frei fühlst und auf neuen Wegen. Diese Stadt ist eine ideale Kulisse für gute Laune, sie wird Dich mit allem versorgen, was Du jeweils so brauchst. Kaffee, Wein, eine Kleinigkeit zum Essen, Du wirst Dich treiben lassen und allmählich in sie hineinwachsen. Und wozu dient letztlich der Zauber? Nur und einzig dem Schreiben. Venedig wird Dir die schönen Schriftmanöver wieder beibringen, die in den Kriegsjahren von anderen Manövern zerstört worden sind. Aber pass auf, dass Du nicht den Gondeln und der Lyrik verfällst. Lord Byron und Robert Browning haben ein Gelände bestellt, mit dem Du nichts zu tun haben willst. Es wird verdammt schwer sein, die Gondeln zu meiden und über Venedig zu schreiben. Nicht der Kunst, sondern den Menschen solltest Du folgen, weiß der Teufel, wo sie sich überall versteckt haben!
Er ging an einem schmalen, schnurgeraden Kanal entlang, dessen blassgrünes Wasser jetzt von den Sonnenstrahlen bestäubt wurde. An den Rändern lagen kleine Boote, die anscheinend den Hausbesitzern zu beiden Seiten gehörten. So ein Boot böte die Chance, den Gondeln auszuweichen, das musste er mit Paolo besprechen. Vielleicht konnte der Junge von Burano aus mit einem Fischerboot kommen – dann ließe sich die Stadt durchfahren, ohne dass es sonst jemand bemerkte. Sich den Menschen, Häusern und Dingen zu nähern, wird nur auf heimliche Weise gelingen, das hatte er bereits verstanden.
Es tat gut, an einem solchen schmalen Kanal entlang zu gehen. Man wurde sehr ruhig, weil es keinerlei Verkehr und auch sonst nichts Großstädtisches, Fremdes gab. Das Wasser, die Boote, die menschenleer wirkenden Häuser – was für eine ideale Umgebung!, dachte er, diese Stadt rückt Dir Deinen kaputten Schädel wieder zurecht.