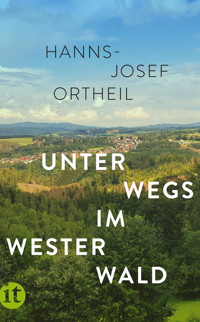9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Siebzig Bücher umfasst das Gesamtwerk von Hanns-Josef Ortheil in seinem siebzigsten Lebensjahr. Dazu gehören neben den großen Romanen auch viele Essaybände, Journale, Reise- und Musikbücher. »Ein Kosmos der Schrift« skizziert erstmals die großen Linien und Zusammenhänge dieses Gesamtwerks. In einem ausführlichen Gespräch mit seinem langjährigen Lektor Klaus Siblewski erläutert Hanns-Josef Ortheil die zentralen Strukturen und entwirft eine Selbstanalyse seines Schreibens von den Anfängen in der Kindheit bis heute. Abschließend gratulieren zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter des literarischen Lebens, indem sie auf zwanzig Fragen zu Ortheils »Treiben und Schreiben« antworten und in humorvoller Weise an die Besonderheiten eines von der Literatur geprägten Lebens erinnern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Siebzig Bücher umfasst das Gesamtwerk von Hanns-Josef Ortheil in seinem siebzigsten Lebensjahr. Dazu gehören neben den großen Romanen auch viele Essaybände, Journale, Reise- und Musikbücher. »Ein Kosmos der Schrift« skizziert erstmals die großen Linien und Zusammenhänge dieses Gesamtwerks. In einem ausführlichen Gespräch mit seinem langjährigen Lektor Klaus Siblewski erläutert Hanns-Josef Ortheil die zentralen Strukturen und entwirft eine Selbstanalyse seines Schreibens von den Anfängen in der Kindheit bis heute. Abschließend gratulieren zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter des literarischen Lebens, indem sie auf zwanzig Fragen zu Ortheils »Treiben und Schreiben« antworten und in humorvoller Weise an die Besonderheiten eines von der Literatur geprägten Lebens erinnern.
Zu Autor und Herausgeberin
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und dem Hannelore-Greve-Literaturpreis.
Imma Klemm, geb. in Mainz, ist die Enkelin des expressionistischen Lyrikers und späteren Verlegers Wilhelm Klemm. Sie studierte an den Universitäten von Mainz, Paris und Göttingen, wo sie mit einer sprachphilosophischen Dissertation zum Thema »Fiktionalität« promovierte. 25 Jahre lang war sie Cheflektorin und Geschäftsführerin im Alfred Kröner Verlag, danach übernahm sie als Verlegerin die Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung.
Ein Kosmos der Schrift
Hanns-Josef Ortheil zum 70. Geburtstag
Herausgegeben von Imma Klemm
Inhalt
»Una vita – oder Herr Ortheil, wie haben Sie das gemacht?«
Siebzig und mehr Bücher von Hanns-Josef Ortheil (Stand: Sommer 2021)
Ein Fragebogen zu Hanns-Josef Ortheils»Treiben und Schreiben«
»Una vita – oder Herr Ortheil, wie haben Sie das gemacht?«
Ein Gespräch von Klaus Siblewski und Hanns-Josef Ortheil über Hanns-Josef Ortheils »Kosmos der Schrift«
Vorbemerkung
Seit 1979 hat der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil über siebzig Bücher veröffentlicht. Fast täglich geschrieben und notiert hat er aber bereits seit seinem achten Lebensjahr. Entstanden ist auf vielerlei Wegen das, was er selbst einen »Kosmos der Schrift« nennt. Er besteht zum größten Teil aus unveröffentlichten Texten, die sich in einem Archiv befinden. Die veröffentlichten wiederum sind den verschiedensten Gattungen zuzurechnen. Es gibt Romane, Sachbücher, Essays, literarische Tagebücher, journalistische Texte, aber auch Dramen, Drehbücher und Libretti.
Drei Tage lang hat sich Klaus Siblewski, Ortheils Lektor im Luchterhand-Verlag, mit seinem Autor über diesen raren und materialreichen Kosmos unterhalten. Schon allein die Dauer dieses intensiven Austauschs erinnerte an den Klassiker unter den Werkstattgesprächen: das 50stündige Gespräch, das der französische Filmregisseur François Truffaut im Jahr 1962 mit Alfred Hitchcock führte und in dem Buch Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? dokumentierte.
Den Titel des Buchs haben Klaus Siblewski und Hanns-Josef Ortheil leicht variiert übernommen. In ihrem Gespräch »Herr Ortheil, wie haben Sie das gemacht?« ging es neben den klassischen Werkstattthemen des Making of aber noch um etwas anderes. Die biografischen und emotionalen Hintergründe des Kosmos sollten in einer »Graphoanalyse« zutage treten. Sie bringt die psychischen Konstellationen mit denen des Schreibens in Verbindung, das in einer westerwäldischen Jagdhütte in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts begann …
Drei Listen und erste Fragen
Klaus Siblewski (KS): Vor mir liegen zwei Listen. Eine mit den Büchern, die Du seit 1979 veröffentlicht hast. Ich habe nachgezählt, es sind über siebzig. Und eine zweite Liste mit einer Bibliografie der Texte, die bisher von Dir erschienen sind. Einige wurden bereits in Deinem Kindesalter gedruckt, rasant wird es, als Du etwa zwanzig Jahre alt bist. Von da an kann man Dein Schreiben in vielen Gattungen und Genres kontinuierlich verfolgen. Zunächst in der Rolle als Film-, Musik- und Literaturkritiker, dann als Essayist und Erzähler, später aber auch als Drehbuchschreiber, Librettist, Dramatiker, Sachbuch- und nicht zuletzt natürlich als Romanautor. Diese Bibliografie der gedruckten kleinen und größeren Texte ist sehr umfangreich, ich habe die Texte nicht gezählt, man käme auf eine astronomisch wirkende Summe. Hinzu kommt aber noch etwas Weiteres, sehr Wichtiges. Du hast mir einmal erzählt, dass der Großteil der von Dir geschriebenen Texte unveröffentlicht ist. Es sind Texte, die Du zunächst nur für Dich selbst oder einen kleinen familiären Kreis geschrieben hast: Chroniken, Tagebücher, kleine Porträts und Erzählungen, Dialogisches, Reflexionen, Notate. Etwa mit acht Jahren hast Du mit solchen Texten begonnen und an diesen Formaten weitergeschrieben, bis heute. Ihre Zahl mag ich nicht kalkulieren, das würde mich überfordern.
Wären wir akribisch genau, hätten wir es in Deinem Fall, verknappt gesagt, mit drei Listen zu tun: der Deiner Bücher, der Deiner veröffentlichten und der Deiner unveröffentlichten Texte. Das Ganze nennst Du oft einen Kosmos, genauer gesagt, einen Kosmos der Schrift.
Ich kenne nichts Vergleichbares, es ist unglaublich, und das im wörtlichen Sinn: Man glaubt es kaum. Und da frage ich mich natürlich: Wie konnte es dazu kommen? Was liegt dem zugrunde? Woraus besteht dieser Kosmos? Wie kam es zu seinen Themen und miteinander verbundenen Gruppen? Was steckt hinter alldem, biografisch, emotional? Und wohin wird das noch führen? Über all diese Themen wollen wir miteinander sprechen, an mehreren Tagen. Wir wollen analysieren, was es mit Deinem Kosmos der Schrift auf sich hat. Bist Du einverstanden?
Hanns-Josef Ortheil (HJO): Ja, bin ich, und ich freue mich sehr auf diese Gespräche. Ich glaube, jetzt, kurz vor meinem siebzigsten Geburtstag, ist genau der richtige Zeitpunkt, über diese Themen zu sprechen. Wir kennen uns seit einem Vierteljahrhundert, Du hast seit 1998 meine Arbeiten betreut und lektoriert, wer wäre als Gesprächspartner besser geeignet?
Lass mich zu Beginn aber noch etwas zu den Zahlen sagen, die Du genannt hast: Ich habe viele Reaktionen von Menschen erlebt, die gesagt haben: Das kann ja nicht wahr sein, das kann er gar nicht alles geschrieben haben, es ist unmöglich. Ich wiederum habe diesen Unglauben nicht verstanden, denn es ist doch alles nachzulesen, schwarz auf weiß. Und noch eins. Es ist keine Koketterie, wenn ich sage: Mein Leben scheint aus nichts anderem als Schreiben bestanden zu haben. Aber so war es nicht. Ich würde sogar behaupten: Das Schreiben war immer notwendig und existentiell, ohne Schreiben hätte es kein Leben gegeben. Ich habe aber nie unter irgendeinem Druck oder Zwang gelitten, zu keinem Zeitpunkt. Das Schreiben war und ist eine starke Freude und ein großes, besonderes Vergnügen. Wäre es nicht so, hätte ich niemals weitergeschrieben. Es war der Kommentar zum Leben, seine Verankerung, seine Vertiefung, seine Deutung. Anfänglich habe ich es fast tranceartig betrieben. Ich habe in dieser Trance des Schreibens mein Leben umkreist, und diese Bewegungen erscheinen mir oft wie Kopfdiktate eines zweiten Ich, aber nie als bittere Kämpfe mit mir selbst. Der Figur des leidenden Schriftstellers habe ich daher nie etwas abgewinnen können. Sollte ich den Charakter meines Schreibens benennen, würde ich sagen: Es verlief frei, locker, entspannt, ohne Verkrampfungen, lauter punktuellen, spontanen, emotionalen Impulsen folgend. Ich benutze dafür gern einen italienischen Begriff aus der Renaissance, den ich sehr mag: Mein Schreiben, sage ich dann, orientiert sich am Ideal der Sprezzatura. Absichtslose Leichtigkeit, Unverstelltheit, pure Schreiblust, fast naturwüchsig. Was ich gerade meine, wird hoffentlich verständlicher, wenn wir in die Details einsteigen …
Die Themen des Gesprächs
KS:Lass mich vorher noch einmal kurz unsere Themen fixieren. Es geht uns ja nicht um ein anekdotisches Gespräch über Deine Schreibvorhaben und Bücher, sondern darum, die Tiefenschichten dieses Schreibens zu ergründen. So gesehen, geht es um Schreibforschung. Wir wollen die Wege des Schreibens verfolgen. Wie ist es Schritt für Schritt entstanden, welche Formen und Genres hat es entwickelt, wie bedingen sie einander? Nach alldem und noch viel mehr wollen wir forschen.
HJO:Ja, wir wollen untersuchen, wie und wodurch der Schreiber und Schriftsteller Ortheil entstanden ist und was dieser lange Entstehungsprozess uns über das Schreiben generell verrät. Ich betrachte mich also in diesem Gespräch als einen Fall, und wir machen uns auf den Weg, eine Fallstudie zu schreiben. Das Schreiben ist mein ganzes Leben lang ein zentrales Thema gewesen, im Blick auf meine eigenen Arbeiten und im Blick auf viele andere Autorinnen und Autoren. Nicht zuletzt aber auch während meiner langjährigen Tätigkeit als Gründer und Leiter eines Instituts für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim, wo ich junge Schreibtalente während ihrer ersten Veröffentlichungen begleitet und dabei viel über das Schreiben erfahren habe.
KS:Dann verwandeln wir Dich doch am besten zunächst einmal zurück in einen Schreibanfänger und Schreibschüler und schauen nach, wie er sich bewegt, was er im Einzelnen tut, wie sein Alltag aussieht, was ihn alles umgibt. Lass uns mit einer kurzen Skizze des Raums und der Zeit beginnen, in die Du hineingeboren wurdest. Das war Köln, im November 1951. Du warst das fünfte Kind Deiner Eltern, Deine zuvor geborenen vier Brüder waren jedoch nicht mehr am Leben. Das hat etwas Furchtbares, Ungeheuerliches, versuchen wir trotzdem, darüber zu sprechen.
Die Familienkonstellation
HJO:Ja, versuchen wir es. Lass mich mit einer möglichst nüchternen Beschreibung der Kleinfamilie zur Zeit meiner Geburt beginnen. Meine beiden Eltern kamen aus Wissen/Sieg, einem Ort im nördlichen Westerwald. 1939 haben sie geheiratet und sind nach Berlin gezogen, wo mein Vater, der in Bonn Geodäsie studiert hatte, eine Stelle als Vermessungsingenieur bei der Deutschen Reichsbahn erhielt. 1940 kam mein erster Bruder während der damals einsetzenden Bombenangriffe auf Berlin ums Leben. Karl-Josef, mein zweiter Bruder, wurde 1942 geboren. Damals war mein Vater bereits Soldat und in Russland im Kriegseinsatz. Die junge Familie kam in diesen Jahren nie zur Ruhe. Mein Vater war meist abwesend, wurde mehrmals schwer verwundet und erlebte das Ende des Krieges als Soldat während der Endschlachten in Berlin, in völlig chaotischen, bedrohlichen und schrecklichen Umständen. Meine Mutter war damals schon mit dem Bruder in die Heimat zurückgekehrt und zusammen mit ihren Eltern auf einen entlegenen Hof in der Nähe von Wissen geflohen. Dort kam im April 1945 mein Bruder ums Leben, als der Hof beim Einmarsch der Amerikaner von deutscher Artillerie beschossen wurde, die versteckt in einer nahen Senke lag. Sie feuerte auf den besetzten Hof und damit auch auf die eigenen Leute, mein Bruder, der gerade in einer Scheune auf dem Schoß meiner Mutter saß, starb durch den Einschlag einer Granate in seinen Kopf. Nach dem Krieg lebten die Eltern in Köln, wo mein Vater eine Stelle bei der Deutschen Bundesbahn antrat. In der Nachkriegszeit verloren sie durch zwei Fehlgeburten erneut zwei Kinder. Als ich 1951 als fünftes Kind zur Welt kam, wuchs ich also in einer Familie mit einer langen, sehr leidvollen Vorgeschichte auf. Davon wusste ich natürlich lange nichts und in späteren Jahren nur wenig Genaues, alles, was mit dieser Vorgeschichte zu tun hatte, war eine Art Familiengeheimnis. Meine Eltern sprachen darüber nicht mit anderen Menschen, und ich selbst habe sie auch nie miteinander darüber sprechen hören. Mutter war zum Zeitpunkt meiner Geburt achtunddreißig Jahre alt, Vater war vierundvierzig. Sie waren damals also im Grunde bereits im Großelternalter. Das war 1951 die Familienkonstellation: Meine Eltern waren ein älteres Paar, das nicht mehr daran geglaubt hatte, jemals ein einigermaßen normales Familiendasein zu erleben. Im Grunde begann dieses ältere Paar im Jahr 1951 und damit zwölf Jahre nach der Heirat ganz von vorn. Ich war damals der Hoffnungsträger dieses neuen Lebens, meine Geburt wurde als ein Zeichen dafür empfunden, dass sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein familiäres Leben zu dritt vielleicht doch noch möglich sein könnte.
Erste Bilder und Erinnerungen
KS:Erinnerst Du Dich an Bilder und Szenen aus diesen frühen fünfziger Jahren?
HJO:Ja, die gibt es, und einige sind sehr prägnant. Ich habe sie in meinem Roman Die Erfindung des Lebens (2009) als Urszenen meiner Kindheit aufleben lassen, jetzt komme ich darauf zurück und erzähle sie möglichst sachlich. Wir lebten im ersten Stock eines Mietshauses in Köln-Nippes am Erzbergerplatz. Das ist ein noch heute sehr eindrucksvoller, ovaler Platz, rundum von Häusern umgeben. In der Mitte befinden sich Spielplätze und Gartenanlagen, der Platz wirkt trotz der vielen Menschen, die dort wohnen, eigentümlich ruhig, fast idyllisch. Woran ich mich als erstes erinnere, ist der Blick aus dem Fenster unseres Wohnzimmers herunter auf den Platz. Ich stand auf einem kleinen Schemel und schaute mir das Leben und Treiben an, und ich war von den vielen Bildern und Szenen sehr fasziniert. Das Zimmer hatte einen Erker, dort standen ein kleiner, runder Tisch und ein Sessel. Das war der Platz meiner Mutter, sie saß in diesem bequemen Möbel, und auf dem Tisch lagen Stapel von Büchern. Ich, auf dem Schemel stehend – und meine Mutter neben mir, sitzend und lesend. Das sind die ersten Bilder, an die ich mich erinnere.
KS:Deine Mutter war eine passionierte Leserin?
HJO:Ja. Sie hatte schon in ihrem westerwäldischen Heimatort als Bibliothekarin für die katholische Pfarrbücherei gearbeitet. Das setzte sie in Köln fort. Sie hat immens viel gelesen, fast ausschließlich Belletristik, und sie war zuständig für die Bestellungen neuer Bücher. Welche schafft man an, in welche Rubriken gehören sie, welche Leserinnen könnte das interessieren? Meine Mutter machte sich auf kleinen Zetteln Notizen und steckte sie in die Bücher, die dann gekauft wurden. Das war die Sichtung vor dem eigentlichen Erwerb.
KS:Deine Mutter hat diese neuen Bücher gelesen und sich gleichzeitig Notizen gemacht?
HJO:Sie notierte bestimmte Stellen und schrieb kurze Kommentare zu jedem Buch. So entstanden Lesetagebücher, mit Eindrücken und Protokollen der Lektüren. Zum einen gab es die Zettel, die in die Bücher gelegt wurden, zum anderen aber auch schwarze Hefte mit fortlaufenden Eintragungen. Meine Mutter nannte sie Cahiers. Ich fand sie immer besonders schön, biegsam, abwaschbar, liniert, dünnes Papier. In diese Cahiers notierte sie die Titel, die Autorennamen und wann sie das Buch gelesen hatte. Von …bis …, alles auf die Minute. Das verstehe ich unter »Lesetagebuch«.
KS:Zum Lesen Deiner Mutter gehörte das Schreiben immer dazu?
HJO:Ja, es war für sie ganz selbstverständlich, während des Lesens und danach etwas zu notieren. Ich habe das später schon als Schüler auch so gemacht, und für mich war es ebenfalls selbstverständlich. Das ist es bis heute, ich kann mir Lesen ohne Schreiben gar nicht vorstellen. Da stoßen wir schon auf eine erste Keimzelle des Schreibens, das Notieren als ein Reagieren aufs Lesen, als seine Bestätigung, letztlich als die Hereinnahme des Gelesenen in den eigenen Erlebnishaushalt. Aber, wie gesagt, mir erschien das nicht als etwas Besonderes, sondern als vollkommen normal. Ich sehe meine Mutter an dem runden, kleinen Tisch sitzen. Auf dem Tisch liegen die Bücher, die Zettel, Hefte und Stifte für die Aufzeichnungen, und auf einer Ebene darunter konnte sie das Teeservice abstellen, sie trank Tee während der Lektüren. Diesen Tisch gibt es übrigens noch, ich benutze ihn weiter fürs Teetrinken.
KS:Deine Mutter hat nur zu Hause gearbeitet oder auch in der Bibliothek? Hast Du sie auch dort erlebt?
HJO:Ja, ich wurde in die Bibliothek mitgenommen, aber nur, wenn es dort etwas zu erledigen gab. Wir holten die neuen Bücher ab und brachten sie wieder hin. Lange aufgehalten haben wir uns nicht. Gelesen oder anderweitig gearbeitet wurde nicht, das geschah ausschließlich zu Hause. Was ja auch daran lag, dass sie damals das Sprechen verweigerte.
Die schweigende Mutter
KS:Deine Mutter hat mit niemandem gesprochen?
HJO: Nein, meine Mutter hat damals nicht gesprochen. Mit niemandem. Die Verständigung mit anderen Menschen verlief ausschließlich über Notizzettel. Sie hatte das Sprechen aufgegeben, nicht aber das Lesen und Schreiben. All das, was sie Schreckliches erlebt hatte, ließ sie schweigen. Meine frühen Bilder im Kopf imaginieren eine lesende und schreibende, nicht aber sprechende Mutter, die im Erker unseres Kölner Wohnzimmers sitzt, ohne einmal herunter zu schauen. Man hat mir erzählt, dass auch ich etwa ab drei Jahren immer weniger gemurmelt oder an Lauten von mir gegeben und mich der Mutter angeschlossen habe. Wir waren in dieser Hinsicht ein Duo oder ein Team, später hat meine Mutter dafür eine in meinen Augen sehr passende Bezeichnung gefunden.
KS:Und welche?
HJO:Sie nannte es das stumme Handwerk. Häufig hat sie leicht ironisch gesagt, wir machten früher oft stummes Handwerk. Die Formulierung ist genial, finde ich. Denn sie fixiert genau, was wir beide machten: Wir waren handwerklich tätig, und wir waren stumm. Ihr Handwerk war das Lesen und Notieren, meines war das Schauen, später auch das Klavierspielen. Und zusammen betrieben wir das Handwerk des Kochens, zu zweit, mittags in der Küche. Ich schnippelte das Gemüse klein, sie machte daraus eine Suppe.
KS:Und dabei wurde auch nicht gesprochen?
HJO:Nein, gesprochen wurde nicht. Aber ich musste nicht rätseln oder überlegen, was gerade geschehen sollte. Im Gegenteil, ich wusste eigentlich immer genau, was zu tun war. Und das war sehr einfach. Das Reden wurde ausgeblendet, wir konzentrierten uns auf das Handwerk. Zu hören war nur das Radio – das hatte eine lautliche Ersatzfunktion. Musik, immer nur Musik, meist klassische, aber auch französische Chansons, etwa von Juliette Gréco. Ich mochte diese Chansons nicht besonders, schon weil ich die Sprache nicht verstand. Meine Mutter aber suchte nach französischen Sendern, Mittelwelle und Ultrakurzwelle, das rauschte in die Zimmer, als käme es aus planetarischer Ferne.
KS:Deine Mutter sprach Französisch?
HJO:Meine Mutter und mein Vater haben Französisch gesprochen, manchmal auch miteinander, unter sich. Der Familienname Ortheil (französisch orteil) verweist auf die französischen Wurzeln der Familie, mehrere Generationen vor meiner Geburt. Diese Herkunft hatte später starken Einfluss auf mich, ich habe die Besonderheiten der französischen Literatur kennengelernt und sie ab der Pubertät geradezu manisch gelesen. Manche Besonderheiten meines Schreibens lassen sich, glaube ich, aus dieser starken Faszination herleiten. Zum Beispiel die Verankerung des Schreibens im Autobiografischen. Gehen wir darauf aber lieber später genauer ein.
KS:Ja, kehren wir zurück zum stummen Handwerk der fünfziger Jahre.
HJO:Mein Metier war damals das Schauen, das unendlich lange Schauen auf den Platz unter uns. Dieses genaue Hinschauen und Fixieren der Bilder – das empfinde ich noch heute als eine zentrale Keimzelle meines Schreibens. Beobachten, Aktionen verfolgen, Atmosphären einsaugen – das ist eine der stärksten Modi vieler Texte. Erst vor wenigen Wochen ist das Buch In meinen Gärten und Wäldern erschienen, es besteht fast ausschließlich aus Beobachtungen der Pflanzen und Bäume in meiner unmittelbaren Umgebung. Solche Beobachtungstexte habe ich oft geschrieben, ein Leben lang, zunächst auch ohne daran zu denken, sie je zu veröffentlichen. Sie entstanden wie von selbst, und sie waren nicht das, was man leichtfertig »Impressionen« nennt. Das nämlich waren sie eben gerade nicht, sie enthielten keine »Stimmungen«, sondern hefteten sich eng und sehr direkt an das Gesehene. Der Gestus war also kein impressionistischer, sondern eher ein phänomenologischer. Und erklären kann ich ihn mir dadurch, dass ich mich an die Kindheitsmomente des regungslosen Starrens und Schauens erinnere. Da sind die Wurzeln und Anfänge.
KS:Wir befinden uns immer noch in Deinen ersten Jahren, richtig?
HJO: Ja, die Erinnerungen sind aus der Zeit, als ich drei, vier Jahre alt war. Ich lebe im Binnenraum meiner Mutter, eng an ihrer Seite. Während sie liest, schaue ich auf den Platz, und während sie das Essen in der Küche vorbereitet, helfe ich ihr, und wenn sie zum Einkaufen geht, begleite ich sie. Wir gehen Hand in Hand, das sind die frühsten Bilder.
KS:Wie war das beim Einkaufen? Da hat sie auch nicht geredet?
HJO:Ich erinnere mich jedenfalls nicht daran. Ich sehe, wie sie ihre Notizzettel, auf denen der Einkauf fixiert war, abgibt und mit mir verschwindet. Am Abend ging mein Vater dann in den Geschäften vorbei und holte die bestellten Waren ab. Das war Arbeitsteilung, ganz praktisch.
KS:Du hast nicht gesprochen – hast Du denn überhaupt verstanden, was in den Geschäften geredet wurde? Die Verkäuferinnen haben doch sicher viel geredet, oder?
HJO:Natürlich – und wie! Kölner Verkäuferinnen, die nicht reden, kann ich mir nicht vorstellen, in Köln haben sehr viele Menschen einen enormen Redebedarf. Verstanden habe ich nicht alles, aber ich habe mir einiges zusammengereimt. Zum Beispiel, wenn Kunden bestimmte Waren aussuchten und die dann hochgehalten und eingepackt wurden. Drei Scheiben Emmentaler … – und ich konnte verfolgen, wie die Scheiben geschnitten und in Papier gewickelt wurden. Es gab sehr lebendige Gesprächssituationen, auch sehr viele laute und drastische. Einkaufen gehen machte mir Spaß, meiner Mutter allerdings nicht, die entzog sich den Unterhaltungen und machte nicht mit. Ihr vorherrschendes Lebensgefühl war Angst. Große Angst und Vorsicht gegenüber allem, was geschah. Meine Mutter hatte das Empfinden, es könnte jederzeit und überall etwas Schlimmes passieren. Deshalb blieben wir vor allem in der Wohnung und mischten uns nicht in den Trubel ringsum.
KS:Du sagst, sie hat das Sprechen verweigert und sich damit direkten Kontakten entzogen. Hast Du diese Verweigerung verstanden?
HJO: Schwer zu sagen. Ich sah, dass sie einfach in vielen Bereichen nicht mitmachte. Keine Gespräche auf der Straße, keine in den Läden, äußerste Zurückhaltung. Was aber nicht bedeutete, dass sie nur passiv gewesen wäre. Nein, das war sie gewiss nicht. Sie kümmerte sich um vieles, sie tat, was sie gern tun wollte, aber sie wollte nicht darüber sprechen. Ob sie mit meinem Vater vielleicht doch gesprochen hat, ohne dass ich es mitbekam, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls nicht erlebt. Es war so, als gehörte das Sprechen nicht zu ihrem Leben, als wäre daran etwas falsch, oder als täte ihr etwas weh, wenn sie gesprochen hätte. Sie machte darum aber kein Gedöns, wie man in Köln sagt, nein, überhaupt nicht. Es war ein Verweigern, eine Enthaltung, und sie hat später gesagt, sie habe es gut entbehren können. Das sei richtig gewesen, es habe das Leben einige Zeit lang leichter gemacht.
KS:Du hast von den Spielplätzen auf dem Erzbergerplatz gesprochen. Hast Du als Kind nicht mitgespielt?
HJO:Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Es gab solche Anläufe, aber sie führten nicht weiter. Entweder spielte ich allein, nur für mich, oder ich saß neben der Mutter auf einer Bank und schaute zu.
KS:Und Deine Mutter hat was getan?
HJO:Na, sie hat wieder gelesen. Bücher, ausschließlich Bücher. Und das ist nun wirklich seltsam: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals eine Zeitung gelesen hätte. Nein, hat sie wohl nie getan. Keine Zeitung. Keine Zeitschriften, nichts, nur Bücher. Romane. Erzählungen. Gedichte. Das war es.
KS:Wie erklärst Du Dir das?
HJO:Sie hatte eine Phobie vor Nachrichten. Sie konnten Katastrophen oder andere Ereignisse enthalten, die extreme Angst machten. Das versetzte meine Mutter in Panik. In ihrem Binnenraum durfte es so etwas nicht geben, er sollte ruhig, still, ereignislos sein. Nachrichten enthielten Bedrohliches, das machte sie verdächtig, deshalb durften sie gar nicht erst zur Kenntnis genommen werden. Noch viele Jahre später, als mein Vater einen Fernseher angeschafft hatte, schaute meine Mutter niemals fern. Sie ging auch nicht ins Kino. Nicht einmal ins Theater.
KS:Das heißt, sie hat am öffentlichen Leben überhaupt nicht teilgenommen?
HJO:O doch! Ich sagte ja bereits, dass sie eine Leserin war und von Beruf eine Bibliothekarin. Es gab aber noch eine zweite, ebenso wichtige Passion, denn sie war auch eine recht gute Klavierspielerin. Klassische Musik, Konzerte, Musik wo auch immer, daran hatte sie eine große Freude. Lesen und Klavierspielen – das machte damals ihr Leben aus, und genau diese beiden starken Leidenschaften hat sie mir dann später vererbt.
Mit dem Vater unterwegs
KS:Moment, beim Klavierspielen sind wir noch nicht. Du bist erst drei oder vier Jahre alt und nichts anderes als ein genauer Beobachter oder Betrachter. Du schaust lange hin, und Du versuchst, genau hinzuhören, wenn Du außerhalb der elterlichen Wohnung unterwegs bist. Blicke und Klänge – das alles, ohne selbst aktiv daran teilzunehmen. Sprechen wir jetzt auch von Deinem Vater! Welche Rolle spielte er? Du hast schon angedeutet, dass er abends die Waren in den Geschäften abholte, die Deine Mutter am Morgen bestellt hatte.
HJO:Ja, so war das. Mein Vater hatte auch präzise festgelegte Rollen, und in die schlüpfte er hinein, wenn er abends von seiner Arbeit nach Hause kam. Es ist kurios – aber er hatte ganz entgegengesetzte, und er unterhielt und beschäftigte sich völlig konträr zu meiner Mutter. Zum Beispiel liebte er Zeitungen und Zeitschriften sehr. Abends drehte er mit mir kleine Runden durch das Nippeser Veedel, und sehr häufig suchten wir dann auch eines der typischen Kölschen Büdchen auf. Da wurden dann Zeitungen oder Zeitschriften gekauft, ich durfte mir welche aussuchen und hatte so meinen eigenen Anschauungsstoff. Beinahe jeden Abend gingen wir auch zusammen in den Goldenen Kappes, ein großes Brauhaus nahe unserer Wohnung, das es übrigens heute noch gibt. Wir gingen in die Schwemme, da standen sechzig, siebzig Leute an kleinen Tischen und tranken ihr Kölsch. Mein Vater kannte viele von ihnen, und es war für mich jedes Mal ein starker Moment, zu erleben, wie freundlich er begrüßt wurde: Jupp, komm her, hier ist frei – und bring den Jungen mit! So bekam ich zu spüren, wie man integriert sein konnte, integriert, angenommen, dazugehörig. Das war mein Vater in hohem Maß, meine Mutter war es aber nicht und wollte es auch nicht sein.
KS:Und Du? Fühltest Du Dich auch integriert? Was hast Du im Goldenen Kappes gemacht?
HJO: Ich bekam einen erhöhten Kindersitz und etwas zu trinken. Ich konnte also schauen, gucken und teilnehmen, obwohl ich kein Wort redete. Das interessierte aber niemand, ich war einfach »dabei« und erhielt sogar einen eigenen Bierdeckel. Wenn ich etwas Kleines zu essen bekam, wurde das auf dem Deckel notiert. Das Essen und ein Getränk – und dazu das Datum. Diese Bierdeckel nahm ich mit nach Hause, sie kamen in eine kleine Kiste, ich sammelte sie, sie waren die erste Sammlung, die ich anlegte.
Die Inseln der schönen Momente
KS:Hast Du eine Ahnung, warum Du sie gesammelt hast?
HJO:Ja, habe ich. Jeder Deckel stand in meinen Augen für einen schönen Moment: das Zusammensein unter Leuten mit meinem Vater, die kleine Abendmahlzeit, friedlich, ungestört. Die Schrift auf den Deckeln hielt diesen Moment fest, deshalb habe ich sie aufgehoben. Ich vermute aber noch mehr, denn im Grunde entstand durch diese Sammlung von Bierdeckeln ja eine Art Chronik. Die dahinströmende Zeit wurde in kleinen Zeitinseln fixiert. Jeder Deckel eine Insel. Und mehrere Deckel hintereinander ergaben eben einen chronikalischen Verlauf. Und genau das hatte für mich eine große Bedeutung: die Zeit festzuhalten, auf etwas zu schauen, das ihren Verlauf imaginierte. Nahm ich einen Deckel in die Hand, setzten die Träumereien ein, sie waren Wege zurück in die gerade erst erlebte Vergangenheit.
KS:Die beschriebenen und gesammelten Bierdeckel brachten zum ersten Mal ein Zeitmoment in Dein Leben. Das sollten wir so festhalten, als wichtigen Bestandteil unserer Schreibforschungen.
HJO:Heute denke ich, sie waren von großer Bedeutung. Vorher war ein Tag wie der andere. Ich stand auf, langweilte mich, schlich durch die Wohnung, versuchte, mich zu beschäftigen, frühstückte. Dann las meine Mutter in ihren Büchern, ich schaute aus dem Fenster, und wir hörten zusammen Radio, klassische Musik, keine Nachrichten. Das alles wirkte zeitlos, wie ein ewiger Stillstand, ohne große Abwechslungen. Die Bierdeckel waren stattdessen erste Markierungen der Zeit: vorher, nachher, die Zeitinsel an einem bestimmten Tag. Daran konnte ich mich orientieren, ich hatte etwas, an das ich mich halten konnte, so sonderbar sich das anhören mag. Für mich als Kind war es eine starke Veränderung. Ich sah und erkannte, was Zeit bedeutet, ich empfand mich als ein Wesen, das eine bestimmte Zeit durchlebt. Deshalb standen auf den Deckeln ja Daten und die jeweils gegessenen Speisen und die Getränke. Der Tageskonsum eben, und der war jeden Tag ein anderer.
Die Kostproben
KS:Wir sprechen von den Mahlzeiten im Brauhaus. Die interessieren mich auch, ich sage Dir später, warum.
HJO:Das Essen kam nie auf großen Tellern, sondern in kleinen Schälchen, das waren Kinderportionen. In der Schwemme wurde normalerweise ja nicht gegessen, sondern nur getrunken. Wer essen wollte, setzte sich an einen Brauhaustisch. Die Mini-Portionen waren etwas Besonderes, wie ein Gruß aus der Küche. Es gab Kölsche Spezialitäten, saure Nierchen oder Reibekuchen, in schmale Streifen geschnitten. Meinen Vater freute das sehr, und er spielte etwas Theater, wenn das gebracht wurde. So sagte er oft: Ah, dem Herrn Baron wird serviert, ah, schau an, der Herr Baron erhält Apfelkompott. Dann lachten alle und schauten zu, wie ich kostete und aß.
KS:Du warst also eine Figur, und Dein Vater sprach in der Schwemme mit den Köbessen und den anderen Gästen über Dich. Damit ließ er Dich am Leben dort teilnehmen.
HJO:Ja, und es war sehr wohltuend, dass ich mich so integriert fühlte. Die meisten Brauhausgäste kamen aus der unmittelbaren Nachbarschaft, so lernte ich die Nachbarn kennen. Allerdings nur die Männer, die Frauen waren meist zusammen mit ihren Kindern auf dem Spielplatz – und den suchte ich ja nicht auf.
KS:Dein Vater hat Dich also in seine Welt eingeführt. Mit der Mutter hast Du Dich in der Zelle der Wohnung aufgehalten, extrem zurückgezogen, und mit dem Vater hast Du soziale Kontakte erlebt. Du bist in einer Doppelwelt groß geworden, so könnte man sagen. Die kleinen Speisen für den Herrn Baron waren der Gipfel, sie machten die Momente im Brauhaus zu etwas ganz Besonderem, Festlichem.
HJO:Ja, so war das, und es war so besonders, weil es einerseits ganz alltägliche Kölsche Speisen waren, die andererseits eigens serviert wurden, als handelte es sich um Delikatessen. Diese kleinen Festmomente, wie Du sie nennst, haben mein ganzes Essverhalten stark geprägt. Sie haben eine kulinarische Lust entstehen lassen, und zwar eben nicht die eines Gourmets, sondern die eines Liebhabers von einfachen, sorgfältig zubereiteten und eigens servierten Speisen.
KS:Jetzt versteht man genauer, warum an so vielen Stellen in Deinen Romanen und Erzählungen etwas gegessen und getrunken wird. Das sind jedes Mal kleine Momente mit einem schlichten, aber eigens betonten Festcharakter. Und jedes Mal spielt das Land oder die Region, in der gerade gegessen wird, eine große Rolle. Das Land ringsum kommt in Gestalt von Zitaten der agrarischen oder maritimen Kultur auf den Tisch. Und das übrigens nicht selten auf kleinen Tellern, als wären es Kostproben.
HJO:Und das sind sie ja auch: Kostproben. Die Speisen und Getränke haben den Status von Figuren, und sie wirken wie Gestalten, die einen besonders intensiven Kommentar zum umgebenden Raum beisteuern. Das Kosten genügt, es geht nicht darum, sich langen Mahlzeiten hinzugeben.
Das visuelle Vergnügen
KS:Und wie war das mit den Zeitungen und Zeitschriften, die Du zusammen mit Deinem Vater an einem Kiosk ausgesucht hast. Waren es nicht auch Kostproben?
HJO:Wir befinden uns ja noch in den mittleren fünfziger Jahren. Es gab kein Fernsehen in unserer Wohnung, aber es gab Zeitschriften mit vielen Fotos und Bildern. Die waren für mich gleichsam Fernsehen. Ich durfte mitnehmen, was ich wollte, ich hatte alle Freiheiten. Zu Hause habe ich viele Fotos und Bilder ausgeschnitten, die mir besonders gefielen. Anfänglich kamen auch sie nur in Kisten, das war aber nicht befriedigend, weil sie chaotisch herumlagen, wie Papierwust. Vater hatte die Idee, sie auf Kartons zu kleben, und das habe ich getan. Damit war ich dann sehr beschäftigt, und ich hatte eine Aufgabe: Zeitschriften und Zeitungen ausschneiden und die Ausschnitte aufkleben und aufbewahren. Auch das war eine chronikalische Arbeit und stark dokumentarisch. Ich steuerte nur das Auswählen und Aufkleben bei, mehr nicht, keine eigenen Zeichnungen, kein Gekritzel, das mochte ich nicht, und ich konnte es auch nicht. Ich habe nie gemalt oder gezeichnet, nur gezwungenermaßen, später, in der Grundschule. Es war desaströs.
KS:Wir sprechen von visuellen und von kulinarischen Kostproben, haben die etwas miteinander zu tun?
HJO: Vielleicht insofern, als die kulinarischen auch wie Bilder oder wie Stillleben erschienen. Drapiert. Gestaltet. Wenige Speisen oder auch nur eine einzige, wie etwa der Reibekuchen, aber eben in schmale Streifen geschnitten, und daneben ein runder Klecks Apfelkompott. Viele Jahre später habe ich übrigens oft allein gegessen. Freunde fanden das seltsam, aber ich ging gerne allein irgendwohin, nahm einige Zeitungen mit und setzte mich an einen Tisch. In Rom war das so während des Studiums, ich ging nicht in Restaurants, das Geld dafür hatte ich nicht, wohl aber ging ich in eine Tavola calda, einen Schnellimbiss. Man holte die kleinen Speisen an einem Büfett ab und stellte sich das Abendessen zusammen. Das habe ich immer sehr geliebt. An einem Tisch mit ein paar Zeitungen sitzen, etwas kosten, ein minimaler festiver Moment, den ich oft lange ausdehnte.
KS:Kurz noch einmal zurück zu den Fotos und Bildern. Der Umgang mit ihnen war ein visuelles Vergnügen, ohne einzugreifen, rein medial?
HJO:Es ging los mit dem Ausschneiden der Fotos, und weiter ging’s mit dem Aufkleben auf Kartons oder Pappen, die mein Vater mitbrachte. Diese Kartons konnte man in unterschiedlichen Formaten zurechtschneiden, quadratisch, rechteckig, rund, groß oder klein. Waren sie beklebt, erschienen sie wie richtige Seiten, und wenn ich sie hintereinander anschaute, blätterte ich in einem selbst gemachten Buch. Einem mit vielen losen Seiten, so sehe ich das heute. Was damals entstand, hatte bereits einen gewissen Werkcharakter. Nichts Großes, aber etwas von einem Werk. Auch das war also eine Hervorbringung des stummen Handwerks, könnte man sagen. Ich betone das so, weil sich darin ein elementares Tun verbirgt: aus einer Quelle, einer Vorlage etwas anderes zu machen. Zielgerichtet, lustvoll, hypnotisiert vom Visuellen, das in andere Formate umgegossen wurde.
Das chronikalische Schreiben
KS:Wir schauen auf die Sammlung der Bierdeckel und auf die der ausgeschnittenen Fotos und Bilder. Beides sind, wie Du betonst, chronikalische Arbeiten. Wann kamen denn Texte hinzu?
HJO:Als ich mit acht, neun Jahren schreiben konnte, habe ich Tag für Tag auch kurze Chroniktexte neben die Fotos und Bilder geschrieben. Nur ein paar Zeilen. Was ist passiert? Was gibt es Schönes zu berichten? Und in späteren Jahren habe ich dann richtige Chroniken geschrieben, völlig verrückt. Als ich in Hildesheim lehrte, habe ich drei Bücher mit exakten Chroniken des Studienangebots sowie sämtlicher Lesungen und Auftritte der Studierenden außerhalb der Universität verfasst. Das wäre für jeden Normalschreiber eine staubtrockene Arbeit gewesen, für mich war es das aber nicht. Ich hatte große Freude daran. Viele meiner Bücher haben unterirdisch einen Chronikcharakter, der hier und da ins Tagebuch übergeht. Ich denke etwa an Blauer Weg.
KS:In so einem Fall wurden die Kurzchroniken in einen literarischen Text verwandelt und veröffentlicht. Was aber ist sonst mit ihnen geschehen und wie sahen sie aus?
HJO:Heute sind es DIN-A4-Skizzenbücher in Hoch- oder Querformat. Eine Zeitlang habe ich die einzelnen Seiten auch in Folien und dann in Ordner gesteckt.
KS:Das heißt mindestens dreihundertfünfundsechzig Seiten und Folien in einem Ordner? Das wäre dann eine Jahreschronik.
HJO:Das bedeutet dreihundertfünfundsechzig Seiten in mehreren Ordnern, denn manchmal schrieb ich am Tag mehrere Seiten.
KS:Du hast nie damit ausgesetzt?
HJO:Nein, ganz ausgesetzt habe ich nie. Aber diese Eintragungen waren natürlich unterschiedlich lang. Etwa ab dem vierzigsten Lebensjahr sind sie jedoch meist von gleicher Länge, ganze Seiten in Skizzenbüchern, lückenlos. Ich konnte jederzeit auf sie zurückgreifen, und das habe ich später auch in vielen Fällen getan. Mit Hilfe dieser Chroniken sind dann literarische Werke entstanden. Wir kommen darauf, wenn wir über die veröffentlichten Reiseerzählungen aus der Kindheit sprechen. Also über Die Moselreise, Die Berlinreise, Die Mittelmeerreise. Die habe ich ja als Kind oder junger Mann geschrieben. Ihnen lagen schon damals die Tageschroniken zugrunde, die ich während der Reisen geführt hatte.
KS:Und wie hat sich das visuelle Vergnügen an Fotos und Bildern entwickelt?
HJO:Das hat sich auf frappierende Weise fortgesetzt. Seit ich etwa zehn, elf Jahre alt war, wurde es aktiver. Ich fotografierte damals mit einem einfachen Apparat, den ich mir sehnlichst gewünscht hatte. Ich habe sogar sehr viel fotografiert und die Fotos dann wieder auf Kartons geklebt, und als diese kindliche Ära vorbei war, kamen Film- und Videokameras hinzu. Es gab Zeiten, in denen ich ununterbrochen mit einer Videokamera unterwegs war.
KS:Um was zu filmen?
HJO:Nichts Besonderes. Den Alltag. Einen Gang durch eine Straße, ein Einkauf in einem Laden, Gespräche mit Freunden, was sich eben so ergab.
KS:Nichts Ausgedachtes also, keine Spielfilmszenen oder etwas Ähnliches?
HJO:Nein, niemals. Ich filmte den ereignislosen, oft stillen Alltag. Typischerweise bewegte ich die Kamera kaum. Ich liebte ruhige Standbilder, ich ließ die Menschen und Dinge sich bewegen und beobachtete sie dabei, ich griff aber nicht ein, und ich sagte nie, was sie tun oder lassen sollten.
KS:Ästhetisch betrachtet, war das ja konsequent. Das Kind, das lange auf den Erzbergerplatz schaute, lebte in Dir weiter. Und die Zurückhaltung Deiner Mutter gegenüber explosiven Nachrichten. Du hast das stille, ereignislose, alltägliche Leben gefilmt, das sie so mochte.
HJO:Und ich habe wiederum selbst genau jene Filme sehr gemocht, die sich ebenfalls an dieses Ideal hielten. Viel später habe ich einige Jahre als Filmkritiker gearbeitet, und anhand dieser Kritiken kann man die ästhetische Reduktion noch immer genau beobachten. Reißerische Filme mit rasanter Handlung mochte ich nie, das ist noch heute so. Oft sitze ich sprachlos vor dem Fernseher, wenn ich einen Trailer für den nächsten abendfüllenden Krimi sehe. Wie kann man sich das nur anschauen? frage ich mich im Stillen. Und ich schaue es mir auch nicht an. Viele meiner Romane halten sich übrigens auch an dieses Ideal, ohne dass ich es mir vornehmen würde. Sie erzählen keine rasanten Geschichten und kommen mit wenig Handlung aus, sie wirken ruhig, fast ereignislos, meditativ. Noch eine letzte Bemerkung dazu: Bis heute träume ich davon, einmal einen längeren Film zu drehen, als Regisseur und mit einem guten Kameramann, mit dem ich mich blind verstehen würde. Diesen Traum werde ich wahrscheinlich nie los.
Klavierspielen
KS:Kommen wir noch einmal zu Deiner Mutter zurück, wir haben das Klavierspielen bisher nur gestreift, es ist aber eminent wichtig, ja, es spielt sogar die Hauptrolle in diesen frühen Jahren, wenn ich das richtig einschätze.
HJO:O ja! Als ich vier war, erhielten wir ein Klavier, es war das Geschenk eines Onkels. Dieses Klavier der Marke Seiler wurde von Möbelpackern ins Wohnzimmer gerollt und machte auf mich als Kind gleich einen enormen Eindruck. Was war das? Was konnte man damit anfangen? Wenig später erlebte ich zum ersten Mal, wie meine Mutter darauf spielte. Das war, aus dem Rückblick betrachtet, einer der stärksten Momente meines Lebens überhaupt. Es wirkte, als gingen tausend Sonnen auf, es warf mich richtiggehend um. Zweierlei kam da zusammen: Zum einen, dass ich plötzlich erlebte, wie man Musik machen konnte. Zum anderen, dass ich meine Mutter in einer neuen, sehr starken Rolle erlebte. Sie war nicht mehr die schweigende Frau, die sich zurückhielt, sondern die Frau, die wunderbar spielte. Sie hatte gleichsam zu einer Art von Sprache gefunden, die ihr damals mehr entsprach als die der Worte. Dass sie als junge Frau eine Ausbildung als Klavierspielerin erhalten hatte, das wusste ich natürlich nicht, ich habe es erst später erfahren. Diese Geschichte kann man in dem Buch Wie ich Klavierspielen lernte (2018) nachlesen, das von dieser lebenslangen Faszination in meinem Leben erzählt. Damals, als ich vier war, kam es erst einmal darauf an, zu erkennen, dass das Klavierspielen auf den ersten Blick anscheinend etwas Einfaches war. Man setzte sich hin und griff in die Tasten – und die machten mit! So machte es jedenfalls meine Mutter.
KS:Ohne Noten, ohne vorher geprobt zu haben?
HJO: Ja, sie legte sofort los, als wäre es das Einfachste von der Welt. Von da an gab es die stille, zeitlos wirkende Wohnung am Erzbergerplatz nicht mehr. Sie war belebt, die Töne und Klänge machten sich in ihr breit, und ich konnte sie sogar näher kennenlernen: indem ich lernte, was Noten sind. Diese Erfahrung war ebenfalls elementar: Ich lernte, sehr langsam, aber doch stetig, dass man die Musik auch festhalten und aufzeichnen konnte. Wie ich vorher die Fotos und Bilder aus den Zeitungen ausgeschnitten und aufgeklebt hatte, malte ich nun Noten auf Papier, schnitt sie aus und klebte sie auf Kartons. Etwas später gab es sogar bereits Notenpapier mit Notenlinien! Das anzuschauen und sich vorzustellen, wie diese Linien zu füllen wären – damit verbanden sich viele Fantasien. Und all das hatte ein einfaches Klavier bewirkt. Es war wie ein Wunder, denn es war ein ideales Angebot für das schweigsame Kind. Erneut gab es etwas zu tun, zunächst etwas Handwerkliches. Ich musste lernen, die Tasten anzuschlagen und zu bedienen, und es gab die Ergänzung durch Theorie, also durch das Notenlernen und Noten aufschreiben. Aus der Zeit, als ich sechs Jahre alt war, gibt es bereits Notenhefte, die voll von Noten sind. Wie kleine Kompositionen. Das waren sie natürlich nicht, es waren aber erste Schreibversuche und damit auch erste Annäherungen an die Schrift, mit der ich sonst nichts zu tun hatte und nichts zu tun haben wollte.
KS:Das Klavier erweitert also die frühen Bilder aus den fünfziger Jahren um etwas Entscheidendes. Wie muss ich mir das vorstellen?
HJO:So, dass meine Mutter jeden Morgen mit dem Klavierüben und Klavierspielen begann. Sie spielte nur klassische Musik, nichts Hochvirtuoses, sondern eher Kompositionen mit eindringlichen Melodieführungen. Musik von Robert Schumann, kurze Stücke von Domenico Scarlatti, Walzer von Chopin, Klaviersonaten von Mozart. Kein Beethoven, niemals Beethoven.
KS:Warum denn das nicht?
HJO:Es entsprach nicht ihrem ästhetischen Empfinden. Ich sagte ja schon, sie entzog sich jeder Dramatik, allen Konflikten, sie bevorzugte das Stille, Ereignislose, Ruhige. Beethovens Kompositionen waren das genaue Gegenteil, sie machten ihr Angst. Sie spielte also sehr selektiv, wodurch ein Kanon von Stücken entstand, die noch heute zu meinen Lieblingsstücken zählen. Wenn ich sie höre, sitze ich in meinen Fantasien auf dem Boden der Kölner Wohnung. Ich höre zu, wie meine Mutter Klavier spielt, genau das habe ich morgens getan.
KS:Sie hat Dich aber auch unterrichtet.
HJO:Ja, das kam bald hinzu. Wir saßen nebeneinander am Klavier, sie spielte mit der rechten oder linken Hand etwas vor, und ich spielte es nach. Es gab noch keine Noten, nichts, es waren Übungen für die beiden Hände, einzeln, dann allmählich auch zusammen, leicht, dann immer schwerer. Heute würde ich sagen, der Unterricht war anfänglich vor allem auf Technik fixiert. Das hatte etwas Sportliches. Wie lassen sich Finger und Hände trainieren, wie machen wir aus ihnen einsatzfähige Körperteile?
KS:Hat Dir das denn gefallen?
HJO:Und wie! Vielleicht gerade deshalb, weil es wie Sport erschien. Ich bewegte oder trainierte den Körper ja sonst nicht, ich schaute und beobachtete, spielte aber nicht mit anderen Kindern, was mir körperlich etwas abverlangt hätte. Am Klavier aber bewegte ich mich, der Körper erhielt jetzt kleine Aufgaben, selbst das richtige Sitzen musste ich lernen. Außerdem war das Klavierüben, gerade weil das Klavier als Instrument so leicht zu bedienen war, keine Qual. Das wäre vielleicht im Fall von Violine, Cello oder im Fall von Blasinstrumenten anders gewesen. Das Klavier zeigte seine Tasten, mit denen konnte ich mich anfreunden, ganz einfach.
KS:Das Klavierüben brachte neue Programme für das stumme Handwerk mit sich, so könnte man sagen?
HJO:Ja, jeder Tag erhielt neue Strukturen. Aufstehen, frühstücken in der Küche, Mutter spielt Klavier, wir üben zusammen, ich übe allein, paff: schon ist Mittag! Wir gehen in die Küche, wir kochen. Ich beschäftige mich mit den Fotos und Bildern, paff: schon ist Nachmittag! Ich übe wieder allein. Was ich sagen will: Die Tage waren randvoll. Es gab keine Langeweile und keinen Stillstand.
KS:Und Du warst damit anscheinend sehr zufrieden. Könnte man sogar sagen, Du warst glücklich? Es hört sich fast so an. Eigentlich hättest Du das Familienleben als eine Katastrophe erleben müssen, hast es aber nicht, sondern sprichst gut nachvollziehbar von einer glücklichen und gelungenen Zeit als Kind.
HJO:Für meine Eltern bedeutete es eben eine große Freude, ein Kind zu haben. Es gibt sehr bewegende Fotos von meiner Mutter mit mir, die dieses Glück zeigen. Auch viele Verwandte teilten dieses Glück, ja, die ganze Familie feierte dieses Zusammenleben.
KS: Die Familie wollte sich von der fürchterlichen Geschichte vor Deiner Geburt nicht niederdrücken lassen. Verstehe ich das richtig?
HJO: Ja, so habe ich es empfunden. Niemand ließ den Kopf hängen. Das Leben konnte etwas Schönes, Wertvolles sein, wenn man es zu leben wusste. Man musste allerdings viel dafür tun. Über die Zeiten vor meiner Geburt wurde nie gesprochen.
KS: Aber war Desintegration zu erleben, nicht etwas Schmerzhaftes?
HJO: Das ist kompliziert, denn die Desintegration hatte auch ihre positiven Kehrseiten. Ich musste nicht runter auf den Erzbergerplatz, mir unter den Kindern Freunde suchen und sagen, Hallo Peter, vielleicht schaffe ich es bald, von Euch anerkannt zu werden, wäre schön! Nein, mir ging es in der Wohnung oben sehr gut. Ich übte Klavier, ich schnitt Bilder aus und sammelte sie, ich hörte meiner Mutter beim Klavierspielen zu und ging abends mit meinem Vater aus. Die Verwandten kamen ab und zu vorbei und sagten, was für ein prachtvolles Kind, es ist schon wieder gewachsen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war, ganz im Gegenteil.
KS: Ein Unglücksbewusstsein hast Du nie besessen?
HJO: Nein, habe ich nicht.
KS: Du hast nichts vermisst?
HJO: Einmal simpel gesagt: Ich war zu beschäftigt, um etwas zu vermissen. Ich betrachtete mich nicht von außen und fragte, wie geht es Dir so? Nein, ich dachte viel konkreter und damit an das Nächste, das zu tun war. Ich war sozial nur schwach integriert, stark aber in die Trainings- und Übungsprogramme, die sich wie von selbst ergeben hatten. Niemand hat mich zu irgendetwas gezwungen oder gefordert: Bub, Du musst viel Klavier üben, sonst wird nichts aus Dir. So etwas habe ich nie gehört. Im Gegenteil, meine Eltern haben von sich aus keine Ansprüche an mich gestellt. Nicht, als ich klein war, und später auch nicht. Sie haben mir ein Leben lang alle Freiheiten gelassen, das war, von heute aus betrachtet, wirklich fantastisch. Die Trainings- und Übungsprogramme waren ja nicht solche, die aus mir etwas Bedeutendes machen sollten. Nein, ganz und gar nicht. Sie sollten mich beschäftigen, unterhalten, mir einfach Freude machen. Dafür waren sie da, nur dafür. Das sollte man nicht vergessen.
Die Werkstatt
KS:Bezogen auf unsere Schreibforschungen, könnte man sagen: Diese Programme, wie Du sie nennst, hatten etwas von einer kleinen, zwar noch kindlichen, aber doch deutlich und markant strukturierten Werkstatt. In ihr gab es bereits Materialien wie Kartons, Papier, Scheren und Klebstifte, und es gab Anweisungen, wie man mit ihnen umgehen sollte: ausschneiden, aufkleben, sammeln, anschauen, chronikalische Experimente machen. Das war bereits recht viel, und es strukturierte den Alltag ja anscheinend auf beeindruckende Weise. Wollte man etwas übertreiben, könnte man sogar sagen: Diese kindliche Werkstatt ließ bereits eine Schriftstellerwerkstatt erkennen. Und von daher wird einem vielleicht erstmalig sehr klar, wie Dein Kosmos entstehen und wachsen konnte. Im Grunde musstest Du nur weitermachen, nicht von diesen Wegen abkommen, sie fortsetzen und weiterentwickeln.
HJO: Na, das hört sich jetzt an wie ein Klacks, und als wäre nichts leichter gewesen als diese Fortsetzung. Das war es natürlich nicht, und es gab durchaus Zeiten, in denen diese Konstellationen stark ins Wanken gerieten. Auch die familiären veränderten sich stark, spätestens mit der Pubertät. Da passierte so allerhand, denn, wie ich ja anfangs hervorhob: Ich lebte nicht mit jungen Eltern zusammen, sondern mit Eltern im Großelternalter. Das hatte seine Vorteile, denn die Eltern waren wegen ihres Alters ruhiger, konzentrierter und trotz aller Verluste doch gelassener als junge Eltern. Es hatte aber auch Nachteile, denn ich spürte ihr Alter natürlich als Kind zumindest indirekt. Vieles, was andere Eltern ganz selbstverständlich mit ihren Kindern machten, machten sie nicht mit mir. Schlitten- oder Skifahren zum Beispiel. Laufen. Ballspielen. Federball. Das gab es alles nicht.
KS:Dann lass uns zu einem Alter wechseln, das die Herausforderungen für die Familie erhöhte. Ich meine das Schulalter. Was passierte da? Wie hast Du diesen Bruch und diesen Übertritt in die neue Welt erlebt?
In die Schule gehen
HJO: Hui, jetzt komme ich ins Schwitzen. Zunächst: Meine Eltern machten nie auch nur die geringste Andeutung, dass sich das Leben jemals ändern würde oder dass es ein Anzeichen für Veränderung gab. Konkret gesagt: Ich wusste gar nicht, dass ich zur Schule musste.
KS:Du lebtest ohne die Vorstellung von Veränderung.
HJO: Genau. Ich lebte in einer anderen Welt, die sah Schule nicht vor. Die Fortschritte auf dem Klavier waren enorm, es war zu verfolgen, wie es voranging, und das Klavierspielen machte mir große Freude. Ich verschwendete nicht den geringsten Gedanken daran, dass sich etwas ändern sollte. An Schule habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Es hat auch niemand jemals Schule erwähnt.
KS: Und Kindergarten?
HJO: Um Gottes willen, Kindergarten kam erst recht nicht vor.
KS: Aber dann hat Dich doch eine Einladung zur Schule erreicht. Was geschah dann?
HJO: Meine Eltern rührten sich nicht. Mein Vater sprach nur manchmal davon, las mir ein Schreiben der Schulbehörde vor und tat so, als wäre das hinzubekommen: in eine Schule gehen, sich anhören, was die Lehrerinnen einem erklären. Lernen. Aufgaben machen. Ich habe das nicht richtig verstanden. Was sollte ich noch lernen? Rechnen? Schreiben? Davon war die Rede. Wozu aber brauchte ich es? Ich lernte doch bereits genug, die Schule war nichts für mich, sie war überflüssig. So empfand ich das.
KS: Am ersten Schultag hat er Dich in die Schule gebracht?
HJO: Meine Mutter hat es versucht, sie ist zunächst mit mir gegangen. Dann hat sie aufgegeben. Mein Vater musste das Hinbringen übernehmen. Ich gehe hier mal nicht in die Details, weil mich diese Erinnerungen noch immer sehr beschäftigen und rühren. Ich kann darüber nur schwer sprechen. Ich will versuchen, es einfach und nüchtern zu sagen. Ich wurde in die Schule gebracht und stand dann mit vielen anderen Kindern auf dem Schulhof, da herrschte ein wildes Treiben. Ich stand neben meinem Vater und wartete still und ruhig. Und ich dachte, das ist das Gefängnis, das ist Knast.
KS:Wirklich Knast?
HJO: Ja, ich habe gedacht, das ist das Furchtbarste, was es gibt. Um die Schule war ein hoher Zaun, und auf dem Schulhof gab es lauter weiße Linien und Zeichen. Wo man sich aufstellen, wo man gehen, stehen, wo man spielen durfte. Hunderte von Kindern liefen da herum und sollten sich zu Reihen formieren, nach Klassen getrennt. Ich habe gedacht, das ist ja die Hölle. Alleine schon das große Eingangstor, durch das man den Schulhof betreten musste. Das ist das Höllentor, dachte ich, ganz im Ernst. Die Hölle kannte ich durch Bilderbücher, ich wusste, wie es da aussah. Ein hohes Tor, ein Schlund, man geht hindurch und kommt nie mehr zurück. Man wird gequält und an Feuern gebraten. Das Leben war zu Ende, ein für allemal.
KS: Aber Dein Vater war doch dabei.
HJO: Ja, mein Vater war mit mir zur Schule gegangen. Er hatte aber nur wenig Zeit. Nachdem er herausgefunden hatte, wohin ich gehörte, übergab er mich einem Lehrer und ging dann zur Arbeit. Ich war in der Hölle, und er war weg. Was habe ich gemacht? Ich bin sofort nach Hause gelaufen. Bevor ich hier umgebracht werde, nichts wie weg.
KS:Dann warst Du zuhause, und was geschah dann?
HJO: Meine Mutter hat mich empfangen und auf einem ihrer Zettel festgehalten, dass ich rasch wieder nach Hause gekommen war. So erfuhr es mein Vater am Abend.
KS: Und was hat er getan?
HJO: