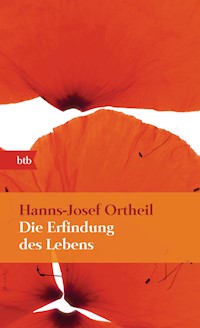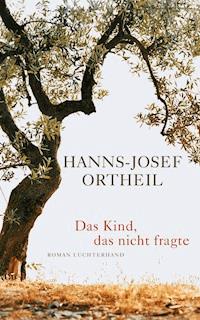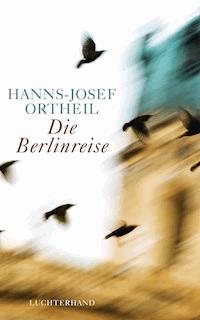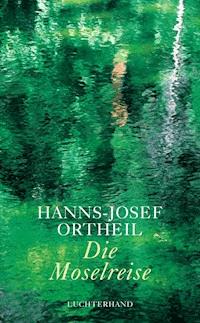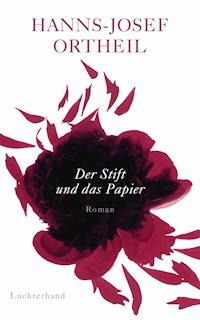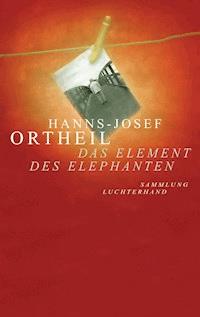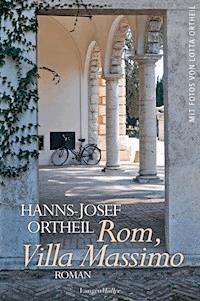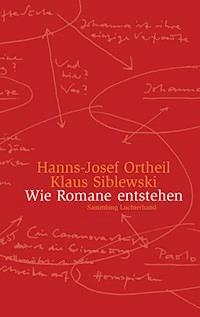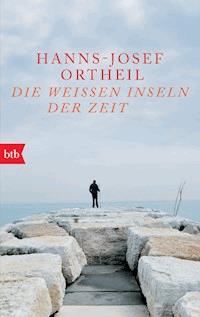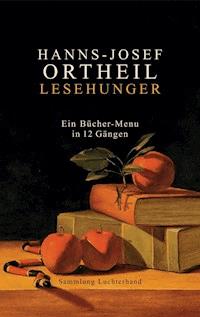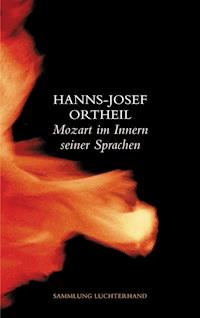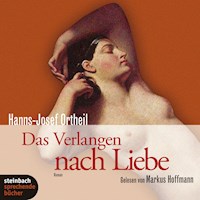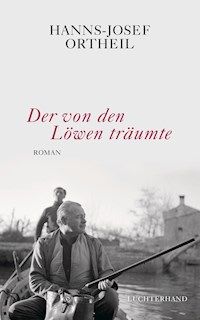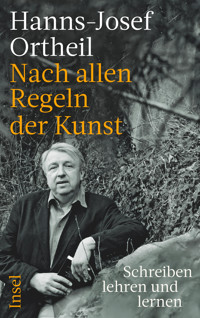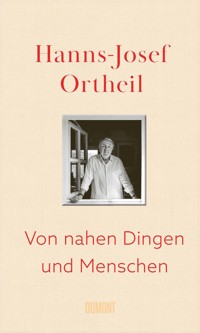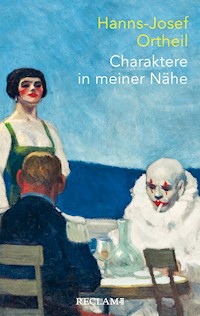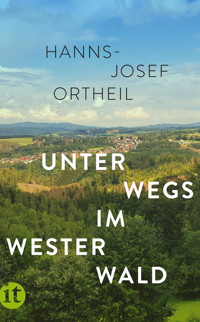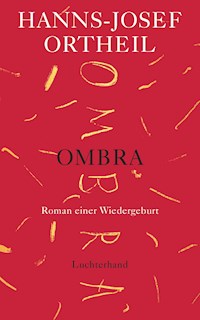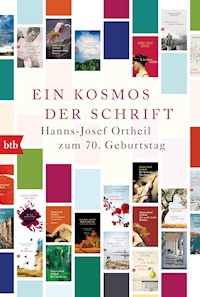9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jean Paul (1763 – 1825), eigentlich Johann Paul Friedrich Richter, war ein Zeitgenosse Goethes, Schillers und Heines, lässt sich aber keiner der gängigen Kunstrichtungen zuordnen. Seine einzigartige «Verbindung von Witz, Phantasie und Empfindung» (Georg Christoph Lichtenberg) machte ihn zu einem Solitär und einem der meist gelesenen Autoren der Goethezeit. Viele seiner Werke haben starke humoristisch-satirische Züge und stecken voller skurriler Figuren. Die großen Romane (wie «Hesperus», «Siebenkäs» oder «Flegeljahre») begeistern noch heute ein Lesepublikum, das die Modernität dieses Erzählens bewundert. Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil präsentiert seinen Lieblingsautor in einem empathischen Porträt, das die Eigenheiten des gefeierten Vorbilds kunstvoll aufscheinen lässt. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hanns-Josef Ortheil
Jean Paul
Über dieses Buch
Jean Paul (1763–1825), eigentlich Johann Paul Friedrich Richter, war ein Zeitgenosse Goethes, Schillers und Heines, lässt sich aber keiner der gängigen Kunstrichtungen zuordnen. Seine einzigartige «Verbindung von Witz, Phantasie und Empfindung» (Georg Christoph Lichtenberg) machte ihn zu einem Solitär und einem der meist gelesenen Autoren der Goethezeit. Viele seiner Werke haben starke humoristisch-satirische Züge und stecken voller skurriler Figuren. Die großen Romane (wie «Hesperus», «Siebenkäs» oder «Flegeljahre») begeistern noch heute ein Lesepublikum, das die Modernität dieses Erzählens bewundert. Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil präsentiert seinen Lieblingsautor in einem empathischen Porträt, das die Eigenheiten des gefeierten Vorbilds kunstvoll aufscheinen lässt.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Hanns-Josef Ortheil (geb. 1951 in Köln) ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus an der Stiftungsuniversität Hildesheim. Seit 1979 veröffentlicht er Romane, Sachbücher und Essays, wofür er mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Seine Werke wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt.
Impressum
rowohlts monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021
Copyright © 1984 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Für das E-Book wurde die Bibliographie aktualisiert, Stand: April 2021
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung bpk/Nationalgalerie, SMB/Klaus Göken (Bildnis des Dichters Jean Paul. Ölgemälde von Friedrich Meier, 1810. Berlin, Nationalgalerie)
ISBN 978-3-644-01022-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Michael Callensee, dem spöttischen Freund, gewidmet
Der Biograph empfängt den Leser
Das Luftschiff steht bereit, vor dem Peterstor in Leipzig, neben der Kirche. Es ist auf den Namen Siechkobel getauft, und sein Luftschiffer heißt Giannozzo. Am ersten Pfingsttag sind der Biograph und Giannozzo angetreten, den Leser zu empfangen. Man steigt ein, das Luftschiff hebt sich, die Wachen am Tor schauen erschrocken, in der Kirche schweigt der Gesang. Schnell erreicht man eine bequeme Höhe, um alles zu entdecken und zu beobachten, Giannozzo deutet auf den gläsernen Fußboden und reicht sein englisches Kriegsperspektiv, und der Biograph wie der Leser blicken herab und erkennen in 22 Gärten von mehreren Zwergstädten auf einmal das Knicksen, Zappeln, Hunds-, Pfauen-, Fuchsschwänzen, Lorgnieren, Raillieren und Raffinieren von unzähligen Zwergstädtern, alle (was eben der wahre Jammer ist) mit den Ansprüchen, Kleidern, Servicen, Möblen der Großstädter. – Hier in der einen Tanzkolonne die Sedezstädterinnen mit bleihaltigen Gliedern und Ideen, aber doch in gebildete Shawls eingewindelt und in der griechischen Löwenhaut schwimmend, viele wie Hühner und Offiziere mit Federbüschen kränklich bewachsen, andere in ihren alten Tagen mit bunten Kleiderflügeln behangen als Denkzetteln der jungen, wie man sonst gebräunte Pfauen mit ungerupften Flügeln in der Bratenschüssel servierte. – In der entgegenstehenden Kolonne die Elegants und Roués, wie sie keine Residenzstadt aufweiset, die Narzissen-Jüngerschaft des Handels, des Militärs und der Justiz, deren modische Kruste in schneller Hitze ausbuk voll schwerer roher Krume, sprechend von Ton und schöner Welt, sehr badinierend über die alte langschößige in der Stadt; nicht gerechnet eine Sammlung gepuderter zarter Junker-Gesichter, die aus Billards und Schlössern vorgucken, wie aus dem durchlöcherten Kaninchenberg weißköpfige Kaninchen.[1] Ist das die berühmte Welt und Erde? – fragt der Leser, aber Giannozzo antwortet nur: Das Spuckkästchen drunten, das Pißbidorchen, das ist der Planet. Nein, der Luftschiffer will nicht freundlich und liebenswürdig erscheinen, er sagt offen heraus, was er denkt, und er lästert laut über das lächerliche Treiben der Menschen unter uns in diesem 18. Jahrhundert. Giannozzo will frei sein, er hat keinen schöneren Traum als diesen, daher hat er sich das Luftschiff gebaut. Das kümmerliche Leben in den zahllosen Kleinstaaten hat ihm die Luft genommen, und so muss er sie oben in der Höhe suchen, wo er Ideen, Träume und Gedanken leichter so an die kleiner werdende Erde anlegen kann, dass diese am Ende ganz den Ausdruck eines bloß geträumten Gebildes und Theaters annimmt. Was ihn ärgert? – fragt der Leser, und Giannozzo nennt die Billionen, die sich den ganzen Monat die Huldigungsgerüste selber bauen – die Repetieruhren, die es immer wiederholen, wie weit sie vorgerückt – alle die Trommelsüchtigen in tausend Dörfern, Gerichtsstuben, Expeditionsstuben, Lehrsälen, Ratsstuben und Kulissen und Souffleurlöchern, welche lustig schwellen können, ohne daß man ihnen mit dem Trokar einen tapfern Stich geben kann[2].
Der Leser sieht, Giannozzo klagt über die falsche Eitelkeit der Menschen, die sich in ihren winzigen Lagern groß dünken, sich in die Brust werfen, ohne doch einen weiteren Blick zu haben als den über das nächste Mauseloch. Sie stecken in sich wie in falschen Puppen, die bloß hangeln und rangeln, ohne daran zu denken, von wo und von wem sie geführt werden. Sie bilden sich vielerlei ein, und sie sind, von oben betrachtet, doch nur sehr wenig. Könnten sie nicht einmal über sich hinauswachsen und empfinden, dass sie selbst da nur eben herumtappen, hilflos wie immer, und dass der kleine Globus, auf dem sie sich abmühen und einander ihren hohen Wert beweisen, nur eine Art Bindestrich im Universum ist? In Deutschland aber fühlt sich Giannozzo besonders unwohl, er hasst dieses blankgescheuerte Blei der polierten Alltäglichkeit, er verflucht diese allgemein-deutsch-bibliothekarischen Menschen, diese Kopiermaschinen der Kopien, die seinem freien Geist mit aller Frechheit in den Weg treten. Aufrütteln möchte er sie, aufwecken, dass sie auf andere Gedanken kommen und die Unfreiheit abschütteln, die politische wie die geistige. Ja, Giannozzo ist vieles in einem: Ein satirischer, skeptischer, aufsässiger Mensch, aber auch ein Träumer und Erfinder, dem man lange zuhören möchte, während unter uns die weite Erde dahinrennt, worauf sich Berge und Holzungen und Klöster, Marktschiffe und Türme und künstliche Ruinen und wahre von Römern und Raubadel, Straßen, Jägerhäuser, Pulvertürme, Rathäuser, Gebeinhäuser wild und eng aneinanderducken, daß ein vernünftiger Mann oben denken mußte, das seien nur umhergerollte Baumaterialien, die man erst zu einem schönen Park auseinanderziehe. Überall regt es sich unter uns, hier in den brennend-farbigen Wiesen wird gemähet – dort werden die Feuerspritzen probiert – englische Reuter ziehen mit goldnen Fahnen und Schabaracken aus – Gräber in neun Dorfschaften werden gehauen – Weiber knien am Wege vor Kapellen – ein Wagen mit weimarschen Komödianten kommt – viele Kammerwagen von Bräuten mit besoffnen Brautführern – Paradeplätze mit Parolen und Musiken …[3]
So geht es fort, rückt manchmal ganz nahe, dass das Heimweh nach unten sich rührt, zieht in die Ferne, dass es kaum zu erahnen ist – das Lebenstheater, das erst stiller steht, als der Biograph und der Leser das Luftschiff verlassen haben und jetzt – allein, selber Figuren des Theaters – drunten stehen, während Giannozzo davonfliegt, weil er Begleiter nicht länger ertragen kann.
Aber Jean Paul hat Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch überliefert und erhalten, und der Leser kann daraus erfahren, wie es dem Luftschiffer später ergeht. Der Biograph indessen wird eine andere Lebensgeschichte erzählen, die Jean Pauls nämlich, die jedoch nie auszuerzählen ist, weil ein einzelner Mensch nie wird fassen können, was der Autor Jean Paul gedacht und geschrieben hat. Aber Hinweise, knappe und verbindende, wird der Biograph im Folgenden geben, nur darf der Leser nicht erwarten, dass er diese Hinweise auf mittlerer Flamme – zwischen Lob und Tadel – zurechtgekocht erhält. Der Biograph kann in diesem Falle nicht bloß kommentieren und ansonsten schweigen. Ab und zu wird er sich selbst in den biographischen Stoff mischen und vor Begeisterung leise aufzischen oder auch nur aufblicken oder aufseufzen, man wird sehen. Denn Jean Paul konnte ja selbst nicht schweigen, wenn er seine Gestalten in die Rennbahn einer Biographie spannte. Immer wollte auch er selbst darin vorkommen, als Urheber und Autor, als Gestalt, nicht allwissend und übermütig, sondern eher bescheiden und auf einem Fuß mit seinen Figuren. So kann auch der Biograph nicht den Fehler machen, seinen Stoff allzu weit von sich zu rücken, als wäre er ihm fremd. Wie er das Ich des großen Jean Paul nicht vergessen will, so will er auch das eigene in diese Biographie einbetten, worin er sich einig weiß mit dem Dargestellten: Nichts wird überhaupt öfter vergessen als das, was vergisset, das Ich. Nicht bloß die mechanischen Arbeiten der Handwerker ziehen den Menschen ewig aus sich heraus: sondern auch die Anstrengungen des Forschens machen den Gelehrten und Philosophen eben so taub und blind gegen sein Er und dessen Stand unter den Wesen; ja noch tauber und blinder.[4] Der Biograph will nicht «mechanisch» handeln, er will auch selbst sagen, wie ihm alles vorkommt. Denn während Namen und Daten nur zu dem gehören, was einen wahrhaften Lebensbeschreiber ungemein belastet und aufhält, weil ein solcher Mann nichts hinschreiben darf, als was er mit Instrumenten und Briefgewölben befestigen kann[5], so gehört das, was der Biograph hinzuzusetzen hat, zur unverzichtbaren Liebe, die ihn mit dem Geschilderten verbindet. Denn er weiß: Nichts ist schwerer, als einen Gegenstand der Betrachtung, den wir allzeit außer uns rücken und vom innern Auge weit entfernen, um es darauf zu richten, zu einem Gegenstand der Empfindung zu machen.[6]
So mag also gleich beim Empfang des Lesers und nach dem ersten Höhenflug deutlich sein, dass der Biograph eine passionierte Lebensbeschreibung vorlegen und sich, wie es auch Jean Paul tat, mit dem Leser in der Folge über manches Detail unterhalten will. Leider sind Zeit und Raum dafür knapp genug; um der Kürze entgegenzuarbeiten, hat der Biograph im Anhang der Anmerkungen zahlreiche weiterführende Wege abgezweigt. Der Leser mag sich umsehen. Und so rüttel’ ich diese dünnen Blätter in den fliehenden breiten Strom der allgemeinen Vergänglichkeit bey meinem Durchflattern dieses umwölkten Lebens, bis ich selber ihnen nachschwimme, hinter oder vor dem Leser und desgleichen dem guten Rezensenten.[7]
Kinderolympiaden
Wie gern nähme der Biograph jetzt den Leser und vielleicht auch den Rezensenten mit, um nach Bayreuth zu fahren, von dort aus aber noch weiter nach Osten, ins Fichtelgebirge, ja am besten gleich auf den Ochsenkopf. Dann könnte er einfach in die Gegend deuten und behaupten: Dort liegt Wunsiedel, wo Jean Paul geboren wurde, südlich davon das Felsenlabyrinth der Luisenburg, nicht weit Alexandersbad. Jean Paul hat dem Biographen eine solche Reise selbst vorgemacht, in der Vorrede zu seiner Unsichtbaren Loge lässt er sich in einer Kutsche, dann auch in einer Sänfte hinauffahren und herumtragen auf den Höhen, bevor er ins Staunen über die Naturschönheiten ausbricht, die er während des Fahrens und Tragens noch mit keinem Blick gewürdigt hat, um alles von der Höhe aus noch stärker genießen zu können: Ach welche Lichter und Schatten, Höhen und Tiefen, Farben und Wolken werden draußen kämpfen und spielen und den Himmel mit der Erde verknüpfen – sobald ich hinaustrete (noch ein Augenblick steht zwischen mir und dem Elysium), so stehen alle Berge von der zerschmolzenen Goldstufe, der Sonne, überflossen da – Goldadern schwimmen auf den schwarzen Nacht-Schlacken, unter denen Städte und Täler übergossen liegen – Gebirge schauen mit ihren Gipfeln gen Himmel, legen ihre festen Meilen-Arme um die blühende Erde, und Ströme tropfen von ihnen, seitdem sie sich aufgerichtet aus dem uferlosen Meer …[8]
Doch bevor der Leser den Erzähler weiter begleiten darf, soll es zurück nach Wunsiedel gehen, wo Jean Paul 1763, im Jahr des Hubertusburger Friedens, zu Frühlingsbeginn am Morgen um 1½ Uhr zur Welt kam, wofür er später nur freundliche Worte fand: Wie gern bin ich in dir geboren, Städtchen am langen hohen Gebirge, dessen Gipfel wie Adlerhäupter zu uns niedersehen![9] Diese Dorfliebe hat damit zu tun, dass Jean Paul sie sich als Bedingung der dichterischen Phantasie dachte. Er war froh, nicht in einer großen Stadt, wo man alles auf einmal kennenlernt und nichts deutlich genug, geboren zu sein, sondern dort, wo im günstigen Fall der eine noch etwas achtgibt auf den anderen und eine gewisse Lebenswärme entsteht, die dem Dichter später viele Erinnerungen beschert. Und dann, wenn der Dichter aus seinem Dorfe wandert, bringt er jedem, der ihm begegnet, ein Stückchen Herz mit und er muß weit reisen, eh’ er endlich damit auf den Straßen und Gassen das ganze Herz ausgegeben hat.[10]
So war also die Dorfkenntnis gleichsam die Kenntnis einer Welt im Kleinen, wo alles ein wenig übersichtlicher ist und sich schärfer abhebt. Es hat lange gedauert, bis Jean Paul in die größere Welt hineinsah (Armut und Hunger hielten ihn zurück), denn es war alles ganz anders als heute, nicht so durchmischt, einander ähnlich und weltoffen. Wunsiedel gehörte zwar zum Fürstentum Bayreuth, das von einer fränkischen Linie der Hohenzollern regiert wurde, bevor es aus den Händen des letzten Nachkommen in die der preußischen Verwandten glitt (1791) und 1806 schließlich in die Napoleons kam, der es seinen bayerischen Verbündeten schenkte. Aber Jean Paul hat die Eremitage und die markgräfliche Stadt erst lange nach seiner Geburt gesehen. Anfangs war vielmehr alles sehr streng getrennt: Die Landleute lebten im Dorf, wo der Vater ein Schulmeister und Organist war (genauer gesagt der Tertius, der dritte Lehrer, mit einem ganz geringen Einkommen); und erst später, als der Vater Pfarrer in Joditz geworden und die Familie dorthin umgezogen war (1765), durfte der Knabe einmal mit in ein kleines Versailles, nach Zedwitz nämlich, das die Residenz der Patronatsherrschaft der Joditzer Pfarrer war: Die Freiin von Bodenhausen empfing ihn, nachdem er lange vor den Ahnenbildern unten im Schlosse herumgegangen, oben auf der Treppe, gleichsam das Präsenzgemach, wo Paul, der sogleich hinaufschoß, nach der Hofordnung ihr Kleid erschnappte und diesem den Zeremoniellkuß aufdrückte.[11]
In Wunsiedel ist Jean Paul getauft worden; sein wirklicher Familienname (unter dem man ihn jedoch selten in Lexika und anderen Nachschlagebrocken findet) war Richter, die Mutter war die Tochter des Tuchmachers Johann Paul Kuhn in Hof. Dieser Johann Paul war der eine Taufpate, der andere aber war der Buchbinder Johann Friedrich Thieme, sodass aus diesen Vornamen dann der lange des Wiegenkindes wurde, nämlich Johann Paul Friedrich (Richter). Die großväterliche Hälfte (Johann Paul) hat er erst später, als er sich anschickte, ein Autor zu werden, ins Französische übertragen und ein Jean Paul daraus gemacht, was viel zu bedeuten hat, hier aber noch nicht verraten wird.
Die Vorfahren waren Schulmeister, der Vater – wie gesagt – Tertius, Organist, später aber Pfarrer, der Großvater Johann Richter Rektor in Neustadt am Kulm. Sein Schulhaus war ein Gefängnis, zwar nicht bei Wasser und Brot, aber doch bei Bier und Brot; denn viel mehr als beide – und etwa frömmste Zufriedenheit dazu – warf ein Rektorat nicht ab, das obwohl vereinigt mit der Kantor- und Organistenstelle, doch dieser Löwengesellschaft von 3 Ämtern ungeachtet nicht mehr abwarf als 150 Gulden jährlich.[12]
Beinahe ebenso ärmlich ging es im Pfarrhaus von Joditz zu, und es waren deshalb andere Freuden als die des Reichtums, die der Junge in seinen Joditzer Knabenolympiaden erlebte. Reichtum lastet mehr das Talent als Armut und unter Goldbergen und Thronen liegt vielleicht mancher geistige Riese erdrückt begraben.[13] Mit solchen Sätzen hat sich Jean Paul später über die Armut hinweggetröstet, aber sie muss hart gewesen sein, und er hat ihr in seinem Werk einige schneidende Figurenporträts gesetzt, die allen wohlhabenden Lesern Tränen des Mitleidens in die Augen hätten treiben müssen. Doch als er später, in der Selberlebensbeschreibung, aus der hier mit Vergnügen zitiert wird, sein Leben bedachte, wollte er von der Armut nicht viel Worte machen, sondern eher Freuden aus dem gedrückten Leben ziehen, weil ja – wie auch dem Biographen bekannt – eine ländliche Kindheit in der Erinnerung leicht zu einem ganzen Idyllenjahrgang wird. Warum sind keine frohen Erinnerungen so schön als die aus der Kinderzeit?[14] – Weil sie das frische Erstlinggefühl für die neue und erste Welt, die sich dem Kinde auftut[15], beleben und einen aus dem verklärenden Schwelgen gar nicht herauslassen. So emphatisch geschwärmt hat Jean Paul auch in der Selberlebensbeschreibung, und man begreift jetzt wohl eher, warum er es trotz der bitteren Armut tat.
Der idyllische Blick jedoch sucht das Vollglück in der Beschränkung und leuchtet in jeden Winkel. Da steigt im Winter der Vater wegen der Kälte aus der höheren Studierstube in die Wohnstube herab, und man darf ihm die Kaffeetasse zutragen, wenn er die Predigt einübt; draußen ist es still, aber drinnen ist Leben, unter dem Ofen ein Taubenstall, an den Fenstern Zeisig- und Stieglitzenhäuser, auf dem Boden die unbändige Bullenbeißerin, unsere Bonne, der Nachtwächter des Pfarrhofs … und daneben die Gesindestube mit zwei Mägden; und weiter gegen das andere Ende des Pfarrhauses der Stall mit allem möglichen Rind-, Schwein- und Federvieh und dessen Geschrei[16]. Gibt es draußen etwas zu tun, zu reden, zu kaufen, so wird der Junge durch den Schnee ins Freie geschickt, und später – in der langen Dämmerung ging der Vater auf und ab und die Kinder trabten unter seinem Schlafrock nach Vermögen an seinen Händen. Jean Paul war das erste Kind der Familie, aber 1770 hatte er schon drei Brüder, Adam, Gottlieb und Heinrich; eigentlich hätten noch drei Schwestern dazugehört, aber jede von ihnen starb nicht lang nach der Geburt, sodass neben dem Erstgeborenen nur ein Triumvirat männlicher Kindsköpfe zurückblieb, das am Abend in langen Schlepphemden herumhüpfen durfte, bei grimmiger Kälte an der Ofenbank lauerte, bis die Botenfrau in die Gesindestube trat mit ihrem Frucht- und Fleisch- und Warenkorbe aus der Stadt, den die Großmutter geschickt hatte, damit die Armut etwas vergessen wurde.
Leicht könnte der Biograph in solchen winterlichen Seligkeitsstunden fortfahren, er kontrastiert das Vergnügen jedoch lieber mit der Furcht. Denn die Geisterscheu wurde der junge Johann Paul lange Zeit nicht los. Der Vater, der mit Erzählungen von Gespenstern und anderen Unwesen die christliche Glaubens- und Spannkraft der Kinder gegen das Böse anheizen wollte, konnte kaum ahnen, was er im Empfindungshaushalt des Kindes anrichtete, das in heftigen Sätzen durch die dunkle Kirche galoppierte, wenn es etwa die Bibel in die Sakristei zu bringen hatte, niemand aber zur Begleitung da war, sondern alles draußen auf dem Friedhof zu einer Beerdigung stand. Auch wälzte es sich am Abend beinahe zwei Stunden geisterscheu in seinem Bett, bis auch der Vater, mit dem es das Lager teilen musste, hinzustieg und sich alles aufhellte trotz des Dunkels.
Leicht kann man sich vorstellen, wie die Phantasie eines solchen Gespensterfliehenden starke Nahrung erhält, wie sie selbst durch herzhafte Mutmacherei nicht stillzulegen ist und wie sie sich später noch in seinen Werken wiederfindet, wo die Helden ebenfalls vor manchen scheinbaren Ungereimtheiten in die Knie sinken, bis der nun erwachsene Autor sie mit aller Finesse erhellt.
Dem Jungen aber war es lieber, wenn die wirkliche Helligkeit einer anderen Jahreszeit, etwa die des Frühlings oder des Sommers, erst gar keine Furcht aufkommen ließ. Da wird geackert – gesäet – gepflanzt – gemäht – Heu gemacht – Korn geschnitten – geerntet – und überall steht der Vater dabei und hilft mit.[17] Nun darf man auch den Kaffee hinaus ins Freie, in den Pfarrgarten nämlich, tragen, man isst des Abends, ohne ein Licht anzünden zu müssen, und man sieht den Vater, der sich eine Pfeife ansteckt. In solchen hellen Zeiten gelingt auch das Lieben besser, und daher begann Johann Paul damit im Sommer, als er ein blauäugiges Bauernmädchen seines Alters, von schlanker Gestalt, eirundem Gesicht mit einigen Blatternarben, das Augusta oder Augustina genannt wurde, nicht mehr aus dem Herzen, während des Gottesdienstes aber auch nicht mehr aus dem Blick bekam. Man kommt bei solchem ersten Lieben aus Mangel an Überlegenheit und Erfahrung aber gar nicht aus demselben heraus, sodass gegenüber der Angebeteten kein Wort abfällt, höchstens einmal ein Zeichen, das sie aber kaum versteht.
Am meisten jedoch tat sich an Sonntagen, wo die idyllische Freude unseres Helden gar nicht mehr zu halten war. Da durfte er schon am Morgen den Pfarrgarten aufschließen und ruhig durch die Kirche gleiten; später trug man das gesetzmäßige Halbpfund Brot samt Geld zu den Fronbauern. Größer jedoch war noch das Vergnügen, den Vater predigen zu sehen und ihm später beim Ausorgeln zuzuhören. Man unterschätzt wahrscheinlich, wie viel Johann Paul davon hatte und wie viel Jean Paul später daraus machte. Eine Interpretin behauptet, sehr viel, beinahe alles.[18] Denn auch in seinen Werken wird später ausreichend gepredigt, und auch solche Figuren, denen nicht die Qualitäten eines Pfarrers anhängen, schwingen sich – gerade in einsamen Momenten – zu großen Predigten auf, klagend gegen sich selbst, klagend gegen den Himmel oder auch klagend gegen das All, aus dem nichts mehr tönt, nicht einmal mehr eine Glocke. So bildet die väterliche Pfarrländerei gleichsam das Herzens- und Empfindungsfutter der Dichtung, die ja sowieso nichts anderes ist als eine weltliche Übersetzung des Predigens in freieres Reden und Schwärmen.
Wie aber wäre Jean Paul je dazu gekommen, wenn es so idyllisch weitergegangen wäre, von Jahreszeit zu Jahreszeit, spielend, erntend, liebend und zuhörend? Nichts wäre geschehen, und daraus erkennt der Leser, dass in diesem idyllischen Jahrgang (außer dem Herbste) noch etwas anderes vergessen wurde, das Wichtigste, das Lernen nämlich. Mit diesem fängt alles erst eigentlich an und macht aus Hungern und Geisterscheu, Phantasieren und Predigen Ernst. Vier Stunden vor- und drei nachmittags gab unser Vater uns Unterricht, welcher darin bestand, daß er uns bloß auswendig lernen ließ, Sprüche, Katechismus, lateinische Wörter und Langens Grammatik.[19] Solches Lehren, das ja eigentlich gar keines war, verdarb nun dem Zögling nicht die Lust auf das Lernen, im Gegenteil. Alles Lernen war mir Leben, und ich hätte mit Freuden, wie ein Prinz, von einem Halbdutzend Lehrern auf einmal mich unterweisen lassen, aber ich hatte kaum einen rechten.[20]
Und hier wird es seltsam. Denn Johann Paul ließ diese Lust ein Leben lang nicht mehr los. Sie hatte ihn mit aller Macht ergriffen, jedes Buch war ihm ein frisches grünes Quellenplätzchen, wie überhaupt in der Langeweile des Dorfes, die ein noch so reicher Idyllenjahrgang nicht verbergen konnte, Bücher sprechende Menschen, die reichsten ausländischen Gäste, Mäzene, durchreisende Fürsten und erste Amerikaner oder Neuweltlinge wurden.[21]
Da es in Joditz kaum eine Welt gab (außer der kunstvoll zurechtphantasierten und idyllisierten), machte sich der Junge selber eine. Die aber musste sprechen, Laute entwerfen, Figuren und Bilder, allerlei Buntes wie im Kinderlehrbuch (dem «orbis pictus») und sich so zu einem kleinen Reich formen, das man in eine Schachtel einsperren konnte, in der eine kleine, selbstgefertigte Etui-Bibliothek von lauter eignen Sedezwerkchen aufs Vervollständigen wartete. Den Inhalt nahm Johann Paul aus Luthers Bibel, indem er die Fußnoten, die ihm gefielen, abschrieb, die Verse, auf die sie sich jedoch bezogen, ausließ. So begann er zu exzerpieren, und das Vergnügen am Abschreiben und Sammeln des Zerstreuten, dem Zusammensetzen und Verkuppeln des eigentlich Fremden miteinander hörte nicht mehr auf. Das ist nicht leicht zu erklären, erst recht nicht dem Leser, dem alles kindisch und unsinnig vorkommt. Dem Biographen kommt es anders vor, er versteht es und will es kurz sagen.
Kinder spielen gerne mit allem Kleinen; sie machen daraus etwas Eigenes, einen Park, in dem Menschen aus Zinn spazieren, einen Zoo, in dem Tiere herumkriechen, ein Spielhaus, in dem man die Sitten des Elternhauses nachspielen kann. So auch Johann Paul; er machte alles mit den Buchstaben, die lockender waren als das mangelnde Spielgerät. So richtete sich die uferlose Tätigkeit unseres Helden mehr auf geistige als auf körperliche Spiele, er erfand neue Buchstaben und zog überhaupt aus den wenigen Büchern, die für ihn herumlagen (denn die anderen hielt der Vater in der Bibliothek versperrt) geistiges und sinnliches Brot zugleich.
Man mag sagen: Er wurde gewitzt, ein Gelehrter im Kleinen, jedenfalls schon ein Schriftsteller, der an den Buchstaben hing und sich an den aus anderen Werken herausgebrochenen Sätzen, die man in neuer Form zusammenzustellen, zusammenzuhalten oder auch nur zusammenzuleimen hatte, nicht sattsehen konnte.
Wer aber so klug sein will, dem wird die Einfalt bald genommen. An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustüre und sah links nach der Holzlege, als auf einmal das innere Gesicht «ich bin ein Ich» wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich fuhr und seitdem leuchtend stehen blieb: da hatte mein Ich zum ersten Male sich selber gesehen und auf ewig.[22] Literarische Kenner haben an diesem Ereignis gezweifelt; sie haben gezeigt, dass der Rätselspruch des gespaltenen und sich zuschauenden Bewusstseins, «ich bin ein Ich», ein Satz des alten Satirikers Swift war und Jean Paul ihn auch später seinen Figuren gern in den Mund legte. So war daran zu denken, dass er ihn auch dem jungen Johann Paul angedichtet habe, doch der Biograph glaubt nicht daran. Natürlich dachte der Knabe nicht swiftisch, nicht «ich bin ein Ich», aber all die genauen Markierungen des Blitzes – unter der Haustüre, links nach der Holzlege sehend – beweisen ihm genug, dass man es mit Wahrheit und nicht mit Dichtung zu tun hat. Überhaupt kennt er aus eigenem Leben Ähnliches: Wie man plötzlich herausspringt aus der Unbekümmertheit und für einen Moment (ja, schon als Kind) allein dasteht und das Lärmen ringsherum verebbt. Andere, manchmal gelangweilte, seltener altkluge Kinder haben schon in frühen Jahren nach dem Sinn von allem um sie herum gefragt, wozu der Biograph ihnen ein Recht gibt. Daher vertraut er der Geburtsschilderung des Selbstbewusstseins, das aus einem Kind ja keinen für immer Einsamen und erst recht kein naseweises Monstrum macht, sondern nur einen Aufgeschreckten. (Auch braucht man die Deutung davon nicht zu übertreiben.)
So fibelte sich Johann Paul mit den Brüdern durch die Lehrbücher, studierte die griechische Sprache in einer lateinisch geschriebenen Grammatik, lernte aber sonst – trotz guten Willens – nichts, da der Vater nicht wollte und vor Zeitarmut auch nicht konnte. Die lerndurstigen Wurzeln unsers Helden drängten und krümmten sich überall umher, um zu erfassen und zu saugen[23], was alles aber noch lange so vergeblich geblieben wäre, wenn der Vater nicht im Jahre 1776 eine besser dotierte Pfarrstelle in Schwarzenbach an der Saale erhalten hätte, wohin die Familie dann umzog und wo das eigentliche Lernen erst begann. Im Januar war es so weit, und der Biograph möchte mitumziehen, wenn er nicht wie auch Jean Paul fürchtete, man werde in Deutschland darüber reden, dass er den Herbst zur höchsten Joditzer Idylle aufgespart. Der Biograph hat es aber nur getan, weil er jetzt selbst im Herbst an diesem Buch sitzt und sich nur darauf spitzt, dass beide Herbste sich treffen mögen. Denn dem Herbste wandte sich unser Held noch mit einer besondern Kehrseite zu; und diese ist, daß er von jeher eine eigne Vorneigung zum Häuslichen, zum Stilleben, zum geistigen Nestmachen hatte. Er ist ein häusliches Schaltier, das sich recht behaglich in die engsten Windungen des Gehäuses zurückschiebt und verliebt.[24] Der Leser verwechsle diese Geborgenheitssehnsucht nur nicht mit ärmlichem Spießertum, der Biograph, der häusliche Freuden nachzuempfinden weiß, käme ihm sonst scharf entgegen. Denn diese Sehnsucht war nur eine unter vielen, die herbstliche eben, und sie wäre wahrhaftig eine ärmliche, wäre es dabei geblieben. Aber Johann Paul strebte aus diesem Haus- und Winkelsinn weit hinaus, obwohl er ihn nie aufgegeben und in vielen Gestalten (in Wutz und Fixlein und Fibel) fortgesetzt hat. Solche Gestalten ehren das Große, weil sie das Kleine gut kennen, und sie strecken ihre Fühler noch gegen den Himmel, wenn die anderen sie längst in ihre Stuben eingezogen haben.
Lernkörper
Erst in Schwarzenbach fing Johann Pauls eigentliches Lernen an; hier besuchte er die Lateinschule, und hier unterrichtete ihn der junge Kaplan Völkel, der bemerkt hatte, wie viel Talente in dem Wissensdurstigen schlummerten, in Philosophie und Geographie. In der Philosophie las er oder eigentlich ich ihm vor die Weltweisheit von Gottsched, welche mich bei aller Trockenheit und Leerheit doch wie frisches Wasser erquickte durch die Neuheit. Aber unter allen Geschichten auf Bücherbrettern … goß keine ein solches Freudenöl und Nektaröl durch alle Adern (m)eines Wesens – bis sogar zu körperlichem Verzücken – als der alte Robinson Crusoe[25]. Defoes Roman ist für Kinder mit Haus- und Winkelsinn das eigentliche Abenteuerbrot; wie der Held sich auf seiner Insel bewährt, einrichtet und ausbreitet ganz in der Enge – so auch das Kind beim lesenden Nachempfinden. Es sieht eine Welt entstehen, von den Anfängen bis zum Hüttenbau, und es nimmt daran teil, als wäre es die erste Schöpfung.