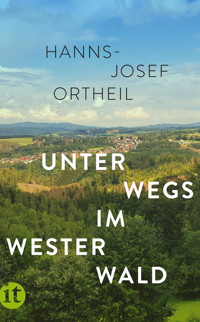9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das neue Reisetagebuch des jungen Hanns-Josef Ortheil.
Anfang der sechziger Jahre hat Hanns-Josef Ortheil zusammen mit seinem Vater eine Reise in das geteilte Nachkriegsberlin unternommen. Es ist eine Reise zurück an die Orte, an denen sein Vater und seine Mutter als junges Paar während des Zweiten Weltkriegs gelebt haben. Geduldig und fasziniert hört er zu, was der Vater ihm von dem Leben damals erzählt. Instinktiv begreift er, welche Bedeutung Berlin für das Leben seiner kleinen Familie hatte und für ihn immer noch hat. Tag für Tag notierend und schreibend, sucht der gerade einmal zwölfjährige Junge sehnsüchtig nach einer Verbindung zu dieser Welt.
Im Sommer 1964 reist der damals zwölfjährige Hanns-Josef Ortheil mit seinem Vater nach Berlin. Wenige Jahre nach dem Mauerbau und ein Jahr nach Kennedys Berlin-Besuch führt der Berlin-Aufenthalt Vater und Sohn die Gegenwart des Kalten Kriegs vor Augen und wird gleichzeitig zu einer Zeitreise in die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs. Im Oktober 1939 waren die Eltern frisch verheiratet aus einem kleinen Westerwald-Ort in die damalige Reichshauptstadt gezogen, wo der Vater bei der Deutschen Reichsbahn als Vermessungsassessor tätig wurde und wo sie bei Luftangriffen ihr erstes Kind verloren. Tag für Tag erkunden Vater und Sohn die Spuren dieser Zeit, besuchen die frühere Familienwohnung, treffen Bekannte und Freunde und lesen die Haushaltsbücher, die die Mutter in den Kriegsjahren geführt hat. Über seine Eindrücke schreibt der Zwölfjährige ein in seiner Art unvergleichliches Reisetagebuch, in dem er auf dramatische Weise vom Nachempfinden der Vergangenheit am eigenen jungen Körper erzählt.
Nach »Die Moselreise« legt Hanns-Josef Ortheil mit der »Berlinreise« das zweite Reisetagebuch seiner frühen Kinderjahre vor, in denen er mit seinem Vater wochenlang allein unterwegs war, um sehen, schreiben und für alle Zeit sprechen zu lernen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman eines Nachgeborenen
Luchterhand
Vorbemerkung
1
Meine Eltern kamen aus einem kleinen Ort des nördlichen Westerwaldes. Nach ihrer Heirat im Jahr 1939 zogen sie von dort nach Berlin, wo mein Vater eine Stelle als Vermessungsingenieur bei der Deutschen Reichsbahn angetreten hatte. Der Umzug aus der ländlichen Einsamkeit des Westerwaldes in die damalige Reichshauptstadt erschien ihnen als ein großes Abenteuer, auf das sie sich sehr gefreut hatten. Sie konnten nicht ahnen, dass ihnen mit dem fast gleichzeitigen Kriegsbeginn ein ganz anderes Leben als das erwartet umtriebige und abwechslungsreiche bevorstand.
In Berlin verloren sie während eines Bombenangriffs ihr erstes Kind. Mein Vater wurde nach Schlesien versetzt und kam dann später als Soldat in Russland zum Einsatz. Über immer längere Zeiträume lebte meine Mutter allein. Ihr zweites Kind brachte sie in der westerwäldischen Heimat zur Welt, wo sie sich dann häufiger zu Kurzbesuchen aufhielt.
Der Lebensraum der kleinen Familie war gefährdet, die Begegnungen in Berlin wurden seltener. Schließlich zog meine Mutter mit ihrem zweiten Sohn wieder ganz zurück in die Heimat, während mein Vater noch in den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 beim Endkampf um Berlin schwer verwundet wurde. Den nur durch ein Wunder möglich gewordenen Heimweg legte er auf Krücken zu Fuß von Berlin aus in den Westerwald zurück. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass mein zweiter Bruder beim Einmarsch der Amerikaner auf einem abgelegenen westerwäldischen Hof ums Leben gekommen war. Ein Granatgeschoß der in der Nähe des Hofs in einem Versteck liegenden deutschen Artillerie hatte ihn in den Kopf getroffen.
2
Nach dem Krieg sind meine Eltern nicht mehr zusammen nach Berlin zurückgekehrt. Mein Vater hatte stattdessen eine Anstellung bei der Deutschen Bundesbahn in Köln gefunden. Dort kam ich selbst Anfang der fünfziger Jahre zur Welt, nachdem meine Eltern in den Nachkriegsjahren noch einmal zwei Söhne verloren hatten, die jeweils kurz nach der Geburt gestorben waren.
Obwohl viele Berliner Freunde und Bekannte meine Eltern immer wieder drängten, sie zu besuchen und den früheren freundschaftlichen Kontakt fortzusetzen, reisten sie nicht nach Berlin. Erst im Frühjahr 1964 entschloss sich mein Vater, noch einmal dorthin zu fahren, um die alten Freunde zu treffen und einige Habseligkeiten, die meine Mutter in Berlin zurückgelassen hatte, wieder nach Köln zu holen. Da sie ihn um keinen Preis begleiten wollte, fuhren mein Vater und ich ohne sie.
Die Reise war die zweite, die wir ohne meine Mutter unternahmen. Im Jahr zuvor hatte uns eine Sommerreise an die Mosel geführt, wo wir eine lange Wanderung zu Fuß von Koblenz nach Trier unternommen hatten (vgl.: Die Moselreise. München 2010). Diesmal ging es jedoch nicht um eine Wanderung durch eine beliebte deutsche Ferienlandschaft, sondern um eine Wiederbegegnung mit den Menschen und Räumen, die meine Eltern während der Kriegsjahre kennen gelernt und aufgesucht hatten. So wurde die Berlinreise wenige Jahre nach dem Mauerbau zu einer Reise in die Gegenwart des Kalten Krieges und in die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs.
3
Ich selbst wusste als damals zwölfjähriger Bub vom früheren Leben meiner Eltern in Berlin so gut wie nichts. Dass sie vor meiner Geburt vier Söhne verloren hatten, hatte ich erfahren, kannte aber damals die genaueren Umstände dieser Todesfälle nicht. Im Grunde war ich also in diesen Familiendingen sehr ahnungslos, als ich die Reise mit meinem Vater antrat.
Bereits seit mehreren Jahren aber war ich darin geübt, täglich Notizen und Aufzeichnungen über all das zu machen, was mir besonders auffiel und durch den Kopf ging. (Ich hatte mit solchen Notizen im Alter von etwa sieben Jahren begonnen, sie waren zunächst von meinem Vater, dann aber auch von meiner Mutter korrigiert und betreut worden. Im Grunde bildeten sie so etwas wie eine sehr lehrreiche Schule des Schreibens.) Solche kleineren, rasch notierten Texte schrieb ich auch während der Berlinreise. Mit einem großen Fundus dieser meist mit dem Bleistift oder einem Füller gemachten Aufzeichnungen kehrte ich nach Köln zurück. Bis Weihnachten 1964 entstand anhand dieses Materials der hier veröffentlichte Text, den ich damals »ein Reisetagebuch« nannte. In ihm hatte ich die von der Reise mitgebrachten Notizen zu einer Art kleinem Reiseroman ausgearbeitet, der die Erlebnisse in eine erzählerisch ausgeschmückte Form brachte. Er war vor allem ein Geschenk an meinen Vater, der an derartigen Texten (und ihrem besonderen Ton) eine große Freude hatte und sie immer wieder mit Vergnügen las. Ich schenkte ihm dieses Reisetagebuch zu Weihnachten 1964, er las es wohl unzählige Male, und er nahm dann und wann (aber nur, wenn er Lust dazu hatte) einige kleinere orthographische und stilistische Korrekturen am Text vor. Ansonsten ist die hier vorliegende Fassung unverändert und wurde im Nachhinein nicht weiter korrigiert. Der kindliche Ton der Darstellung sollte vielmehr mit all seinen Eigentümlichkeiten, Fehlern und Kuriosa erhalten bleiben.
4
Da mein Vater befürchtete, dass die Lektüre dieses Textes meine Mutter belasten und die Erinnerungen an früher wieder lebendig werden könnten, hat sie dieses Reisetagebuch nie zu lesen bekommen. Es befand sich bis heute im Familien-Archiv meiner Eltern, wo ich es erst vor einiger Zeit wieder entdeckte. Mit wachsendem Erstaunen las ich, was ich damals als Zwölfjähriger in Berlin alles beobachtet und wahrgenommen hatte. Vieles hatte ich längst wieder vergessen, aber schon mit den ersten Lektüremomenten war die Vergangenheit wieder da: hellgraue, leicht dunstige Schwarz-Weiß-Umgebungen endloser Straßen, dunkler Züge und toter Bahnhöfe, wo der Bub, der ich gewesen war, gegen einen mit den Tagen immer stärker werdenden Schrecken angekämpft hatte.
Bis heute habe ich diesen Berlin-Schrecken nicht verloren, noch bei jedem Aufenthalt regt er sich zumindest für kurze Augenblicke wieder. Es sind jene Momente, in denen ich panisch nach der nächsten Möglichkeit fahnde, die Stadt mit Flugzeug, Bahn oder Auto sofort wieder zu verlassen. Ohne jeden Erfolg habe ich auch immer wieder versucht, in Berlin einmal für längere Zeit zu leben und die Stadt unter den stark veränderten heutigen Bedingungen besser und anders kennen zu lernen. Es ist mir bis jetzt nicht gelungen.
Köln, Wissen/Sieg, im Januar 2014
Die Berlinreise
Ein Reisetagebuch im Frühjahr 1964
Für Papa – zu Weihnachten 1964 – von seinem Bub
30. April 1964
Im Bahnhof, nachts
Die Einfahrt des Zuges nach Leipzig, mit Kurswagen nach Berlin
Die leeren Abteile des Kurswagens
Die allein reisenden Männer mit sehr viel Gepäck
Die Abfahrt nach Berlin mit über 15 Minuten Verspätung
Mit Papa in einem sonst leeren Abteil
Ich: Was machen wir jetzt?
Papa: Schlafen, so schnell wie möglich.
Ich: Wann kommen wir in Berlin an?
Papa: Morgen früh, gegen 7 Uhr.
Ich: Ich kann noch nicht schlafen.
Papa: Dann lies doch etwas.
Ich: Ich habe Winnetou III dabei, das könnte ich lesen.
Papa: Ja, lies Winnetou III.
Ich: Soll ich gleich loslegen?
Papa: Du kannst auch erst mal durch den Zug laufen und dir alles genauer anschauen. Lauf nur, ich bleibe hier beim Gepäck.
Zum ersten Mal bin ich eine ganze Nacht lang mit einem Zug unterwegs. Ich habe unser Abteil verlassen und bin langsam von Wagen zu Wagen gegangen. Unser Kurswagen war nicht stark besetzt, aber die anderen Wagen waren sehr voll. In vielen Abteilen war gar kein Platz mehr, so dass die Menschen auch draußen, auf den Gängen, standen. Kurz nach der Abfahrt war es sehr laut, viele sprachen aufgeregt miteinander oder hantierten noch an ihrem Gepäck, und es gab auch Menschen, die gleich nach der Abfahrt zu trinken oder zu essen begannen. Einige hatten dicke, aufgequollene Taschen mit vielen Flaschen und Esssachen dabei, und die besonders gut gelaunten fingen auch an, etwas davon an die anderen Fahrgäste zu verteilen.
Ein älterer Mann, der besonders laut sprach, fragte mich, ob ich eine Stulle wolle. Ich antwortete, dass ich nicht wisse, was das sei. Da lachte er laut und rief den anderen, die in seiner Nähe standen, zu, ich wisse nicht, was eine Stulle sei. Ich musste mitlachen, weil er so fröhlich war, da zeigte er mir eine Stulle. Er holte sie aus seiner Tasche, wickelte sie aus hellem Butterbrotpapier und hielt sie mir hin. Sie bestand aus zwei halben Schwarzbrotscheiben, zwischen denen sich viel roher Schinken befand. Er hing an den Seiten der Brotscheiben heraus und pendelte in der Luft herum. »Das ist eine Stulle, mein Junge«, sagte der Mann, »oder wie würdest Du dazu sagen?« Ich sagte, dass ich die Stulle ein Pausenbrot nennen würde. Da lachte der Mann noch lauter und rief den anderen wieder zu, in Köln nenne man eine Stulle ganz vornehm ein Pausenbrot, in Berlin aber nenne man es richtiger eine Stulle. Dann drückte er mir die Stulle mit dem Butterbrotpapier in die Hand und sagte, dass er ein Berliner sei und dass ich von ihm Berlinerisch lernen könne. Ich antwortete, dass ich vielleicht später wieder zu ihm kommen werde, um noch mehr Berlinerisch von ihm zu lernen. Danach ging ich weiter durch die vielen Wagen. Ich hatte vorgehabt, sie zu zählen, aber ich kam immer wieder durcheinander, außerdem achtete ich wohl zu sehr auf die Stulle in meiner Hand, denn ich dachte laufend darüber nach, was ich mit ihr anfangen sollte, essen wollte ich sie nämlich auf gar keinen Fall.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!