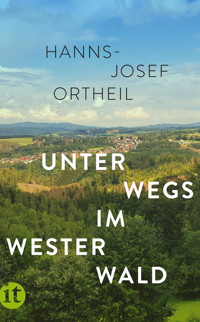Inhaltsverzeichnis
DER ERSTE TAG - Wieder ein Glück ist erlebt … (Stutgard, von Friedrich Hölderlin)
ERSTER GANG - Das Tagebuch der Lektüren
Bücher-Menu 1
Copyright
DER ERSTE TAG
Wieder ein Glück ist erlebt … (Stutgard, von Friedrich Hölderlin)
ERSTER GANG
Das Tagebuch der Lektüren
Stuttgart. Ein großes, hoch gelegenes Gartengelände mit Blick auf die Stadt, frühmorgens, ein sonniger Tag. Zwei bequeme Stühle und ein kleiner, kreisrunder Tisch auf einer Terrasse, Kaffee, Tafelwasser, Bücher, Papier, einige Stifte: Der Versuch eines entspannten Beginns.
Die Besucherin: Was für ein schönes Gelände! Seit wann leben Sie hier?
Ortheil: Seit siebenundzwanzig Jahren, ja, vor genau siebenundzwanzig Jahren habe ich dieses Gelände während eines Spaziergangs entdeckt. Damals war ich gerade zusammen mit meiner Frau nach Stuttgart gezogen, sie übernahm hier eine Stelle in einem Verlag. Ich kannte Stuttgart zu dieser Zeit noch kaum, deshalb war ich damals ununterbrochen zu Fuß unterwegs, um die Stadt und ihre Umgebung genauer kennenzulernen.
Und dann kam ich irgendwann während eines Spaziergangs an diesem Gelände vorbei und schaute herunter auf die Dächer der Stadt, es war ein Moment, den ich nie vergessen werde, ein Moment, wie es ihn sonst nur gibt, wenn man sich plötzlich, auf den ersten Blick, in jemanden verliebt. Ich stand still und starrte ins Tal. Ohne es zu ahnen, war ich auf ein Urbild meiner Vorstellungen von Landschaft gestoßen, auf älteste Zeichen, ältestes Bildinventar.
Was meinen Sie mit »Urbild«, meinen Sie, dass Sie dieses Bild bereits kannten, dass es Ihnen vertraut war?
Ja, es war etwas sehr Vertrautes in diesem Bild, und dieses Vertraute hatte mit meiner Kindheit zu tun. Die Räume, in denen wir als Kinder aufwachsen, prägen unsere Wahrnehmung ja besonders stark, die Innenräume der Wohnungen und Behausungen sowieso, aber natürlich auch die Außenräume, die Räume also, in denen wir als Kinder immer wieder gespielt und uns aufgehalten haben. Man sollte Biographien einmal von solchen Raumerfahrungen her entwerfen und Menschen präzise daraufhin befragen, wie ihre Kindheitsräume aussahen, das würde unsere beinahe ausschließliche Fixierung auf Zeit-Erfahrungen erschüttern. In den Kindheitsräumen haben wir oft viele Jahre verbracht, Tag für Tag, wir waren an ihre Atmosphären und Strukturen ebenso stark gebunden wie an bestimmte Menschen, mit denen zusammen wir groß wurden, das sollte uns doch zu denken geben.
In meinem Fall war einer dieser prägenden Kindheitsräume ein großes, ebenfalls auf einer Anhöhe gelegenes Waldgrundstück im Westerwald, auf dessen Erhebung sich meine Eltern in den fünfziger Jahren ein kleines Haus gebaut hatten. In diesem Haus und in seiner unmittelbaren Umgebung habe ich viel Zeit meiner Kindheit verbracht, zum einen bin ich in der Großstadt aufgewachsen, zum anderen aber auf dem Land, auf diesem Westerwald-Grundstück mit dem Blick in die Weite der Landschaft.
Dieses Westerwald-Grundstück war ein Hanggrundstück, wie dieses hier in Stuttgart?
Ja, sonderbar, nicht wahr? Das Westerwald-Grundstück war und ist ein Hanggrundstück mit vielen kleinen Plateaus und Aussichtsterrassen, von denen aus man einen immer neuen, anderen Blick auf die Landschaft hat. Die Plateaus und Terrassen waren eigens für solche Ausblicke angelegt worden, auf einigen standen kleinere Behausungen wie etwa ein Pavillon oder eine Blockhütte. Das führte dazu, dass wir uns nicht nur im Haus aufhielten, sondern zu den verschiedensten Gelegenheiten auch außerhalb, entweder im Freien oder in diesen Mini-Behausungen, die übrigens besonders auf ein Kind eine enorme Anziehungskraft ausübten.
Die Mini-Behausungen erlaubten eine kurzfristige Entfernung von den Eltern, es waren Räume, die das Kind für sich allein hatte, die es also selbst einrichten und oft allein benutzen durfte. Diese besonders intimen Räume, in denen ich nicht gestört wurde und in denen ich in Ruhe gelassen wurde, waren zunächst Räume zum Spielen und wurden mit der Zeit dann zu Lese- und fast gleichzeitig auch zu Schreibräumen.
Mini-Behausungen nennen Sie diese Räume, das heißt also, es waren sehr kleine, aber doch separate, geschlossene Räume?
Ja, es waren sehr kleine, meist geschlossene Räume, die es zum Teil heute noch gibt und deren frühere Einrichtung ich noch genau in Erinnerung habe. Aus dieser Zeit habe ich eine besondere Anhänglichkeit an kleine Räume behalten, ich fühle mich in solchen Räumen oft wohler als in weitläufigen Wohnräumen, wie sie in der Zeit der Bungalow-Bauten überall entstanden. Da wurden dann ja plötzlich große Zimmer mit kühlen Inneneinrichtungen modern, und es gab riesige Glasfenster, hier und da ein Möbel und dazwischen weite Wege von einem Gegenstand zum andern.
In den kleinen Räumen aber konnte man das, was ich die »Lesekapsel« nennen möchte, viel besser erfinden. Die »Lesekapsel« - das ist der eigentliche Leseraum, in den sich der Lesende zurückzieht: Der Körper nimmt eine Lesehaltung oder eine Lesestellung ein, das Buch wird mit der Hand gehalten oder auf eine Unterlage gelegt, und dann gehört meist noch ein bestimmtes Möbel dazu, das den Rückzug unterstreicht und ihm eine gewisse Bequemlichkeit verleiht. Vor Jahren habe ich in einer Ausstellung über Die Kunst des Lesens viele Abbildungen solcher Lesemöbel gesehen. Die mittelalterlichen zeigen zum Beispiel immer wieder den heiligen Hieronymus im Gehäus, wie er sich in irgendeinen Winkel eines kleinen Raums auf einen einfachen Sitz zurückgezogen hat. Das Buch, das er studiert, liegt oft auf einem Lesepult, und meist liegt daneben ein Stift mit Feder, für das rasche, unmittelbare Notieren und Exzerpieren.
Das »Gehäus« ist die Urform dessen, was ich die »Lesekapsel« nenne, in späteren Jahrhunderten wird sie dann immer bequemer, bis hin zu besonderen Lese- und Ruhesesseln mit einer Fußstütze und einem an der Seite angebrachten, schwenkbaren Lesepult. Das Lesen wurde mit der Zeit also entspannter und nahm immer mehr Atmosphären auf, es wurde zu einem »Schweben im Raum« …
Das heißt also, Sie verbinden Lesen und Schreiben mit bestimmten Räumen, das Lesen und das Schreiben werden besonders durch Raumerfahrungen bestimmt und geprägt …
Durch Raumerfahrungen, die ja immer auch atmosphärische Erfahrungen sind. Instinktiv habe ich als Kind wohl auf solche Atmosphären reagiert, denn ich habe bestimmte Bücher nur in bestimmten Räumen gelesen. Das Lesen war für mich also nicht immer ein und dieselbe Tätigkeit, sondern hatte viele, sehr unterschiedliche Formen. Damals, in der Kindheit, war mir das natürlich noch nicht bewusst, heute aber weiß ich aus der Erfahrung von vielen Jahrzehnten, dass ich mein Leben lang solchen Instinkten gefolgt bin.
Ich habe ein sehr eigentümliches, nuanciertes Lese-Verhalten entwickelt, das mit den Räumen und Atmosphären zu tun hat, in denen es sich jeweils ereignet. Hier, auf dem Stuttgarter Grundstück, sind daher auch eigene, sehr unterschiedliche Räume für das Lesen und Schreiben entstanden, ich könnte sie Ihnen nacheinander zeigen, und wir könnten anhand dieser sehr unterschiedlichen Räume über die unterschiedlichen Formen des Lesens sprechen.
Das hört sich verlockend an, ja, das sollten wir unbedingt tun. Aber erzählen Sie mir vorher doch, wie Sie dieses Grundstück in Besitz genommen haben. Sie waren zunächst ja nicht mehr als ein Spaziergänger, der dieses Grundstück von einem Spazierweg aus betrachtete …
Ich möchte es etwas anders beschreiben: Ich war ein junger Schriftsteller von etwas mehr als dreißig Jahren, der schon einige Bücher veröffentlicht hatte und wusste, dass er in seinem Leben nichts anderes mehr tun würde als schreiben. Dieser junge Schriftsteller suchte nach »seinem Ort«, »seinem Platz«, und das heißt: Er suchte nach dem Ort und dem Platz für ein dauerhaftes Schreiben und Lesen.
Ich glaube, dass sich eine solche Suche im Falle von Schriftstellerinnen und Schriftstellern anders vollzieht als bei den meisten anderen Menschen. Als Schriftsteller sucht man nicht in erster Linie nach einer Drei-Zimmer-Altbau-Wohnung mit Balkon, sondern eben nach Räumen für das Schreiben und Lesen und damit nach Räumen, die wie dafür geschaffen sind, dass sich in ihnen etwas derartig Substantielles wie Schreiben und Lesen über einen längeren Zeitraum ereignet. Das kann eine Drei-Zimmer-Altbau-Wohnung mit Balkon sein, dann ist es aber eine Drei-Zimmer-Altbauwohnung, die auf das Schreiben und Lesen hin angelegt ist.
Man kann beobachten, dass sich Schriftsteller in einem bestimmten Alter sehr bewusst irgendwo »niederlassen«, nicht nur in einer bestimmten Wohnung oder einem bestimmten Haus, sondern auch an einem »Ort«, in einer Umgebung. Ein sehr bekanntes und schönes Beispiel ist das Weimarer Gartenhaus Goethes, das er ja direkt nach seiner Übersiedlung nach Weimar bezogen hat. Goethe war damals sechsundzwanzig Jahre alt, er hatte bereits den Werther und all die großen Gedichte geschrieben, die wir mit seinen Jugendjahren in Frankfurt, Leipzig und Straßburg verbinden.
In das Weimarer Gartenhaus einzuziehen, war für ihn eine sehr bewusste Entscheidung: Sich an einem ganz bestimmten Ort für längere Zeit niederzulassen, zur Ruhe zu kommen, einen bestimmten Raum ganz und gar zu bewohnen und ihn auf das Schreiben und Lesen hin auszurichten. Im Grunde hat Goethe sein frühes Weimarer Schreiben und Dichten um dieses Haus und seinen Garten gruppiert, Haus und Garten sind das Fundament für alles, was dann seit 1775 entstand, man kann das bis in die kleinsten Nuancen verfolgen, zum Beispiel auch daran, dass er plötzlich beginnt, ein Tagebuch zu führen. Im Tagebuch notiert er die von Tag zu Tag fortschreitende und sich fortsetzende Inbesitznahme eines Raums, »Im Garten« schreibt er immer wieder, und dann listet er all das auf, was er in Haus und Garten getan hat …
Sie glauben also, dass viele Dichter und Schriftsteller zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens eine besonders intensive Beziehung zu einem bestimmten Raum eingehen?
Der amerikanische Lyriker Gary Snyder hat in einem Gespräch mit dem übrigens wunderbaren und bei uns viel zu unbekannten amerikanischen Essayisten Eliot Weinberger einmal versucht, diesen besonderen Raum begrifflich einzukreisen. Snyder hat davon erzählt, dass seine Gedichte ab einem gewissen Alter etwas von seiner Haltung, an einem bestimmten Platz zu leben, reflektieren, und zwar an einem Platz oder an einem Fleckchen Erde, zu dem er immer wieder zurückkehrt. Wie könnte man diesen Vorgang nennen?, fragt Snyder sich.
Snyder spricht dann von »Verortung«, das gefällt mir, und er spricht vom »Fleckchen Erde«, das gefällt mir auch. Ich habe selbst genau diese Beobachtung gemacht: Dass mein Schreiben ab einem gewissen Alter sehr eng mit dem »Fleckchen Erde« zu tun hat, auf dem ich mich niedergelassen habe und zu dem ich immer wieder zurückkehre. Das alles ist recht geheimnisvoll, im Grunde müsste man sehr genau und minuziös erforschen, was da geschieht, wenn sich die Dichter verorten. Das hat etwas Großes, Mythisches, und es sind da Kräfte und Energien am Werk, die bis zu den frühsten Anfängen der Magien des Dichtens zurückreichen.
Dann erzählen Sie doch bitte noch etwas konkreter von dieser Verortung. Sie erwähnten ja schon, dass Sie damals etwas über dreißig Jahre alt waren und dass Sie eines Tages eher zufällig an dem Ort standen, an dem Sie jetzt leben …
Ja, ich sagte, dass ich von einem Moment auf den andern genau wusste, dass ich hier leben wollte, genau hier, auf diesem »Fleckchen Erde«, wie Gary Snyder es genannt hat. Es gab auf diesem Fleckchen Erde ein kleines Haus aus roten Ziegelsteinen, das sehr versteckt in einer grünen Wildnis aus wild wachsenden Brombeeren, Ahorn und Robinien lag, dieses winzige Haus war zunächst mein Fixpunkt. Ich stellte Erkundigungen darüber an, ob dieses einsam und anscheinend unbewohnt daliegende Haus mitsamt dem umgebenden Gartengrundstück zu kaufen war. Und ich bekam bald heraus, dass der Besitzer von Grundstück und Haus gerade damals einen Käufer suchte.
So wunderbar und märchenhaft das klingt: Der Besitzer des Geländes suchte wirklich einen Käufer, er hatte die Anzeige, die er in der Zeitung aufgeben wollte, sogar gerade zu dem Zeitpunkt formuliert, an dem ich auf ihn zukam. Meine Liebe wurde also erwidert, das »Fleckchen Erde« nahm uns auf. Und von da an haben wir es bewohnbar gemacht, Stück für Stück, es war eine jahrzehntelange Verortungsarbeit, wenn man es so nennen darf, und meine Frau und ich - wir sind darüber zu Bewohnern dieses großen Geländes mit all seinen Schauplätzen des Lebens, Schreibens und Lesens geworden.
Dieser Raum wurde also mit der Zeit zu einem weiten Schreib- und Leseraum …
Ja, und zu einem Raum des nicht abreißenden, unendlichen Gesprächs über Bücher, zunächst natürlich zwischen meiner Frau und mir, dann zwischen uns und den Kindern, und immer wieder zwischen uns allen und den vielen Gästen, die uns besuchen. Manche dieser Gespräche habe ich sogar notiert, dieser Gartenraum spielt in ihnen eine große Rolle.
Können Sie aus diesen Notaten einige Passagen vorlesen?
Einen Moment... (Ortheil verschwindet im Haus und kommt nach einer Weile mit einigen Kladden zurück. Er setzt sich wieder und blättert darin …) Ich mag jetzt nicht lange suchen, ich lese Ihnen einfach das Erstbeste vor. Hier zum Beispiel, am Montag, dem 7. Juli 2003, da gibt es eine längere Eintragung über das Lesen und das Gespräch, das dieses Lesen umgibt:
Montag, den 7. Juli 2003. Las in Alkor, Walter Kempowskis Tagebuch des Jahres 1989, und beneidete ihn um die vielen Tage, die er in diesem Jahr zu Hause in Nartum erleben durfte. In Ruhe frühstücken, die Katzen hinter dem Ohr kraulen, viel arbeiten, sich mit Frau Hildegard unterhalten, Lektüren nach Lust und Laune, in der Nacht zum soundsovielten Mal Frenzy von Hitchcock, Klavier spielen, Streichquartette hören …, ich gäbe etwas darum, so die Tage verbringen zu dürfen, ohne laufend verreisen zu müssen.
Am meisten gefallen mir Aufzeichnungen von Tagen, an denen fast nichts geschieht, ein Gang ums Haus, ein junger Igel im Gras, Tee am Nachmittag, und im Radio »eine sonderbar akademische Sache von Schumann, für vier Hörner«. Man wird ganz ruhig bei dieser Lektüre und freut sich über die alle paar Seiten auftauchenden kleinen Spitzen: »Dass Streichquartette eine deutsche Angelegenheit sind, kapiert man sofort.«
Las I. in der Küche, während sie das Abendessen vorbereitete, einige Seiten daraus vor, fragte sie, ob wir die bevorstehende Woche nicht mit einer Flasche Prosecco einleiten sollten, sie zögerte einen Moment, stimmte dann aber zu. Holte die Flasche aus dem Keller und schenkte ein, während ich weiter in Kempowskis Tagebuch las, ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen, so sehr hatte ich mich festgelesen. Überlegte, ob mir selbst etwas ähnlich Tagebuchartiges, jetzt zu unserem Prosecco-Trinken zum Beispiel, einfallen würde, kam aber nicht weiter als bis zu einem dümmlichen »Am frühen Abend Prosecco getrunken, Kempowski-Lektüre«.
Legte Alkor nach dem zweiten Glas zur Seite und ging leicht irritiert und wohl auch etwas über mich selbst verärgert hinüber ins Arbeitszimmer. Schlug die neue Albrecht-Dürer-Biographie in der Reihe rowohlts- monographien auf und suchte mit beinahe herrischer Lese-Raffgier nach ein paar interessanten, leuchtenden Stellen. Blieb bei der Schilderung von Dürers Arbeitstechniken hängen, angeblich arbeitete er bei besonders schwierigen Zeichnungen nach der Natur mit dem Silberstift, sonst aber mit der Feder in allen nur erdenklichen Formen des Zuschnitts von spitz bis breit.
Schaute mir dann vor allem seine Selbstporträts an, mehrmals zeichnete er sich seitlich, von Bild zu Bild erfassen seine Augen immer mehr den Betrachter, sie spüren ihn auf und wollen ihn packen, bis er sich endlich entschließt, ihm frontal zu begegnen. Studierte dann auch die Blicke der vier Apostel auf den großen, sich in München befindenden Tafeln und starrte eine Weile auf den weißen Mantel des Paulus, bis ich las: »Nie wurde je wieder ein solcher Mantel gemalt. Wie aus Metall verhüllt er den Träger und steht mit säulenartigen Kanneluren auf dem Boden, während die große Form seiner Eintiefung das lauschende menschliche Ohr riesig reflektiert.«
Nickte und starrte weiter auf das Mantelgebilde, ging dann aber wieder in die Küche hinüber und sagte zu I.: »Nie wieder hat ein Maler einen solchen Mantel gemalt wie Dürer den weißen Mantel des Apostels Paulus.« I. schaute mich von der Seite her an und stellte die Flasche Prosecco aus meiner Reichweite. Setzte mich stumm wieder hin und dachte an Kempowski und Dürer und daran, dass Woody Allen es meisterhaft verstanden hätte, meine Tagebuch-Sprachnot zu karikieren: »Idee für eine Geschichte: Ein paar Biber übernehmen die Carnegie Hall und führen Wozzeck auf. (Heißes Thema. Wie werde ich es gliedern?)«
Hatte in den letzten Tagen immer wieder in Allens Alles von Allen gelesen und war nach jeder Lektüre unbrauchbar für jede andere, ernsthafte Lektüre gewesen. Musste auch jetzt, bei der bloßen Erinnerung an einige Stellen, lauthals lachen, was I. dazu veranlasste, die Flasche Prosecco rasch wieder in den Kühlschrank zu stellen.
War über das Missverständnis derart erbost, dass ich in den Garten ging, um mit Hilfe einiger Lektionen östlicher Lebensweisheit wieder zur vollkommenen Ruhe des kontemplativen Weisen zurückzufinden. Erinnerte mich an den Meister Zhuangzi, der neben Konfuzius und Laotse zu den drei großen klassischen chinesischen Weisen gehörte und die subtilen Lektionen des »Unbekümmerten Wanderns« beherrschte. Versuchte also, unbekümmert durch den Garten zu wandern, und hörte auf die Worte des Weisen: »Meister Lie konnte auf dem Wind reiten, wohin er wollte; auf wunderbare Weise trieb er dahin und kehrte erst nach fünfzehn Tagen zurück. Doch auch wenn er nicht daran hing, Segnungen nachzujagen, und deshalb nicht zu Fuß gehen musste, gab es doch noch etwas, worauf er sich stützen musste.«
Wanderte noch etwa fünf Minuten bekümmert durch den Garten und ging dann geläutert zu I. in die Küche, um ihr weiter aus Alkor vorzulesen …
Möchten Sie noch ein anderes Notat hören?
Unbedingt...
Also gut:
Seit über zwanzig Jahren hatte ich die Hemingway-Droge nicht mehr eingenommen, ich galt als Hemingway-clean und dem stärksten literarischen Lese-Mittel meiner Jugend entwöhnt. Doch dann kam diese Taschenbuch-Sendung des Rowohlt-Verlages mit Büchern von lauter amerikanischen Erzählern, und ganz obenauf lagen die frischen vierhundertfünfzig Seiten Hemingway, die sein Sohn Patrick aus dem Nachlass herausgegeben hat.
Ich riskier’s, dachte ich, die Texte aus dem Nachlass sind bekanntlich schwächer als die zu Lebzeiten erschienenen, und so nahm ich bei brütender Hitze im Liegestuhl Platz, um noch einmal Hemingway zu lesen. In Die Wahrheit im Morgenlicht beschreibt er eine afrikanische Safari, die ihn 1953 zusammen mit seiner vierten Frau Mary nach Kenia führte, er hat die Erlebnisse in seine altbekannte Erzähldramaturgie gepackt, so dass man schon bald einen seiner Romane zu lesen glaubt.
Ich las und las und die Stunden vergingen, und ich lernte, dass man Elefanten mit dem ersten Schuss in den zweiten Ring des Stoßzahns treffen sollte, besser noch zielte man aber auf die siebte Nasenfalte, von der ersten Stirnfalte an nach unten gezählt. »Vielen Dank«, sagte ich bei jeder Belehrung, und dann holte ich mir einen GinTonic und begann, den GinTonic in kleinen, guten Schlucken während der Lektüre zu trinken. Die Sonne über mir war schon bald die afrikanische Sonne, und ich wurde ein guter Freund des weißen Jägers, und dann und wann kam Mary vorbei und brachte etwas zu trinken.
Am frühen Abend erschien I. im Garten, und als sie erkannte, was ich da im Liegestuhl las, sagte sie nur: »O mein Gott!« - »Fein, dass du da bist«, antwortete ich, »zieh dich rasch um, und mach uns was zu trinken, wir könnten einen wunderbaren Abend zusammen haben.« - »O mein Gott«, wiederholte sie aber nur und ging schnell ins Haus, und ich wartete darauf, dass sie in ihrer weißen Bluse und den frisch gebügelten, ausgebleichten Khakihosen mit etwas Campari oder Gin wieder erscheinen würde. Wir würden den Campari oder den Gin in große Gläser gießen, und dann würden wir anstoßen, und ich würde ihr sagen, wie phantastisch sie sei und dass sie sich vor den Löwen nicht zu fürchten brauchte, denn die Löwen kämen des Nachts nie in ein bewohntes Zelt, sondern höchstens in Zeltnähe.
I. erschien dann wieder mit einer Flasche Hirschquelle, und sie hatte ihr rotes Kleid einfach anbehalten, und ich sagte ihr, dass sie auch in dem roten Kleid unglaublich frisch aussehe und Hirschquelle wirklich ein phantastisches Mineralwasser sei, mit dem man sich einen feinen Abend machen könne. »Bitte«, sagte I., »rede doch wieder normal«, und dann schaute sie mich an wie einen Kranken und goss das Mineralwasser in kleine Gläser, und dann stießen wir an, und es sah aus, als tränken wir Wasser mit sprudelndem Aspirin, zur Genesung.
Da ging mir auf, dass ich vielleicht schon zu lange Hemingway gelesen hatte und nicht mehr von ihm fortkommen würde, wenn ich nicht sofort etwas dagegen tun würde, und so nahm ich rasch die Bücher der anderen amerikanischen Erzähler hervor.
Flying Home von Ralph Ellison enthält lauter gute Erzählungen, und ich begann mit In einem fremden Land. In dieser Geschichte saßen gleich zu Beginn zwei Männer in einem Pub und unterhielten sich so feierlich und nostalgisch, wie sich die Männer immer in Hemingways Büchern unterhalten, und so legte ich Ellisons Geschichten schnell weg und schlug die wunderbaren Erzählungen von Tobias Wolff auf.
In Zwei Jungen und ein Mädchen sah einer der Jungen das Mädchen auf einer Party in einem Liegestuhl, und dann ging die Geschichte so los, wie sie auch bei Hemingway losgegangen wäre, und so trennte ich mich auch von diesem Buch wieder, weil die Hemingway-Dramaturgie zusammen mit einem Liegestuhl jetzt bestimmt nicht das Richtige für mich war.
»Verdammt«, sagte ich zu I. und biss mir auf die Lippen, »es ist gar nicht einfach, ihn loszuwerden.« - »Ich weiß, Liebster«, antwortete I. und goss mir noch ein Glas Hirschquelle ein, und dann kramte sie aus dem Haufen all der Taschenbücher, die sich auf dem Gartentisch stapelten, ein schmales, blaues Bändchen hervor. Ich ahnte gleich, dass sie das Richtige gefunden hatte, etwas, das meinen Hemingway-Rausch mit einem Schlag abtöten und mich zur Vernunft bringen würde, und so schloss ich die Augen, trank das Mineralwasser wie ein Genesender in kleinen Schlucken und hörte I. lesen.
Es war das Beste für meinen Zustand, denn es war Wird alles gut?, eine Rede von Johannes Rau, und ich sagte mir, Johannes Rau wirkt selbst in den schlimmsten Fällen, er ist einfach phantastisch, so knochentrocken, nüchtern und unsentimental, einfach phantastisch, und schon nach zwei Minuten war es so weit, und ich träumte von Elefanten und Löwen, während im Hintergrund eine Stimme eindringlich fragte: »Wie gehen wir mit der Natur um?«
Auf Ihre Hemingway-Lektüren kommen Sie immer wieder zurück, und an vielen Stellen gehen Sie damit, dass Sie Hemingway derart ausgeliefert waren, ironisch um …
Ja, dann versuche ich, ihn mir mit Hilfe der Ironie etwas vom Leibe zu halten. Aber es gibt auch sehr ernste Texte über dieses Ausgeliefertsein, wie Sie es nennen. Hier zum Beispiel …, das ist ein ernster Text der Verehrung, den ich geschrieben habe, als mir zufällig eine Taschenbuchausgabe seines Romans Über den Fluss und in die Wälder wieder in die Finger geriet.
Dann lesen Sie doch bitte …
Heute stieß ich zufällig wieder auf Hemingways Roman Über den Fluss und in die Wälder, und als ich die alte, vergilbte Taschenbuchausgabe aufschlug, entdeckte ich anhand einer Eintragung ganz vorne, dass ich sie mir bereits als Fünfzehnjähriger während einer Türkei-Reise gekauft hatte.
Der Roman erschien 1950, als Hemingway etwas über fünfzig Jahre alt war, er hat eine Vor- und eine Nachgeschichte. Die Vorgeschichte hat mit Hemingways damaligen Schreibproblemen zu tun, über ein Jahrzehnt hatte er keinen großen Roman mehr veröffentlicht. 1948 war er deshalb, um sich zu regenerieren und auf gute Gedanken zu kommen, mit seiner vierten Frau nach Venedig gereist, er wollte dort den Herbst und den Winter verbringen.
Sie wohnten an einem der Lieblingsplätze Hemingways inmitten der venezianischen Lagune im einsamen Torcello, in der Locanda Cipriani waren sie die einzigen Gäste, Hemingway ging auf Entenjagd, an den Abenden legte man große Buchenscheite ins offene Kaminfeuer, es müssen glückliche Monate gewesen sein.
Im Dezember 1948 aber lernte Ernest bei einem Jagdausflug die damals erst neunzehnjährige Adriana Ivancich kennen. Adriana hatte lange schwarze Haare und war eine hinreißende Venezianerin, ihr Vater hatte wenige Jahre zuvor sogar Bürgermeister von Venedig werden wollen, war jedoch von politischen Gegnern ermordet worden. Als übernähme er jetzt die Vater-Rolle, redete Hemingway Adriana mit »Tochter« an, konnte aber damit nicht verbergen, dass er sich in sie verliebt hatte, die unmögliche Liebe muss so heftig gewesen sein, dass seine vierte Frau immer wieder eingreifen und ihn vor Schlimmerem bewahren musste.
Über den Fluss und in die Wälder ist Hemingways Venedig-Roman, es ist seine Huldigung an eine Stadt, die er liebte wie keine andere, und es ist zugleich der Versuch, seine Verbindung mit Adriana Ivancich glücklich zu schreiben. Im Roman heißt sie »Renata«, ist neunzehn Jahre alt und dem etwas über fünfzigjährigen amerikanischen Oberst Richard Cantwell in tiefer Liebe verbunden. Nirgends eine Ehefrau, nirgends ein ermordeter Vater, Renata und Cantwell lieben sich ohne alle Trübungen, nichts trennt sie, ihre Liebe ist so sehr als ein andauernder Gleichklang beschrieben, dass sich die langen Liebes-Dialoge bis zur Blödigkeit hin wiederholen.
Der Roman ist daher vollkommen statisch, beinahe bewegungslos, ohne jede eigentliche Aktion oder Entwicklung, das Paar besucht Harry’s Bar, speist im Gritti, setzt sich in eine Gondel, streift durch Venedig, und allüberall stehen Cantwells alte Haudegen herum, Freunde aus Kriegszeiten und den Zeiten davor, jetzt aber Barbesitzer, Barkeeper oder Kellner. All diese freundlichen und meist gut aufgelegten Männer sind nichts anderes als eine harmonische Kulisse, sie schenken den richtig gekühlten Martini ein, besorgen den richtigen Gin, rütteln den richtigen Champagner und erstehen auf dem Fischmarkt einen garantiert frischen und daher noch lebendigen Hummer, der dann später ganz hinten in einer Bar und keineswegs im großen Speisesaal serviert wird.
So durchzieht den Roman eine Orgie des nicht abreißenden Genusses, schon kurz nach dem Aufstehen am Morgen nimmt Oberst Cantwell Witterung auf und zieht allein durch die Stadt, ihre Fisch- und Gemüse-Stände, ihre Wurst-, Käseund Brot-Läden inspizierend, ein paar Muscheln werden auf dem Fischmarkt eigens für ihn geöffnet, und er lässt sich ein gebogenes Messer geben und schneidet das Muschelfleisch dann eigenhändig und besser als jeder venezianische Fischverkäufer heraus.
All das muss einem nicht eingeweihten Leser sehr auf die Nerven gehen, und die amerikanische Literaturkritik hat sich an diesem Roman so ausgetobt wie an keinem anderen Hemingway-Roman. Es ist aber der Roman eines Mannes, der sich nach der vollkommenen Stille sehnte, nach purem Dasein, nach nichts anderem als einem ihn erneuernden Leben in einer Stadt, die hier mit so viel Genauigkeit und so viel Liebe zu den unauffälligen Details beschrieben wird wie in keinem anderen der vielen Venedig-Romane. Daher habe ich als junger Leser sogar die penetranten Kriegserzählungen des Obersts überstanden und darüber hinwegphantasiert, dass er mit seinen gerade fünfzig Jahren bereits todkrank, herzkrank natürlich, ist und manchmal schon Mühe genug hat, die vielen venezianischen Brücken schmerzfrei zu nehmen.
Mit Über den Fluss schrieb Hemingway sich zu den starken, sinnlichen Erfahrungen seines großen Frühwerks zurück, mit diesem Roman hatte er sein geheimes Ideal der absoluten Gelassenheit und der atmosphärischen Verdichtungen wiedergefunden. Mich wunderte es daher nie, dass zwei Jahre später sein Meisterwerk Der alte Mann und das Meer erschien, das die Impulse des Venedig-Romans auf noch kleinerem, konzentriertem Raum zusammenführt.
Der alte Mann ist also die Nachgeschichte, und die Locanda Cipriani im (in Herbst- und Winterzeiten) unvergleichlich stillen Torcello gibt es noch heute, und wenn du sie mit einer schwarzhaarigen Venezianerin betrittst, legen die jungen Haudegen noch heute die Buchenscheite ins offene Kaminfeuer und fragen dich, ob du übernachten möchtest, in Hemingways Zimmer, oben, im ersten Stock, mit dem Blick in die Weite der Lagune.
Das ist sehr schön, das gefällt mir sehr. Aber schauen Sie, jetzt bin ich seit etwa anderthalb Stunden bei Ihnen, und wir haben schon über so viele Bücher gesprochen, dass ich mich kaum noch an alle Titel erinnere.
Kein Problem, dann beenden wir jetzt den Ersten Gang dieses Bücher-Menus mit einer Liste all der Titel, die wir erwähnt oder gestreift haben. Ähnelt eine solche Liste nicht einem Koch-Rezept? …: Man nehme und nehme und füge hinzu und nehme noch davon, man lese ein wenig hier und lese dort, man gehe ein wenig hinaus, man lese und komme auf dieses und jenes zurück …, und schon ereignet es sich, das schöne Gespräch …
Bücher-Menu 1
Eva Hanebutt-Benz: Die Kunst des Lesens. Frankfurt/M. 1985; Sigrid Krine: Das häusliche Umfeld Goethes. Frankfurt/M. 2000; Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Band: 1775-1787. Stuttgart/Weimar 1998; Gary Snyder: Feldnotizen zur Dichtung. Ein Interview mit Eliot Weinberger. Aus dem Amerikanischen von Ingrid & Reinhard Harbaum. Göttingen 2003; Eliot Weinberger: Kaskaden. Essays. Aus dem Amerikanischen von Peter Torberg. Frankfurt/M. 2003; Walter Kempowski: Alkor. Tagebuch 1989. München 2003; Johann Konrad Eberlein: Albrecht Dürer. Reinbek 2003; Woody Allen: Alles von Allen. Deutsch von Benjamin Schwarz. Reinbek 2003; Zhuangzi: Auswahl. Einleitung und Anmerkungen von Günter Wohlfart. Übersetzung von Stephan Schuhmacher. Stuttgart 2003; Ernest Hemingway: Die Wahrheit im Morgenlicht. Deutsch von Werner Schmitz.
Ästhetik des Schreibens, Band 3,hrsg. von Hanns-Josef Ortheil
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage Originalausgabe
© 2009 Luchterhand Literaturverlag GmbH, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Druck und Einband: CPI - Clausen & Bosse, Leck
eISBN : 978-3-641-02578-6
www.luchterhand-literaturverlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de