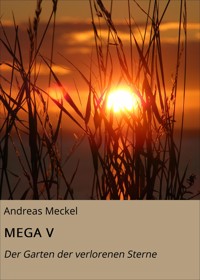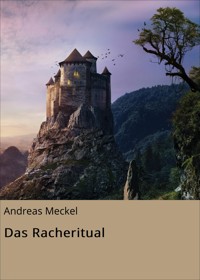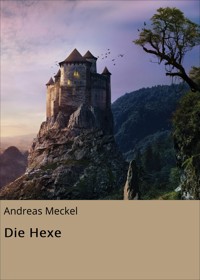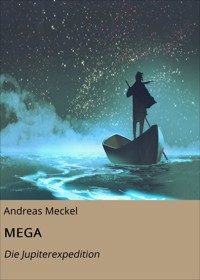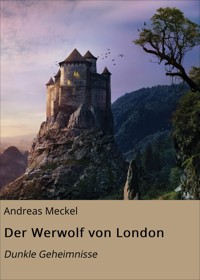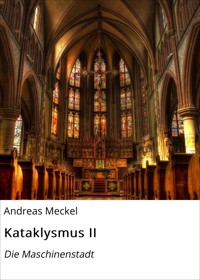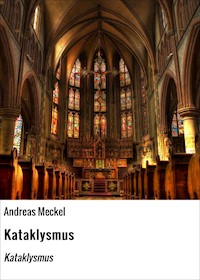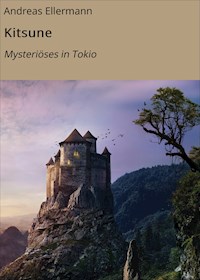14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mysteries
- Sprache: Deutsch
Archäologie, wer mag dieses Feld der Wissenschaft nicht! Durch einen Fund in Takatsuki wird eine Ereigniskette ausgelöst, die unsere Helden auf den Plan ruft. Dabei werden sie mit einem Geheimnis konfrontiert, dessen Wahrheit ihr komplettes Weltbild erschüttert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
1. Prolog
3. Jahr Ninna,
Kanto-Ebene
Kamakura Keniji liebte seinen Beruf. Denn sein Beruf brachte ihn nicht nur stabiles Silber ein, sondern sorgte auch bei einem Ruf bei all denjenigen, die sich auf die dunklen Mächte einließen. Kamakura war kein sonderlich cleverer Mann, aber er war von ganzem Herzen der Krieger, der er war.
Und er war kein normaler Krieger. Eigentlich könnte man solches auch als Söldner bezeichnen, doch Kamakura war kein normaler Söldner. Er führte gleichzeitig ein goldenes, ein silbernes, und ein stählernes Schwert. Letzteres war ein Geschenk seines Lehrmeisters gewesen, der ihn vor über zwanzig Jahren hatte gehen lassen. Das goldene Schwert war ein Beutestück, daß er einem äußerst gefährlichen Dämonen im Kampf abgetrotzt hatte, und das silberne Schwert war das Geschenk eines polnischen Dämonenjägers gewesen, den ein Zeit- und Dimensionsriß für kurze Zeit an die Südküste von Kagoshima verschlagen hatte. Nachdem Kamakura jenem Polen wieder einen Weg in dessen Heimat geschaffen, bekam er von diesem das silberne Schwert. Und jenes erwieß sich als äußerst praktisch jenen dämonischen Kreaturen gegenüber, bei denen sonst nur Bannflüche etwas ausrichteten.
Keniji zog nun schon sehr lange durch die Lande. Inzwischen kannte er Nippon, das Land der aufgehenden Sonne, besser als manch Samurai unter dem sich gerade formierenden Kaiserhaus. Aus dem kleinen Küstendorf Kyoto war inzwischen eine anständige Stadt geworden, die es dennoch immer wieder fertig brachte, einmal in der Dekade abzubrennen. An dieser Stelle würde der Kaiser noch eine Menge zu tun bekommen, wenn er nicht nur sein Reich, sondern auch seine Hauptstadt erhalten wollte.
Kamakura war ein einfacher Mann. Mehr als seine Schwerter und sein treues Kampfpferd besaß er nicht. In seinem Beutel klimperten gerade einmal ein halbes Dutzend Gold- und Silberstücke. Mehr war ihm nicht geblieben, nachdem er vor geschlagenen zwei Monaten mit einem Schiff von Korea hatte herüber kommen müssen.
In Korea war wieder einmal eine Zombieseuche ausgebrochen, und die dortigen Dämonenjäger waren dem Problem nicht allein Herr geworden. Der neue König von Joeson war zwar spendabel gewesen, doch sein verwüstetes Reich warf nicht soviel ab, wie es hätte abwerfen können. Mit einem halbwegs vollen Sack Gold und Silber war er aufgebrochen. Und nun waren ihm nur noch eine Handvoll Münzen verblieben. Es hätte ihn auch schlechter treffen können. Manche japanischen Dämonenjäger hatten es aus diesem Zombiekrieg nicht mehr lebend nach Hause geschafft. Ihre Kadaver hatten auf dem Schlachtfeld noch verbrannt werden müssen. Kamakura hatte in jenen Tagen eine Menge guter Freunde auf immer verloren.
Jetzt war er aber wieder zurück in der Heimat.
Nicht, weil ihn jemand gerufen hätte, sondern weil der Krieg vorbei war, und er unbedingt wieder in Kyoto einige Tage in Begleitung leichter Frauen verbringen wollte. Die Koreanerinnen schmeckten zwar gut, aber im Bett machten sie nur dann etwas her, wenn sie in Stimmung waren. Japanerinnen waren in Kenijis Augen ein wenig leichter für den Spaß auf dem Kopfkissen.
Als er jedoch in Hiroshima an Land ging, erfuhr er von einem einfachen Händler, daß sich wieder Vampire in der Gegend herumtrieben. Vampire waren für einen Dämonenjäger keine sonderlich schwere Arbeit. Das Hauptproblem bestand meist daraus, ihr Versteck ausfindig zu machen und die gesamte Brut dann im Verlauf eines einzigen Tages auszulöschen, ohne das ein Einziger entkommen konnte.
Es waren etwas mehr als zwei Dutzend Vampire gewesen, die er zu Beginn dieser Woche erledigt hatte. Am Ende waren nur noch drei weitere übrig geblieben, die er in den letzten Tagen Stück für Stück zur Strecke gebracht hatte. Aktuell ritt er der Spur desjenigen hinterher, den er für den Ältesten dieser Vampire hielt.
Augenscheinlich ein koreanischer Vampir, denn diese Kreatur sah sich vor, versuchte keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und dennoch ihr Ziel zu erreichen. Der Mann war clever, aber trotz allem ein Monster.
Kamakura war es Leid, diesem Monster einfach hinterher zu traben. Inzwischen war klar, daß sich die dunkle Kreatur in einem Dorf versteckte, welches in den undurchdringlichen Wäldern vor Kyoto lag. Eigentlich kein schlechtes Versteck, hätte der Kaiser nicht begonnen, die Städte Osaka und Kyoto mit einer vernünftigen Schotterstraße auszustatten. Bisher war die Straße nur eine einfache ungrade Sandpiste, die nur gelegentlich durch Bambusstangen verstärkt worden war.
Der Hauptweg führte in ein winziges Dorf, das nur von ein paar Feldern umgeben war, dahinter schloß sich direkt wieder der undurchdringliche Wald an. Besaß der Vampir auch nur halbwegs Verstand, würde er in den Wald flüchten, die Wege meiden und sich das nächste Jahr nur von Wild ernähren.
Das Dorf bestand aus gerade einmal einem Dutzend Häuser. Die Hauptstraße war noch nicht einmal stabilisiert, sondern besaß vom Regen noch Trittlöcher und Senken und erlaubte keine höheren Geschwindigkeiten. Weder mit dem Pferd, noch mit der Kutsche. Diese Dorfstraße war eine wirkliche Zumutung.
Keniji riß sich zusammen und stieg kurz nach dem primitiven Holztor von seinem Pferd ab. Anscheinend waren die kaiserlichen Bauarbeiten noch nicht bis hierher vorgestoßen. Dieses Dorf, sein Nachbardorf und eine winzige Enklave eines noch winzigeren Mönchsordens bildeten hier am Hauptweg so etwas wie Haltepunkte.
Als Dämonenjäger hatte er das Recht sich in der Mönchsenklave einzuladen, doch er verzichtete daraus. Heute nacht würde der Vampir wahrscheinlich wieder auf Jagd gehen. Die Frage war nur, welches der beiden Dörfer er sich aussuchte. Und wenn diese dunkle Kreatur keine halben Sachen machte, würde man die Bevölkerung zumindest eines Dorfes aufgeben müssen.
Kamakura hatte nicht sonderlich viel Lust darauf, es hierauf ankommen zu lassen. Er war nicht umsonst Dämonenjäger geworden. Es war nicht das Geld gewesen, welches ihn gelockt hätte. Oder die Möglichkeit für verlorene Familienmitglieder Rache zu nehmen. Nein, Kamakura tat diesen Beruf weil er einst von einem Schamanen seines Heimatdorfes dazu bestimmt worden war. Seine Reise für seine Ausbildung hatte ihn weit nach Tibet geführt, wo er schließlich von einem der besten und ältesten Dämonenjäger ausgebildet worden war.
In Tibet hatte er auch gelernt, seine eigenen Emotionen zu kontrollieren. Keniji haßte die Dämonen noch nicht einmal, die er tötete. Für ihn war dies ein einfacher Beruf, so wie ein Jäger jagte, oder ein Polizist Verbrecher zur Strecke brachte. Es war ein alttäglicher Beruf, den jeder nachgehen konnte, der es sich zutraute, die gefährliche Ausbildung zu überleben. Keniji hatte genug Grauen gesehen, daß es für mehrere Leben reichte.
Ihn berühte emotional nicht mehr sehr viel. Dafür war er aber umso treffsicherer mit seinen Klingen. Außer den drei Schwertern trug er noch drei geweihte Dolche aus Obsidian bei sich, und vier Shuriken, in die uralte Glypen eingraviert waren, die noch nicht einmal sein Lehrmeister, der fließend das alte Sanskrit sprach, mehr lesen konnte.
Seine Rüstung bestand aus Papier. Sie war federleicht, aber unheimlich stabil. Nicht einmal die Krallen einer Mondbestie konnten Kratzer hinein machen. Diese papierne Lackrüstung war nicht nur unheimlich stabil und fester als Stahl, sondern auf der Innenseite auch mit einem guten Dutzend mächtiger Schutzzauber versehen. Keniji hatte sich angewohnt, jene uralten Zaubersprüche alle drei Monate einmal mit frischer geweihter Tinte nachzufahren. Inzwischen konnte er den Text sogar rezitieren, der auf der Innenseite seiner Rüstung stand. Zu dieser Rüstung, die der eines Kriegsherren nachempfunden war, gehörte auch ein genauso prunkvoller Helm. Jener stammte jedoch aus China und hatte einst einem General gehört, der seine Ehre der Liebe opferte und seitdem lebendig im Grab des Drachenkaisers wachte, damit kein Unbefugter die Anlage je betrat.
Dieser Helm bestand aus Stahl und auf seiner Innenseite befanden sich achtzehn magische chinesische Zeichen, die nicht einmal Keniji richtig interpretieren konnte. Tibetanische Schrift hatte er lesen und schreiben, und sogar ein wenig sprechen, gelernt. Aber dieser uralte Helm, der angeblich bereits weit über eintausend Jahre alt sein sollte, trotzte jedem Versuch ihn zu übersetzen. Ein koreanischer Schamane meinte einst zu ihm, daß der Helm noch in der Schrift der alten Lemurier beschrieben worden war. Einer Zivilisation, die an ihrer eigenen Rachsucht zugrunde ging, und deshalb eine Menge Monster gebar, die bis heute die Menschen peinigten.
Keniji sah sich, als er in das Dorf herein kam, nach einer Gaststätte um. Es gab keine. Das Dorf war schlicht zu klein. Der Schrein in der Mitte des Ortes umfaßte gerade einmal drei umfaßte Säulen und sah irgendwie unfertig aus.
Das nächste Dorf war noch öder. Jenes bestand zwar aus ein paar gemauerten Häusern mehr, aber selbst dort gab es keine Taverne, in die man einkehren konnte. Über dem zweiten Dorf befand sich oben im Felsen eine uralte Quelle, neben die ein weiser Mann einen Brunnen hatte graben lassen, damit das Wasser von dort weiterhin ungestört fließen konnte. Der Hauptweg nach Kyoto führte genau dort vorbei, lief dann ein wenig herab, um einen kleinen See herum, und dahinter bog dann die Straße leicht nach links ein, um sich an genau dieser Stelle zu teilen.
Folgte man der Abzweigung, kam man folgerichtig zu der kleinen Mönchsenklave. Jene bestand aus vielleicht acht gemauerten Häusern, von denen mindestens drei Tempel waren.
Dieses Dorf hier war schon jetzt eine gesicherte Niederlage. Es gab noch nicht einmal ein festes Haus für den ortsansässigen Samurai, der eigentlich für beide Gemeinden verantwortlich zeichnete. Nicht einmal daran war gedacht worden. Also konnte man davon ausgehen, daß es einen solchen Samurai nicht gab.
Keniji näherte sich einem der Häuser. Es gab keine äußere Ummauerung, wie in den reicheren Städten, sondern nur einen gesteckten Zaun aus Bambusresten, der aussah, als würde er jeden Augenblick in sich aus Altersgründen zusammen fallen. Die ältere Frau, die an einer nicht gerade grade wirkenden Terrasse den Besen schwang, grüßte ihn freundlich. Es war mehr als nur ein einfaches Nicken oder eine Verbeugung.
Keniji sah die alte Frau an und fragte: »Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo ein Reisender unterkommen und etwas zu essen bekommen kann?«
Die Frau sah ihn überrascht an.
»Dieses Dorf ist genauso arm wie seine Nachbarn. Ihr hättet in Osaka bleiben sollen, denn die Strecke in die Hauptstadt ist nicht an einem Tag ohne Eskorte zu bewerkstelligen. Es gibt hier kein Haus, wo man euch aufnehmen würde. Dieser Ort hier hat bereits zuviel Grauen gesehen.«
Irritiert hielt Keniji inne.
»Grauen?«
Die alte Frau nickte wieder.
»Im benachbarten Dorf hat vor fünfhundert Jahren ein Kriegsherr sich eine Feste erbaut und grausam gewütet. Schließlich standen die Bauern gegen ihn auf und brachten ihn und seine gesamte Familie um. Seitdem scheint über diesem Tal ein schrecklicher Fluch zu liegen. Und der jetzige Samurai, der sich in der Burg einquartiert hat, oder besser gesagt in deren Überresten, ist um keinen deut besser. Es ist zu bezweifeln, daß er euch das Bleiben gestattet, und ein Bett oder etwas zu Essen werdet ihr dort erst Recht nicht bekommen.«
Kamakura lächelte amüsiert.
Auch das noch. Die alte Feste hatte er vollständig vergessen. Ja, sie war vor Ewigkeiten gebaut worden. Aber nachdem ein Dämonenjäger die Dorfbevölkerung dazu brachte, aufständig gegen ihren Herrn zu werden und dies später sogar gegenüber dem Kaiser in Osaka verständlich machen konnte, war diesen beiden Gemeinden nichts geschehen. Nur hatten beide Dörfer den Aufstand nicht eben schadlos überstanden. Zu viele waren dabei getötet worden.
Aber dies bedeutete, daß er nur oben an der Quelle sein Nachtlager aufschlagen konnte. Jeder andere Platz war schon vergeben. Am See, im Schatten der Ruine, wollte er ungern ein Lager aufschlagen, wenn die Bogenschützen des Samurai auf ihn jederzeit Zielübungen veranstalten konnten. Und zu den Mönchen wollte er auch nicht, denn jene lebten in einem arg zentrierten Orden, der selten nach außen aktiv wurde. Dennoch unterstützen sie mit dem wenigen, was sie selbst hatten, beide Dörfer.
Kamakura führte sein Pferd also den Rest des Weges durch das erste Dorf, ritt dann die zwei Stunden bis er beim zweiten Dorf mit der Burgruine angekommen war, und von dort aus ritt er dann ohne weitere Pause zu der Quelle und dem Brunnen. In der Höhle der Quelle würde er rasten können. Gleichzeitig würde es ihm die Möglichkeit geben, aufzupassen, ob in dieser Nacht der Vampir hier durchkam. Und wenn er es tat, würde er ihn ein für alle Mal erledigen. Am darauffolgenden Morgen würde er dann in Richtung Kyoto weiterreisen und diese elende Jagd endlich hinter sich lassen.
Zumindest solange, bis seine finanziellen Mittel sich wieder vollständig erschöpft hatten. Was bei seinem Lebenswandel nicht sehr lange dauern würde.
Er war uralt. Wie alt genau, wußte er selbst nicht einmal mehr. Seine menschliche Geburt lag schonviel zu lange zurück. Seine Existenz als Vampir dauerte nun schon viele menschliche Leben lang. Wo er genau geboren worden war, wußte er nicht einmal mehr. Nicht einmal, ob dieses Dorf heute noch existierte. Und es interessierte ihn auch nicht sonderlich.
Dies alles lag Jahrhunderte zurück.
Zu viel Zeit, selbst für einen unsterblichen Vamnpir, den es nur nach menschlichem Blut dürstete. Auch wenn der Blutdurst nicht so allmächtig und allgewaltig war, wie es in den Legenden hieß, war er jedoch für die Existenz eines Vampirs entscheidend.
In der Theorie konnten Vampire ewig leben.
Jedoch nur in der Theorie.
Malik bekam einen schlechten Ruf, als er sich das erste Mal Blut von den Lebenden holte. Er war zu ausgehungert gewesen, um seine Gier kontrollieren zu können. Sein Opfer hatte es nicht überlebt.
Also hatte er flüchten müssen.
Da in der Zeit, als er als Vampir wiedergeboren wurden, die Seefahrt noch nicht so weit entwickelt gewesen war, blieb ihm nur die Flucht über den Kontinent. Zuerst von seiner alten Heimat hinunter nach Ägypten. Von dort dann weiter in Richtung Osten. Zuerst durch das, was später Persien wurde, dann in Richtung Samarkand.
Der Glaube, sich in der Handelshauptstadt verstecken zu können, hielt nicht lange an. Malikl hatte dort, wenn es sehr positiv gerechnet wurde, gerade einmal einhundert Jahre ausgehalten, bevor er wieder auffällig wurde und sein Blutdurst erneut eine ganze Menge Leichen hinterließ.
Doch Malik machte noch einen weiteren Fehler in dem er ungewollt weitere Vampire schuf. Seine Opfer verehrten ihn als ihren Gott und richteten ein wahres Massaker an. Nicht, daß er so etwas nicht gewollt hatte. Doch es löste schließlich eine der schlimmsten Jagden aus, die er je erlebt. Malik war stolz darauf, überlebt zu haben. Ob es einer seiner Anhänger geschafft, interessierte ihn nicht weiter.
Sein Weg führte ihn zuerst in das aufblühende China, wo er beinahe ein Opfer der kaiserlichen Häscher geworden wäre. Der Drachenkaiser hatte wirklich geglaubt, mit dem Blut eines Vampirs wirklich selbst die Unsterblichkeit erreichen zu können. Malik war froh, diesem Horror entgangen zu sein.
Schließlich landete er in Korea.
Hier verlebte er ziemlich lange und ruhige Jahrhunderte, bis eines Tages wieder das Mißgeschick geschah und er weitere Vampire schuf. Von seinen ersten Anhängern hatte nur ein Einziger überlebt, jener war aber mit einem Schiff wieder in Richtung Indien abgereist. Ihm war China und die benachbarten Länder zu gefährlich gewesen.
Malik schuf weitere Gefährten. Doch jene achteten seine Regeln nicht, wenn es darum ging, nicht aufzufallen. Und so entsponn sich vor nicht einmal zwanzig Jahren ein grausamer Krieg zwischen den Dämonenjägern und den Vampiren.
Ein Krieg, den die Vampire unmöglich gewinnen konnten.
Die Dämonenjäger jedoch genauso wenig.
Es würde kein ewiges Patt geben, sondern es würde in einer Katastrophe enden.
Malik hatte es vorher gesehen, doch er konnte nichts dagegen unternehmen. Als die Armee der Dämonenjäger in seine Feste einfiel, schlachteten sie alles, was sie an Leben vorfanden, ab. Die Dämonenjäger gingen gründlich vor.
Sehr gründlich.
Malik und eine Handvoll seiner Geschöpfe entkamen durch einen Zufall. Doch die Jagd war eröffnet. In den letzten Monaten hatte Malik seine Begleiter nach und nach sterben sehen. Wie durch ein Wunder entkam er jedes Mal.
Schließlich sah er sich gezwungen ein Schiff in Richtung Nippon zu besteigen. Die meisten Dämonenjäger waren aus Nippon gekommen, wo es ein Sport zu sein schien, Kreaturen aller Art effektiv zu jagen. Wenn er also etwas über seinen Feind lernen wollte, mußte er in dessen Heimat reisen.
Der uralte Vampir bereute diesen Schritt schon nach den ersten Tagen. Nippon war eine Insel. Es gab nicht viele Fluchtmöglichkeiten. Zudem er auch nur wieder über den nördlichen Hafen entkommen konnte, wenn er ihn wieder erreichte.
Doch die Dämonenjäger in Nippon waren aufmerksam.
Die Sache mit dem Ernähren funktionierte relativ gut, solange Malik dafür sorgte, niemals zuviel von einem Opfer zu nehmen. Dabei achtete er tunlichst darauf, den Keim nicht weiter zu geben. Es gelang nicht immer, daß der Keim bei ihm blieb, aber es gelang oft genug, daß er nicht gleich wieder ein ganzes Dutzend Anhänger schuf, die seinen Aufenthaltsort verraten konnten.
Ein sturer Dämonenjäger war ihm von Korea gefolgt und begann systematisch alle abzuschlachten, die er aus Versehen geschaffen hatte. Malik störte dies nicht weiter. Er war nicht auf eine Gefährtin oder einen Gefährten aus. Er wollte nur ein sicheres Versteck, um die nächsten Jahrhunderte zu überleben. Ein Ort, an dem er nicht auffallen würde.
Als er schließlich in dieses wunderbare Tal mit jenen beiden Dörfern am einem Ende, und der großen Brücke am anderem Ende kam, atmete er befreit auf. Dieses Tal war zu idylisch, um sich als Todesfalle zu entpuppen.
Doch die beiden Dörfer hatten diverse Nachteile. Das erste Dorf bildete direkt am Eingang des Hohlwegs, der in das Tal hinein führte, eine unüberwindliche Sperre, sollte man dort jemals eine Feste errichten wollen. Außerdem gab es in ihm kein einziges Gasthaus.
Das zweite Dorf, das nur fünf Meilen weiter dem Weg hinunter folgte, war noch ärmlicher dran. Dort gab es auch kein Gasthaus, dafür aber eine heruntergekommene, Jahrhunderte alte Festung, die in einem bemitleidenswerten Zustand war. Gegenüber von diesem Dorf gab es einen kleinen, dicht bewachsenen Berg, an dessen Rand, genau gegenüber der Straße, sich eine Höhlenquelle befand, vor die man einen Brunnen gegraben hatte. Folgte man der Straße weiter, würde man in die nächstgrößere Stadt kommen.
Entscheidend war jedoch, daß sich unweit der Burg eine Klosteranlage befand. Sie bestand nur aus wenigen Gebäuden und die Mönche dort blieben mehr unter sich. Ihre Felder waren von dem heruntergekommenen Dorf sehr genau zu sehen. Und irgendwie hatte Malik den Eindruck, als ob diese Gegend irgendwann einmal eine Zeit erlebt hatte, in der es ihr besser ergangen war.
Dieses Dorf war nicht einmal weit genug gewachsen, daß man sich gefahrlos hier ernähren konnte. Doch Malik hatte Durst. Er mußte etwas trinken, sonst würde er die nächsten Tagesreisen nicht überstehen. Er erschien als einfacher Wanderer. Nur mit einem Wanderstock bewaffnet und einem einfachen Stoffbündel über dem Rücken.
In dem Bündel befand sich nicht viel.
Quasi alles, was ihm verblieben war. Von einem kleinen Königreich, daß er einmal besessen hatte. Darunter auch genug Gold, um seine bisherige Flucht finanzieren zu können.
Jenseits der Brücke gab es noch ein weiteres Dorf, welches den Talausgang markierte. Dies war ein wenig größer und dort gab es auch so etwas wie ein Gasthaus für Durchreisende. Genau das richtige Versteck für einen uralten Vampir.
Malik interessierte sich nicht dafür, wie der Fluß hieß, den er da passierte. Für ihn stand nur fest, daß er nur noch eine knappe Woche von der nächstgrößeren Stadt entfernt war. Dort würde er erst einmal untertauchen können und seinen Verfolger abhängen.
Als er an dem Brunnen vorbei kam, fiel ihm auf, daß in der kleinen Höhle, in der sich die Quelle befand, eine Menge Bannflüche an die Wände gepinnt waren. Diesen Aberglauben hatte er nie verstehen können, doch die Bannflüche wirkten bei den meisten dunklen Kreaturen.
Von jenen hatte Mailk auch mehr als genug bisher gesehen. Eigentlich wollte er nur noch ein Heim, in dem er vor sich hin leben konnte. Eine stabile Nahrungsversorgung, und keinerlei Aufregung mehr.
Die Straßen könnten besser sein.
Aber für seine Zwecke reichten sie gerade so aus. Und solange er mit einem festen Schritt lief, mußte er nichts befürchten. In wenigen Stunden ging die Sonne unter. Wenn er bis dahin die Brücke passiert, würde ihm nicht mehr viel passieren können. Dann würde der Dämonenjäger kapitulieren müssen, weil er ihn nicht mehr fand.
Der Weg war lang und beschwerlich und sein Bündel wurde ihm wieder fast zu schwer. Schließlich passierte er die Abzweigung, die hinunter zum Kloster führte. Natürlich würde er dies meiden, denn Glauben war etwas, daß für einen Vampir wirklich gefährlich werden konnte. Malik hatte nie die Kreatur kennengelernt, die ihn selbst geschaffen hatte. Es war einfach passiert. So wie es auch bei ihm hin und wieder geschah.
Malik war einmal Herrscher gewesen.
Nun war er wie ein Flüchtling auf der Flucht, ohne festes Ziel. Einfach nur weit genug weg von seinem Feind, um sich wieder etwas Neues schaffen zu können. Es war zehrend.
Je näher er der rettenden Brücke kam, um so sicherer fühlte er sich.
In dem Dorf dahinter würde er endlich wieder Nahrung zu sich nehmen können, und dann wieder untertauchen, ohne das es auffiel. Dort war er dann endlich sicher. Er ignorierte den Abzweig hinunter zum Kloster und folgte der Straße weiter. Im nächsten Dorf lag sein Schicksal, zumindest für heute. Da war er sich ganz sicher.
2. Fundstücke
Jahr 2 Reiwa,
Kanto-Ebene
Wenn man der Geschichte der arschäologischen Ausgrabung wirklich so folgte, wie sie erzählt wurde, dann war es ein reiner Zufallsfund. Schon seit Jahren war in der Nähe des Dorfes Kamakura eine größere Grabanlage vermutet worden.
Achtunddreißig Jahre vorher hatte man unweit der Stadt Takatsuki eine Ruine der sogenannten schwarzen Burgen ausgegraben. Damit war nun auch das Rätsel um diese ein wenig aufgeklärter. Inzwischen wußte man, daß diese Burgen nur deshalb einen so schlechten Ruf genossen, weil dort zumeist grausame Herrscher residierten.
Kamakura selbst war ein rekonstruiertes Dorf aus alten Tagen, neben dem man schließlich die Reste einer einst herrschaftlichen Burg fand. Die Gerüchte bestätigten sich und ein wenig weiter im Norden machte man dann schließlich auch die Ruinen einer kleineren Klosteranlage aus.
Die Stadtoberen von Takatsuki waren eigentlich gegen die Ausgrabungen. Doch wenn das nationalhistorische Museum in Tokyo erst einmal etwas anwies, verhielt man sich danach. Zudem die umliegenden Universitäten aus Kyoto und Osaka an den archäologisch begründeten Ausgrabungen voll beteiligt sein sollten. Die Gemeinde erhielt auch ein wenig Zubrot vom nationalhistorischen Museum. Es war nicht viel, aber es reichte aus, um die Stadtoberen zumindest bis auf die nächste Zeit zur Ruhe zu bringen.
Wie gesagt, es war mehr ein Zufallsfund, daß man die Grabstätte überhaupt entdeckte. Sie war gut versteckt. Nicht nur unter einem wahren Hügel von Geröllsteinen, die man extra aus dem Gebirge herbeigeschafft, sondern auch noch hoch genug mit Erde zugeschüttet hatte, daß es wirklich den Eindruck machte, daß man nicht wollte, daß dieses Grab denn überhaupt gefunden werden würde.
Die Grabstätte an für sich war nichts Besonderes, wie sich später herausstellte. Die Anlage selbst war es, die es außergewöhnlich machte. Da war erst einmal der gut vierzig Meter hoch aufgeschichtete Steinhaufen, der in regelmäßigen Abständen mit verdichteter Erde versiegelt worden war. Man war wohl auf Nummer sicher gegangen, damit dieses Grab niemals gefunden werden sollte.
Jedenfalls entpuppte sich die erste Schicht, die man unter den Bruchsteinbrocken fand als reiner Quarzitsand. Diese Sandschicht selbst war noch einmal gut anderthalb Meter dick gehalten. Darunter folgte eine weitere Schicht aus massiven Schieferplatten, die sogar einen noch weiteren Weg zurückgelegt hatten, als die Bruchsteine, die den darüberliegenden Hügel bildeten. Die Schieferplatten bildeten eine massive Wand von etwa achtzig Zentimeter. Erst hier wurde es richtig interessant. Erst ab hier konnte man sich sicher sein, daß man es mit einem Grab zu tun hatte.
Unter dem Schiefer folgte eine Reihe dicker Holzbretter, die noch einmal durch eine doppelt gelegte Schicht Bambus verstärkt worden waren. Jetzt folgte noch einmal eine halb Meter breite Kieselsteinschicht, und eine weitere Reihe massiv gehaltener Holzbretter. Ein genauer Vergleich erbrachte schließlich, daß diese Hölzer aus den nördlichen Wäldern am Mount Fuji stammten. Sie hatten also neben den Steinen ebenfalls einen sehr weiten Weg hinter sich.
Erst jetzt erschloß sich dem Betrachter die Grabkammer.
Diese war schlicht gehalten. Sie bestand fast vollständig aus vorbearbeiteten Holz. Man sah diesem Holz richtig an, daß es lange gelagert worden war. Aus religiösen Gründen befanden sich Symbole des Glaubens an jeder Seite der Grabkammer. Man könnte meinen in einem ägyptischen Grab zu stehen, so viele Symbole bedeckten die Wände.
Im Zentrum der Grabkammer lag ein einfacher Holzsargophag. Ungewöhnlich für die Zeit, auf die man die Bretter der Verkleidung datiert hatte. Im achten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung war es äußerst selten gewesen, daß hölzerne Sarkophage überhaupt erstellt wurden. Im Norden Japans waren sie Tradition. Aber so weit im Süden waren sie äußerst selten, beinahe nicht vorhanden.
Die Grabkammer war ansonsten ziemlich schmucklos und beinhaltete neben einer Handvoll gut verschlossener gut ein Meter großer Sakekrüge nichts auffälliges. Nicht einmal normales Brot fand man, was sonst in solchen alten Gräbern üblich war. Nur die religiösen Zeichen an den Wänden, mehrere große Sakekrüge und sonst keine weiteren Grabbeigaben.
Ungewöhnlich für ein Grab, welches man für die Mitte des achten Jahrhunderts datierte. Außerdem war der Ort, an dem sich der Grabhügel befand, genauso ungewöhnlich. Normalerweise würde man eine solche aufwändige Grabanlage auf eine große Wiese setzen, und den frisch aufgeschütteten Hügel später zum Mästen von Ziegen und Schafen verwenden. Doch diese Grabanlage befand sich am Rande der nördlichen Hügelkette, die das Tal auf dieser Seite einschloß. Man hatte das Grab nicht in einen Berg gebaut, welches wahrscheinlich leichter gegangen wäre, sondern hatte sich die Mühe gemacht, Bruchsteine weit aus dem Norden zu holen, genauso wie genug Holz, um damit ein eigenes Haus bauen zu können.
Der Sargophag machte einen frischen und edlen Eindruck, obwohl er absolut schmucklos gehalten worden war. Das Holz für ihn stammte jedoch aus dem Süden des Landes, weit jenseits der Grenzen Osakas. Auch wieder eine massive Abweichung. Entweder war der Besitzer des Grabes sehr reich gewesen, oder zu Lebzeiten war eine wichtige Person des Dorfes gewesen, zu dem das Grab augenscheinlich gehörte.
Nur wurden sich die Archäologen nicht wirklich einig, zu welchem Dorf das Grab nun wirklich zählte. Kamakura, oder wie es einige Zyniker anmerkten, doch eher zu Takatsuki.
Verglich man nämlich die alten Karten mit der aktuellen Lage, hatten sich einige kleinere Änderungen ergeben. Kamakura war ein wirklich winziges Dorf gewesen, daß von seinen Bewohnern nach einem Zwischenfall im Kamakura aufgegeben worden war. Stattdessen hatten sie auf der anderen Seite des kleineren Hügels, der auch die heilige Quelle umfaßte, eine neue Stadt gegründet. Takatsuki war auch entsprechend schnell gewachsen, weil die Einwohner der umliegenden Dörfer sich der neuen Gemeinschaft gleichfalls anschlossen.
Takatsuki hatte eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Aber die Stadt zählte heute zu Osaka. Sie besaß kein eigenes Stadtrecht mehr, sondern galt als eingemeindete Stadt Osakas. Das sich hier dann auch vornehmlich Industrie ansiedelte, lag wohl eher daran, daß diese Gegend sonst nicht viel bot.
Die Aufsicht führenden Archäologen aus Tokyo wiesen schließlich an, daß der Sargophag aus Takatsuki nach Tokyo selbst gebracht werden sollte. Dort sollten ihn Spezialisten öffnen und nach dem Inhalt schauen. Fest stand nur, daß der Sargophag deutlich kleiner war, als man es gewohnt war.
Sonst waren die Särge der alten Kriegsherren immer wuchtig und schwer zu transportieren. Dieser Sargophag hier war eher klein und leicht gehalten, obwohl seine Außenseite so dick mit Pech bestrichen worden war, daß er wohl als versiegelt gelten konnte.
Nur weshalb sollte man im achten Jahrhundert einen Sargophag derart sicher versiegeln wollen?
Die Antwort auf diese Frage würde sich schwieriger gestalten, als man dachte. Es gab mehrere Möglichkeiten. Die erste war, daß in Takatsuki eine schlimme Seuche gewütet hatte, und der Inhalt des Sargs wohl einer der Verursacher davon gewesen war. Doch für diese Theorie fand man keinerlei schriftliche Hinweise. Nicht einmal in den alten Dokumenten, die man schon vor Jahrzehnten aus den Überresten der Klosterruine hatte retten können. In den Schriften des Klosters wurde so etwas nicht einmal im Ansatz erwähnt.
Die zweite Theorie besagte, daß der Inhalt des Sargophags den Einwohnern Angst gemacht hatte, und sie ihn deshalb so gut verschlossen. Gerade so, als wollten sie sich vor einem Wiedergänger sichern. Diese Erklärung klang halbwegs glaubwürdig, immerhin war die Grabkammer über und über mit religiösen Symbolen motiviert gewesen. Doch irgendwie machte auch dies keinen Sinn. Aber es war zumindest eine einleuchtende Erklärung, die man verwenden konnte, wenn man den Sargophag und dessen Inhalt erst einmal in der großen Halle ausstellte.
Eine dritte Theorie, die unter den Studenten die Runde machte, sagte etwas völlig anderes. In dieser Theorie wurde ausgesagt, daß der Inhalt des Sargophags absolut tot war, und man ihn nur deshalb so gut verschlossen hatte, weil das Grab, in dem man ihn gefunden, nur ein Provisorium gewesen sei. Diese Idee fand unter den Studenten am meisten Anklang, doch die Spezialisten aus Tokyo lehnten sie ab. Wohl eher deshalb, weil ein Student erkannte, daß die Grabkammer irgendwie unfertig wirkte, als man sie zugeschüttet hatte.
So kam es, daß der Sargophag auf einem Lastkraftwagen quer durch das Land gefahren wurde, um im nationalhistorischen Museum in Tokyo weiter untersucht zu werden. Natürlich hatte man die Ladung entsprechend abgedeckt, natürlich war sie entsprechend gesichert. Aber es war eine weite Fahrt, denn zwischen Osaka und Tokyo lagen immer noch mehr als vierhundert Kilometer Straße.
3. Erinnerung
Jahr 3 Reiwa,
7. Monat, 16. Tag
Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan,
Ueno-Park, Central City, Tokyo
Der etwas ältliche, korpulente, Museumsdirektor hatte in Folge der sogenannten »Kitsune-Affäre« seinen Posten Jemanden räumen müssen, der nicht nur halb so alt wie er war, sondern auch deutlich versierter im Umgang mit Altertümern.
Der neue Direktor war eine Frau. Schön anzusehen, gerade am Anfang ihrer Vierziger zu stehen, und sehr versiert in der Kunst alte Papiere zu lesen und zu transkriptieren. Die neue Frau Direktor hatte sich sehr für die Ausgrabungen eingesetzt. Ihre wichtigste Trophäe im Waffenraum war ein uralter persischer Dolch, der in eine genauso abenteuerliche Geschichte verwickelt war, wie sie anscheinend auch. Doch die Geschichte wurde nur unter der Hand erzählt. Offiziell war der Dolch ein uraltes Fundstück, daß ein reicher Sammler dem Museum hinterlassen hatte.
Unter der neuen Frau Direktor wurde der Sargophag in den Untersuchungsbereich des Museums geschafft und erst einmal vergessen. Es dauerte fast ein ganzes Jahr, bis sich wieder Jemand darum kümmerte.
Doch dieser ganze Streß, der das Museum in der Zwischenzeit in Atem hielt, lag mit einem aufsehenerregenden Fund im japanischen Meer zusammen. auf einem Riff im Drachenmeer war ein altes japanisches Segelschiff gefunden worden, welches eindeutig aus der Zeit vor der ersten Beeinflussung durch Ausländer, stammte. Dieser Schiffsfund war einfach zu wichtig gewesen.
Das gesamte Museum geriet aus den Fugen, denn ein solches Wrack, oder dessen Reste davon für das große nationalhistorische Museum zu bergen, würde seinen Wert in den Augen der einfachen Bürger nur heben. Also konzentrierte man sich zuerst darauf, bis endlich wieder ein Archäologe wieder ein wenig Zeit fand, sich mit dem Sargophag zu beschäftigen.
Man hatte den Sarg sehr gut verwahrt. Er stand all die Monate in einer gekühlten Kammer und wartete vor sich hin. Da er mit Pech verkleidet war, konnte er nicht brüchig werden oder sonst auf die Kälte reagieren. Er blieb also geschlossen und wartete.
Zeit ist eine äußerst relative Sache.
Und das lag nicht nur daran, von welcher Warte man es denn nun genau sah. Zeit verging nun einmal. Während der Ausgrabungen stieß man noch auf eine weit verrostete metallene Stele, deren Text sich so niemand erklären konnte. Denn der Text war in modernen japanisch gehalten. Ungewöhnlich, wenn man bedachte, daß die moderne Schriftsprache erst im zwölften christlichen Jahrhundert wirklich perfektioniert wurde. Dennoch war der Text sehr modern gehalten. Sowohl im Ausdruck, als auch in der Schreibweise. Deshalb war es jedem an der Ausgrabung beteiligten auch möglich ihn zu lesen und zu verstehen. In einfachen Kanji stand auf der Stele nur ein einzelner Satz:
Der Tod ist nicht das Ende, aber auch kein Anfang.
Man hatte die Stele an einem Platz errichtet, der auf dem ersten Blick weder etwas mit der gefundenen Grabstelle, noch mit dem Dorf zu tun hatte. Von der Stele aus konnte man gut in Richtung des Klosters von Kamakura blicken. Auf der anderen Seite, auf der die Schrift stand, befand sich nur das dritte Dorf dieses merkwürdigen Tales. Und die Stele befand sich nicht am altbekannten Weg, wie früher die Straße gelaufen war, sondern ungefähr dreihundert Meter davon ab, in einem Gebiet, welches man ohne weiteres als leicht sumpfig bezeichnen konnte. Man stieß auf die Stele aber auch nur, weil ein Student seine Anweisung, wie er mit dem Metalldetektor zu laufen hatte, falsch verstand.
Jedenfalls war die Stele auf dem gleichen Lastkraftwagen gewesen, der auch den Sargophag gebracht hatte. Nur stand die Stele in einer der weitläufigen unterirdischen Kammern des Musems und rostete dort lustig vor sich hin, während der Sargophag in seiner Kühlkammer auch nicht frischer wurde.
Das schlimmste an der Arbeit eines Archäologen ist nun einmal der Umstand, daß man seine Funde immer wieder Restauratoren überlassen muß, die von den alten Dingen genauso viel wie man selbst verstand. Es gab nur wenige Archäologen, die selbst restaurierten. Die Hauptarbeit an einem Fund lag nämlich nach dessen Konservierung bei der Restauration. Alle Museen auf der Welt leisteten sich für solche Arbeiten große, vielköpfige Teams, weil mehr Augen nun einmal mehr Details wahrnahmen.
Aus diesem Grund arbeiteten in keinem Museum weniger als sechs Personen an einem Fund. Dabei war es unabhängig, welche genauen Fachbereiche sie hatten. Wichtig war, daß sie die Fundstücke im eigentlichen Sinne wieder aufleben lassen konnten, in dem sie sie möglichst originalgetreu rekonstruierten.
Am meisten Spaß machte diese Arbeit bei Särgen, Sargophagen und ähnlichen Grabkisten, sofern sie erhalten waren. Die Archäologen, die vorher die Ausgrabung geleitet hatten, waren nun voll in die Arbeit integriert, wenn das Restauratorenteam Stück für Stück begann die Fundstücke genauer zu säubern und genau zu schauen, was es denn nun eigentlich war.
Man begann mit den langweiligsten Fundstücken.#
Den Sakekrügen, die man gefunden hatte.
Es waren in etwa zwanzig Krüge gewesen. Alle versiegelt. Zum einen mit Bienenwachs, zum anderen mit Pech. Doch man hatte darauf geachtet, daß nur die Deckel richtig verklebt waren. Der Inhalt der meisten Krüge entpuppte sich als reiner, hochprozentiger Sake. Quasi Reisschnaps, der direkt aus der Brauerei kam, und nicht zum Trinken erst verdünnt worden war. Dieser Reisschnaps war pur. Außer das er einen etwas merkwürdigen Geruch aufwies, war er vollkommen normal. Die restlichen Krüge beinhalteten keinen Sake, dafür etwas anderes, eher ungewöhnliches. Es war getrocknetes, eingelegtes Fleisch. Eine genauere Analyse offenbarte, daß es sich um Wildfleisch handelte. Aber wohl eher Hasen- als Rehfleisch.
Dies war ungewöhnlich.
Die japanische Kultur hatte bereits im zweiten vorchristlichen Jahrhundert aufgehört, Nahrungsmittel als Grabbeigaben zu opfern. Dies war eine solche archaische Sitte, daß sie einfach nicht passen wollte. Nicht passen konnte.
Die Wissenschaftler des Museums nahmen sich des Falles nun richtig an, und nun wurde bereichsübergreifend genauer nachgeforscht, was denn überhaupt los war. Der Sake entpuppte sich als echt und auch genauso alt, wie man es wohl schon geahnt hatte. Der Sake jedenfalls hatte mindestens elf Jahrhunderte Zeit bekommen, um gut durchzureifen. Da er jedoch pur war, veränderte er weder Geschmack, noch Aussehen. Doch wie alles in demn Grab paßte er auch nicht in die Gegend, denn in Kamakura hatte es nur genug Reisfelder gegeben, daß man davon eine winzige Dorfbevölkerung gerade einmal so durchbekam. Die beiden Dörfer an den Außenseiten des Tales hatten die Möglichkeit auch jenseits des Tales Felder anzulegen. Hinzu kam noch der winzige Teich unweit der alten Burgruine, die man einst dort gefunden hatte, der es auch nicht eben einfacher machte, entsprechend anzubauen.
Kamakura hatte Pech, das es gegenüber dem Dorf nur diesen Hügel gab, auf dem sich heute der Tempel von Takatsuki befand. Als man die neue Stadt gründete, hatte man jenseits des Hügels auch genug neue Felder anlegen können. Deshalb war die Stadt auch so schnell gewachsen. Kamakura war nur noch der Schatten eines Dorfes. Heute wie damals. Takatsuki jedoch hatte sich in wenigen Jahrzehnten zu einer wirklichen Stadt gemausert und von da an das kleine Tal dominiert.
Diesen Teil der Geschichte kann man inzwischen.
Was man nicht wußte, weshalb man für eine Beerdigung extra einen besonders scharfen, besonders würzigen, und besonders starken Sake aus Mie hatte importieren müssen. Mie war zur damaligen Zeit mehrere Tagesreisen entfernt gewesen. An diesem gesamten Grab eröffnete jeder neue Fund, jede neue Analyse, neue Geheimnisse. Neue Rätsel, die nicht zu lösen waren.
Zumindest nicht auf Anhieb.
Man legte dieses neue Wissen erst einmal ad acta und machte weiter. Außer den Tonkrügen und dem Sargophag war nicht viel in dem Grab gewesen. Manche Dinge hatte man gar nicht retten können. Doch wie es ausschaute, war dieses Grab nicht für eine hochherrschaftliche Person angelegt worden. Zumindest deuteten einige wenige Details darauf hin.
Schließlich machte sich ein Mitarbeiter des Museums die Mühe, die gefundenen Schriftzeichen von den Wänden der Grabkammer dem obersten Mönch des kaiserlichen Tempels nur eine Straße weiter zu zeigen. Auch hier kam es zur nächsten Überraschung. Der Mönch las sich die Texte wirklich intensiv durch, doch dann erklärte er: »Dieser Text ist für die Augen der Person bestimmt, die in dem Sargophag begraben liegt. Ich kann dazu nicht sehr viel sagen. Nur eines: Dieser Text soll die Seele der Person im Sargophag halten. Doch den genauen Wortlaut weiß nur die begrabene Person.« Damit verabschiedete er sich aus der Mitarbeit und ließ sich nur wenige Wochen später im weiten, kalten, Norden Japans in einem kleinen Tempel nieder.
Blieb nur noch der Sargophag.
Diesen zu öffnen würde eine ganz besondere Aufgabe sein.
Und man dachte schon daran, sich einen auswärtigen Spezialisten für so etwas zu holen. Doch die Museumsdirektion entschied anders. Einer der eigenen Fachleute sollte es tun. Gleichzeitig sollte die Sargophagöffnung weltweit übertragen werden, damit die ganze Welt sah, welche Schätze noch im japanischen Boden ruhten. Es würde ein Weltereignis werden.
4. Museum
Jahr 3 Reiwa,
7. Monat, 19. Tag
Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan,
Ueno-Park, Central City, Tokyo
Der staatliche Fernsehsender TBS hatte ein halbes Dutzend moderner Kameras in dem Raum aufgebaut, in dem der Sargophag schließlich geöffnet werden sollte. Jede der Kameras hatte einen anderen Blickwinkel und war genau auf den Tisch ausgerichtet worden. Von der zusätzlichen Beleuchtung, den zusätzlich überall im Raum angebrachten Mikrofonen gar nicht zu reden. Am Boden kreuzten sich Kabel in einem wilden, wirren, Durcheinander.
Die Spezialisten, die den uralten Sargophag öffnen sollten, waren Koryphäen auf ihrem Gebiet. Der eine davon, Doktor Maguto, war bereits im Ausgrabungsteam des größten ägyptischen Ausgräbers Saphi Havas tätig gewesen, und half diesem die berühmte Mumie von Ramses III. aus ihrer Ruhestätte zu holen. Doktor Maguto hatte mehrere Jahre in Ägypten zugebracht und war dort mehrfach für das japanische Ausgrabungskommando Ausgrabungsleiter gewesen. Es wäre auch nicht eben seine erste Sargophagöffnung, denn unter Saphi Havas war er an solchen Öffnungen ein gutes Dutzend Mal beteiligt gewesen.
Sein Gegenstück war die noch jugendlich anmutende Akira Sae. Die junge Doktorin war eigentlich Anthropologin und mehr auf japanische Funde spezialisiert. Doktor Akira war unter anderem an der Ausgrabungskampagne an der schwarzen Burg von Takatsuki beteiligt. Sie kannte also das Tal und die Gegend.
Außerdem war noch zusätzlich vom Fernsehsender selbst ein Weltklassechirurg hinzugezogen worden. Ein Mann, der wohl mehr Operationen am offenen Körper vollbracht hatte, als sonst wer. Der Mann war ein absoluter Spezialist, dem man nachsagte, daß er anhand einer Narbe bereits sagen konnte, wer derjenige war, der vor ihm an dem Patienten herumgeschnitten hatte.
Es war also eine wirklich große Sache für das Museum.
Es war eine Sache nationaler Tragweite.
Denn wenn man es genau nahm, gab es in Japan keine Mumien. Dieser Fall war also mehr als außergewöhnlich. Dieser Fall war einzigartig. Denn diese Mumie schien eigentlich gar nicht hierher zu gehören. Allein deshalb war das Museum so daran interessiert, so viele Daten wie möglich bei der Sargophagöffnung zu sammeln. Natürlich gab es schon aus älterer Zeit entsprechende Sargophage. Doch bisher waren den japanischen Museen keine dermaßen gut versiegelten Sargophage untergekommen. Dieser hier stellte allein damit schon eine Weltsensation dar.
Die Frau Direktorin sah auf den hell erleuchteten Raum hinunter, in dem in wenigen Stunden der Sargophag geöffnet werden würde. An ihrer Seite ihr jugendlich wirkender Freund Mimo. Mimo arbeitete als einfache Putzkraft im Museum. Zumindest solange, bis er sein Studium an der Universität Tokyo hinter sich gebracht hatte.
Der junge Mann lächelte seine Freundin und Chefin an, die vielleicht doppelt so alt wie er war. »Und was wirst du tun, wenn es sich nicht als das entpuppt, was uns gesagt wurde?«, fragte er dann.
Direktor Ahihara lächelte ihren Freund nur an. »Ich weiß, was Inari gemeint hat. Wir sollen nur dafür Sorge tragen, daß alles wie von ihr geplant verläuft. Sie hat ihre Gründe, warum sie uns diese kleine Aufgabe übertrug.«
Mimo lächelte wieder schief. »Der letzte Auftrag ließ dich dein Herz an einen Journalisten verlieren. Inari sagte uns nicht einmal im Ansatz, was wir hier sollen. Und was machst du? Du läßt dich gleich zur Direktorin des Museums machen!« Dabei hatte er ein amüsiertes Grinsen im Gesicht.
Ahihara trug ihrem Freund nichts nach. Sie waren nicht zum ersten Mal unterwegs. Der letzte Auftrag war eine Familienangelegenheit gewesen, und die Göttin Inari hatte sich ihnen beiden gegenüber äußerst huldvoll und gnädig gezeigt. Dieser Auftrag war ein Nichts.
Direktor Ahihara hatte nur dafür zu sorgen, daß der Sargophag ordnungsgemäß geöffnet und sein Inhalt dabei möglichst nicht beschädigt wurde. Anhand der Versiegelung konnte man schon darauf schließen, daß sich in seinem Innerem eine Mumie befand. Denn der Schreiner, der diesen Sargophag erstellt, war ein wahrer Meister seines Faches gewesen. Trotzdem verwirrte die komplette Abdichtung mit Pech ein wenig. Dies war selbst für japanische Verhältnisse äußerst ungewöhnlich.
Die beiden gingen wieder hinüber in den Verwaltungstrakt. Ahihara hatte noch mehr als genug zu tun. Die ganze schriftliche Arbeit kannte sie noch aus ihrer Zeit, als sie noch die einfache Assistenz des alten Direktors gewesen war. Inari hatte sich zumindest so gütig erwiesen, ihr ihren alten Job noch zu ermöglichen, den sie in der Menschenwelt eindeutig benötigte, wollte sie nicht auffallen.
Ahihara Tomoe war wohl der einzige Kitsune, der sich so gut wie nie verwandelte. Bei Mimo war das etwas Anderes. Ihr Begleiter war nun schon gut ein Jahrtausend bei ihr und hielt ihr nach wie vor die Treue. Ihre Freundschaft ging weit über das normale Band hinaus. Mimo konnte sich genauso blind auf die Fähigkeiten seiner Freundin wie auf die eigenen verlassen. Nur mit dem Unterschied, daß sie nicht den gleichen Beschränkungen, wie er selbst, unterlag. Ahihara konnte jederzeit ihr Aussehen verändern und war nicht gezwungen, in jeder Inkarnation noch einmal neu anzufangen. Mimo war zwar auch unsterblich, aber dazu gezwungen, in einem menschlichen Körper geboren zu werden. Es sei denn, er entschied sich endgültig zur dauerhaften Erscheinung eines Kitsune. Dies würde auch gehen. Doch Mimo liebte seine menschliche Form, die sich schon ein paar Mal als äußerst nützlich erwies.
Ahihara Tomoe hatte da ein anderes Problem. Grob gerechnet feierte sie in den nächsten Tagen sowieso ihren achthundertsten Geburtstag. Wäre sie nicht als junges Mädchen getötet worden, hätte sie ein anderes Schicksal erwartet. Nun war sie eine unsterbliche Kitsune, die für Göttin Inari kleinere und auch größere Aufträge erledigte. Noch war Tomoe nicht mächtig genug, um wieder in ihre eigene Zeit zurückzukehren, um das an ihr begangene Unrecht wieder umzukehren. Inari hatte ihr versprochen, daß sie dies irgendwann einmal tun dürfe, wenn sie sich dafür im Tausch für ein weiteres Jahrtausend verpflichtete.
Tomoe betrat ihr stilvoll eingerichtetes Büro im Westflügel des Gebäudes. Mimo verabschiedete sich, als er im Vorzimmer mal wieder Schlipsträger sitzen sah. Hohe Tiere aus der Politik, die unbedingt ein Mitspracherecht haben wollten.
Ahihara betrat ihr Vorzimmer, begrüßte kurz ihre Sekretärin und bat dann die beiden Herren in den Anzügen in ihr eigentliches Büro. Die beiden Männer machten einen deutlich nervösen Eindruck. Nervöser als sie sein sollten.
Schließlich stellte sich der Eine der beiden vor. »Ich bin der Abgeordnete Getsuo Keniji.« Die Direktorin nickte. »Und was will ein Abgeordneter von mir kleinen Museumsdirektorin? Hat das Parlament entschieden, daß ich dieser Sache nicht gewachsen bin?«, entgegnete sie mit trockenem Humor. Dabei behielt sie die beiden Männer genau im Auge. Sie wußte, daß sie nichts zu befürchten hatte. Sie war ein Kitsune. Und das nur einfache Menschen. Zudem Bannflüche bei einem Kitsune sowieso nicht wirkten.
Der Begleiter des Abgeordneten nickte jenem zu, damit er sich näher erklärte. Der Abgeordnete sah sie fest und vermeintlich durchdringend an, und sagte dann mit fester Stimme: »Ich möchte sie im Sinne des Parlaments bitten, den Sargophag nicht öffnen zu lassen!«
Jeder andere wäre verdutzt ob einer solchen Forderung gewesen. Ahihara jedoch entfleuchte ein sanftes Lächeln. »Wenn das Parlament dann bereit ist, TBS bereits die einhundert Millionen Yen zurückzuzahlen, die das Museums schon als Vorleistung erhalten hat, dürfte dies kein Problem sein. Doch ich bin sicher, daß sie erst einmal ausdiskutieren müssen, wer denn nun die Berechtigung hat, einem unabhängigen, staatlichen, Museum zu verbieten, seine Arbeit zu tun.«, konterte sie lächelnd.
Getsuo Keniji sah sie fest an. »Tun sie sich selbst einen Gefallen, lassen sie den Sargophag nicht öffnen. Er stammt aus einer verfluchten Gegend.«, stammelte er dann.
Die Kitsune hatte genug gehört. »Ich kann sie verstehen, daß sie Vorbehalte haben. Und mir ist bekannt, daß das Tal von Takatsuki einen ganz speziellen Ruf hat. Mir sind auch die vielen Gerüchte bekannt, die es um den Tod des Senators gibt, dessen Familie ja vermeintlich ebenfalls aus diesem Tal stammt.«
Ahihara machte eine kurze Pause.
»Aber ich habe als Museumsdirektor eine Aufgabe zu erfüllen. Und jene besteht darin, neues Wissen zu erwerben, erforschen zu lassen und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. In diesem Fall kann ich die Sargophagöffnung nicht einmal verbieten, denn es steckt allgemeines Interesse dahinter.«
Nach einer weiteren, sehr kurzen Pause, fuhr sie fort.
»Sollte sich in diesem Sarg die erste japanische Mumie überhaupt befinden, so sind wir verpflichtet, ihn zu öffnen. So leid es mir tut, allein von den Bestimmungen des Museums her kann ich nichts mehr gegen die Sargophagöffnung unternehmen, weil ich ansonsten, genauso wie mein Amtsvorgänger mich der groben Fahrlässigkeit schuldig machen würde. Ich würde verhindern, daß das japanische Volk weiteres Wissen über seine Vergangenheit erhält. Und diese Art von Versäumnis kann ich mir nicht leisten.«
Der Abgeordnete sah sie nun fest an.
»Sie kennen nicht die Legenden um diesen Sargophag?«, wollte er dann wissen.
Tomoe wurde hellhörig. Es war das erste Mal, daß sie in dieser Angelegenheit von Legenden hörte. »Es gibt eine Legende um diesen speziellen Sargophag?«, fragte sie skeptisch nach.
Die Ordonanz des Abgeordneten nickte wieder auffällig schnell. Dann erklärte er, ohne sich vorzustellen: »Der Herr Abgeordnete ist für jenen Teil von Takatsuki verantwortlich, in dem das gesamte Ausgrabungsgebiet liegt. Also beide Seiten um die alte Brücke und die Burgruine herum gehören mit zu seinem primären Aufgabenbereich. Normalerweise setzt sich der Herr Abgeordnete nur für die Infrastruktur ein, aber in diesem Fall war er schon verwirrt, als der alte Herr Senator die erste Grabungskampagne gestattete.«
Mit einem Mal verstand die Kitsune.
»Das heißt, es gibt eine uralte Legende um diesen Sargophag, die nur in eben dieser Gegend im Norden von Osaka bekannt ist, ansonsten aber gar nicht?«, stellte sie dann fest.
Die Ordonanz nickte wieder auffällig schnell.
»So ist es. In dieser Legende heißt es, daß in diesem Sargophag der lebende Tod eingesperrt sei, und das er nicht befreit werden dürfe. Es würde ansonsten sehr viel Unheil über das Land kommen.«
Ahihara nickte.
»Gut, ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Die Sargophagöffnung wird ohnehin einige Tage in Anspruch nehmen, bis dahin werden sie mir doch mit Beweisen für ihre Behauptung kommen. Eine schriftliche Niederlegung dieser Legende wäre schon einmal eine kleine Hilfe, um die akute Gefahr besser einschätzen zu können.«
Der Abgeordnete nickte nun auch zustimmend. »Ich werde sehen, was ich machen kann und ihnen die nötigen Dokumente besorgen.«
Mit diesen Worten standen die beiden Herren wieder auf und verließen auffallend schnell das Büro durch die Tür, die direkt auf den Gang führte.
Tomoe war noch am Überlegen, wie es nun weiter gehen sollte, als es an eben jener Tür klopfte. Ohne aufzusehen, sagte sie: »Mimo, komm bitte herein.«
Wie erwartet, stand ihr Gefährte dann im Raum, schloß hinter sich die Türe wieder und sagte: »Die beiden sahen nicht eben so aus, als würde es ihnen gut gehen!«
Tomoe nickte leicht abwesend. Doch dann erklärte sie: »Die beiden wollten mir etwas um eine alte Legende, die diesen Sargophag angeht, auftischen. Angeblich soll er den lebenden Tod beinhalten.«
Nagajima Mimo lächelte amüsiert. »Das hört sich ja fast so an, als würdest du beiden kein einziges Wort glauben.«
Der Blick, der ihn von ihr traf, ließ einem das Mark in den Knochen gefrieren. Die Kitsune sah ihren jahrhundertealten Partner fest an, und entgegnete: »So lustig ist das nicht. Aber Inari gab uns noch nie eine Mission, die auch gleichzeitig eine Gefahr für die Umwelt darstellte.«
Nagajima nickte zustimmend. »Glaube ich diesen beiden Abgeordneten, dann bleibt der Sarg geschlossen. Glaube ich ihnen aber nicht und halte mich an das, was Inari zu uns sagte, dann wird er geöffnet. Und dann bin ich auch bereit, gewisse Risiken einzugehen.«, erwiderte sie dann.
Der junge Nagajima lächelte schon wieder, auch wenn der Blick vorher ihn ziemlich erschreckt hatte. Doch er kannte seine Gefährtin, und wußte, daß er sich auf ihr Urteil verlassen konnte.
»Und was schlägst du nun vor? Inari hintergehen und den Sarg geschlossen halten, oder die Mission durchführen und sich danach ein ruhiges Eckchen suchen, bis sie uns wieder einmal braucht!«
Nun mußte sogar Tomoe lachen.
»Unser Auftrag von Inari hat immer Vorrang. Sobald der erledigt ist, suche ich uns wirklich ein ruhiges Plätzchen. Ich wäre dafür, daß wir Tokyo verlassen und dieses merkwürdige Takutsuki-Tal ziehen.«, spöttelte sie.
Mimo wußte, wann er verloren hatte.
Tomoe würde sich nicht wirklich von dem Auftrag abbringen lassen. Deshalb erschien es ihm, als ob sie nicht eine eigene Idee hatte. Inari hatte sie nicht umsonst mit der sicheren Sargophagöffnung betraut. Auch dazu mußte es einen triftigen Grund geben. Diesen Grund zu kennen könnte schon bei einigen anstehenden Schwierigkeiten helfen. Denn der Kitsune war sich sicher, daß sie diesmal auch wieder in einige Ärgernisse hinein geraten würden.
5. Priestertagebuch
Jahr 3 Reiwa,
7. Monat, 18. Tag
Irgendein Götterschrein im Stadtgebiet,
Takatsuki, Shin-Osaka
Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Manchmal haben selbst diese ebenfalls eine Vorgeschichte. So könnte man sagen, daß die kleinen Schreine Osakas schon immer einer Grundregel folgten: Decke ein möglichst großes Gebiet ab, und verweise mit deinen Bannschriften Kreaturen der Unterwelt genau dort wieder hin.
In Osaka wurde die Legende des wohl berühmtesten Dämonenjägerschwerts geboren. Auch in einem Schrein. Und zu einer Zeit, die man kaum als christlich oder ähnlich gläubig, beschreiben könnte.
Nun, manche Vorgeschichten haben selbst Vorgeschichten.
Der kleine Schrein, der neben dem Anwesen der Familie Oshiro lag, war bereits jahrhundertealt. Familie Oshiro hatte sich anfangs wenig darum gekümmert. Doch dann beschloß der Stadtrat in seiner Weisheit, daß die kleineren Schreine, die keine einfachen Wegschreine waren, sondern über mindestens ein Gebäude verfügten, von nun an, es war irgendwann im Taisho, von der Nachbarschaft in Ordnung zu halten seien. Sowohl der Shogun des Landes, als auch der Kaiser unterzeichneten das Dekret. Damit wurde die einfache kleine Bestimmung des Stadtrates von Osaka landesweites Gesetz.
Die umliegenden Anwesen gehörten gleichfalls nicht eben armen Familien Osakas. Man entschloß sich also eine einfache Lösung für das Dilemma zu finden. Die Lösung bestand darin, daß bis zu ihrer Hochzeit jeweils die jüngste Tochter einer jeden Familie Hüterin des Schreins wurde.
Die Liste zieht sich ewig, um sie wirklich aufzuzählen. Da Familie Oshiro den Nachteil hatte, die erste Familie zu sein, die ihre Töchter in den Schrein schicken mußte, erließ sie die zusätzliche Regel, daß jede Familie in jedem Jahrzehnt, das verging, etwas zu dem Schrein dazu geben sollte.
So geschah es auch.
Der Götterschrein war immer noch winzig, wenn man ihn mit anderen Schreinen verglich, die es in Osaka gab. (Und Osaka ist eigentlich dafür bekannt, eine der japanischen Städte zu sein, die mit über die höchste Schrein- und Tempeldichte, neben der alten Hauptstadt Kyoto, verfügt.) Dafür hatte er sich ein wenig ausgedehnt.
Mittlerweile war das Gebiet des Schreins ein wenig ausgedehnt worden, so daß der einfache Schrein nun über ein kleines Gebäude für heilige Schriften, und einen winzigen Schlafraum für die amtierende Dienerin verfügte. Der eigentliche Schrein befand sich inzwischen in einem eigenen, winzigen, Gebäude, welches jeden Morgen von der Dienerin und einem Priester gewartet werden mußte.
Im Laufe der Zeit hatte sich jedoch auch an dem Schrein einiges verändert. Aus den schlichten Holzgebäuden waren inzwischen welche mit gemauerten und gegossenem Fundament geworden. Neben der Dienerin tat auch noch eine Priesterin ihren Dienst.
Die Priesterin war notwendig geworden, nachdem eine der anderen Familien den Schlafraum für die Bedienstete einrichten ließ. Seitdem teilten sich die beiden jungen Frauen das winzige Gebäude.
Die junge Priesterin gehörte zu den Kamashitas aus dem fernen Aomori. Das war zwar eine der ältesten Präfekturen des Landes, aber so abgelegen und so weit im Norden, daß eine Zugfahrt durchaus schon einmal eine Woche betragen konnte.
Natsumi Kamashita war eine wirklich junge Priesterin. Ihre Weihe lag gerade einmal achtzehn Monate zurück. So lang war sie noch nicht in ihrem Amt, und die erste Arbeit, die ihr der Orden auflud, war nach Osaka zu reisen, um ausgerechnet jenen völlig unwichtigen Götterschrein im Süden der Stadt zu übernehmen.
Manche Schreine waren größer, breiter, schöner.
Dieser Schrein hier war eine einzige Zumutung. Zwar war er ein wenig größer als manche Schreine, die man aus Tokio kannte, dafür machte er nicht viel Arbeit, und die Anwesenheit einer Dienerin wurde auch nicht absolut gebraucht.
Natsumi kam sich deshalb schon nach wenigen Wochen als fünftes Rat am Wagen vor, daß zwar all morgendlich das übliche Schreinritual durchführte, ansonsten nicht sehr viel zu tun hatte. Der Schrein fiel noch nicht einmal von der Straße her auf, obwohl er ein großes, rotes, Torii hatte.
Aber das war Osaka.
Diese Stadt war gerade zu verrückt, wenn es um verrückte Sachen ging. Vor einigen Jahren war hier einmal ein Lagerhaus der Yakuza explodiert, bei dem dreißig Mann den Tod fanden. Noch heute hielt sich das Gerücht, daß dieses Lagerhaus nicht unbegründet in die Luft geflogen und ausgebrannt war, sondern daß »Die Hand« selbige im Spiel gehabt hatte. Alles unbewiesene Gerüchte, aber so etwas machte das Leben in Osaka nun einmal interessant.
Deshalb war es auch ein wenig verwunderlich, daß dieser uralte, potthäßliche Schrein mit einem gewaltigen roten Torii gekennzeichnet war, aber ansonsten nur drei Gebäude beinhaltete, die man nur mit sehr viel Mitgefühl als solche bezeichnen konnte. Das wichtigste Gebäude des kleinen Ensembles war gleichzeitig auch das winzigste. Hier wurden nur heilige Schriften aufbewahrt.
In einem ungesicherten Schrank in einem Gebäude, dessen gegossener Betonboden mit einem Estrich verkleidet worden war, der jetzt bereits chronische Alterserscheinungen aufwies. Das Gebäude war gerade einmal groß genug, damit eine einzelne Person darin bequem lesen konnte.
Und da sich um die restliche Arbeit auf dem Gebiet des Schreins die Dienerin kümmerte, hatte Kamashita nicht eben viel zu tun. Am Anfang ihrer Arbeitszeit in dem Schrein hatte sie noch versucht sich um irgendwelche Gläubigen zu bemühen. Doch schon nach einigen Wochen mußte sie überrascht feststellen, daß sich nur alles Schaltjahr mal Jemand auf das Gelände des Schreins verlief.
Dementsprechend öde wurde es dann auch.
Sie hatte nichts zu tun, und die junge Schreindienerin tat das, was eben getan mußte, damit der Schrein nicht halb so heruntergekommen aussah, wie er es wirklich war. Die junge Oshiro gab sich wirklich Mühe.
Kamashita bewunderte dies an ihr.
Im Vergleich zu ihr war sie zu diesem Schreindienst gezwungen. Kamashita brauchte nur ihre Sachen zusammen zu packen, offiziell zu erklären, daß sie den Schrein aufgab und gehen. Die Schreindienerin würde sich danach wieder ganz allein um die kleine Anzahl Gebäude kümmern.
Doch Natsumi war in der Hinsicht völlig anders.
Sie kannte ihre Aufgabe nur zu gut. Nur langweilte sie sich, weil sie so gut wie nie dazu kam, diesen Aufgaben auch nur ein wenig nachzukommen. Wenn ein Schrein einen Priester bekam, erfolgte meist innerhalb eines Jahres die Aufstufung zum Tempel, dann konnten mit dem inzwischen gesammelten Geld entsprechende Ausbauten getätigt werden und man sich in die Runde der wirklich anspruchsvollen Tempel einreihen.
Doch bei diesem Schrein war nichts geschehen.
Wie schon seit Jahrhunderten nicht.
Es war ja nicht so, daß Kamashita ihrem Gott böse wäre, weil er sich nicht um seinen Schrein kümmerte. Doch die Langeweile fraß sie über kurz oder lang auf. Oshiro hatte sie schon mehrfach davon abgehalten, einfach nur noch wild Essen in sich hinein zu stopfen. Jetzt war ihr nur noch die Langeweile geblieben.
Um also diese Einsamkeit ein wenig zu überbrücken, hatte sie sich vorgenommen, sich einmal die Sammlung an heiligen Schriften dieses Schreines näher anzuschauen. Eigentlich eine relativ leichte Sache. So sollte man meinen. Leichte Sache, sollte man meinen.
Pustekuchen.
Natsumi fing mit den modernen Büchern an, die erst dem Schrein überlassen wurden, nachdem er zum Gemeinschaftseigentum avancierte. Da waren Lehrschriften über Medizin vorhanden, über Architektur, und noch ein ganzes Bündel anderer Werke, die man wohl eher als allgemeine Wissenswerke bezeichnen konnte. Keines davon war älter als fünfzig Jahre und auch modern gebunden.
Kamashita scheute sich nicht und las sie trotzdem. Die Universität und die Ausbildung im Seminar war nicht halb so anstrengend gewesen, wie sich in den vergangenen achtzehn Monaten quer durch die Handwerksbücher von einem guten Dutzend Berufe zu quälen. Dafür hatte Natsumi aber inzwischen die Grundregeln der Statik verstanden, und wußte nun auch, daß ein Teil des Schreingeländes deshalb absackte, weil sich unter dem Teilstück eine Wasserblase befand, die langsam instabil wurde. Gleichzeitig hatte sie auch gelernt, daß die Fundamente der drei Schreingebäude teilweise falsch gegossen worden waren.
Wenn dieser winzige Schrein nun genügend Gläubige gehabt hätte, wäre es kein Problem, ihn nicht nur wieder instand zu setzen, sondern ihn auch wieder in einem Glanz erstrahlen zu lassen,den er vielleicht nie zu sehen bekommen hatte.
Blöd war halt nur, daß die umliegenden Familien diejenigen waren, die in erster Hinsicht für den Schrein verantwortlich zeichneten. Zwar alles wohlhabende Familien, sonst hätten sie nicht letztlich auch eine Priesterin für ihren winzigen Schrein bestellen können. Doch diese Familien zeichneten sich durch eines besonders aus: Geiz.
Natsumi hatte also ihre liebe Not, ihre Erkenntnisse bei der richtigen Person anzubringen. Statt dessen bekam sie meist zynische Antworten und den Verweis darauf, daß sie froh darauf sein konnte, frisch vom Seminar an diesen wirklich ruhigen Schrein zu kommen.
Also las sie einfach weiter.
Die nächsten Bücher, die sie fand, waren aus der Edo-Zeit, aus dem Kansai, wenn die Datierung wirklich korrekt war. Es waren Bücher über Heilkunde. So gut wie jede Krankheit, die man entweder durch magischen Einfluß erwerben, oder als Fluch abbekommen konnte, war aufgeführt und dazu eine ziemlich detaillierte Liste der Heilmittel, die mit Garantie funktionierten. In einigen anderen Büchern standen dann natürlich auch die dazugehörenden Rezepte, um die Heilmittel dann auch herstellen zu können. Allein diese alten Schriften waren an für sich gesehen schon kleine Schätze.
Kamashita tat nun etwas, das wirklich außergewöhnlich war. Sie besorgte sich die Werkzeuge, die benötigt wurden, um einige der Heilmittel herstellen zu können und begann, allein um sich ein wenig abzulenken, damit einfache Wundsalben herzustellen.
Oft genug war sie dann auch gezwungen, sie an Oshiro zur Anwendung zu bringen. Viele der Mittelchen, die sie so mischte, funktionierten auch. Andere versagten völlig, sorgten nur für eine wirklich sanfte und glatte Haut.
Nun war in Kamashita der Ehrgeiz geweckt.
Gegen den Willen der Schreinbewahrer stellte sie eine weitere Kraft ein, der sie einmal beibrachte, die Salben und Wundmittel herzustellen. Und dann wurde diese Kraft auch noch angewiesen, mit einem kleinen Brustkoffer diese Dinge auf der Straße vor dem Schrein zu verkaufen. Eigentlich eine Aufgabe, die die Schreindienerin hätte übernehmen müssen.
Doch Natsumi sah das völlig anders. Im Laufe der Zeit brachte sie Oshiro bei, wie sie einige der Mittelchen selbst herstellen konnte. Noch überraschender war, daß in diesen ersten todlangweiligen achtzehn Monaten am Schrein, sich nun endlich auch ein kleiner Geldsegen einstellte. Die bezahlte Kraft wollte ja bezahlt werden, also verlangte sie für die Salben und Wundmittelchen bald auch entsprechende Preise.
Und die Mittel verkauften sich.
Zuerst nur ein wenig, doch dann immer besser. Immer öfter kamen vormalige Käufer wieder vorbei, um sich Nachschub zu holen. Immer öfter betraten auch Neugierige den Schrein und ließen Spenden zurück. Oshiro hatte genug damit zu tun, hinter dem Ansturm hinterher zu räumen.