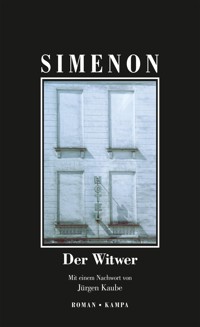
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georges Simenon
- Sprache: Deutsch
Hôtel Gardénia in der Nähe der Champs- Élysées: In Zimmer 44 liegt eine Frau tot im Bett, sie trägt ein weißes Seidenkleid, in den Händen hält sie einen Strauß verwelkter Rosen, auf einem kleinen Tisch steht eine leere Champagnerflasche. Jeanne hat sich mit Schlaftabletten das Leben genommen. Und ihr Mann Bernard versteht die Welt nicht mehr. Was hat seine Frau in diesem Hotel gemacht, woher hatte sie das teure Kleid? Acht Jahre ist es her, dass er Jeanne vor einem brutalen Zuhälter gerettet hat, sie bei sich aufgenommen hat. Ihre Ehe war doch gut, vielleicht nicht leidenschaftlich, aber Bernard war glücklich. Und Jeanne, war sie es nicht auch? Für die Polizei ist der Fall schnell erledigt: eindeutig Selbst- mord. Aber nicht für Bernard. Spät, zu spät muss er erkennen, dass er nichts gewusst hat über seine Frau, ihre Wünsche, ihre Vergangenheit. Bernard blickt in einen Abgrund. Und der Richter, dem er sich stellen muss, ist er selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 95
Georges Simenon
Der Witwer
Roman
Aus dem Französischen von Hansjürgen Wille, Barbara Klau und Heiko Arntz
Kampa
Für
Pierre Nicolas Chrétien Simenon
Erster TeilDie eigenen vier Wände
1
Er war so ahnungslos, wie es Reisende sind, die in einem Zug wenige Augenblicke vor der Katastrophe im Speisewagen essen, lesen, schwatzen, vor sich hin dösen oder die vorübergleitende Landschaft betrachten. Ohne sich über die Ferienstimmung zu wundern, die in Paris von einem Tag zum anderen eingekehrt war, ging er seines Weges. Ist es nicht jedes Jahr zu dieser Zeit so, wenn die Tage heiß werden und die Kleidungsstücke unangenehm an der Haut kleben?
Um sechs Uhr nachmittags lebte er noch in einer Art Unschuld, die sich vor allem in einer gewissen Leere zeigte. Was hätte er antworten können, wenn man ihn unversehens gefragt hätte, woran er denke, während er, der die meisten Passanten überragte, mit großen, ein wenig müden Schritten dahinschlenderte?
Was hatte er von der Rue François-Ier gesehen, wo er mehr als eine Stunde in den Büros seine Arbeit präsentiert hatte, vom Faubourg Saint-Honoré, wo ihm ein Scheck ausgestellt worden war, und dann auf dem langen Weg bis zur Druckerei, der Imprimerie de la Bourse, und von dort bis zur Porte Saint-Denis?
Es wäre ihm schwergefallen, die Frage zu beantworten. Er hatte die Touristenbusse gesehen, vor allem an der Madeleine und der Oper, gewiss, aber keiner war ihm besonders aufgefallen, und er hätte nicht sagen können, welche Farbe sie hatten. Sie mochten blau, rot, gelb gewesen sein. Und auf den Gehsteigen gingen Männer ohne Jackett, ohne Krawatte, in kurzärmeligen Hemden, mit offenem Kragen, und hier und dort begegnete man Amerikanern in cremefarbenen Anzügen.
Er hatte nichts genau wahrgenommen. Oder vielmehr doch. In der Rue du 4 Septembre war er ein erstes Mal stehen geblieben, um sich das Gesicht zu wischen, denn er schwitzte sehr stark, er trug im Sommer und Winter denselben Anzug. Aus Diskretion, aus Scham hatte er so getan, als betrachte er ein Schaufenster. Es war zufällig das eines Hutmachers, und unter all den ausgestellten Hüten war sein Blick von einem flachen Strohhut angezogen worden, dem einzigen in diesem Fenster. Er ähnelte dem, den sein Vater in Roubaix trug, wenn er am Sonntagvormittag mit den Kindern an der Hand spazieren ging. Eine Sekunde lang hatte er sich gefragt, ohne dem viel Bedeutung beizumessen, ob »Kreissägen« wieder in Mode kamen, ob er die Mode mitmachen und wie er mit einem solchen Hut wohl aussehen würde.
Ein zweites Mal war er vor einer roten Ampel stehen geblieben, und in der Kolonne der Wagen, die im Schritt fuhren, hatte er einem Mann nachgeblickt, der einen Handkarren mit einer Kiste schob, die groß genug war, um ein Klavier zu transportieren. Der Gedanke an das Klavier hatte ihn einige Sekunden beschäftigt, dann hatte er kopfschüttelnd eine junge Frau gemustert, die sehr wenig anhatte und in einem riesigen offenen Wagen saß.
Er hatte diese Bilder nicht miteinander verbunden, hatte keinen Schluss gezogen. Er hatte bestimmt die Straßencafés gesehen und jedes Mal, wenn er an einem vorüberkam, den Geruch von Bier wahrgenommen. Was würde ihm noch einfallen, selbst wenn er angestrengt nachdächte? Es war fast, als hätte er vorübergehend gar nicht gelebt.
Und in seinem Viertel, das ihm noch vertrauter war und wo er all das, was ihn umgab, für selbstverständlich nahm, hatte er überhaupt nichts gesehen.
Seine Wohnung im zweiten Stock eines Hauses am Boulevard Saint-Denis, zwischen einer Brasserie und einem großen, auf Pendeluhren spezialisierten Geschäft, konnte er durch zwei Eingänge erreichen. Gleich neben der Brasserie führte eine niedrige Toreinfahrt, ein dunkler, feuchter Tunnel, den die Vorübergehenden nicht bemerkten, auf einen zwei mal drei Meter großen gepflasterten Hof, zu dem hin die Loge der Concierge lag, hinter deren schmutzigen Scheiben das ganze Jahr hindurch Licht brannte.
Er konnte aber auch durch die Rue Sainte-Apolline und hinter der Werkstatt des Transportverpackers einen Flur betreten, der mehr einem richtigen Hauseingang glich.
Hätte man ihn ein paar Monate später, zum Beispiel vor dem Schwurgericht, gefragt, hätte er gezögert, unter Eid zu versichern, dass er den einen und nicht den anderen Eingang benutzt habe.
Aber man würde ihn nicht befragen. Es war überhaupt nicht die Rede davon. Der Weg, den er gegangen war, hatte ebenso wenig Bedeutung wie die Tatsache, ob die Concierge in ihrem Loch gehockt hatte oder nicht.
Die Treppe war dunkel. Manche Stufen knarrten mehr als andere. Er kannte sie. Er kannte die Wände mit ihrem tristen Gelb und die beiden braunen Türen im ersten Stock. An der Tür rechts hing ein Emailleschild: Maître Gambier, Gerichtsvollzieher. Hinter der Tür links hörte man Lachen und Singen. Da manchmal diese Tür offen gestanden hatte, wusste er, dass dort etwa zehn Mädchen künstliche Blumen herstellten.
Genauso langsam und bedächtig, wie er durch die Straßen ging, ging er auch die Treppe hinauf. Die Leute, die glaubten, er versuche sich auf diese Weise eine gewisse Feierlichkeit zu geben, täuschten sich. Sein Gang war auch nicht seiner Beleibtheit, seinem Körpergewicht geschuldet. Er hatte sich diesen Gang mit zwölf Jahren angewöhnt, als er es satthatte, von seinen Kameraden als Klumpfuß verspottet zu werden.
»Warum lassen Sie ihn nicht Schuster werden?«, hatte er einmal eine Nachbarin zu seiner Mutter sagen hören. »Die meisten Klumpfüße werden Schuster.«
Er hatte eigentlich keinen Klumpfuß. Ein Bein war von Geburt an ein wenig schwächer und kürzer als das andere, und schon als er noch ein kleiner Junge war, hatten ihm seine Eltern orthopädische Schuhe gekauft mit Metallschienen in dem einen Schuh. Ganz von selbst und ohne jemandem etwas davon zu sagen, hatte er sich beigebracht, auf eine bestimmte Art zu gehen, und schon nach einigen Jahren konnte er Schuhe tragen, die gewöhnlichen Schuhen glichen. Er hinkte nicht mehr.
Er dachte an diesem Tag nicht daran, dachte überhaupt an nichts Besonderes. Er war nicht müde. Er hatte keinen Durst, obwohl er in kein Café eingekehrt war.
Weder in der Rue François-Ier bei Art et Vie, wo man seine Entwürfe angenommen hatte, noch bei den Gebrüdern Blumstein im Faubourg Saint-Honoré, wo er seinen Scheck in Empfang genommen hatte, hatte sich etwas Unangenehmes ereignet, und schon gar nicht in der Imprimerie de la Bourse, wo er in den fast leeren Büros das Layout für eine Reklamebroschüre fertig gemacht hatte.
Auf dem Treppenabsatz griff er nicht wie gewöhnlich nach seinem Schlüssel, den er an einer Kette in der Hosentasche trug. Jeanne war ja zu Hause. Er drückte die Klinke herunter. Der Luftzug verriet, dass zumindest ein Fenster offen stand, und auch das überraschte ihn nicht. Der Lärm des Boulevard Saint-Denis drang in die niedrigen Zimmer, die eine Art Resonanzkörper bildeten, und weil er daran gewöhnt war, störte ihn das nicht mehr. Er war gegen Lärm unempfindlich. Auch gegen Luftzug. Und abends und nachts merkte er gar nicht mehr, wenn das lila Neonschild über dem Uhrengeschäft wie ein Leuchtturm immer wieder aufblitzte.
Während er seine lederne Aktentasche und dann seinen Hut auf den Zeichentisch legte, sagte er aus Gewohnheit:
»Ich bin’s.«
Und damit begann zweifellos das Drama, jedenfalls für ihn. Die Tür zum Esszimmer stand offen, und er erwartete, das Rücken eines Stuhls zu hören, Schritte, Jeannes Stimme als Echo auf die seine. Er wartete reglos, erstaunt, aber ohne Unruhe.
»Bist du da?«
Selbst wenn sie in der Küche gewesen wäre, hätten Geräusche es verraten, denn bis auf das Zimmer, das er sein Atelier nannte, waren alle Räume der Wohnung winzig. Er konnte sich später nicht erinnern, was er in jenem Augenblick gedacht hatte. Er war schließlich auf die Tür zugegangen. Der Anblick des Esszimmers hatte ihn unangenehm berührt. So wie sein Atelier, das er auch als Schlafzimmer benutzte, kein richtiges Atelier war, war das Esszimmer ebenfalls kein richtiges Esszimmer.
Gewiss, sie nahmen hier die Mahlzeiten ein, aber Jeannes zusammenklappbares Eisenbett stand an der Wand und war von einer alten roten Samtdecke notdürftig verhüllt. In einer Ecke stand neben dem Radio eine Nähmaschine, und an manchen Tagen wurde das Bügelbrett aus dem Wandschrank geholt.
Er hätte mindestens eine Art Unordnung vorfinden müssen, je nachdem, was Jeanne an diesem Nachmittag getan hatte – den abgenommenen Deckel der Nähmaschine, herumliegende Stoffe und Garne, oder auf dem Tisch Schnittmuster aus braunem Papier, Modezeitschriften, oder Erbsen, die darauf warteten, gepalt zu werden. In der winzigen Küche mit der runden Dachluke statt eines Fensters war niemand, und es stand auch kein Topf auf dem Gasherd, kein Geschirr im Spülstein, und auf dem mit einem karierten Wachstuch bezogenen Tisch lag nicht einmal ein Messer.
Sie hatte ihm nichts gesagt. Sie war auch nicht im Badezimmer, das er mit so viel Mühe vor sechs Jahren in der ehemaligen Dunkelkammer eingerichtet hatte.
Er ging wieder in sein Zimmer, das heißt in das Atelier, hängte den Hut an seinen Platz hinter der Tür, über den Regenmantel, den er seit drei Wochen nicht hatte anzuziehen brauchen.
Ehe er sich setzte, wischte er sich den Schweiß aus dem Gesicht, und sein Blick glitt über die Dächer der Autobusse und dann über eine Menschentraube, die sich an der Ecke des Boulevards plötzlich in Bewegung setzte, um die Kreuzung zu überqueren.
Er wusste nicht, was er tun sollte. Er lehnte sich zurück in seinem Ledersessel, streckte die Beine aus und starrte auf die Uhr mit dem Messingpendel ihm gegenüber an der Wand, auf der es halb sieben war. Ohne nachzudenken, tastete er auf dem Tisch mit der Hand nach der Abendzeitung, die dort hätte liegen müssen, denn für gewöhnlich ging Jeanne gegen fünf Uhr hinunter, um Kleinigkeiten für das Abendessen zu holen.
Es war verwirrend. Noch nicht dramatisch oder beängstigend. Es war nur ein unangenehmes Gefühl. Er mochte es nicht, enttäuscht zu werden, und er ließ sich nur ungern in seiner Ruhe stören, auch nicht von Jeanne. Er steckte sich eine Zigarette an. Er rauchte zehn am Tag. Er hatte einen empfindlichen Hals und war, ohne es zu übertreiben, sehr auf seine Gesundheit bedacht. Hin und wieder zuckte er zusammen: Die Geräusche, die in die Wohnung drangen, klangen anders als sonst.
Er vermisste Jeannes Hin-und-her-Gehen in der Küche, ihre Gestalt im Türrahmen, von wo aus sie ihn manchmal stumm betrachtete. Wenn sie auch beide wenig sprachen, jeder wusste jederzeit, in welchem Zimmer der andere gerade war und was er tat.
»Sie wird zu Mademoiselle Couvert hinaufgegangen sein!«, sagte er sich schließlich, erleichtert.
Dumm, dass er nicht eher daran gedacht hatte. Mademoiselle Couvert, die fünfundsechzig Jahre alt war und ihrer Augen wegen kaum noch die Wohnung verließ, wohnte genau über ihnen. Seit vier Jahren lebte ein Kind bei ihr, das gewiss zu ihrer Familie gehörte, eine Waise, wenn Jeanne es richtig verstanden hatte.
Wenn er nicht genauer über den Jungen informiert war, so darum, weil er nur mit halbem Ohr den Erklärungen lauschte, die man ihm gab, weniger aus Gleichgültigkeit gegen die anderen als aus Diskretion, aus Scham.
Der Junge hieß Pierre, war zehn Jahre alt und bat oft, herunterkommen und sich zu Jeanne setzen zu dürfen, um seine Schularbeiten zu machen.
Manchmal ging Jeanne auch hinauf, um der alten Mademoiselle Couvert zu helfen, die zwar noch nähte, aber nicht mehr zu schneidern wagte.
Es war einfach. Er brauchte nur auf den Esszimmertisch zu blicken. Sicherlich hatte sie, wie sie es immer in solchen Fällen tat, einen Zettel dorthin gelegt: Bin bei Mademoiselle Couvert. Komme gleich wieder.
Er war dessen so sicher, dass er erst seine Zigarette zu Ende rauchte, ehe er ins Esszimmer ging. Aber auf dem Tisch lag kein Zettel. Er blickte in den Wandschrank. Seine Frau hatte nicht viele Kleider, sodass es nicht schwer war, herauszubekommen, welches sie an diesem Tag trug. Außerdem hatte er, da sie ihre Kleider und Mäntel selber machte, die Stoffe tage- und manchmal wochenlang vor Augen und erlebte mit, wie sie allmählich Form annahmen. Auf jeden Fall hatte sie sich nicht für einen regelrechten Ausgang angekleidet, für das, was sie »in die Stadt gehen« nannte, denn ihre beiden guten Kleider hingen dort ebenso wie ihr strohgelbes Sommerkostüm. Sie hatte gewiss das kleine schwarze Kleid an, das sie eigentlich nur noch zu Hause trug, und dazu alte Schuhe, die ihr als Pantoffeln dienten.
Sie war also irgendwo im Viertel. Oder aber sie befand sich oben und hatte vergessen, den Zettel für ihn hinzulegen. Er hätte hinaufgehen und an Mademoiselle Couverts Tür klopfen können. Aber da er das noch nie getan hatte, war es ihm peinlich. Er konnte auch hinuntergehen und die Concierge fragen. Allerdings sprachen sie und Jeanne nicht miteinander, und wenn man zur Rue Sainte-Apolline hinausging, kam man nicht an ihrer Loge vorbei. Dies war kein Haus wie die anderen. Die Concierge war nur nebenher Concierge, meist half sie ihrem Mann auf dem feuchten Hof bei der Reparatur von Stuhlgeflecht, und in der Loge sortierte sie nur die Post der Mieter.
Da er schon aufgestanden war, ging er in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. Er ließ den Hahn ziemlich lange laufen, damit das Wasser schön kalt war.
Der Gedanke, zu arbeiten oder zu lesen, kam ihm nicht. Er zögerte, sich wieder zu setzen. Sein Atelier erschien ihm weniger einladend als an anderen Tagen. Und dennoch kannte er es in- und auswendig. Er hatte jeden Gegenstand, selbst den bescheidensten, so gestellt, dass ihn sein Anblick befriedigte.
Aus den vier Wänden – vielmehr sechs, denn zur Rue Sainte-Apolline hin gab es eine Nische, eine Art Alkoven, wo die Couch stand, auf der er schlief – hatte er sich eine Welt geschaffen, die ihm behagte und die ihm entsprach. Die Wände waren grellweiß gestrichen wie in einer Mönchszelle. Zwei Zeichentische, ein großer und ein kleiner, ließen an ein friedliches, mit Bedacht ausgeführtes harmonisches Handwerk denken.
Er malte zwar keine Madonnen im Stil von Fra Angelico, aber er zeichnete mit der gleichen Inbrunst Buchstaben und Titel für Luxuszeitschriften wie Art et Vie und Initialmajuskeln und Vignetten für Bücher mit kleiner Auflage.
Außerdem arbeitete er schon seit mehreren Jahren an einer neuen Schrift, wie sie nur einmal in zwanzig oder fünfzig Jahren geschaffen wird, einer Schrift, die seinen Namen tragen würde.
In den Druckereien und den Redaktionen würde man dann von der »Jeantet« sprechen, so wie man jetzt von der »Elzevir«, der »Auriol«, der »Naudin« sprach.
An den Wänden hingen schon Buchstaben in großem Format, von schönem Schwarz, mit Tusche gezeichnet.
Er sah sie nicht, sah auch nicht mehr die silbernen Autobusse, die von oben gesehen Walfischen glichen, noch die Porte Saint-Denis, die in der Sonne wie Terrakotta leuchtete.
Schließlich setzte er sich doch wieder. »Sein« Sessel, den er nach monatelanger Suche auf dem Flohmarkt entdeckt hatte, hatte eine Geschichte. Jeder Gegenstand hier hatte eine, auch die Louis-Philippe-Uhr mit dem graugrünen Zifferblatt und den römischen Ziffern, die jetzt sieben Uhr zeigte.
Man hielt ihn oft für einen Weichling, wie er wusste. Und nicht zu Unrecht. Sein großer Körper schien keine Festigkeit zu haben. Er war zwar nicht dick und erst recht nicht fettleibig, aber ihm schien ein stabiles Knochengerüst zu fehlen. Alles an ihm war rund und weich, und schon als Junge war er in den Pausen in der Schule schneller außer Atem geraten als die anderen.
Die Leute ahnten nicht, dass er ebenso nervös war wie sie, ja noch nervöser vielleicht, dass er bei der geringsten Erregung von einer inneren Panik geschüttelt wurde. Sein Blut schien dann nicht mehr normal zu fließen. Vage und geheimnisvolle Dinge bewegten sich in seiner Brust. Manchmal schmerzte ein Finger wie in einem Krampf, dann plötzlich versteifte sich die eine Schulter, und fast immer endete es mit einer unangenehmen Hitze im Hinterkopf.
Ihn erschreckte das nicht. Er sprach mit niemandem darüber, nicht einmal mit dem Arzt und schon gar nicht mit Jeanne. Er wurde von selbst wieder ruhig. Schon lange übrigens hatte er das nicht erlebt, oder aber es war nur ein leichter Anfall gewesen, infolge einer Verärgerung oder einer Demütigung. Aber »Demütigung« war nicht das richtige Wort. Der Anfall kam immer dann, wenn er den Eindruck hatte, dass man ihn verkannte, dass man ihn ungerecht behandelte, dass man es darauf anlegte, ihm wehzutun. Er hätte nur ein Wort zu sagen brauchen. Er suchte es, bemühte sich, es auszusprechen, und es war das Gefühl seiner Ohnmacht, das plötzlich die Katastrophe auslöste.
Im Augenblick war es nicht so. Es geschah nichts. Jeanne würde zurückkommen. Er horchte auf ihre Schritte im Treppenhaus, malte sich aus, wie sie heraufkam, auf dem Treppenabsatz stehen blieb, ihre Handtasche öffnete …
Ein Detail war ihm nicht geheuer: Er hatte seinen Schlüssel nicht gebraucht, um hereinzukommen, und er erinnerte sich nicht, dass Jeanne auch nur ein einziges Mal ausgegangen war, ohne die Tür zweimal abzuschließen.
»In einem Viertel wie diesem …«, sagte sie.
Er hatte nie Angst vor Einbrechern gehabt.
Er wartete jetzt schon mehr als eine Stunde, also war sie ausgegangen. Es war etwas geschehen, gewiss nichts Ernstes, aber etwas Unvorhergesehenes. Er konnte es in seinem Sessel nicht mehr aushalten. Weil ihm der Hals wie zugeschnürt war, ging er in die Küche, um ein zweites Glas Wasser zu trinken, und dann verließ er die Wohnung ohne Hut und ohne die Tür abzuschließen.
Da er noch nicht wagte, zu Mademoiselle Couvert hinaufzugehen, schlich er die beiden Stockwerke hinunter und auf den kleinen Hof, auf den die Lampe der Loge hinter der schmutzigen Scheibe einen gelben Fleck warf. Er klopfte, ohne hineinzusehen, denn ein kurzer Blick hatte ihm gezeigt, dass auf einem Stuhl neben dem bereits zum Abendbrot gedeckten Tisch ein Mann saß und ein Fußbad nahm.
»Mélanie!«, rief der Mann, ohne sich zu rühren.
Und hinter dem Vorhang, der als Trennwand diente, sagte eine Stimme:
»Was ist?«
»Ein Mieter.«
»Was will er?«
»Ich weiß es nicht.«
Das war seine erste Überraschung, und er hatte das Gefühl, eine Entdeckung zu machen. Allerdings klopfte er auch nur selten an die Tür der Loge. Aber jetzt sah er plötzlich zwei Menschen, die in dieser schlecht beleuchteten Höhle lebten, kaum zwanzig Meter vom Boulevard entfernt, wo Menschen vorüberhasteten oder auf der Terrasse der Brasserie saßen und wo samstagabends und am Sonntag ein aus vier oder fünf Musikern bestehendes Orchester spielte.
Die Frau kam aus dem Dunkel, klein und gekrümmt und mit dem starren Blick eines Tiers, das auf der Hut ist. Sie öffnete nicht die Tür, sondern nur ein kleines Fenster, das einem Schalter glich.
»Wenn ich Post für Sie hätte, hätte ich sie hinaufgebracht.«
»Ich wollte Sie fragen …«
»Na, was denn? Was wollen Sie?«
Er war bereits entmutigt.
»Nur, ob Sie meine Frau haben ausgehen sehen …«
»Ich kümmere mich nicht um das Kommen und Gehen der Mieter und schon gar nicht darum, was die Frauen tun.«
»Sie hat Ihnen wohl nichts gesagt?«
»Wenn sie etwas gesagt hätte, dann hätte ich es Ihnen wohl ausgerichtet!«
»Ich danke Ihnen.«
Er sagte das nicht ironisch, sondern aus Gewohnheit, weil er nun einmal höflich war. Sie hatte ihn gerade ohne Grund beleidigt. Er war ihr nicht böse. Wenn jemand unrecht hatte, dann er. Er ging durch die Toreinfahrt auf den strahlend erhellten Boulevard und, um seine Nerven zu beruhigen, durch die Porte Saint-Denis zur Rue Sainte-Apolline.
Es war ein wenig, als sähe man eine Theaterkulisse von hinten. Die Häuser wirkten von hinten anders als von vorn. Am Boulevard Saint-Denis sah man verlockende Schaufenster, elegante Restaurants und am Abend jede Menge Leuchtreklamen in allen möglichen Farben.
Rue Sainte-Apolline – Handwerker, die Werkstatt des Verpackers, ein Stück weiter der Laden eines Flickschusters neben einer Wäscherei, in der Frauen den ganzen Tag bügelten, während auf dem Gehsteig gegenüber zwei oder drei Mädchen in Schuhen mit sehr hohen Absätzen vor einem kleinen Hotel auf und ab gingen und Männer im Halbdunkel einer Bar Karten spielten.
Niemand kannte ihn. Aber er kannte jeden, jede Gestalt, jedes Gesicht, weil er sie alle vom Fenster seines Ateliers aus beobachtet hatte.
War Jeanne womöglich, während er diesen Rundgang machte, nach Hause zurückgekehrt? Um seine Chancen zu vergrößern, beschloss er, den Weg noch ein-, zweimal zu machen. Beim dritten Mal blieb er vor dem Käsegeschäft stehen, in dem Jeanne regelmäßig einkaufte und das noch geöffnet war. Es gab dort nicht nur Käse, Butter, Eier, sondern auch Gemüsekonserven für Leute, die keine Zeit zum Kochen haben oder in Hotelzimmern wohnen, wo sie nicht kochen dürfen.
»Haben Sie zufällig meine Frau gesehen, Madame Dorin?«
»Nur heute früh, als sie ihre Besorgungen gemacht hat.«
»Vielen Dank.«
»Sie machen sich doch nicht etwa Sorgen?«
»Nein, natürlich nicht.«
Aber während er das sagte, hätte er am liebsten vor Angst geweint. Wieder erlebte er jene Ohnmacht, unter der er so litt. Jeanne war irgendwo. Es war gewiss nichts Ernstes – sie hatte sich verspätet, hatte etwas vergessen, ein Missverständnis, ein Missgeschick.
Warum sollte er nicht wieder hinaufgehen und, während er auf sie wartete, essen, was er im Speiseschrank fand? Oder ins erstbeste Restaurant gehen? Oder aber, wenn er keinen Hunger hatte, in seinem Sessel lesen?
Er vergaß die Abendzeitung zu kaufen, ging in die Wohnung hinauf, in der immer noch niemand war und in der sich eins der Fenster rot färbte. Der Tag kam ihm länger vor als die anderen. Es war fast acht Uhr, und die Sonne war immer noch nicht untergegangen. In den Straßencafés tranken die Leute immer noch Bier und Aperitifs, und Männer promenierten immer noch in Hemdsärmeln. Jeanne litt nicht an Schwindelanfällen. Es war unwahrscheinlich, dass sie auf der Straße ohnmächtig geworden war, und selbst wenn – sie hatte immer ihren Personalausweis bei sich, und seit zwei Jahren hatten sie in der Wohnung Telefon.
Er starrte auf den Apparat auf dem Tisch und runzelte die Brauen. Wenn sie aufgehalten worden war, warum hatte sie dann nicht angerufen?
Ging sie davon aus, dass er sich bei Mademoiselle Couvert erkundigen würde? Hatte sie ihm also dort eine Nachricht hinterlassen?
Er glaubte es nicht, ging aber trotzdem diese ihm unbekannte Treppe hinauf, sah neben ihrer Wohnungstür ein Blechschild mit dem Namen der alten Jungfer, mit dem Zusatz: Schneiderin.
Während er noch zögerte zu klopfen, hörte er das Geklapper von Besteck und die Stimme des kleinen Pierre, der beharrlich fragte:
»Darf ich runtergehen?«
»Ich weiß nicht recht. Vielleicht.«
»Meinst du eher ja oder eher nein?«
»Vielleicht. Ich würde es dir ja gern erlauben.«
»Warum tust du es dann nicht?«
Er klopfte, verlegen darüber, sie unfreiwillig belauscht zu haben.
»Ich mach auf«, rief der Junge.
Im nächsten Moment wurde die Tür weit aufgerissen, und die Seiten einer Illustrierten, die auf einem kleinen Tisch lag, und selbst die grauen Haare der alten Frau, die aufgehört hatte zu essen, bewegten sich im Luftzug.
»Es ist Monsieur Bernard!«, verkündete Pierre.
»Entschuldigen Sie … Ich wollte nur fragen, ob meine Frau zufällig eine Nachricht für mich hinterlassen hat.«
Der Junge musterte ihn mit einem durchdringenden Blick, der nichts Kindliches hatte. Dann sah er zu Mademoiselle Couvert, unsicher, ob er die Tür wieder schließen sollte.
»Ist sie noch nicht zurück?«, fragte die Schneiderin verwundert.
»Nein. Und ich frage mich …«
Wozu es erklären? Jeanne und er hatten Gewohnheiten, die vielleicht etwas sonderbar waren und die andere zu einem Lächeln reizen konnten. Der Mittwoch war sein Tag, der Tag, an dem er zu den Verlagshäusern ging, für die er arbeitete, so wie er es heute Nachmittag getan hatte.
Es gab keinen Grund, dass Jeanne, wenn sie Besorgungen zu machen hatte, nicht am selben Tag ausging. Aber seit acht Jahren war das seines Wissens kein einziges Mal geschehen.
Im Übrigen verließ sie selten das Viertel, und wenn sie es tat, sprach sie schon Tage vorher davon, da es sich dann





























