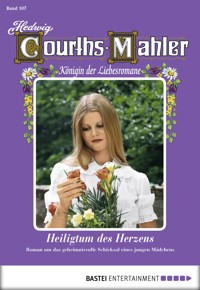Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine spannende Liebesgeschichte rund um die klassischen Themen: Ehre, Liebe und Eifersucht. Konsul Albert Henrici umwarb in seinen jungen Jahren zahlreiche Frauen, ohne dabei Rücksicht auf das Ansehen eines anderen Mannes zu nehmen. Nun, nachdem er mit der schönen Vera verheiratet ist, hat er Angst, sie an einen Liebhaber zu verlieren. Und dann begegnet seiner jungen Ehefrau Heinz Althoff...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Des anderen Ehre
Saga
Des anderen Ehre
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1928, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950281
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Ronsul Henrici öffnete die Tür zum Boudoir seiner Frau. „Bist du fertig, Vera?“
Vera Henrici stand mitten im Zimmer. Eine Crep de chine-Toilette fiel in weichen Falten von ihren Schultern herab. Sie war in mattweissen und lichtgrauen Tönen gehalten und brachte die blühende Schönheit der jungen Frau zur vollsten Geltung. Wie eine fremde Wunderblume, von Duft und Liebreiz umwoben, stand Vera in anmutiger Haltung und prüfte ihr Spiegelbild. Vor ihr kniete ihre Zofe und befestigte am Saum des Kleides eine gelöste Ranke von Blütenknospen. Neben ihr stand ihre Gesellschafterin, Fräulein Helma Olfers, und entnahm einer Kassette von silberbeschlagenem Ebenholz Veras Schmuck.
„Nur einige Minuten noch Geduld, Albert, gleich bin ich bereit,“ rief Vera ihrem Gatten zu, ohne den Blick von ihrer eigenen Erscheinung abzuwenden.
Albert Henrici warf einen aus Lust und Schmerz gemischten Blick auf seine schöne Frau, dann trat er zurück und schloss die Tür. Langsam schritt er im Nebenzimmer über den dicken Teppich. In seinem scharfgeschnittenen, charaktervollen Gesicht zuckte es wie verhaltene Erregung. Mit nervösen Fingern strich er über das kurzgehaltene, an den Schläfen schon graumelierte Haar. Dann liess er sich wie müde in einen Sessel fallen. Die schlanke, sehnige Gestalt sank wie haltlos in sich zusammen, und das Gesicht zeigte in diesem Augenblick des Sichgehenlassens schlaffe Züge.
Wer von seinen Bekannten ihn so gesehen, hätte in ihm kaum den sonst so stattlichen, elastischen Mann erkannt, dessen geistvolle Liebenswürdigkeit und Frische überall bewundert wurde. Trotzdem Henrici schon nahe den Fünfzig war, behauptete er sich sonst mit seiner eleganten Erscheinung selbst an der Seite seiner um fünfundzwanzig Jahre jüngeren Gattin. Der Altersunterschied kam kaum jemand zum Bewusstsein, wenn man diese beiden Menschen zusammen sah.
Jetzt freilich hätte ein scharfer Beobachter in seinen Zügen und den umflort blickenden Augen wohl die Zeichen des nahenden Alters erblickt.
Henrici war in seiner Jugend einer von den Männern gewesen, die das Leben mit vollen Sinnen auskosten. Sonst ein Ehrenmann im strengsten Sinne des Wortes, gab es auch bei ihm, wie bei so vielen seiner Art, eine Stelle, wo er nicht einwandfrei empfand und handelte. In bezug auf die Frauen war sein Gewissen sehr dehnbar. „Des Andern Ehre“ galt ihm nichts, wenn es sich um eine begehrenswerte Frau handelte.
Übersättigt von der Gunst der Frauen, die dem reichen und interessanten Manne im Übermass zuteil wurde, reizte ihn eine Liaison nur noch, wenn sie mit einiger Gefahr verknüpft war, wenn sie zu den verbotenen Früchten gehörte. Aber dann kam ein Tag, der ihn emporschreckte aus diesem leichtsinnigen, gewissenlosen Genussleben.
Ein beleidigter Ehemann forderte ihn vor die Pistole. Das Duell sollte wohl ein Gottesgericht sein. Aber wie so oft, entschied es auch in diesem Falle ungerecht. Albert Henrici schoss seinen Gegner durch die Brust. Er hatte es nicht gewollt, in der Erregung des Augenblickes hatte er kaum gezielt; seine Hand war unsicher. Wie durch einen Nebel sah er seinen Gegner wanken und fallen. Erschrocken taumelte er vorwärts. Da traf ihn der letzte Blick seines Opfers mit wilder Anklage. Diesen Blick vergass Albert Henrici nie. Noch heute verfolgten ihn die brechenden Augen des Sterbenden bis in seine Träume.
Seit jener Stunde war er ein anderer geworden. Während der Festungshaft, die wegen des Duells über ihn verhängt wurde, quälte ihn sein erwachtes Gewissen Tag und Nacht. Er machte sich selbst die bittersten Vorwürfe, es so leicht genommen zu haben mit des Andern Ehre.
Nach verbüsster Haft schickte ihn sein Vater, ein mehrfacher Millionär, auf Reisen. Es sollte Gras über die Angelegenheit wachsen, und vor allen Dingen wollte sein Vater verhindern, dass er mit der Frau, um deretwillen das Duell ausgefochten wurde, wieder in Berührung kam.
Albert Henrici wäre ihr indessen auch ohnedies fern geblieben. Sie war ihm nichts mehr als eine Zeugin seiner Schuld. Und als er nach Jahren von ihrer Wiederverheiratung hörte, berührte ihn das kaum.
Überhaupt — seit dem Duell waren ihm die Frauen gleichgültig geworden. Er ging ihnen aus dem Wege, wo er konnte. Seit seiner Weltreise, die sich auf zwei Jahre erstreckte, hatte sich sein Sinn ernsteren Zielen zugewandt. Das Inhaltlose seines Lebens war ihm zum Bewusstsein gekommen.
Als er nach zwei Jahren nach Europa zurückkehrte, nahm er einen mehrjährigen Aufenthalt in Italien, um dort die Geschäfte seines Vaters zu vertreten. Er kam immer nur besuchsweise heim zu seinen Eltern. Bei dieser Gelegenheit versuchten sie, ihn zu einer Heirat zu bewegen — aber er mochte nichts davon hören. Wohl hätte er jetzt, nun er das Leben ernster auffasste, gern eine eigene Familie gegründet. Aber eine Stimme in seinem Innern sprach ihm unaufhörlich von Vergeltung. Er wagte nicht, eine Frau zur Hüterin seiner Ehre zu machen. An die absolute Treue einer Frau glaubte er nicht. Und warum sollte ihm nicht mit demselben Mass gemessen werden, mit dem er gemessen hatte?
So blieb er unverheiratet, zum Schmerze seiner Eltern.
Sie starben ihm kurz nacheinander, als er bereits über vierzig Jahre zählte. Kurz zuvor war er für immer nach L . . . . . zurückgekehrt, um in seiner Vaterstadt das italienische Konsulat zu übernehmen.
Nach dem Tode seiner Eltern wohnte er allein mit der Dienerschaft in der grossen, vornehmen Villa am Stadtwald, die sein Vater hatte erbauen und mit allen Bequemlichkeiten versehen lassen.
Natürlich fehlte es nicht an Versuchen, ihn in Hymens Fesseln zu schlagen. Freunde und Bekannte wetteiferten mit töchtergesegneten Müttern, ihn unter die Haube zu bringen. Aber umsonst — er blieb ledig.
Aber eines Tages ereilte ihn doch das Geschick. Gelegentlich eines Besuches auf dem Landsitz eines Freundes lernte er eine junge Dame kennen, die mit ihrer Mutter gleichfalls dort zu Besuch war. Er wusste nicht, dass dies Zusammentreffen nicht ganz zufällig war. Die Gattin seines Freundes hatte Vera Böhmer mit ihrer Mutter absichtlich zu gleicher Zeit eingeladen. Veras Mutter war die verarmte Witwe eines hohen Beamten, die nur über eine schmale Pension verfügte. Entfernt verwandt mit der Gastgeberin, hatte sie dieser ihren Wunsch ausgedrückt, Vera mit einem vermögenden Mann zu verheiraten. Konsul Henrici wurde als glänzende Partie für die junge Dame in Aussicht genommen. Vera wusste, was man von ihr erwartete, die Mutter hielt ihr einen langen Vortrag über die Notwendigkeit einer reichen Heirat. So stand das junge Mädchen Henrici in einer Befangenheit gegenüber, die den seltsam eigenartigen Reiz ihrer Schönheit noch verstärkte. Wie ein Feuerstrom schoss das Blut zum Herzen des gereiften Mannes, als er das junge, wunderholde Geschöpf vor sich sah. Der mächtige Eindruck, den Vera auf ihn machte, verstärkte sich von Tag zu Tag. Alle Bedenken, alle Erwägungen gingen unter in dem starten Gefühl, das ihn beherrschte. Er fühlte, dass er jetzt zum ersten Male die echte, wirkliche Liebe empfand. Weil sie so spät kam und so unerwartet, unterjochte sie alles, was sich ihr in seinem Innern in den Weg stellen wollte.
Kurzum, Albert Henrici kehrte als Vera Böhsmers Verlobter nach L . . . . . zurück, um alles vorzubereiten zu seiner baldigen Hochzeit.
Verwöhnt, bewundert und geliebt wie nie in ihrem Leben, zog Vera wenige Monate später ein in die schöne Villa am Stadtwald. Das glänzende Los, welches sie gezogen, täuschte sie hinweg über die Herzensleere, die sie bei dieser Verbindung empfand. Ihr Gatte erschien um Jahre verjüngt, und seine elegante Erscheinung gefiel ihr sehr wohl. Sie bildete sich allen Ernstes ein, etwas wie Liebe für ihn zu empfinden, und lebte die ersten Jahre ihrer Ehe wie in einem Rausch von Glanz und Reichtum.
All ihre Reize entfalteten sich in dem luxuriösen Leben, sie war sinnberückend schön, und wo sie an der Seite ihres Gatten erschien, wurde ihr gehuldigt.
Henrici liebte seine junge Frau grenzenlos, und eine kurze Zeit war er in ihrem Besitz restlos glücklich. Aber als er dann sah, wie die jungen Männer der Gesellschaft sich eifrig um ihre Gunst bemühten, als er merkte, wie gern sie sich diese Bewunderung gefallen liess, da erwachte die alte Angst vor Vergeltung in seinem Innern. Er hätte mit Vera in einen stillen Erdenwinkel flüchten, sie vor allen Augen verbergen oder wenigstens ganz zurückgezogen mit ihr leben mögen.
Wenn sie ihn dann aber mit ihren herrlichen dunklen Augen ansah und ihm zeigte, wie sie sich auf dieses und jenes Fest freute, dann fand er nicht den Mut, ihr die Freude zu vergällen. Aber so sehr er sich dessen schämte, beobachtete er Vera unausgesetzt mit sorgendem Misstrauen, wenn sie sich mit den Verehrern ihrer Schönheit unterhielt.
Bisher hatte er noch nichts entdeckt, was ihm ein Recht zu dieser Sorge gab. Aber vor jedem neuen Fest, das er mit Vera besuchte, überfiel ihn diese lähmende Angst. Er wusste, es gab auch heute noch genug Männer, die es leicht nahmen mit des Andern Ehre.
Mitten in eine besonders glänzende. Saison fiel dann plötzlich eine Trauerbotschaft, die Vera zwang, den geselligen Freuden vorläufig zu entsagen. Ihre Mutter starb. Die Liebe zu dieser war nicht gross genug gewesen, um Vera lange niederzudrücken. Aber dass sie all den schon geplanten Festlichkeiten fernbleiben musste, war ihr ein grosser Kummer. Sie war noch so jung und lebensfreudig und hatte bis zu ihrer Verheiratung wenig vom Leben genossen.
Ihr Mann dagegen schien wie von einem bösen Alp befreit. Er war glückselig, dass er Vera nun eine lange Zeit für sich allein haben konnte.
Und doch sollte gerade diese stille Zeit seinen Glück gefährlich werden. Im geselligen Trubel zwischen Routs, Theater und Bällen hatte Vera keine Zeit gehabt, sich auf sich selbst zu besinnen. Jetzt, ganz auf ihren Mann angewiesen, empfand sie zum ersten Male, dass er ihrem Herzen im Grunde fremd geblieben war. Eine unbestimmte Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem erfüllte ihre Seele. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie ihren Gatten nicht liebte, dass sie sich verkauft hatte für Glanz und Reichtum. Eine tiefe Traurigkeit wechselte in ihrem Wesen mit nervöser Reizbarkeit. Sie klagte über Langeweile, wenn ihr Mann in Geschäften von zu Hause abwesend gewesen war. Henrici tat alles, was er ihr an den Augen absehen konnte, um sie zu zerstreuen. Die Veränderung in ihrem Wesen hielt er für den Ausfluss ihrer Trauer.
Um sie nicht allein lassen zu müssen, wenn er seinen Geschäften nachging, engagierte er eine Gesellschafterin für seine Frau, mit der sie musizieren, plaudern und spazierenfahren konnte. Diese junge Dame, die Tochter einer Majorswitwe, gefiel Vera sehr. Helma Olfers war ein sehr kluges, taktvolles und lebensfrisches Geschöpf. Sie übte einen heilsamen Einfluss aus auf die junge Frau. Henrici bemerkte das sehr wohl und wünschte sich Glück zu dem guten Griff, den er getan hatte.
Helma Olfers wurde, ohne dass es sonderlich auffiel, so etwas wie ein guter Hausgeist. Ihre Anwesenheit allein hatte schon etwas Wohltuendes, Erfrischendes. Mit feinem Takt fühlte sie heraus, wann ihre Anwesenheit erwünscht oder störend war. Vera konnte sich bald ein Leben ohne Helma nicht mehr denken, zumal ihre Anwesenheit die Lücke, die sie jetzt empfand, etwas ausfüllte.
Nun war das. Trauerjahr zu Ende, und heute sollte Henrici seine junge Frau zum ersten Male wieder zu einem Feste führen. Vera schien wie neubelebt in Erwartung neuer geselliger Freuden. Mit besonderer Sorgfalt schmückte sie sich und freute sich ihrer Schönheit.
Sie waren zu einer glänzenden musikalischen Soiree im Hause des Kommerzienrats Delbrück geladen. Die Geldaristokratie war in der alten Handelsstadt, die zu den ersten des Reiches gehörte, tonangebend. Die reichen Handelsherren liebten bei ihren Festen gediegenen Glanz, und ihre Frauen gaben ihren Salons gern ein schöngeistiges Gepräge.
Die Kommerzienrätin Delbrück tat das mit viel Geschick. Sie protegierte hauptsächlich junge musikalische Talente, weil sie mit dem Direktor des Konservatoriums sehr befreundet war. Meist wurde auch wirklich gute Musik in ihrem Hause gepflegt, sie selbst war eine hervorragende Klavierspielerin. Alles, was zur guten Gesellschaft L . . . . . s gehörte, traf bei ihr zusammen. Es gehörte zum guten Ton, ihre Soireen zu besuchen. Da nach den musikalischen Genüssen auch für die materiellen einer gutbesetzten Tafel gesorgt wurde, kamen auch unmusikalische Naturen auf ihre Rechnung. Vera wusste, dass sie all ihre Verehrer dort treffen würde. Sie verlangte im stillen sehnlichst nach Bewunderung und Verehrung, nach schmeichelhaften Komplimenten und feurigen Blicken aus Männeraugen. Galt ihr auch nicht ein einziger mehr als ihr Mann, so hatte sie doch genug von dem süssen Gift der Bewunderung genossen, um sich danach zu sehnen wie nach einem berauschenden Tranke. Und das Jahr, welches sie in Stille und Zurückgezogenheit hatte verbringen müssen, hatte allerlei Begehren in ihr erweckt, welche die Öde in ihrem Herzen unterdrücken sollten.
Sie ahnte nicht, wie sehr sich ihr Mann fürchtete vor dieser in Aussicht stehenden Festsaison. Er verstand es meisterhaft, sich zu beherrschen. Nie hatte er sie fühlen lassen, was er litt, wenn er sie von Verehrern umlagert sah. Sie wusste nicht, dass er auf atmete, wenn er nach einer Gesellschaft endlich wieder allein mit ihr im Wagen sass, um heimzufahren. Und kein Gedanke beunruhigte sie, wenn er sie scheinbar scherzhaft ausforschte nach allem, was man ihr Schönes gesagt, dass er etwas anderes bei ihren Berichten empfand, als Freude. Sie wusste so drollig kleine Eigenheiten ihrer Bewunderer zu karikieren und freute sich, wenn ihr Mann darüber lachte. Dass dieses Lachen eine Erlösung war von schwerer Pein, ahnte sie nicht. Und doch war es so. Solange Vera über ihre Verehrer glossierte, waren sie ungefährlich, das fühlte Henrici. Und deshalb löste sich seine heimliche Spannung noch immer in ein befreiendes Lachen. —
Nun würde dies Spiel von neuem beginnen. Henrici sass in düstere Gedanken versunken. Er empfand schon im voraus die tausend Qualen, die ihn wieder erwarteten. Wie sie sein schönes junges Weib wieder umschwärmen würden von allen Seiten! — Er musste es dulden, dass man ihr huldigte, ihr schöne Worte sagte und sie mit kühnen, eroberungssüchtigen Blicken streifte. Ach — er kannte ja all die kleinen Manöver, mit denen man die Gunst der Frauen gewann. Alte Zeiten tauchten auf in seiner Erinnerung, alte Sünden wurden lebendig, und die grosse Schuld seines Lebens hob grinsend ihr Haupt und drohte ihm mit grauenhafter Gebärde. Ein sterbendes Antlitz — darin die brechenden Augen mit der wilden, vernichtenden Anklage — fort — fort! — Wie abwehrend streckte er die Hände aus. Ein helles Frauenlachen drang aus dem Nebenzimmer an sein Ohr. Mit fahlem Gesicht richtete er sich gewaltsam auf und sah mechanisch nach der Uhr.
In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet, und Fräulein Olfers trat aus dem Boudoir seiner Frau.
Wie befreit von einem quälenden Traum, sah er lächelnd zu dem schlanken blonden Mädchen hinüber, dessen liebes Gesicht ein reizendes, anmutiges Lächeln zeigte.
„Nur noch einen Augenblick Geduld, Herr Konsul. Die gnädige Frau ist jetzt wirklich in zwei Minuten fertig,“ sagte sie mit einer warmklingenden, frischen Stimme.
,,Danke, Fräulein Olfers. Sie hätten sich nicht zu bemühen brauchen. Aber nun Sie einmal hier sind, plaudern wir ein wenig, bis meine Frau erscheint. Wie geht es denn zu Hause? Sie haben ja heute Nachricht bekommen!“
„Danke sehr, Herr Konsul. Gottlob ist meine Mutter wieder wohlauf nach ihrem kleinen Influenzaanfall.“
„Das freut mich — auch für Sie. In den letzten Tagen waren Sie mit Ihren Gedanken doch mehr zu Hause als bei uns.“
Helma Olfers sah erschrocken zu ihm auf. „Hab ich meine Pflichten vernachlässigt?“
Er schüttelte mit gütigem Lächeln das Haupt. „Sehen Sie doch nicht gleich so erschrocken aus, kleines Fräulein! Sie und eine Pflicht vernachlässigen, das gibt es doch nicht. Daran merkt man die Soldatentochter. Immer stramm im Dienst — nicht wahr, das war die Losung bei Ihnen daheim?“
Helma nickte lächelnd und rückte sich gerade. „Immer stramm im Dienst, und nicht gemuckst,“ sagte sie mit schelmischem Ausdruck im Gesicht in militärischem Tone. Und dann ihre ungezwungene Haltung wieder annehmend, fuhr sie mit einem leichten Seufzer fort: „Ja, Papa verstand in dieser Beziehung keinen Spass, weder im Dienst noch daheim, trotzdem er sehr gut und liebevoll war.“
„Das ist Ihnen jedenfalls eine gute Schule gewesen für Ihren schweren Lebensweg, armes kleines Fräulein!“
Helma schüttelte lächelnd den Kopf. „Ach, jetzt brauchen Sie mich wirklich nicht zu bedauern, Herr Konsul. So gut wie jetzt hab ich’s noch nie in meinem Leben gehabt. In meiner ersten Stellung, da war ich manchmal recht verzagt. Ich konnte Frau von Sterneck nicht zufriedenstellen — wie ich’s auch anfing. Und man liess mich dort recht schroff fühlen, dass ich nur eine bezahlte Gesellschafterin war. Aber hier, seit ich hier in Ihrem Hause bin, fühle ich mich wie im Himmel.“
Henrici lachte gutmütig.
„Nun, jeder hat wohl eine besondere Vorstellung von himmlischen Freuden. Was erleben Sie denn hier so Schönes, dass Sie sich wie im Himmel vorkommen?“
Ein warmer Glanz lag in Helmas schönen, dunkelblauen Augen. „Erstens erfahre ich von Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin viel Güte und Nachsicht. Sie lassen mich als Menschen gelten, gewähren mir so viel freie Zeit, dass ich mit meinen Lieben daheim in reger Verbindung bleiben kann. Jede Sorge um das tägliche Leben ist von mir genommen, und von dem reichlichen Gehalt, das Sie mir ausgesetzt haben, kann ich Mama manche Erleichterung verschaffen, damit sie mit meinen vier Geschwistern nicht so viel Sorgen hat. Ist das nicht viel des Guten? Ich wünsche, dass es mir immer so gut gehen möge, dann bin ich zufrieden.“
Henrici nickte gedankenvoll vor sich hin. „Wohl Ihnen, kleines Fräulein, dass Sie nicht anspruchsvoller sind. Nun freuen Sie sich gewiss darauf, heute wieder einen freien Abend zu haben. Da will ich Sie nicht länger aufhalten. Meine Frau wird Ihrer wohl nicht mehr bedürfen.“
„Nein, die gnädige Frau hat mich bereits entlassen. Doch da ist sie schon!“
Vera trat in sieghafter Schönheit in das Zimmer. Während sie sich lächelnd, bewunderungheischend vor ihrem Gatten um sich selbst drehte, erblickte sie Helma. „Da sind Sie ja noch, liebe Helma! Ich denke, Sie wollen einen hundert Seiten langen Brief nach Hause schreiben —?“
„Fräulein Olfers hat mir ein wenig die Langeweile vertrieben,“ sagte Henrici, Vera mit entzückten Blicken betrachtend.
Sie sah schelmisch abbittend zu ihm auf. „Hab ich dich lange warten lassen? Bist du böse?“
Helma schlüpfte mit leisem Gruss aus dem Zimmer, und Henrici umfasste mit heisser Innigkeit seine Frau.
„Böse? Dir? Nein, Vera — das wird nie geschehen.“
Sie streichelte seine Wange und sah ein wenig kokett zu ihm empor. „Wer weiss! Ich will dich lieber nicht auf die Probe stellen.“
Er küsste ihre Hand über dem feinen Gelenk. Es lag eine vornehme Ritterlichkeit in seiner Bewegung. „Ich würde jede Probe bestehen, Vera, auch die schwerste.“
Sie schmiegte sich einen Augenblick an ihn wie ein verwöhntes Kind. Dann richtete sie sich schnell empor. „Nun müssen wir aber gehen, sonst kommen wir wirklich zu spät.“
Er legte ihr den kostbaren Pelzmantel um die Schönen Schultern. Dabei drückte er einen Kuss auf ihren Nacken. Sie zuckte leise zusammen und schloss einen Augenblick die Augen. Als sie dieselben wieder öffnete, lag ein sonderbar sehnsüchtiger Ausdruck darin. Aber sie sah ihren Gatten nicht an.
Wer vermag die rätselhaften Empfindungen einer Frauenseele zu ergründen! Vera wusste selbst nicht, nach was sie sich sehnte. Aber sie war in einer jener Stimmungen, in denen die Frauen besonders bezaubernd sind — und am leichtesten fremdem Zauber erliegen. — —
Sie kamen wirklich zu spät. Die musikalischen Vorträge hatten bereits begonnen. Ein junger Sänger mit weicher, voller Baritonstimme sang gerade ein Brahmssches Lied. Um nicht zu stören, blieb Vera im Vorzimmer zum Musiksaal sitzen und streifte lässig ihre Handschuhe über. Ihr Gatte trat leise durch die offene Tür des Musiksaales und blieb dort lauschend stehen.
„Immer leiser wird mein Schlummer,“
tönte es in schmerzlicher Klage an Veras Ohr. Sie lauschte traumverloren. Das Lied sprach zu ihrem Herzen, als wenn es aus ihrem eigenen Empfinden herausströmte.
„Niemand wacht und öffnet dir,
Ich erwach und weine bitterlich.“
Ein Seufzer entfloh ihren Lippen, ohne dass sie es wollte. Gab es eine Liebe wie diese, aus der das Lied geboren war? Wie mochte das sein, wenn man eine solche Liebe empfand? Musste sie nicht mehr Schmerz als Freude bringen? Süsse Schmerzen! Gab es das? Existierte solch ein Gefühl nicht nur in der Phantasie der Dichter? Und doch — es musste etwas Wahres daran sein, das sagte ihr die unbestimmte Sehnsucht, die sie beherrschte.
Immer tiefer verstrickte sie sich in solch gefährliche Träume. Ihr im Grunde sehr leidenschaftliches Naturell verlangte heimlich nach etwas anderem, als ihr die kühle Vernunftehe brachte, die sie gedankenlos eingegangen war. Mit grossen Augen sah sie weltverloren um sich, und da blieb ihr Blick plötzlich in einem anderen Augenpaar hängen, welches sehr deutlich bewunderndes Entzücken bei ihrem Anblick verriet. Dies Augenpaar gehörte einem schlanken, grossen Mann von ungefähr dreissig Jahren an. Er war als gleichfalls verspäteter Gast leise in das Vorzimmer getreten und stand nun, im Anschauen der eigenartig schönen Frau versunken, regungslos neben der Tür. Vera kannte ihn nicht. Seine Erscheinung wirkte aber in diesem Augenblick wie Offenbarung auf sie ein — wie eine Verwirklichung ihrer Träume. Verwirrt sah sie in das frische, gutgeschnittene Männergesicht mit den sonnigen, strahlenden Augen, die eine ungestüme Seele verrieten und wie im jugendlichen Übermut wetterleuchteten. Es lag so etwas Junges, Kraftvolles, Ursprüngliches in der eleganten Erscheinung, dass es wie ein heimliches Jauchzen durch Veras Seele flog.
Wie gebannt hingen die Augen der beiden ineinander. Es war, als wenn Flammen herüber und hinüber schlügen. Endlich verneigte sich der junge Mann wortlos vor Vera, ohne den Blick von ihr zu lassen. Sie dankte mit einem verträumten, verwirrten Lächeln und fühlte dabei, wie ihr heisse Glut in das Gesicht stieg.
Schicksal — du wählst die Stunden gut, um die Menschen deiner Macht zu beugen! — Die Stimme drüben im Musiksaal verstummte, und lebhafter Applaus lohnte den Sänger. Vera sehrack zusammen, ein Lächeln umspielte ihren Mund. Noch nie hatte sie so schön ausgesehen wie in diesem Augenblick.
Henrici trat in das Vorzimmer, um seine Frau in den Saal zu begleiten. Als er sich eben zu ihr neigte, um ihr seinen Arm anzubieten, erblickte er den jungen Mann, der sofort auf ihn zuschritt.
Lächelnd bot ihm Henrici die Hand. ,,Auch zu spät gekommen? Guten Abend, mein lieber Herr Althoff!“
Heinz Althoff legte seine Hand in die Henricis. „Guten Abend, Herr Konsul! Endlich sieht man Sie wieder! Sie waren wie verschollen.“
„Ja — wir hatten Trauer. Und vorher waren Sie lange Zeit in Paris. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Ihren Herrn Vater treffe ich oft. Und er hat mir gesagt, dass Sie sich wohl befinden.“
Vera hatte interessiert dem kurzen Gespräch gelauscht. Jetzt machte Heinz Althoff eine bittende Bewegung nach der jungen Frau. „Wollen Sie mich, bitte, dem gnädigen Fräulein vorstellen?“
Henrici lachte. Keine innere Stimme warnte ihn in diesem Augenblick. „Gestatte, Vera, Herr Heinz Althoff, der Bruder von Robert und Felix Althoff — meine Frau. Ich vergass, dass Sie sich noch nicht kannten.“
Heinz Althoff konnte seine Überraschung nicht ganz verbergen. Das also war die schöne Konsulin, von der er schon so viel schwärmerische Beschreibungen gehört hatte! Zufällig hatte er sie vor seiner Abreise nach Paris nie gesehen, und als er heimkehrte, ging Vera der Trauer wegen nicht in Gesellschaft. Als er sie vorhin erblickte, hatte er sie für ein junges Mädchen gehalten.
Während er einige höfliche Worte mit ihr wechselte, begegneten sich ihre Blicke wieder. Und da zuckte es auf in seinen Augen, denn er erkannte mit scharfem Blick, dass er Eindruck auf sie gemacht hatte. Heinz Althoff war nicht der Mann, dies zu übersehen. Während Vera ihre Handschuhe vollends anzog, plauderte Heinz mit Henrici. Dabei liess er Vera kaum aus den Augen. Wie ein heimliches Wetterleuchten zuckte es herüber und hinüber. Vera fühlte mit einer Sicherheit, die sie bis ins. Innerste erschütterte, dass Heinz Althoff ihr Schicksal sein würde. Noch nie hatte sie Ähnliches beim Anblick eines Mannes empfunden. Widerstandslos ergab sie sich dem Zauber, den seine lachenden, übermütigen Augen auf sie ausübten. Seine ganze kraftvolle Persönlichkeit strömte etwas Zwingendes aus, dem sie sich mit einer Heimlichen Wonne unterwarf.
Zusammen betraten die drei Menschen den Saal. Vera wurde sofort von allen Seiten umringt. Aber ihr Blick flog wieder und wieder zu Heinz Althoff hinüber, der lächelnd am Flügel lehnte und mit einer jungen Dame plauderte. Über deren Kopf hinweg fing er Veras Blicke auf und erwiderte sie kühn. Wie verhaltene Leidenschaft flammte es zuweilen auf zwischen den beiden.
Und Henrici sah nichts von alledem. Er beobachtete nur die Herren, die sich um Vera drängten. — An Heinz Althoff dachte er gar nicht. —
Don diesem Tage, an war Vera eine andere geworden. All die zurückgehaltene Heissblütigkeit, die in ihrem Naturell schlummerte, kam jetzt zum Ausbruch. Mit Sturmesgewalt hatte sie die Liebe zu Heinz Althoff erfasst. Und da sie fast täglich irgendwo in Gesellschaft zusammentrafen, fand ihre Liebe immer neue Nahrung.
Während aber ihr ganzes Sein eine Umwandlung, erfahren hatte und die Liebe ihr ganzes Wesen durchdrang, war sie Heinz Althoff nicht mehr als viele andere schöne Frauen, denen er schon gehuldigt hatte. Zuweilen loderte wohl auch in ihm ein Strohfeuer auf, wenn Veras Schönheit wie ein Rausch auf ihn einwirkte. Er zeigte dann ziemlich unbekümmert, wie ihn ihre fremdartig süsse Schönheit in Entzücken versetzte, und liess seine Augen eine kühn bewundernde Sprache reden. War sie aber fern, dann konnte er sich mit gleicher Begeisterung in die Reize einer anderen schönen Frau versenken. Er liebte die Frauen — aber er liebte alle, die sein schönheitsdurstiges Auge befriedigten. Und er ahnte nicht einmal, welches Unheil er damit anrichtete, dass er Vera gegenüber kein Hehl daraus machte, wie bewunderungswürdig sie ihm erschien.
Zu tief und eingreifend war die Veränderung, die mit Vera vor sich gegangen war, als dass sie Henrici nicht bemerkt hätte. Sie war nervös, launenhaft und unberechenbar, und ihr Verhältnis zu ihrem Gatten erschien ihr eine endlose Marter. Wenn er sie mit sorgender Unruhe betrachtete, ging sie aus dem Zimmer, um dann bald darauf zurückzukehren und ihn um Verzeihung zu bitten. „Du musst Nachficht mit mir haben, Albert. Ich weiss, ich bin unausstehlich jetzt. Ich glaube wirklich, ich bin etwas nervös. Sei mir nicht böse.“
Er küsste und streichelte sie dann wie ein krankes Kind. „Du gehst zu viel aus, Vera. Es strengt dich an. Wollen wir nicht lieber einige Festlichkeiten absagen?“
Da schüttelte sie aber heftig den Kopf. „Nein, nein, ich glaube eher, ich bin nervös geworden, weil wir so lange nicht ausgegangen sind. Ich freue mich doch sehr auf alles. Achte nur nicht auf mich, es wird schon vorübergehen.“
Aber es ging nicht vorüber. Wie eine rastlose Unruhe lag es über ihrem Wesen, und nur dann war sie zufrieden und glücklich, wenn sie mit Heinz Althoff zusammen sein konnte.
Henrici befragte endlich besorgt den Arzt wegen seiner Frau. Der verordnete Ruhe und Luftveränderung.
Aber Vera lachte ihn aus und behauptete, ihre Nervosität würde sich auch ohnedies verlieren.
Und wirklich schien es besser mit ihr zu werden, weil sie sich zusammennahm. Aus Furcht, dass ihr Mann darauf bestehen würde, sie zu entfernen, beherrschte sie sich meisterhaft. Aber es lag ein feuchter, sehnsüchtiger Glanz in ihren Augen, der sie nur noch schöner machte.
Ihren Mann erfüllte die Sorge um ihre Gesundheit so ausschliesslich, dass er für alles andere blind zu sein schien. Er bemerkte die dunkle Wolke nicht, die sich drohend über seinem Glück zusammenballte.
* * *
Karl Althoff, Heinz Althoffs Vater, war Besitzer einer bedeutenden Hutfabrik. Er hatte vor dreissig Jahren die Fabrik von seinem Vater übernommen. Damals bestand sie nur aus einem schmalen, dreistöckigen Gebäude. Karl Althoff besass jedoch viel Unternehmungsgeist und einen scharfen kaufmännischen Blick. Seine Frau, die Tochter eines reichen Seifensieders, brachte ihm ein hübsches Vermögen mit in die Ehe. Damit nahm er die erste Vergrösserung seines Unternehmens vor. Neben der Strohhutfabrik errichtete er noch eine für Filz- und Seidenhüte. Mit den Jahren vergrösserte sich sein Geschäft immer mehr. Mit Fleiss und Umsicht brachte er sein Unternehmen immer mehr in Schwung. Heute galt seine Fabrik als die bedeutendste in ganz Deutschland, und seine Fabrikate fanden reissenden Absatz.
Das Fabrikgebäude bestand jetzt aus drei Häusern, die mit dem neuerbauten Wohnhaus ein Viereck bildeten und einen grossen Hof umschlossen. In dem einen Hause wurden Strohhüte fabriziert, in dem zweiten Filz- und Seidenhüte und das dritte war für den Versand eingerichtet. In dem grossen, hübschen Wohnhaus war nun gar in den letzten zehn Jahren ein Detailgeschäft eingerichtet worden, in dem sich die Damenwelt von L . . . . . all die reizenden Hüte kaufte, die ihre Schönheit krönen sollten.
Karl Althoff war bei der Einrichtung dieser Abteilung seines Unternehmens von folgenden Gedanken geleitet worden. Er besass drei Söhne, die, nachdem sie genügend gelernt und sich ein wenig in der Welt umgesehen hatten, in des Vaters Geschäft eintraten. Karl Althoff war ein guter und vernünftiger Vater. Er war für reinliche Arbeitsteilung. So ging er von dem Standpunkte aus, dass seine Söhne jeder einen besonderen Wirkungskreis haben sollten, für den sie die Verantwortung übernehmen mussten. Also bestimmte er folgendermassen: Robert, der Älteste, leitet die Fabrik, Heinz, der zweite, den Versand, und Felix, der Jüngste, der infolge eines Sturzes in der Kindheit lahmte, das Detailgeschäft.
Diese Einrichtung erwies sich als sehr zweckentsprechend. Die drei Brüder, ausgesprochen verschiedene Charaktere, wetteiferten miteinander, ihre Abteilung auf der Höhe zu erhalten. Statt dass sie bei einem Durcheinander der Arbeitseinteilung in Streit gerieten, wusste sich jeder in seinem Ressort an erster Stelle und für alles verantwortlich.
Das Detailgeschäft nahm Parterre und ersten Stock des Wohnhauses ein. Im zweiten Stock befand sich die Wohnung der Eltern und im dritten Stock für jeden der drei Brüder ein Wohn- und ein Schlafzimmer, welche, den Wünschen jedes einzelnen entsprechend, sehr gediegen und gemütlich eingerichtet waren. Auch das Schlafzimmer der Eltern befand sich im dritten Stock, da man im zweiten Stock einige grosse Räume für gelegentliche Festlichkeiten reserviert hatte.
Karl Althoff war eine bekannte und beliebte Persönlichkeit in L . . . . . Nicht nur, weil er ein reicher Mann geworden war, sondern weil von seinem ehrlichen, geraden Wesen etwas Belebendes, Erfrischendes ausging. Er trug immer Anzüge aus schwarzem Tuch, und auf seinem dichtgelockten grauen Haar sass stets ein tadelloser Zylinder neuester Mode. Darauf hielt er. Das gehörte für ihn zur Aufrechterhaltung seines geschäftlichen Renommees.
Seine drei Söhne waren begehrenswerte Partien, sie hätten in allen töchtergesegneten Familien mit Erfolg anklopfen dürfen, wenn sie nur gewollt hätten. Bis jetzt hatte aber noch keiner von ihnen gewollt.
Robert zählte zweiunddreissig Jahre, Heinz dreissig und Felix achtundzwanzig. Sie lebten in einer sehr innigen Gemeinschaft mit ihren Eltern.
Robert huldigte in seinen Mussestunden dem Sport, Heinz hatte neben dem Geschäft nur eine Passion — schöne Frauen, und Felix beschäftigte sich in seiner freien Zeit mit schöngeistiger Literatur. Durch das leichte Lahmen seines linken Fusses, welches durch eine Sehnenverkürzung entstanden, war er an mancher freien Bewegung verhindert. Beim Gehen benutzte er meist einen Stock. So musste er sich von manchem zurückhalten, was anderen jungen Männern Freude machte. Da kam es ganz von selbst, dass er sich viel mit Büchern beschäftigte. Während Robert Tennis spielte, ruderte und andere Leibesübungen vornahm, während Heinz den Spuren schöner Frauen folgte, fass Felix über seinen Büchern.
Im Charakter waren die Brüder sehr verschieden, trotzdem sie fest und herzlich aneinander hingen. Robert war ein wenig kühl, gelassen, überlegen, Heinz übermütig, voll sonniger Heiterkeit, immer zu Scherzen aufgelegt, und Felix sensitiv, tief empfindend und zurückhaltend.
Karl Althoff hatte im Verhalten zu seinen Söhnen eine Richtschnur: ,, Sei der Freund deiner Kinder.“ Es gab keine väterliche Tyrannei in der Familie, kein blindes, sklavenhaftes Unterordnen unter die väterliche Autorität. Seine Erziehung bestand aus einer vernünftigen, liebevollen Leitung. Er stärkte die Willensregung seiner Söhne und verwarf sie nicht, wenn sie mit seiner Ansicht nicht übereinstimmte. Gemeinsam mit ihnen überlegte er ruhig, wo der beste Weg hinausführte aus allen Fährlichkeiten des Lebens. So entstand bald zwischen Vater und Söhnen eine echte Kameradschaftlichkeit.