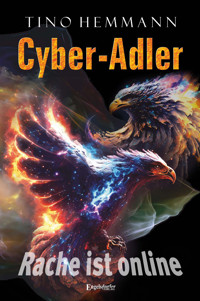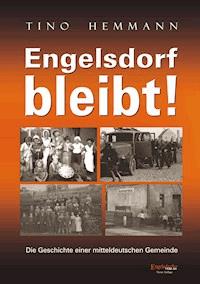Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem höchsten Leipziger Denkmal treffen sich der zwölfjährige Sebastian – ein Leipziger Straßenkind – und der sechzigjährige Stolle. Die beiden unterschiedlichen Menschen wollen sich in den Tod stürzen. Stolle hält den Jungen davon ab. Auf der Plattform – 500 Stufen über Leipzig – entwickelt sich ein Dialog, in dessen Verlauf sich beide Ihre Lebensgeschichte erzählen. Stolle, der sich angesichts des Kindes seiner Lausbubenstreiche aus den 50ern erinnert und an die Demütigungen durch den Stiefvater, der als FDJ-Bezirkssekretär dem Jungen das Singen in einem Kirchenchor mit derben Schlägen austrieb. Und Basti, der bereits vor der Geburt zur Adoption freigegeben und von einem Schicksalsschlag nach dem anderen heimgesucht wurde, bis er als Straßenkind endet, das sich nach Wärme und Familie sehnt. Während sich die beiden gegenseitig ins Leben zurückholen, sucht die Kripo Leipzig verzweifelt nach dem Jungen. Autor Tino Hemmann gelingt neben der spannenden Handlung ein äußerst authentischer Einblick in die deutsche Geschichte. Anhand der Schicksale werden dem Leser nachvollziehbar die Probleme der beiden Gesellschaftsformen nahe gebracht, mit denen sich die Menschen Mitteldeutschlands in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg arrangieren mussten. Zwei Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage präsentiert der Engelsdorfer Verlag die komplett überarbeitete und erweiterte zweite Auflage von Hemmanns Erfolgsroman »500 Stufen über Leipzig«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Widmung
Tino Hemmann
DIALOG
500 Stufen über Leipzig
Roman
Bibliografische Information durch
Die Deutsche Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Diese Geschichte ist frei erfunden.
Eine Ähnlichkeit mit lebenden Personen
oder mit solchen, die einst lebten,
wäre rein zufällig und unbeabsichtigt.
Zweite komplett überarbeitete Auflage des Buches
„500 Stufen über Leipzig“
Engelsdorfer Verlag (2005) ISBN 3-938288-86-8
eISBN: 978-3-86703-955-0
Copyright (2008) Tino Hemmann
Alle Rechte beim Autor.
Titelfoto Mann © Joss – Fotolia
Titelfoto Junge © pixelcarpenter – Fotolia
Covergestaltung Tino Hemmann
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.wigipetia.de
„Florian?“ Jutta Krahmann stand fragend in der Küche. Sie lauschte, obwohl sie nicht wirklich eine Antwort erwartet hatte.
„Florian!“ Ihre Stimme wurde nun deutlich lauter. Eine Zeitung raschelte, denn der Mann am Frühstückstisch, der gerade die letzten Seiten der aktuellen Leipziger Volkszeitung studierte, sah erschrocken auf. Die Morgenruhe war jäh zerstört.
„Was ist denn los, Jutta?!“
Er erhielt keine Antwort.
Ein Elfjähriger kam, sich den Hosenstall zuknöpfend, aus dem Badezimmer und stellte die gleiche Frage: „Was ist denn los, Mami?“ Er lächelte erst die Mutter und dann den Vater an. „Guten Morgen, Toni!“
Jutta Krahmann verzog ihr Gesicht. „Du hast da noch Zahnpaste im Gesicht.“ Sie wischte dem Jungen mit einem Daumen über die Wange, was der gar nicht mochte. Schon oft bat sie ihren Sohn darum, Papa oder Vati zu Toni Engler zu sagen. Sie wollte den Freund in diesem Jahr heiraten und der Polizeiassistent wohnte immerhin schon fast zwei Jahre mit der Frau und dem Jungen zusammen.
Wahrscheinlich vergaß Florian es einfach. Im Kopf des Jungen, der im zweiten Jahr ein Gymnasium besuchte, spukten viel wichtigere Dinge herum. Für das Alltägliche der Familie war in diesem Kopf nur wenig Platz.
„Flori, ich habe zwei Packungen Toastbrot gekauft. Eine davon ist spurlos verschwunden.“ Jutta Krahmanns Stimme klang verärgert. Das gefiel weder dem Vater noch dem Jungen.
Das Kind lächelte noch immer die Mutter an. „Hab ich gestern nach der Schule gegessen.“ Sofort wurde Florians Gesicht etwas rot.
„Eine ganze Packung Toastbrot?“ Jutta Krahmann schüttelte den Kopf. „Das glaubst du doch selbst nicht.“
„Der Junge befindet sich in einer Wachstumsphase, das ist völlig normal“, warf Engler ein, ohne den Blick von der Zeitung zu wenden.
„Normal?“ Jutta Krahmann winkte ab. Dann griff sie sich ihren Sohn. „Und die neue Prinzenrolle war dein Nachtisch? Die Packung Buletten, die fünfhundert Gramm Jagdwurst – für die Makkaroni am Sonnabend? Die zweite Packung Milch, vier große Flaschen Cola …“ Sie schüttelte energisch ihren Kopf. „Mein lieber Florian, in letzter Zeit nehmen unsere Vorräte schneller ab, als ich sie auffüllen kann. Auch wenn ich in einem Supermarkt arbeite, die schenken mir das Zeug nicht. Und ich verrate dir hiermit, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, die Kripo einzuschalten.“
Florian setzte sich verstummt und kaute an einer Schnitte. Noch roter konnten seine Wangen unmöglich werden.
Engler blickte über den Rand der Zeitung. Schließlich war er in der Familie die Kripo. Sein Job war der eines Kriminalassistenten, eingesetzt im Kommissariat 1 der Kripo Leipzig!
Das Gesicht des Jungens blieb knallrot, einschließlich der Ohren. Es wäre heute das erste Mal, dass er mit dem neuen Vater ernsthaft zusammenstieß.
Doch Toni Engler sagte noch nichts. Wahrscheinlich wartete er auf weitere Fakten und Beweise.
Die lieferte ihm seine Frau. „Wachstumsphase! Wenn Florian das alles gegessen haben will, müsste er zwei Meter fünfzig groß sein“, stellte sie fest.
Florian sprach noch immer kein Wort. Toni Engler ebenfalls nicht. Sein Fehler, denn nun wurde er dazu gezwungen.
„Sag doch auch mal was, Toni!“
Der faltete die Zeitung zusammen und legte sie bedächtig in die Klappbox zum Altpapier. Dann blickte er dem Jungen ein Weilchen in die Augen, als könnte er dort die Wahrheit lesen. Der Verdächtigte versuchte, dem Blick des Kriminalassistenten auszuweichen.
„He, was ist los, Flori?“
Florian zuckte leicht mit den Schultern, was einem „Ich schweige beharrlich“ gleichkam.
„Muss ich dich jetzt verhören oder willst du ein Geständnis ablegen?“ Engler beugte sich ein wenig über den Tisch. Dann entdeckte er einen Schmerz in den Augen des Jungen, der zusehends stärker wurde und sich bereits in Tränen verwandelte.
Engler griff neben die Eckbank, nahm Florians Ranzen hoch und öffnete ihn. „Vermisst du auch vier Brötchen und eine Packung Wiener? Ach, und ein Tetrapack Saft?“, richtete er die Fragen an seine Frau und legte die Dinge auf den Tisch. „Das hier ist ja sein richtiges Frühstück. Oder?“ Engler hielt die Brotbüchse hoch, die er wieder in den Ranzen steckte.
Jutta Krahmann verzog ihr Gesicht noch mehr und öffnete vorsichtig den Kühlschrank. „Nee, du, das hab’ ich noch gar nicht bemerkt.“
„Flori, reicht dir das Essen in der Schule nicht?“ Engler griff vorsichtig über den Tisch, um Florians zitternde Hand zu erreichen.
Der Junge schüttelte erneut den Kopf.
„Immerhin hat er seit langem nichts wieder mit nach Hause gebracht“, stellte Jutta Krahmann fest und warf nun ebenfalls einen prüfenden Blick in den Ranzen.
Im gleichen Moment erhob sich Florian und lief aus der Küche. Der Kriminalassistent erhob sich sogleich und nahm die Verfolgung auf, nachdem er einen kurzen Blickkontakt mit seiner Frau hatte.
Im Kinderzimmer fand Toni Engler den Jungen weinend auf dem Bett liegen, das Gesicht im Kissen vergraben.
Er fuhr ihm durch die Haare. „He, was ist los, Florian? Hast du kein Vertrauen mehr zu mir?“
„Ich hab nichts geklaut …“ Der Junge zeigte sein verweintes Gesicht, setzte sich neben Engler und schnäuzte sich, dass seine Nase tiefe Furchen zeigte.
„Was machst du dann mit den Sachen? Warum nimmst du sie weg?“ Engler hielt die Schulter des Jungen fest, holte ein Zellstofftaschentuch aus einer Packung und gab es ihm.
„Es … es … ist für sie …“
„Für sie? – Wer sind sie?“
„Straßenkinder …“
„Straßenkinder? – Woher kennst du … Los, komm, erzähl mal!“ Engler setzte sich den Jungen auf den Schoß, als wäre er ein Kleinkind.
„Auf der Wiese, wo ich mit Erik Schwarz oft Fußball spiele, da sind oft zwei Kinder, mit denen verstehen wir uns gut. Der eine Junge heißt Sebastian, ist ein bisschen älter als ich. Und da ist noch ein größeres Mädchen dabei, das ist die Jennifer. Die ist von zu Hause weg, weil irgendwas Schlimmes mit ihrer Mutter war. Und Sebastian … Der hat gar keine Eltern. Die beiden haben sich in einem alten Haus versteckt. In Connewitz. Und wenn die Hunger haben, dann müssen sie sich was klauen, weil Geld haben die ja keins …“
Engler nickte. „Und damit sie nicht so viel klauen, versorgst du sie mit dem, was Mama kauft?“
Der Junge nickte. „Sie haben doch nur Hunger … Sebastian ist beim Fußballspielen ohnmächtig geworden, weil er so einen schrecklichen Hunger hatte. Und die frieren … Ich hab ihm eine Jacke geschenkt, die war mir eh zu groß …“
„So, so. Du hast ihm eine Jacke geschenkt. Wenn sie dir zu groß war, wird sie dir wahrscheinlich irgendwann doch passen! – Und wenn er mal Fernsehen will, dann schenkst du ihm unseren Fernseher?“
Florian sprang wütend auf. „Nein! – Ich wusste, dass du das nicht verstehst … Niemand will sie verstehen!“ Er weinte wieder.
„He! – Nicht gleich so überreizt!“ Toni Engler zog den Jungen zu sich zurück. „Ich kann dich wohl ganz gut verstehen, Flori. Und es würde solche Zustände wahrscheinlich weder in Leipzig noch sonst wo geben, wenn alle Leute denken würden, wie du es tust. – Pass auf, ich seh’ mal zu, ob ich mit jemandem vom Jugendamt reden kann, vielleicht gibt es da Möglichkeiten …“
Florian beruhigte sich allmählich, umarmte zögernd seinen Stiefvater. „Ich möchte doch nur …“
„Du möchtest diesen Kindern helfen. Das ist gut von dir. Was du getan hast, war nicht schlimm. Doch besser wäre es, wenn du mit uns reden würdest. Denn es belastet mächtig unsere Familienkasse. Verstehst du? Wer mehr Kinder hat, der bekommt vom Staat Kindergeld. Wir sind nicht so reich, dass wir alles verschenken können. – Los, ab jetzt Junge, wir reden heute Abend weiter! Okay? Die Schule wartet nicht auf dich.“
*
Zwei Wochen waren vergangen.
Kriminaloberkommissar Holger Hinrich schüttelte den beleibten Körper. „Mann … ist das ein Sauwetter draußen! So was hässliches, der Winter kommt schon wieder.“ Tatsächlich stürmte und regnete es seit zwei Tagen. „Das legt sich aufs Gemüt, sag ich dir, die Selbstmordrate wird steigen.“
Sein Assistent Toni Engler sah nicht einmal von seinem Rechner auf. „Wir haben November. Da ist’s meistens so hässlich. Und die Statistiken besagen, dass das Wetter keinen Einfluss auf die Anzahl der Suizide hat.“ Die Stimme klang nörgelnd und belehrend.
Hinrich hängte den Mantel an einen Haken. „Guten Morgen, Herr Assistent. – Was ziehst du denn für ein Gesicht? Was für ‘ne Laus ist dir über die Leber gelaufen?“
Engler erhob sich von seinem Drehstuhl und reichte endlich seinem Chef die Hand. Die Bewegungen schienen automatisiert. Er ging zur Kaffeemaschine, holte eine Tasse aus dem Schrank, legte drei Stück Zucker hinein, goss den dampfenden Kaffee bis zum Rand der Tasse, rührte vorsichtig mit einem Löffel um und trug die Tasse am Henkel zu Hinrichs Arbeitsplatz, wo er sie vor die Tastatur auf einem unbeschriebenen Bogen Papier abstellte.
„Was ist, Toni, hast du Ärger zu Hause?“ Hinrich setzte sich und drehte den Stuhl mit einem Ruck zu seinem Kollegen.
Engler war vor zwei Jahren von seinem Chef mit der attraktiven Jutta Krahmann verkuppelt worden. Die war damals Zeugin einer nervenaufreibenden Kindesentführung gewesen. Engler wollte es nie bemerkt haben, dass er damals zu seinem Glück gezwungen wurde. Es wäre ihm auch egal gewesen. Jedenfalls gelangte der Vierunddreißigjährige so zu einer liebenswürdigen Frau samt Kind.
„Flori …“, der Assistent räusperte sich.
„Was ist mit Florian? Ich habe Kinder und Enkel. Es gibt keinen Kinderstreich, den ich nicht schon auswerten musste.“ Hinrich holte eine Packung Gummitiere aus dem Schreibtischfach und schlürfte an der übervollen Kaffeetasse. Nebenbei prüfte er seinen Email-Eingang am Computer. „Guck mal, hier verkauft wieder jemand Viagra … Ist aber alles englisch.“ Hinrich klickte ungeschickt einen Button an. „Na so ein Mist!“, meinte er kurz darauf. „Ich wollte das Zeug löschen, und jetzt ist irgendwas aufgegangen. Nu schau dir diese Ferkelei mal an!“
Engler, der mit technischen Dingen etwas bewanderter war als der Chef, zog seinen Bürostuhl an Hinrichs Tisch heran. Auf dem Bildschirm hatte sich eine Internetseite geöffnet, aus der nun etliche nackte, gut gebaute Damen in das Büro der Kripo Leipzig schauten. „Was hast du jetzt wieder angestellt? Hoffentlich haben wir uns keinen Virus eingefangen …“
Hinrich beobachtete Englers Handgriffe, als wäre er ein kleines Kind, das Blödsinn angestellt hatte. „Nu, schau dir das mal an!“ Der Kriminalkommissar steckte sich ein Gummitier nach dem anderen in den Mund. „Die wollen Viagra verhökern. Und mit solchen Bildern müssen die ihren Kunden wohl beweisen, dass die welches brauchen?“
„Nein, nein.“ Engler schloss die Seite und löschte Verlauf und Cookies. „Das sind alles nur Fallen. Wenn du die Anlage des Emails anklickst und die Internetseite aufgeht, dann wird unter Umständen eine Spyware auf deinen Rechner geladen. Oder es öffnet sich eine kostenpflichtige Verbindung. Die kann sich auch später noch öffnen“
„Spy… – was?“ Hinrich schaute seinen Assistenten interessiert zu, der gerade die Mail für immer löschte.
„Spyware. Die setzt sich irgendwo im Rechner fest und sorgt für einige unerklärliche Dinge. Fast wie ein Virus.“
„Und was sind das für Dinge?“
Engler zuckte mit den Schultern. „Das wirst du vielleicht noch sehen.“
„Ach so …“ Den Kriminaloberkommissar überkam ein schlechtes Gefühl. „Und … Und was ist nun mit deinem Florian?“
Auch Engler griff jetzt in die Gummibärentüte. „Ich kann den Jungen schließlich nicht festbinden …“
„Im Notfall kann man einen Elfjährigen durchaus festbinden. Was ist denn nun mit ihm? Muss ich dir jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen?“
Engler zögerte einen Moment. „Er hat wohl draußen beim Spielen ein paar Kinder kennengelernt. Florian sagte, die würden in Abrisshäusern schlafen. Also sind es Straßenkinder. Ich habe mit dem Jugendamt geredet, die könnten nichts machen, sagen die, dafür wären die Streetworker zuständig. Und die Streetworker sagen, sie kämen an diese Kinder nicht ran, weil die mit den Streetworkern nichts zu tun haben wollten. Ich hatte den Eindruck, die Kinder werden einfach ihrem Schicksal überlassen.“
„Ja, das klingt schlimm …“ Hinrich nippte an der Kaffeetasse. „Aber … Damit müssen wir uns wahrscheinlich abfinden, die Härten unserer Gesellschaft werden vor Leipzig keinen Halt machen. Und die Parteien, die neue Gesetze dazu beschließen könnten, die haben mit sich selbst zu tun. – Aber letztendlich hast du Recht und dein Sohnemann auch. Es sind Kinder, und die verdienen unsere höchste Aufmerksamkeit. Meistens kommen solche Kinder aus zerrütteten Elternhäusern. Man kann nicht einfach nur darauf warten, dass sie endlich strafmündig sind, wenn sie mal negativ auffallen. Es gibt da eh solche und solche. Die, denen es halbwegs vernünftig gehen könnte, wenn sie bei ihren Eltern blieben, denen es nur um Bereicherung und Action auf der Straße geht. Und dann gibt es die, die kein zu Hause haben oder dort nicht sein können, weil ihr Leben sonst in Gefahr wäre. Die klauen nur, weil es ums Überleben geht. Weil sie was zum Essen brauchen, oder, oder, oder … – Und Florian macht sich jetzt einen Kopf um den Freund?“
„Nein, nein … Doch, doch … Das heißt … Also, da ist ein Mädchen dabei, die hat gestern bei uns geklingelt, also, … eigentlich hat Florian sie mitgebracht, vielleicht fünfzehn. Jennifer … Florian hat ihr erzählt, dass ich bei der Kripo arbeite. Deshalb kam sie zu uns. Und …, weil sie Florian vertraut. Der hat sie schließlich oft mit Essen versorgt.“
„Und?“
„Na, ja, sie hat sich richtig ausgeheult. In der Klicke ist auch ein Dreizehnjähriger, der heißt Sebastian. Und das Mädchen sagt, der wäre in den letzten Tagen so komisch gewesen und nun plötzlich verschwunden.“
„Straßenkinder sind für die Offiziellen immer verschwunden. Die machen sich absichtlich unsichtbar.“
„Nein, nein … Sie meint, der Junge hing an seiner Klicke. Und das Mädchen hat nun Angst, dass der Junge sich was antut. Und Florian … Na, ja … Dieser Sebastian scheint sein Freund gewesen zu sein.“
Der Kommissar schluckte. „Du meinst, dass er … Dass der verschwundene Junge – gewissermaßen – suizidgefährdet ist?“
Engler nickte. „Nicht nur vielleicht.“
„Mit dreizehn Jahren?“
„Ja … Leider.“
„Nun, mein lieber Assistent, ich denke, dann sollten wir der Sache nachgehen. Das fällt doch in unseren Bereich. Oder?“
„Bestimmt … wenigstens ein bisschen.“ Engler schob seinen Stuhl an den eigenen Arbeitsplatz zurück. „Ich habe schon ein paar Dinge zusammen. – Aber …“, Engler kratzte sich am Kopf, „das wird richtig schwer. Wir suchen eine ganz winzige Stecknadel in einem verdammt großen Heuhaufen. Hier … vom Jugendamt, so eine Art Akte … nicht viel drin. Der Polizei ist der Junge auch bekannt. Fiel aber nur einmal negativ auf, hat in einem Supermarkt Brötchen geklaut. Was du sagtest. Und ist dabei natürlich erwischt worden. Meine Jutta hätte ihn wahrscheinlich gehenlassen, wenn sie ihn erwischt hätte …“ Engler übergab Hinrich mehrere Zettel, die der Kollege rasch überflog, ohne dass ihm auch nur eine Kleinigkeit entging.
„Der Junge hat ja wirklich was durchgemacht … Schon vor der Geburt zur Adoption freigegeben, von den Ersatzeltern fortgelaufen, sexueller Missbrauch, ein unbedeutender Diebstahl, aus dem Kinderheim abgehauen. Der Junge sieht auf dem Bild gar nicht so schlimm aus …“ Hinrich betrachtete lange das Foto. „Der sieht irgendwie jünger aus als dreizehn.“ Dann schüttelte er seinen Kopf.
„Wer sagt denn, dass Sebastian schlimm ist? – Das Bild ist wahrscheinlich schon älter. Das Mädchen meinte, der Sebastian wäre ein ganz lieber, der sich vor allem nach Gesellschaft sehnt und von einer Familie träumt. Und Florian hat das bestätigt.“ Engler zögerte kurz. „Ich habe Angst, dass mein Junge in solchen Kreisen …“
„Solche Kreise?“ Hinrich schüttelte energisch den Kopf. „Was meinst du mit solchen Kreisen? Die meisten merken erst, dass es solche Kreise gibt, wenn die eigenen Kinder hineingeraten. Und da reicht manchmal ‘ne Sechs auf dem Zeugnis. Wir reden hier von Kindern. – Angst? Nee, solange du deinen Jungen fest im Griff hast und nicht vernachlässigst, passiert da nichts. Glaub mir. Diese Kids von der Straße, die brauchen ein wenig Bindung zur Gesellschaft, die bekommen sie nur über städtische Streetworker, über den einen oder anderen Verein oder aber über Kinder, die in vernünftigen Verhältnissen leben und mit denen sie sich anfreunden. Du musst mit dem Gegenteil rechnen. Nicht mit dem Schlimmen. Wahrscheinlicher ist es vielleicht, dass so eine Freundschaft die Kids von der Straße holt, weil sie sehen, dass es auch anders geht. Verstanden, Toni?“
„Aber … Da gibt es Drogen und …“
Hinrich erhob sich. „Wer sagt das? Ich bin mir sicher, dass es vor manchem Leipziger Gymnasium mehr Drogen gibt, als in einem Abrisshaus. Die Straßenkinder haben doch gar kein Geld dafür, also sind sie für die Dealer uninteressant … Zeichne mal nicht den Teufel an die Wand. Schwarzmalerei kann ich nicht ab. – Und wie kommen wir an dieses Mädchen ran?“
„Sie hat mir verraten, wo ich sie finden kann.“
„Na los dann, worauf warten wir noch? Du sagst Fräulein Wolff bescheid, ich schreib schnell ein Einsatzprotokoll. Und gib Fräulein Wolff die Unterlagen, die soll mal eine Suchmeldung an die Medien rausschicken, mit Bild. – Wir fahren aber mit deinem Wagen, meiner ist frisch gewaschen.“
Engler nickte wieder. Dann schnappte sich der Assistent die Jacke und lief hinüber in das Sekretariat des K 1, das von der sechsundzwanzigjährigen Kollegin Wolff gut behütet wurde.
*
Henry Stollmann, dreiundsechzig, sportlich, im warmen, langen Mantel, mit Schal, betrat das Kassenhaus am Fuße des Leipziger Völkerschlachtdenkmals.
„Ein Erwachsener“, meinte er und klemmte einen Fünf-Euroschein in die Kassierbox.
Die Kassiererin, eine ältere Frau hinter einem Fenster, legte ihr Buch zur Seite, schaut freundlich auf. „Ach Sie sind das. Guten Morgen!“ Sie legte das Restgeld in die dafür vorgesehene Klappe und die Eintrittskarte.
„Dienstag … wir haben Dienstag. Ich bin immer dienstags hier.“
Die alte Dame lächelte. „Ja, ja! Dienstag. Hoffentlich sind Sie warm angezogen. Ein scheußliches Wetter ist das heute. – Finden Sie es nicht anstrengend, jede Woche einmal hinaufzusteigen?“
„Ja, schon wieder ist Herbst. Die Jahre vergehen wie im Flug. Doch auch der Herbst hat seine schönen Seiten. – Es hält jung, das Treppensteigen.“ Stollmann steckte das Kleingeld ein und nahm die Eintrittskarte in die Hand.
„Na, von wegen jung. Gehen Sie mal schön langsam, guter Mann, die Stufen sind nass und glatt.“
„Ich werde darauf achtgeben, dass mir nichts geschieht. Vielen Dank für den Hinweis. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.“ Stollmann verließ das Kassenhaus.
Die Kassiererin machte einen zweiten Strich in eine Liste und las weiter in ihrem Buch. „Na, mehr als die beiden werden heut nicht kommen.“
Stollmann, der die Stufen zur Aussichtsplattform des Völkerschlachtdenkmals hinaufeilte, atmete gleichmäßig. Jede Stufe, jeder Vorsprung war ihm bekannt.
Stollmann betrat die Aussichtsplattform, hielt sich schnaufend mit einer Hand an einem stählernen Geländer fest und schaute in den verregneten Himmel.
Dann versteckte er sich hinter dem Ausstieg und beobachtete die Plattform. Feiner Nieselregen kroch unter die Sachen.
Wenige Minuten später hörte er ein Schnaufen und Schritte auf den Stufen, kurz darauf tauchte ein Junge auf der Plattform auf – höchstens zwölf Jahre alt, in dünnen Sachen und schmutzigen Jeans. Er sah sich kurz um, dann ging er zur Brüstung, kletterte auf eine der Stufen, die der besseren Aussicht dienten, und setzte sich auf die Brüstung. Das Kind sah hinunter und erhob sich langsam.
In diesem Moment rannte Stollmann los. Der Junge drehte sich kurz um, sein Gesicht wirkte verheult.
„Nein!“, schrie Stollmann.
Das Kind stand jetzt aufrecht und bewegte sich einen kleinen Schritt zum Abgrund. Stollmann stieg blitzschnell auf die Stufen vor der Brüstung, ergriff mit beiden Händen den Hosensaum der Jeans des Jungen und riss ihn zurück. Der stürzte in den Innenraum der Plattform, wurde von Stollmann aufgefangen, der den Jungen fest umklammerte.
„Lass mich los! Verdammt, lass mich los!“
Stollmann verlor das Gleichgewicht und kam auf einer der Aussichtsstufen zum Sitzen, er zog den Jungen mit sich. Der schlug mit den Fäusten auf Stollmanns Schultern ein, weinte und brüllte. Der Erwachsene hielt den Jungen fest umklammert und fuhr ihm mit einer Hand durch die Haare.
„He, beruhige dich! – Komm, ganz ruhig, Junge!“
Das Kind drückte plötzlich sein Gesicht in Stollmanns Schulter, schlug nicht mehr um sich, sondern heulte nur noch bitterlich, hin und wieder nach Luft schnappend. Die Augen waren gerötet.
Stollmann lockerte die Umklammerung etwas. „Okay, Junge, wein dich aus. Alles wird gut. Du wirst sehen. – Ganz ruhig.“
Der Junge Sebastian schien sich zu beruhigen. Doch kaum konnte er sich wieder frei bewegen, sprang er auf, lief zu einem anderen Aussichtsblock und stieg erneut auf die Brüstung. Er kniete darauf und blickte Stollmann hasserfüllt an.
„Lassen Sie mich allein!“
Stollmann erhob sich, stand in einer Ecke des quadratischen Ausblicks, fünfhundert Stufen über Leipzig, lehnte an der hüfthohen Umsäumung aus Beuchaer Granit, die Hände in den Taschen des langen Mantels.
„Außer uns beiden ist niemand hier“, sprach er, ohne sich dabei zu bewegen. Dunkle Wolken zogen über die beiden hinweg, so nah, als könnte man sie ergreifen.
Sebastian ließ den Erwachsenen nicht aus den Augen. Die Gesichtszüge des fremden Mannes wirkten sehr ernst. Er hatte trotz seines Alters eine stattliche Figur.
Der Junge kniete noch immer auf der breiten Brüstung, die Blicke suchten einen Halt in der sich unter ihm ausbreitenden Stadt. Die Lunge hatte sich wieder beruhigt, nur sein Herz schlug wie wild. „Wenn man hinunterfällt, was man wohl denkt dabei?“, fragte er und versteckte die zitternden Hände.
Jetzt näherte sich Stollmann ein wenig, blieb drei Schritte von Sebastian entfernt an der Brüstung stehen und stützte sich mit den Händen darauf. „Man wird keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Die Zeit ist nur kurz. Und die Angst vor dem Aufprall blockiert bestimmt schlagartig das Gehirn. – Warum?“
Der Junge war dazu gezwungen, dem Mann in die Augen zu sehen, über denen wuschlige Augenbrauen wucherten. „Warum? – Warum was?“ Sebastian setzte sich vorsichtig auf die Brüstung, die Beine baumelten schwerelos über dem Abgrund. Die Höhe störte ihn nicht. Was er in den Stunden zuvor beschlossen hatte, wurde durch die Anwesenheit des fremden Mannes über den Haufen geworfen. Kälte kroch unter Sebastians Sachen. Der Junge zuckte – ohne eine Antwort zu geben – mit den Schultern.
Stollmann musterte das Kind. Es schien ihm, als hätte sich lange Zeit niemand um den Jungen gekümmert. Die Sachen waren schmutzig und wirkten zu eng, das Gesicht schien von Trauer gezeichnet und fast etwas eingefallen, die Lippen grau, als wollten sie erfrieren, die Augenhöhlen dunkel.
„Es lässt sich wahrscheinlich nicht mit wenigen Worten erklären“, sagte er endlich.
„Nein, das lässt es sich nicht.“ Sebastian rieb die eisigen Hände und steckte sie dann in die Taschen der alten Sommerjacke. Nun zuckte er wieder mit den Schultern. Schon oft hatte man ihn bei verbotenen Dingen erwischt. Und eben dieses Gefühl der Wut auf die eigene Dummheit kroch nun durch den Jungen. – Es hätte längst vorbei sein können!
Noch einen Schritt näher kam der Mann, ganz vorsichtig, um den Jungen nicht zu einer unüberlegten Handlung zu zwingen. „Oft ist es einfach nur die verdammte Einsamkeit, der Rauswurf aus der Gesellschaft, die Ignoranz der anderen Leute, die Menschen zum Selbstmord treibt. Ist es dann geschehen, wenn es zu spät ist, so sagen die Leute: ‘Das konnte ja keiner ahnen.’ Sie sagen es, um ihre Unfähigkeit zu entschuldigen, ein Gespräch mit jemandem zu führen, eine Frage zu stellen … Na ja … – Wie alt bist du?“
Sebastian sah dem Mann ins Gesicht, er schätzte ihn auf sechzig Jahre. Der sprach einen sächsischen Dialekt, also war er von hier. „Dreizehn. Ich werde … Ich würde vierzehn werden. – Und warum sind Sie hier oben?“
„Ich?“ Stollmann lächelte. „Bist du einsam? Ist das der Grund? Mit dreizehn Jahren …“ Er schüttelte ein wenig seinen Kopf. „Was ist nur aus unserer Gesellschaft geworden?“
„Warum sind Sie hier oben?“, wiederholte Sebastian die bereits gestellte Frage. „Ja, verdammt, vielleicht bin ich einsam.“
Stollmann ging noch näher, stieg auf die Steinstufe, die auch Kindern den Ausblick auf die Stadt ermöglichen sollte und setzte sich direkt neben dem Jungen auf die Brüstung. Die Beine innerhalb der Plattform. Auch er versteckte die Hände in seinem Mantel. „Erzähl mir, was und wen du verloren hast.“
„Verloren?“, fragte der Junge und lächelte. „Ich habe niemanden verloren. Ich habe nie jemanden wirklich besessen, also konnte ich auch niemanden verlieren. – Sie haben mir nicht gesagt, was Sie hier oben machen.“
„Vielleicht suchen wir nach den gleichen Antworten. Wer weiß. Wie heißt du?“
„Sebastian. Jemand nannte mich Sebastian.“
Ein Flugzeug flog dröhnend über die Stadt. Beide schauten für einige Zeit nach oben.
„Jemand? – Mich nennt man Stolle. Henry Stollmann ist mein richtiger Name“, erklärte der Mann, nachdem das laute Brummen in der Ferne verebbt war. „Wer war dieser Jemand?“
„Stolle …“, wiederholte Sebastian, ohne die letzte Frage zu beachten. Die dunklen Wolken zogen rasch am Himmel dahin. Der Wind, der unsanft das Denkmal streifte, wurde zunehmend stärker. Für einen Moment gaben die dicken Wolken die Sonne frei, Wolkenschatten kletterten über die Stadt, die den beiden zu Füßen lag.
„Ich glaube fast, wir beide haben sehr viel Zeit“, meinte der Mann und zündete sich eine Zigarette an. „Auch ich hatte so etwas vor. Auch ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen.“ Er hustete, hielt eine Faust vor den Mund.
Sebastian schaute erstaunt auf. „Heißt das, sie wollten sich auch …? Wenn Sie nicht hier gewesen wären, dann wäre ich jetzt schon längst …“
Stollmann überlegte einige Momente. „Nur ein Zufall. Deshalb leben wir beide noch. Vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt nicht mehr einsam sind? Wir haben uns hier getroffen, gewissermaßen im allerletzten Moment. Man bezeichnet es als Schicksal.“ Er blies ganz langsam den Zigarettenqualm zwischen den Lippen hinaus. Im Denkmal war Rauchverbot, Sebastian wusste dies. Doch wer sollte von unten erkennen, dass einer der beiden winzigen Punkte auf der Plattform rauchte? – „Wo wir nun so viel Zeit haben, sollten wir uns erzählen, was uns hierher gebracht hat. Immer im Wechsel. Mit allen Einzelheiten, so, als muss man in der Schule einen Lebenslauf schreiben, verstehst du? Bist du damit einverstanden, Sebastian?“
Sebastian zuckte erneut mit den Schultern, lehnte sich zurück und stützte sich mit den Ellenbogen auf den kalten Stein. Er lag nun fast auf dem Rücken; sah über sich den Himmel und spürte die wartenden Blicke dieses Mannes. „Sie interessieren sich für mein Leben? Einen mündlichen Lebenslauf? Was soll das bringen? Aber … Aber wenn Sie wollen …“
„Du kannst mich duzen. Wir sind vom gleichen Kaliber. Willst du anfangen, Sebastian?“
Der Junge überlegte. Wieder krochen Wolken vor die Sonne. „Wo soll ich anfangen?“
„Am besten, ganz von vorn. Nicht lügen, keine Unwahrheiten, nur das, was tatsächlich passiert ist. Ja, ich denke, das wäre gut. Fang ganz am Anfang an. Alle deine Erinnerungen, erzähl sie mir!“
Einige Momente noch blickte der Junge wortlos in die Wolken, verfolgte ihre ununterbrochene Fahrt. Sebastian sprach erst leise und stockend. „Es gibt aber Dinge, die muss ich ein bisschen erraten. Vor allem am Anfang. Man hat mir erzählt, wie es war. Man hat aber bestimmt einige Dinge verschwiegen.“ Immer wieder trafen Sebastians Blicke auf den erwachsenen Mann. Zu Beginn zitterte seine Stimme, klang heiser. Mit der Zeit aber wurde die Erzählung flüssiger und sicher.
Und er begann tatsächlich ganz am Anfang, an der Quelle des Bösen.
*
Manchmal landen sie auf dem Laken.
Aber dieses eine winzige Ding, das mich verkörpern sollte, ausgerechnet dieses dumme, aus dem Sperma eines lüsternen, wahrscheinlich besoffenen Kerls stammende Samenfädchen, erreichte eine gerade empfängnisbereit wartende Eizelle. Und in jenem Augenblick, als ER noch stöhnte, sich kurz darauf zur Seite rollte und einschlief, als SIE sich erhob und mit verächtlichen Blicken in ihr winziges Badezimmer lief, um sich Wasser zwischen die Beine zu spülen, dabei über seine Hose stolperte, die er sich im Flur von den Beinen getreten hatte und dabei fluchte, just in jenem Augenblick begann meine unheilvolle Existenz, unterstützt durch lauwarmes Wasser, das mich Fädchen schnell und sicher zum Ziel spülte.
Ich kam nicht zum Jammern. Dazu war es längst zu spät. Alles wurde so, wie ich es wahrscheinlich verdient hatte. Und doch war ich sauer auf den Kerl. Mit einem Kondom wäre ich nicht passiert.
Allmählich wuchs ich heran. In meinem Fruchtwasser waren immer viel Alkohol und Nikotin. Dass meine Trägerin geschwängert war, wollte sie noch nicht wahrhaben.
Als mir endlich kleine Füße gewachsen waren, trat ich kräftig gegen die Fruchtblase, damit sie ihren Umstand wahrhaben würde. Irgendwie hat sie das dann auch gemerkt.
Plötzlich die fremde Stimme eines Mannes.
„Nein, junge Frau, dazu ist es zu spät. Das Gesetz verbietet eine Abtreibung im sechsten Monat.“ Das Gesetz! Ich war noch nicht mal draußen, da kam ich mit ihm schon in Konflikt!
Und dabei wäre mir so viel erspart geblieben. Aber als Kind, ob geboren oder ungeboren, hat man eben kein Mitspracherecht.
„Kann man DAS denn DANN gleich weggeben?“, fragte sie, ohne darüber nachzudenken, was sie mir mit dieser Frage antun würde. „DAS hat es bei mir bestimmt nicht gut. Ich will DAS nicht behalten.“
„Das?“, fragte die andere Stimme erzürnt. „Sie reden von einem ungeborenen Kind. Aber … Ich gebe Ihnen eine Adresse. Sie können doch lesen?“
„Hm …“
„Melden Sie sich in diesem Amt. Die Leute dort wissen besser Bescheid. Und …“
„Hä?“
„Tun Sie dem ungeborenen Kind den Gefallen, trinken Sie keinen Alkohol und rauchen Sie nicht mehr. Gehen Sie vorsichtig mit dem Kind um, Sie machen sich sonst strafbar. Es wird im Übrigen ein Junge.“
„Hä?“
„Sie können sich jetzt anziehen und gehen.“
Kurze Zeit später ließ sie eine gewaltige Schüttung über mich ergehen, der pure, vernichtende Alkohol traf in meiner Fruchtblase ein. Mir wurde schlecht, ich rotierte und verhedderte mich in der Nabelschnur. Fast wäre ich erstickt. Aber eben nur fast.
Was dich nicht tötet, macht dich stark.
Sie konnte tun, was sie wollte, ich wuchs und gedieh gegen ihren Willen. Und als sie mich den achten Monat mit sich herumschleppte und ich ein paarmal miterleben musste, dass sie sich von blindwütigen Kerlen vögeln ließ, da hatte ich es wirklich satt. An diesem Freitag, dem Dreizehnten, im Februar, zertrat ich wütend ihre Fruchtblase. Nur raus hierr, dachte ich.
Meine Trägerin war besoffen und die Hebammen, bei denen sie endlich landete, legten mehr Wert darauf, mein Leben zu retten, als ihres zu schonen.
Ich kümmerte mich nur wenig darum, ich konnte diese Frau nicht leiden. Schließlich gab es ein Papier, auf dem stand, dass man mich anderswo aufziehen sollte, nur nicht unter ihrer Obhut. Ich schrie, was meine Stimmbänder hergaben, als das gleißende Licht und die unheimliche Kälte erbarmungslos nach meinem winzigen Körper gierten.
Wir – meine Trägerin und ich – wurden augenblicklich getrennt. Man verfrachtete mich in einen Glaskasten, jemand machte ein paar Notizen zu meiner Geburt. Ich war draußen angekommen.
„Schwester Inge“, sagte ein väterlicher Mann, der mich am nächsten Tag vermaß und mit einem kalten Hörgerät untersuchte. „Dieses Kind hat keinen Namen in der Kartei. Haben Sie eine Ahnung …?“
Eine etwa dreißigjährige Krankenschwester kam näher. Sie hatte ihre blonden Haare zu einem Zopf gebunden, nahm mich auf den Arm und drückte mich zärtlich an ihre weichen Brüste. „Ach der Kleine“, flüsterte sie, „wenn ein Leben so beginnt, was soll aus diesen Kindern nur werden. Schauen Sie nur, Doktor … Ich glaube, er hat ein wenig gelächelt.“
Natürlich hatte ich das. „Willst du nicht meine Mama werden?“, fragte ich, doch sie konnte mich nicht hören, weil ich zum Reden noch nicht in der Lage war und stattdessen nur unverständlich grunzte.
Der Doktor ließ die Karteikarte in seiner Hand herumflattern. „Einen Namen muss er haben, sonst kommt die ganze Bürokratie durcheinander. Sagen Sie mir einen, dass ich ihn eintragen kann.“
Alles, außer Heinz-Rüdiger, dachte ich mir. Bitte!
„Haben Sie es schon einmal erlebt, dass Sie von einem Kind innerhalb kürzester Zeit so begeistert waren, es liebgewonnen haben und sich dann immer wieder gefragt haben, was wohl daraus geworden ist?“, fragte meine Lieblingsschwester Inge den Doktor. „Haben Sie das schon einmal erlebt?“
Der Doktor schüttelte seinen Kopf und klickte immer wieder die Mine seines Kugelschreibers rein und raus. Dessen Leben war bestimmt eine einzige, unendlich langweilige Arztserie.
„Die Leute wohnten in unserem Haus in der Nachbarwohnung. Er war damals sechs oder sieben, kam immer zu mir rüber, mal um sich auszuheulen, manchmal, weil er einfach jemanden brauchte, der sich um ihn kümmerte. Seine Eltern waren beide berufstätig, der Vater Bimmelfahrer, die Mutter machte irgendetwas in einem Planungsbüro.“
„Und …?“ Dem Arzt ging es nur um einen Namen.
Schwester Inge schaute sehr traurig aus und eine ihrer Tränen tropfte auf meine Wange. Ich versuchte den Tropfen mit meiner kurzen, kleinen Zunge zu erreichen, doch es wollte mir nicht gelingen, sosehr ich mich auch bemühte.
Schwester Inge suchte nach Worten. „Eines Tages kam ich nach Hause und war verwundert. Im Haus standen zwei Polizisten und befragten die Leute. Ich dachte, es wäre etwas passiert. Die fragten mich nach meinen Nachbarn aus. Ich erfuhr, dass die in den Westen geflüchtet waren. Seitdem habe ich nie wieder etwas von ihnen gehört, auch von dem Kleinen nicht. Ich hatte das Gefühl, ich hätte ein Kind verloren. Ganz plötzlich.“ Sie seufzte tief und gab mir einen kleinen, zärtlichen Kuss auf meine rechte Wange.
„Und … und wie hieß der Junge nun?“ Der Arzt war ungeduldig. Und ich auch.
Die Schwester blickte auf, ihre Augen glänzten feucht. „Sebastian. Der Junge hieß Sebastian. Was wohl aus ihm geworden ist? Der ist jetzt über zehn … Der kleine Basti … Zehn Jahre … – Das war gerade mal ein halbes Jahr vor der Wende …“
Der Doktor schrieb in Druckbuchstaben meinen neuen Namen auf das Kärtchen und steckte es wieder an das Bettchen. Während er zum nächsten Glashaus ging, raunte er meiner Schwester Inge zu: „Gut. Heißt er eben Sebastian. Vielleicht bekommt er vernünftige Stiefeltern. Vielleicht wird er nie merken, dass seine wirkliche Mutter ihn nicht haben wollte.“ Kurz darauf hatte er mich vergessen.
Entschuldigung, aber das wusste ich doch längst. Mit dem Namen Sebastian war ich zufrieden. Es hätte schlimmer kommen können.
Die Schwester harrte noch ein Weilchen neben meinem Glaskasten aus, einer ihrer Finger fuhr mir zärtlich über die Wange, genau dort, wo die Lippen aufhörten. Es krabbelte angenehm und ich grinste. Schwester Inge gefiel mir.
Später erfuhr ich, dass sie selbst drei Kinder hatte und sie erzählte einer anderen Schwester, als ich mithören konnte, dass ihr Mann im Westen auf Montage sei, weil die Treuhand seinen Betrieb ruiniert hatte. Und sie sagte wortwörtlich: „Wenn mein Mann hier in Leipzig wäre, dann würde ich den kleinen Sebastian sofort adoptieren. Aber so … Die Zukunft ist so ungewiss, weißt du …“
Das mit der Treuhand und dem Westen verstand ich damals natürlich nicht. Aber den Rest schon. Ich heulte und schrie wie am Spieß und war wütend auf die Treuhand. Drei Tage lang. Und der Doktor befürchtete, ich könnte sterben, denn ich bekam hohes Fieber und verweigerte jede Nahrung. Mein Trinken bekam ich über Schläuche, deren Enden sie in meine Haut pieksten.
Meine Schwester Inge schenkte mir eines Tages eine kleine, gelbe Kuschelente. Ich liebte dieses Ding und gab es nicht mehr her.
Um mein Essen brauchte ich mich da noch nicht zu kümmern. Erst vier Wochen später bekam ich wieder mein Fläschchen. Das Zeug darin war ekelhaft, aber es ließ mich kräftiger werden.
Die Zeit in diesem Krankenhaus war wirklich schön.
Und besonders schön war es, wenn Schwester Inge Dienst hatte. Ich glaubte fast, ein bisschen Hoffnung war noch in mir, dass sie es sich anders überlegen würde. Ich wollte zu meinen drei Geschwistern auch ganz bestimmt immer lieb sein. Das nahm ich mir jedenfalls vor.
Doch warum sollte sich gerade dieser Wunsch erfüllen? Ihr Mann musste weiter in den Westen. Und eines Tages sagte Schwester Inge, er wäre nun arbeitslos geworden.
Ich sah ganz viele gelbe Kuschelenten davon schwimmen. Sie trieben bis zum Horizont und verschwanden auf Nimmerwiedersehen in einem Wasserfall, der von der Welt stürzte.
Zunächst kamen zwei Leute – ein Mann und eine Frau – die mich lange betrachteten.
„Wirklich süß, der Kleine!“
„Aber ein Junge.“