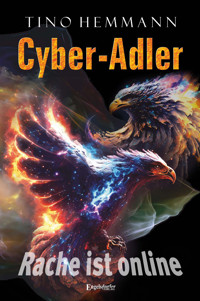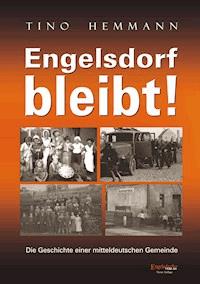
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Engelsdorf bei Leipzig war die größte jemals in Deutschland zwangseingemeindete Stadt. Die Nähe zu Leipzig und der dort vorhandene kommunalpolitische Selbstanspruch, der andauernden Massenabwanderung des Volkes durch Zwangseingemeindungen entgegenzuwirken, wurde Engelsdorf zum Verhängnis. Heute können wir nur noch zurückblicken auf eine langjährige Geschichte. Beginnend in der Urzeit und endend in der Gegenwart, spiegelt die vierte überarbeitete Auflage unter Berücksichtigung vieler Episoden die historische Entwicklung einer Gemeinde wieder, die zwar alle großen Kriege, Diktatoren und Gesellschaftsformen, jedoch nicht die Demokratie überstand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tino Hemmann
Engelsdorf bleibt!
Die Geschichte einer mitteldeutschen Gemeinde
Engelsdorfer Verlag
2012
eBook
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag.
Vierte veränderte Auflage
Alle Rechte bei den Autoren und Fotografen!
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Mein Engelsdorfer Land
Ich hab ein Stückchen Welt gesehen,
Und war so weit von Ihr entfernt.
Doch muss ich heute Eingestehen;
Ich hab dabei etwas Gelernt.
Die Heimat kann man Nicht vergessen.
Sie ist ein Teil von Unsrem Sein.
Sie hat sich tief in Unsre Herzen eingesessen;
Wer Heimat hat, Ist nicht allein.
Sie gibt Geborgenheit Und Ruhe.
Sie ist wie eine Mutterhand.
Wo ich auch bin, Was ich auch tue;
Die Heimat bleibt Mein Engelsdorfer Land.
Hans Kunze
Vorwort
Es ist der Gang der Zeit, dass Orte, Städte und Gemeinden, die in unmittelbarer Nähe von größeren Städten liegen, zu diesen eingemeindet werden. Früher änderten sich nur die Besitzverhältnisse über eine Gemeinde, wenn es zu einem Verkauf oder zu einer Schenkung kam. In unserer jetzigen Zeit bringt eine Eingemeindung tiefe Wunden mit sich. Die Selbstbestimmung wird beendet, öffentliche Aufgaben werden von ortsfremden Personen ausgeführt, Wege werden länger, Ereignisse werden vergessen, Straßen umbenannt. Es kam also nicht von ungefähr, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung gegen die Eingemeindung der Engelsdorfer Ortschaften nach Leipzig wehrte. Immerhin gab es eine fast 800-jährige Selbständigkeit, die über Nacht beseitigt wurde. Früher kam man in den Besitz einer Ortschaft, hatte man genügend Geld, sich diese zu kaufen, heute kann eine verarmte Stadt einen wohlhabenden Ort übernehmen, wenn sie nur den längeren Arm zu den Verwaltungsgerichten hat. Das Fazit ist, dass die in diesem Buch beschriebene Gemeinde Engelsdorf seit dem Beginn des dritten Jahrtausends nur noch ein Stadtteil der altehrwürdigen Messestadt Leipzig ist und damit ihre Selbstbestimmung weitgehend verloren hat.
Genau an dieser Stelle sehe ich den Ansatzpunkt, einen Blick zurück zu werfen, Begebenheiten an das Tageslicht zu holen, die ansonsten schnell in Vergessenheit geraten können. Das Volk von Engelsdorf war aufgefordert, sich an diesem Werk zu beteiligen und tat das, in der bekannten sächsischen Zurückhaltung. So wird der Wunsch gehegt, in einer zukünftigen Neuauflage dieses Bandes, noch mehr persönliche Erinnerungen aus der Neuzeit niederschreiben zu können.
Das Engelsdorf, in dem es in diesem Buch geht, so sei dem ortfremden Leser berichtet, liegt im sächsischen Tiefland, in unmittelbarer Nähe der Stadt Leipzig. Zu der Verwaltungseinheit Engelsdorf gehörten im Laufe der Zeit mehr oder minder die Ortschaften Sommerfeld, Hirschfeld, Althen, Baalsdorf, Mölkau, Kleinpösna und natürlich Engelsdorf selbst. Ein bisschen spielte die Nähe der Stadt Taucha und des Ortes Paunsdorf eine Rolle, so dass wir im Verlaufe der Zeilen auch da und dort einen historischen Blick riskieren werden. Zwischen den beiden Ortschaften Engelsdorf und Sommerfeld verläuft eine der wichtigsten, mitteldeutschen Verbindung, der Pfad, der Weg, die Heeresstraße oder die Landstraße von Leipzig nach Dresden und weiter bis Prag. Nicht unbedeutend war die Entwicklung des Stahlrosses für unsere Ortschaften, nahm denn die Eisenbahn sowohl in Form der ersten öffentlichen Ferneisenbahnstrecke, wie auch als wichtiger Standort bei der Inspektion und Reparatur der gleichen Dampfrösser einen wichtigen Platz ein.
Ich will jedoch nicht der Geschichte vorgreifen.
Es sei nur noch gesagt, dass ich keinen Wert auf detaillierte Zahlenangaben, sondern viel mehr Wert auf den menschlichen Erinnerungsfaktor legte, als ich dieses Buch zusammenstellte. Erwarten Sie also nicht, dass alle Eintragungen fehlerfrei nachweisbar sind, erwarten Sie aber, dass persönliche Blickwinkel, Erfahrungen und Erlebnisse, als auch neu entdeckte Dokumente des Engelsdorfer Volkes kleinlich wiedergegeben werden. Wollen wir uns doch unterscheiden von Bildbänden, und Videos, die es sicherlich auch von Engelsdorf gibt.
Wichtig ist es außerdem zu bemerken, dass wir keineswegs die eine oder andere Epoche und ihre jeweiligen Führer verherrlichen wollen. Die Betrachtung soll ganz einfach nicht, wie bisher oft geschehen, einseitig und politabhängig, sondern völlig neutral und bestenfalls pro Engelsdorf erfolgen. Erstmalig sollte es gelingen, auch die Geschichte unserer Gemeinde und ihrer Menschen, vorbehaltlos während der Zeit des Dritten Reiches zu beleuchten.
Unser erklärtes Ziel ist es, dazu beizutragen, dass unsere Kinder und Kindeskinder verstehen, warum ein Engelsdorfer ein Engelsdorfer ist und nicht ein Leipziger. Dieses Unterfangen ist äußerst schwer. Hätten Sie vor 600 Jahren einen Sommerfelder gefragt, ob er denke, dass alles Land zwischen Sommerfeld und Leipzig mit der Zeit bebaut sein könnte, er hätte an Ihrem Verstand gezweifelt, lagen doch damals zwischen Sommerfeld und Leipzig fast zwei Stunden schwerer Fußmarsch durch Dickicht und Unterholz, durch Schlamm und Felder. Alles ist nur eine Frage des Zeitpunktes einer Betrachtung.
Im Vorfeld möchte ich mich auf das Herzlichste bedanken, bei all denen, die mich während meiner fast dreijährigen Suche nach den Hinterlassenschaften unserer Menschen unterstützt und bei der Auswertung dieser Dokumente geholfen haben.
Im Besonderen möchte ich an dieser Stelle meinen Dank an Frau Ursula Ackermann richten, die sich schon seit jeher um die Erinnerungen der Engelsdorfer bemühte. Ebenso an unseren unvergessenen Herrn Fred Rabe, der vor wenigen Monaten Opfer einer schweren Krankheit wurde und nicht mehr unter uns weilt, der häufig eine Idee auffasste und loszog, um die richtigen Leute zu finden und zu befragen. Weiter gilt der besondere Dank Frau Iris Vieck aus Leipzig und Herrn Günther Bauer aus Naunhof, die ihrerseits die ältesten gefundenen Dokumente transkribierten, so dass ich sie verstehen und wiedergeben konnte.
Seit der Ausgabe der ersten Auflage sind einige Jahre ins Land gegangen. Diese – im Vergleich zur Gesamtentwicklungszeit – vergleichbar kurze Periode hat jedoch gezeigt, wie viele Erinnerungen verloren gehen können, wenn eine Gemeinde nicht mehr selbständig existieren darf. Der Zerfall von Engelsdorf hat seit der Eingemeindung einen raschen Verlauf genommen.
Es ist nicht der Steuern oder der Straßenumbenennungen wegen, es ist nicht der Selbstbestimmung oder der Eingemeindung wegen, es geschieht nur aus einem Grund, dass dieses Buch erscheint:
Damit Engelsdorf bleibt!
Die Entstehung
Wie es um Engelsdorf in grauer Vorzeit aussah, darüber gibt es jede Menge hochwissenschaftlicher Abhandlungen, die sich schwer lesen und noch schlechter verstehen lassen. Aus diesem Grunde überlassen wir Herrn Kurt Braune das Wort, der im Jahre 1927 im Heimatboden unserer Gemeinden einfach und verständlich über die urzeitliche Entwicklung unserer Region berichtete. Und manches aus seinem Bericht könnte heute schon wieder vergessen sein, hätten wir es nicht für die Nachkommenschaft aufgefrischt:
Wir wissen heute, dass unser Leipziger Land bereits seit vielen Jahrtausenden bewohnt wird; ja für die früheste Anwesenheit von Menschen müssen wir sogar mehrere Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung annehmen. Die einfachen Feuersteinwerkzeuge, wie Messer, Kratzer, Schaber, Bohrer, Spitzen und Faustkeile, welche sich in den Schottern der alten Elster-Pleiße bei Markkleeberg finden, liefern uns Beweise für diese Behauptung. Während des Eiszeitalters wurden jene Kiese und Sande zusammen mit den Flintwerkzeugen dort abgelagert. Artefakte nennt man diese ersten, durch Menschenhand künstlich erzeugten Waffen und Werkzeuge, und ältere Steinzeit heißt jener älteste Abschnitt menschlicher Kulturgeschichte.
Kein so hohes Alter weisen die geschliffenen und oft auch durchbohrten Äxte, Beile und Hämmer aus verschiedenen Gesteinen auf, welche sich häufig in unserer Gegend finden. Sie wurden von Menschen verfertigt, die während der jüngeren Steinzeit, etwa 5000 bis 2000 vor Christi, in unserer Heimat hausten.
Aus dieser Zeit, und zwar wohl aus dem letzten Drittel, stammt auch ein kleiner durchbohrter Axthammer, der sich in geringer Tiefe bei den Ausschachtungsarbeiten zu der Scheune des Herrn Gutsbesitzers Naumann in der Nähe der Kirche in Baalsdorf im Jahre 1925 fand. Er wurde liebenswürdiger Weise von seinem Besitzer, Herrn Faust in Baalsdorf, durch die dankenswerte Vermittlung des Herrn Pfarrer Hager, Engelsdorf, dem Naturkundlichem Heimatmuseum Leipzig, Lortzingstraße 3, als Leihgabe überwiesen.
Dieses Steinbeil, wie man verallgemeinernd oft sagt, ist 10 cm lang und an der dicksten Stelle 4 ½ cm breit. Es hat über dem Stielloch eine als Hammer verwendete ebene Fläche. Die 2 cm breite Schneide läuft parallel zur Durchbohrung. Gefertigt ist das Stück aus so genannten Amphibolschiefer. Durch das in mühevoller Arbeit mit einem Hartholzstabe oder einem Röhrenknochen und scharfkörnigem Sand unter Zuhilfenahme von Wasser gebohrte Loch wurde das Ende eines Astes gesteckt. Tiersehnen oder Bast dienten zur weiteren Befestigung. Der Baalsdorfer Axthammer ist nicht ganz regelmäßig geraten. Es gibt bedeutend schöner und ebenmäßiger geschliffene Exemplare. Jedoch lässt auch er eine schwache Facettierung erkennen. Seine Form zeigt, dass er von dem so genannten Volke der Schnurkeramiker hergestellt wurde. Das waren Menschen der jüngeren Steinzeit, welche ihre Tongefäße meist mit schnurähnlichen Verziehrungen versahen. Sie müssen also auch, wie der Fund zeigt, in der Gegend des heutigen Baalsdorf ihre Wohnsitze gehabt haben.
In früherer Zeit legten abergläubische Landleute solche Steinbeile, welche sie auf ihren Äckern fanden, auf die Türbalken oder unter das Dach, da sie glaubten, diese „Donnerkeile“ schützten das Haus gegen Blitzschlag.
Auf die jüngere Steinzeit folgte dann eine Kulturepoche, in der die Menschheit allmählich Metalle kennen lernte. Die schöne, goldgelb glänzende Bronze war das erste Metall, aus dem Werkzeuge und Waffen in größerem Umfang gegossen wurden. Bronzezeit heißt diese vorgeschichtliche Periode, während der in Sachsen und also auch in unserer Heimat ein fleißiges, friedfertiges Volk lebte, das Ackerbau und Viehzucht trieb. Das war etwa in der Zeit von 1800 bis 800 vor Christi. Zahlreich ist die Hinterlassenschaft jenes Volkes. Ein tönerner Spinnwirtel aus Engelsdorf, der sich ebenfalls im Besitze des Naturkundlichen Heimatmuseums befindet, beweist, dass sich also auch in der Engelsdorf-Baalsdorfer Gegend solche bronzezeitliche Siedlungen befanden, wo die Frauen den angebauten Flachs verspannten und ihre Gewandstoffe daraus webten. Während die Menschen der jüngeren Steinzeit ihre Toten bestatteten, verbrannten die Siedler der Bronzezeit ihre Toten auf Scheiterhaufen und setzten den Leichenbrand in Urnen bei, wobei solche Spinnwirtel häufig den Aschenurnen von Frauen beigegeben wurden.
Erst wenige Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung wurde Bronze als Werkzeugmetall endgültig vom Eisen verdrängt. So mögen die Funde, welche im mütterlichen Schoße unserer Heimaterde verborgen ruhen, bis sie ein glücklicher Umstand ans Tageslicht befördere.
Das Jahr 743
Es war wohl eine eher kleine Gruppe von Sorben, die im Laufe eines Menschenlebens den Weg entgegen der Mittagssonne genommen hatte, um eine neue Heimat zu finden. Die Menschlein, ihre Heimat war einst an der großen blauen Donau, hatten ihr Slawenland verlassen und liefen und liefen, bis sie nicht mehr konnten, dann machten sie eine Pause, die sich auf Stunden, Tage oder Wochen dehnen konnte, verloren sie einen der ihren auf dem Weg, verbrannten sie ihn und verließen schnell den unglückseligen Ort.
Eines Tages aber, man hatte gerade einen unendlichen Sumpf hinter sich gebracht, blieben unsere Sorben nicht nur Stunden, Tage oder Wochen, sie blieben Monate, ein Jahr, Menschenleben lang. Die Gegend erschien ihnen optimal. Es war feucht, riesige Wälder erstreckten sich durch die Flur, es war warm, der Boden war angenehm und weit und breit hatte man keinen verfluchten Germanenweiler gesehen. Aller Orten sprudelten kleine und große Flüsschen durch das Land.
Erst nachdem eine Generation geboren ward, die sich nicht an die lange, lange Reise erinnern konnte, als die Dörfer gewachsen waren, kreisförmig, wie die Sonne, als die ersten Einwanderer andere Einwanderer gefangen und zu ihren Halbfreien gemacht hatten, als die Sorben begannen, lokale Ortsvorsteher zu benennen, die als dann Bezirke bildeten, welche sich wiederum sorbische Edelleute unter den Nagel rissen, erst zu diesem Zeitpunkt könnte man von einer festen Ansiedlung von Menschen sprechen. Ob jedoch in dieser Zeit schon unsere Gemeinden entstanden, das kann heute niemand behaupten, weil es keine Beweise gibt.
Die Sorben waren ein sehr friedfertiges Volk und auch, wenn man ihnen das angebliche Bringen von Menschenopfern nach sagt, die sie ihren jeweiligen Gottheiten opferten, so sollte man denn eher davon ausgehen, so dass sie das einzige friedliche Volk waren, das in den letzten 1300 Jahren in der Gegend um Leipzig lebte.
Man sollte sich vorstellen, dass ein Sorbe sieben Tage und Nächte laufen musste, bevor er den Bewohner eines anderen Dorfes begegnen konnte, so dünn besiedelt waren die Auen und Flächen unserer heutigen Gegend. Fast vierhundert Jahre lebten die Sorben in ihrer friedlichen Einsamkeit, angelten, jagten, liebten, rodeten, bestellten und vermehrten sich tagein und tagaus. Was anders hätten Naturmenschen ihrer Art auch tun sollen? Das Land unserer Region war bestenfalls schlechtes Ackerland. Der Rest der Völkerwanderungen jedenfalls strömte an den Sorben vorbei. Streitigkeiten gingen sie aus dem Weg, so sie nur konnten.
Bis eines Tages die Deutschen kamen.
Das Jahr 1094
Es war an einem lauen Herbstnachmittag, als der deutsche Mönch Angelus, gemeinsam mit seinem Halbbruder Herse und fast sechzig Getreuen (während des Marsches hatten sich einige flandrische Bauern dem Zug angeschlossen) im Kloster Altenzella eintraf. Die Rittersleute, die den etwas verwahrlost erscheinenden Zug begleitet hatten, wurden entlohnt und ritten über staubige Wege davon.
Der Gruppe wurde Einlass gewährt, nachdem Angelus mit lauter Stimme darum gebeten hatte.
Drei Tage verbrachte die Gruppe im Kloster, die Menschen, unter ihnen auch etliche Kinder, konnten nun endlich ausharren und Kräfte sammeln. Schließlich wussten sie, dass ihre Reise noch kein Ende hatte. Angelus und die Seinen suchten eine neue Heimat, in der sie Ackerbau betreiben, Häuser bauen und ihr Leben fristen konnten.
Am vierten Tage nach der Ankunft im Kloster Altenzella, Angelus war gerade etwas eingeschlafen und hatte sich in seine Mönchskutte zurückgezogen, als ihn ein Knecht unsanft mit den Worten weckte: „Angelus, euer Begehren wurde erhört. Man ist bereit, euch zu empfangen.“
Angelus streckte sich, rückte seine Kutte zurecht, schickte ein kurzes Stoßgebet gen Himmel und rief: „Bruder Herse!“
Herse, der zehn Jahre mehr auf dem Buckel hatte, als Angelus, stand sofort bereit. „Es ist Zeit“, sagte er nur.
Unter den hoffnungsvollen Blicken der Angehörigen, stampften Angelus und Herse hinter dem Knecht her, hinein in die kühlen Gemäuer des Klosters.
In einem dunklen Raum, in dem nur ein einziges flackerndes Kerzenlicht stand, wurden sie von einem Edlen empfangen, der einem Fürstenhause entstammte und dem Bischof von Meißen hörig war.
„Nennt euer Begehren!“, sprach jener, ohne sich zu Angelus und Herse umzuwenden.
„Unsere Wünsche sind nicht groß, Herr. Wir suchen für die unseren einen gerodeten Strich Land mit Wasser und Wald daneben. Dort wollen wir unser Leben fristen, im Dienste des Herrn und in eurem Dienste“, antwortete Angelus leise.
„Nun sagt denn, was euer Gefolge zählt!“
„Es sind derer vieler. Und einige Bauern dabei, die zu uns stießen und auch Kinder.“ „So sei es denn“, sprach der vornehme Herr nach einer längeren Denkpause. „Ihr bleibt hier, bis zwei Ritter samt Knappen auftauchen, die euch die Striche zuweisen, an denen ihr leben und verteidigen könnt. Aber seid gewarnt vor Schalartahnen, Landstreichern und fremden Heeren. Schützt euch und euer Hab und Gut und macht euch die Sorben zum Untertan. So geht denn mit Gott.“
„Gott sei mit Euch, edler Herr!“, murmelten Herse und Angelus fast gleichzeitig. „Wir werden Euch in unsere Gebete einschließen.“
Rückwärts schlürften die beiden neu ernannten Siedler aus dem Raum. Draußen warteten die Angehörigen gespannt. Und auch die Bauern waren des Herumziehens leid.
Letztendlich verging noch einige Zeit und die ersten Vorboten des Winters klopften an das Tor des Klosters, als endlich zwei Ritter auftauchten, die mit ihren Knappen und gut gewaffnet unsere Siedlergruppe in ihre Obhut nahmen.
Ein ausgedehnter Marsch über einige Tage folgte. Man wand sich gen Osten, durchquerte viele Wälder und Sümpfe, sah hier und da bereits das eine oder andere Straßendorf von Siedlern und begegnete auch einem Runddorf, das die Sorben das ihre nannten.
Irgendwann gelangte man auf einen deutlich erkennbaren Weg, der schon viele Hufe und Füße gesehen haben musste. Was die Siedler nicht ahnten war, dass sie auf Heerstraße liefen, die von Leipzig über Dresden und Prag nach Wien führte. Man kam entlang einer Civitas, einer stolzen Burg an einem feinen Flüsschen. Es war jener Ort, der zwei Menschenleben später das Stadtrecht verbrieft bekam, an der Pleiße liegt und nach der Linden benannt wurde, die es hier im Überfluss zu geben schien.
Nach einer nächtlichen Pause, es herrschte eine gewisse Aufregung in Hinblick auf das Kommende, die Rittersleute hatten zu verstehen gegeben, dass man bald schon am Ziele wäre, setzte man den Marsch gen Süden auf dem schon genannten Wege fort. Einige Zeit später, die Sonne lugte gerade etwas durch die Wolken, stiegen die Ritter unter Hilfenahme der Knappen von ihren gut bestückten Rossen und sammelten Angelus, Herse und den Anführer der Flandern um sich.
„Wir sind am Ziel. Hier ist das Land, das unser Herr euch zugewiesen hat“, hub einer der Ritter zu reden an. „Es sollen derer drei Höfe entstehen. Ihr“, er zeigte auf Angelus, „sucht euch ein Fleckchen in dieser Richtung.“ Seine Hand wies rechts vom Weg in die Büsche. „Und ihr“, er zeigte auf den flandrischen Bauern, „siedelt euch auf der anderen Seite des Weges an. Aber seid gewarnt, bleibt in der Nähe dieses Weges und schützt euch vor Plünderung und Dieben. Und ihr“, damit meinte er Herse, „sucht euer Feld in dieser Richtung. Wenn die Sonne am höchsten steht, haltet ein und bleibt.“
Es folgte eine kurze ritterliche Verabschiedung, kombiniert mit der Übergabe kleiner Schriftrollen, die leider Gottes im Laufe der Zeit verschwanden, dann ritten die Begleiter der Siedler von Dannen und verschwanden hinter einem flachen Hügel. Einige Zeit hielten die Siedler inne, nur das Rascheln abfallender Blätter, das Zwitschern einiger Vögel und das Rauschen des Windes waren zu hören. Ringsum erhoben sich hohe Laubbäume, dazwischen lagen traumhafte, von hohem Gras bewachsene Lichtungen.
Als Erster brach der Bauer aus Flandern das Schweigen. In seiner niederländischen Sprache, welche die deutschen Siedler kaum verstehen konnten, erklärte er seinen Bauern und dem wenigen Gefolge: „Man hat uns dies Sommerfeld (niederländisch Sumvelt) zugewiesen. Hier werden wir bleiben und kein Wasser wird mehr unsere Felder bedrohen. Lasst uns für die Nacht ein Lager vorbereiten.“ Mit diesen Worten verließen die Neusommerfelder den Weg und sollten in den kommenden Generationen das Land urbar machen, dass sich direkt am Wege befand. Später würde sich herausstellen, dass diese Entscheidung nicht die beste war, denn immer wieder wollten fremde Heere die reiche Messestadt Leipzig erobern, und ein jedes Heer nahm als erstes von den Eigentümern des direkt am Heeresweg liegenden Dorfes Sommerfeld Besitz. Und noch später quälten sich lange Staus durch Sommerfeld, als die Straßen befestigt und stinkende, motorisierte Fahrzeuge sich durch den Ort bewegten ...
Der Ort Sommerfeld jedenfalls war gegründet.
Herse tat, wie ihm befohlen. Er nahm die Seinen und schlug sich durch das Unterholz in südlicher Richtung, bis die Sonne am höchsten stand. Man fand sich auf einer riesigen Lichtung wieder, die glatt wie eine Scheibe war, kaum ein Hügel störte die Landschaft. Der Boden war gelblich und Bäche schlängelten sich durch das Gehölz. Schon vor dem Winter hatten Herses Leute eine Hütte gebaut, die ihnen das Überleben sichern würde. Herses Feld lag weit ab von der Heeresstraße, so dass die meisten Krieger es nicht fanden und verschonten. Jedoch machte im Laufe der Zeit auch die industrielle Entwicklung einen Bogen um das gegründete Hirschfeld, wie man es heute nennt, denn noch immer ist das Dorf ursprünglich wie eh und je.
Letztlich fanden auch Angelus’ Leute ihren Platz. Auf einer großen Lichtung, unweit eines sorbischen Dorfes (Mölkau) und wenige hundert Schritte nur von Sommerfeld entfernt, ließ man sich, zweihundert Fuß von einem kleinen Hügel entfernt, nieder. Angelus’ Dorf, später auch Engelsdorf genannt, hatte damals die meisten Bewohner. Der Mönch sorgte sich auch mehr um die Sicherheit seiner Leute. Schon im nächsten Frühjahr begann man, auf den kleinen Hügel, unweit der Feuerstellen, große Steine zu rollen, hinter denen man sich bei nahender Gefahr verstecken und die Lage gut beobachten konnte. Wahrscheinlich ist, das diese Steine in die Grundmauern der später erbauten Kirche mit einbezogen wurden.
So, oder ganz anders, könnte die Entstehung der Ortschaften Sommerfeld, Engelsdorf, Hirschfeld und Mölkau vonstatten gegangen sein. Ringsum entstanden auf ähnliche Weise Althen, Kleinpösna und Baalsdorf. Großer Chef zu jener Zeit war der Markgraf Hermann, genannt wurde die Leipziger Tieflandbucht damals Gau Chutizi. Manch einer behauptet bis heute noch, bei der Gründung der Siedlung wäre einem der Siedler eine Engelsgestalt erschienen und daher käme der Name Engelsdorf.
Um 1300
Dass jenes kleine Dorf Hirschfeld zu Beginn des 3. Jahrtausends nach Christi der Stadt Leipzig zugeordnet wurde, erscheint schon etwas makaber, ist es doch ein ursprüngliches Straßendorf geblieben. Die nachgewiesene Ersterwähnung führt in das Jahr 1327 zurück, wobei man annehmen kann, dass die ersten Ansiedlungen schon früher erfolgten. Die Abhängigkeit von der Stadt Leipzig war selbstverständlich schon häufiger gegeben, betrachtet man die Historie des Dörfchens, allerdings als Ortsteil der Stadt wird Hirschfeld erst seit der Zwangseingemeindung nach Leipzig in der jüngsten Neuzeit gehandelt.
Im Folgenden betrachten wir einige interessante Bemerkungen aus verschiedenen geschichtlichen Dokumenten, die sich mit dem Dörfchen, das wenige Meter neben der heutigen Autobahntrasse von Leipzig nach Dresden liegt, befassen.
Der Name hat mit dem Auftreten von Hirschen in jener Gegend wahrscheinlich nichts zu tun. Eher könnte es sein, dass es das Feld eines Ansiedlers mit Namen Hirse oder Herse (es kommt auch die Bezeichnung Hersfeld vor) war, weniger, dass dort Hirse angebaut wurde.
Die Kirche ist mit ihrem Turm der älteste Zeuge vergangener Zeiten. Man schätzt ihre Erbauung zu Anfang des 13. Jahrhunderts.
Hirschfeld gehörte dem Jungfrauen- oder Nonnen-Kloster zu St. Georgen in Leipzig zu Lehen.
Aus dem Amtsbuch de ao 1564 Rep. XVI. Loc. fol. 19b lt acta (die sogen. Kirch-Hufe) Item das dorf Hirschfeld Ist ym Ampt Leipzigk gelegen und dem Jungfrau Kloster zur Sanct Georgen vor Leipzigk zustendigk mit allen gerichten obersten und nydersten soweit die Graben und Zeune des Dorfes wenden. Aber auswendig der Zeune und Grebenfymdt die gerichte oberst und nyderst gnedigen Herrn zustendig und die Margk des Dorfes begreift alle wuste Margk darauf auch meynen gnedigen Herrn alle gericht oberst und nyderst dergleichen zustendig. Und erstrecket dieselbige margk bis an Zweendorffer, Alten, Kleindost, und Wolfhayner Margk.
Im Jahre 1543 ging es in den Besitz des Rates zu Leipzig über lt. Pf. Akt. Kirchenmatrikel (Abschrift aus den Ephoralakten). Zu Hirschfeld hat es 16 besetzte Höffe, darunter 5 Erb Pferdner; der Rat hat soweit die Zaun und gràben gehen, die Ober- undt Erbgerichte. Im 30jährigen Kriege kaufte der Rat (1622) von Herrn Ponickau auf Pombsen 500 Scheffel Korn für 6500 Gulden; der Rat konnte nicht bar bezahlen; er zinste jährlich, bis er schließlich 1641 die Dorfer Baalsdorf und Hirschfeld an Johann v. Ponickau auf Pomsen und Görg von Ponickau auf Preusa u. Gornewitz verpfändete. Durch kürfürstliche Verordnung vom 15. März 1663 hieß es: Welcher gestalt wir pp. unserm pp. Ponickau die Hufen- Kalb-Weinwagen und Heuwagengelder, sowohl Zinskorn und Zinshafer, so die Dörfer Baalsdorf und Hirschfeld dem amte Leipzigk abzuführen schuldig gewesen, erblich überlassen. Über die Ponickaus lassen wir uns bereits an anderer Stelle aus, so dass wir hier nicht näher darauf eingehen müssen. 1729 verkauft Johann August v. Ponickau Baalsdorf u. Hirschfeld an s. Bruder Johann Christoph von Ponickau auf Belgershayn für 9000 Gulden, meißnischer Währung, den Gulden zu 21 Groschen gerechnet. Es wurde damals den Gemeinden ein Schriftstück vorgelegt (lt. Akten im Archiv zu Pomsen).
Untertanen Pflicht
Ihr sollet geloben und schwören, daß dem Hochwohl gebohrnen Herrn Johann Christoph von Ponickau auf Belgershain und Köhra Sr. Kgl. M. in Polen und kurfürstl. durchl. zu Sachsen hochbestallten Kammerherrn Schlosshauptmanns zu Wurzen als euern Erb- Lehn- und Gerichtsherrn und demselben Leibes- und Lehns Erben. Ihr wollt getreu, gehorsam und gewärtig sein daneben alle demjenigen, was von Sr. Excell. oder der Schöffen und Gerichten euch anbefohlen wird mit allen treuen Fleiße und nach unserm Vermögen unweigerlich nachkommen, die Steuern, Zinsen und andern Abrichtungn und Gefälls iedesmahl zur rechten Zeit abzuhalten, desgleichen die Dienste nach Anleitung eures Kaufbriefs und was ihr sonst fur schuldig jederzeit willig verrichten. Und inübrigen euch in keiner Versammlung der eurer Obrigkeit gehandelt oder geratschlagt worden und derselben zum Nachteil, Schaden und Gefährlichkeit gereichen möchte weder mit dem Rath noch viel weniger mit der Tat finden lassen, sondern vielmehr so viel an euch ist, Schaden warnen und verhüten, hingegen aber derselben Nutzen frommen und bestens befördern helfen, auch da ihr etwas so wider Sr. Exc. und derselben Lehns- und anderer Erbe an Standes Würde oder Hab und Güter zu wider vorgenommen würde, erfahren sollet, solcher alsobald Sr. Exc. oder derselben Schöffen ohne Scheu getreulich offenbaren und auch sonsten im allerwege also bezeugen wir einem frommen und gehorsamen und getreuen Untertanen eignet, oblieget und gebühret.
Die Verpflichtungsformel lautete:
Wir allerseits vorher benannt Untertanen zu Baalsdorf und Hirschfeld schwören hiermit diesen leibl. Eyd, daß wir alle demjenigen so uns anitzo deutlich ab und fürgelesen und zur Genuge erklärt worden, wir auch wohl verstanden, überall treulich und unverbrüchlich nach unseren äußersten Vermögen nachkommen und auch davon weder Furcht oder Gunst, Freund oder Feindschaft, Geschenk und Gabe noch sonst einiger anderer Ursache abhalten lassen wollen. So wahr uns Gott helfe und sein heiliges Wort Jesus Christus.
Es haben unterschrieben von Hirschfeld:
Andreas Helbrich, Richter; Hannß Rolle, Pferdner; Ambros Mühlberg, Schöpper; Christoph Winkler; Christoph Döring, Schöpper; Christian Beck, Häußler; Martin Graul, Pferdner; Gottfried Schrön, Häußler (u. Wagner); Gottfried Döring, Halbhuffner; Daniel Scholle, Halbpferdner; Hannß Krebs, Häußler; Christian Winkler; Witwe Hentzschel; Michael Encke, Pferdner; Sabina Heßl (Heßler), Halbhüffner; Christoph Encke, Halbhuffner; Hans Mosche, Häußler; Hans Brückner, Häußler u. Leineweber.
Um 1729 wohnten noch in Hirschfeld, lt. Kirchenbuch:
Gottfried Wachsmuth, Inwohner in Mühlbergs Häusel; Christian Findeisen, Windmüller; Christoph Böttger, Schneider; Gregor Reinknecht, Hufschmied; Christian Riedel, Nachtwächter; Jacob Hecht, gewes. Richter, als Auszügler; Georg Richter, Hütmann (Hirt).
In den Jahren um 1700 wurden noch genannt Jäger, Straube, Heinicke, Klette, Franke, Friedrich, Nötzsch, Hoffmann, Wißner.
Hirschfeld war auch verpflichtet, der Universität zu Leipzig jährlich ein gewisses an Gelde, so der große und kleine Schoß genannt wird, zu geben.
Unter dem Ort befinden sich große Ansammlungen von Kiesen, die dazu führten, dass nach der Industrialisierung und durch den großen Bedarf der Stadt Leipzig direkt neben dem Ort der Kiesabbau erfolgen sollte. Rings um den Ort wird nach wie vor Ackerbau betrieben.
Heute ist Hirschfeld von Kiesgruben und Autobahn eingeschlossen.
Unglaublich aber wahr ist die Tatsache, dass eines Tages auch der winzige Ort Hirschfeld von der Stadt Leipzig eingemeindet werden sollte.
Um das Jahr 1350
Da gibt es in Engelsdorf eine Kirche, die eigentlich nicht in Engelsdorf liegt. Warum sie außerhalb auf einem Hügel gebaut wurde, liegt auf der Hand und wurde schon erläutert. Es sei nun erzählt, woher die Kirche ihren Namen hat, und was im Laufe der Zeit mit ihr geschehen ist.
Den Namen St. Pancratius hat nicht die Kirchbehörde oder der Kirchenvorstand vergeben, damit man sie besser von der Sommerfelder Kirche unterscheiden könnte, sondern die Kirche zu Engelsdorf trägt ihren Namen St. Pancratius nachweisbar mindestens seit dem Jahre 1520.
Die Kirche selbst gibt es jedoch viel länger. Am ältesten sind die Grundmauern des Turmes, die bereits im 13. Jahrhundert errichtet wurden. Man hatte den Turm auf einer Anhöhe angelegt und um ihn herum eine Mauer gezogen, eine Art Burgwall. Damit liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine Wehrkirche gehandelt haben musste. Dass diese Anlage früher manchmal als Zufluchtsort gedient hat, ist sicher anzunehmen.
Da die Kirche, wie bereits bemerkt, außerhalb des Dorfes stand, war es nicht immer einfach, diese bei herannahender Gefahr zu erreichen. Aus jenem Grunde huben die Bewohner Engelsdorfs irgendwann einen Graben aus, der vom alten Brauschankgut im Dorfe quer durch die Wiese zum Hügel führte. Später legten sie dicke Äste darüber und Erde oben auf, so dass sie nun unbemerkt zur Wehrkirche gelangen konnten. Da aber immer wieder Menschen und Tiere in den Gang einbrachen und die Zeit der Abdeckung mächtig zusetzte, ließen die Engelsdorfer den Graben wieder verfallen und alles was blieb, ist die Legende darüber. An der Ostseite des Kirchturmes befand sich eine halbkreisförmige Apsis oder Concha, deren Fundament und Triumphbogen heute noch zu erkennen sind. Diese Concha war gewölbt und diente jedenfalls als Sakristei. Als im ursprünglichen Mauerwerk gelegen, muss auch der Treppenaufgang angesehen werden, der sich in der jetzigen Sakristei befindet und als Aufbewahrungsraum mit einer eisernen Tür beschlagen dient. Jedenfalls führte diese schmale und enge Treppe nach der Kanzel, die sich danach nicht in der Mitte, sondern auf der vom jetzigen Kircheingang gesehenen rechten Wandseite befunden haben musste. In einer Kirchrechnung vom Jahre 1734 wird erwähnt, dass der Turm noch sehr gut in Mauerwerk mit grauen Kalk- und Bruchsteinen gemauert, aber wenig höher als das Kirchendach sei, so dass die wenigsten Kirchenkinder das Läuten hörten. Nach der Kirchrechnung aus dem Jahre 1769, befand sich der Altarraum in der heutigen Sakristei, im Untergeschoss des Kirchenturmes. Der Rundbogen, in dem der Altar stand, ist in der Sakristei noch sichtbar.
Im Jahre 1773/74 machte sich eine Erneuerung des Glockenstuhles notwendig. Eine durchgreifende Veränderung des Turmes wurde jedoch erst im Jahre 1863 vorgenommen. Der bisherige Turm war eine spitz zulaufende Pyramide, in der Höhe von 22 Ellen vom Sims aus gerechnet. Unter dem Sims befanden sich die Schalllöcher, die ungefähr in der Mitte der Höhe des Kirchdaches lagen. Auf der Mittagsseite des Turmes ist das Schallloch noch zu sehen. Über dem Sims befand sich dem Dorfe zu gewandt, das in einem Erkerchen befindliche Ziffernblatt. Die Turmfahne trug die Jahreszahl 1815.
1863 baute man den Turm in seine jetzige Gestalt um. Der Umbau kostete immerhin 3000 Taler und wurde durch den Baumeister Guth aus Hirschfeld ausgeführt. Bald darauf zeigten sich im alten Unterbau Risse, die durch das Läuten der Glocken verursacht wurden. Dem wollte man Abhilfe dadurch tun, dass man den Turm mit Eisengürteln umspannte. Als das nichts half, entschloss man sich, den Glockenstuhl vom Mauerwerk zu trennen, und so ruhte nun der Glockenstuhl auf vier großen Balkensäulen, die durch den ganzen Turm laufen und auf dem Erdboden gegründet sind.
Woher aber nun stammt der Name St. Pancratius?
Es ist einem Herrn Dr. Krebs aus Leipzig zu verdanken, der mit einer Vorliebe das Leipziger Ratsarchiv durchforstete und dabei im so genannten Kontraktenbuch im Jahre 1926 auf eine alte Urkunde stieß, aus der man das Folgende entnehmen konnte:
„Mattis schultz hat die Hülfe vmb 61 Gulden 7 Groschen, So er der Kirchen zu Sandt pancratius zu Engelsdorf schuldig, gewilligt, in maßen, die wirklich bescheen dergestalt, sich bynnen dreien virzcehn tagen zu vortragen. Aber alsdan die einweisunge zu dulden. Act. Dinstag nach Johannis baptiste.“
Heute hätte Matthias Schultz ein Schreiben erhalten, auf welchem ihm mitgeteilt worden wäre, dass er gefälligst die 61 Gulden und 7 Groschen, die er der Engelsdorfer Kirche St. Pancratius schuldet, kurzfristig zahlen sollte, da er ansonsten gepfändet werden würde.
Mit der Entdeckung dieser Urkunde hat Dr. Krebs der Kirchgemeinde Engelsdorf einen großen Gefallen getan, denn damit wurde ein vergessener Name 1926 wieder an das Tageslicht gebracht. Die Engelsdorfer Kirche, die bekanntlich der evangelisch-lutherischen Konfession folgt, hatte demzufolge den Namen erhalten und wieder angenommen, der aus katholischen Zeiten stammte. Bedenkt man, dass die katholische Kirche und die evangelische Kirche schon seit langer Zeit wenigstens nicht gut Freund miteinander waren (darauf gehen wir an anderer Stelle nochmals ein), war diese Namensübernahme schon bedeutungsvoll. Zu Pancratius sei zu sagen, dass ihm der 12. Mai im Kalender vorbehalten ist. Er ist einer der drei Eisheiligen. Höchstwahrscheinlich sollte dieser Kirchenname die umliegenden Fluren vor den Unwettern der Eisheiligen schützen. Nach der Legende soll Pancratius als 13-jähriger Knabe am 12. Mai 257 (manche meinen auch 304), den Märtyrertod durch das Schwert unter dem römischen Kaiser Valerian (253-260) erlitten haben. Er ist deshalb meistens mit einem Schwert oder einer Lanze abgebildet. Jedenfalls soll er glaubensfreudig gestorben sein.
Doch zurück zur Kirche.
Wenngleich die Engelsdorfer schon häufig etwas neidvoll hinüber schauten, auf die Sommerfelder Kirche, so gibt es doch noch einiges über das Längshaus der St. Pancratius zu erzählen. Das alte und ursprüngliche Längshaus, stand auf der selben Fläche, wie das an seine Stelle getretene, jetzige Längshaus. Das Dach, mit Ziegeln gedeckt, war, wie die vorhandenen Spuren an der Turmseite des Kirchbodens zeigen, zirka anderthalb Meter niedriger und lief nicht so schräg. Die Außenmauern und damit auch die Decke des Längshauses, waren zirka ein Meter niedriger, was man an der ursprünglichen noch vorhandenen Eingangstür vom Turm aus nach dem Kirchboden erkennt. Die jetzige Öffnung ist später erst in das Gemäuer des Turmes gebrochen worden. Vor dem Längshaus befand sich eine Vorhalle, die 1770 erweitert wurde. 1768 erhielt die Kirche eine gründliche Ausbesserung, bei welcher auch eine neue Treppe angelegt wurde, die auf das Sakristeigewölbe und den Turm führte. Es ist möglich, dass diese Steintreppe außen von der Mitternachtsseite des Turms in die Höhe führte. Vom Inneren des Turms ist diese Turmnische noch zu sehen. Sie ist später zugemauert worden, und nur ein kleines Fenster blieb offen. Im Jahre 1832 machte sich abermals eine Renovierung nötig. Es stellte sich heraus, dass die alten Mauern so baufällig waren, dass sie abgebrochen werden mussten. Es entstand das Längshaus, wie es heute noch steht, in ganz anderem Stile, wie der Turm, ohne Hallenanbau. Die Engelsdorfer stellten fest, dass das altehrwürdige Gebäude viel an Harmonie und Schönheit verloren hatte. So manches aus alter Zeit stammende, fiel damals dem Umbau zum Opfer.
Die Engelsdorfer Kirche rettete sich über die Kriege und stellt sich heute fast unverändert dar. Leider wurden zu Zeiten der Kommunisten nur wenige Mittel für solcherlei unbedeutende Kirchen bereitgestellt, so dass die Kirche recht undicht wurde und mehr Regenwasser als Taufwasser in ihr floss. Dabei wurden auch mancherlei altehrwürdige Schriften in Mitleidenschaft gezogen, so dass zur Zeit viele Papiere mit Hilfe chemischer Verfahren gerettet werden müssen. An der Finanznot der Engelsdorfer Kirche hat sich jedoch auch nach der kommunistischen Herrschaft nichts geändert.
Das Jahr 1359
Die örtliche Nähe der Stadt Leipzig, die in unserer Zeit zur gänzlichen Eingemeindung führen sollte, brachte auch im 14. Jahrhundert einige Unannehmlichkeiten für unsere hiesigen Bauern mit sich. Unter anderem berichtet darüber ein sehr seltenes Dokument aus dem Jahre 1359, das bis in unsere heutige Zeit erhalten blieb. Um Ihre Fähigkeit, liebe Leser, zu testen, diese alte deutsche Sprache zu verstehen, werden wir das Dokument in seiner ursprünglichen Fassung niederschreiben. Als Hinweis sei erlaubt, lesen Sie laut und hintereinander weg, was da steht, damals war es Sitte, alles so zu schreiben, wie es gesprochen wurde. Geschrieben wurde auf Pergament mit Tusche und einer Gänsefeder. Danach werden wir aufklären, ob Sie verstanden haben, was damals geschrieben wurde.
„In deme jare nach gotis geburt thusent drihundert in deme nuen unde viunftzigsten jare, do hensil schus burgermeister waz (war) onder deme diz buch gemachet wart, also vorn in disem buche geschriben ist, do waz man vorn wurden unn waz in vurgessenheyt komen umme die helleschen (hallischen) brucken unn ouch umme andere brucken unn wege der stat zeu lipzk (Leipzig), der vil geburn (Bauern) unde dorfern umme in der solbin stat zol vri von unserm aldem herren gemacht sint. Do wurden de solbin geburn unde dorfer de da zcol vry sint besant vor den solbin rant der stat alda benanten ir eyn teil, waz itlicher unn itlich dorfschaft machen adir (oder) geben sal, nach deme alse hir nach geschriben ist. Doch bleibt ir eyn teil unschriben umna kriges willen, de sprachen se weren vri von iren vrien sadelhouen unn von anderen wederreden, de doch unglauplich waren.
Die geburn von syuerdishayn (Seifertshain) bekanten czu machen die zweite roten (Rute als Längenmaß) Die geburn von vorholn (Fuchshain) de dritten Die geburn von holtzhausen die vierden Die geburn von der weinigen pezen (Kleinpösna) de viunften Die geburn von hersuelt (Hirschfeld) bekanten zeu machene eyne rothen vor deme huse daz etteswenne waz Jenchin swartzen.
Die geburn von baldewinstorf (Baalsdorf) bekanten eyner rothen zeu machene vor deme huse, daz etteswenne waz henniges von der pezen unn vor deme hurze tetzen meynhart. ...“
Das Schriftstück umfasste im Übrigen noch mehr Eintragungen, im Ganzen 59 Pergamentblätter, in denen erstens die gefassten Beschlüsse des Leipziger Rates, 2. die Namen der wegen begangener Verbrechen Geächteten und 3. die Renten der Stadt Leipzig innerhalb und außerhalb der Stadtmauern beschrieben wurden. Aus dem dritten Abschnitt entstammen auch unsere Ausführungen.
Tatsache war, dass im 14. Jahrhundert die Bauern besonders zur Messe in die nicht allzu weit entfernte Stadt kamen. Nun konnte es sein, dass sich ein Dorf durch besondere Weise (Geschenke, Kriegsdienste o.ä.) durch den Landesherrn das Recht erwirkte, dass seine Bürger ohne Entrichtung des damals üblichen „Torgeldes“ durchs Stadttor fahren durften. Ebenso ließen die Bauern sich von der Verpflichtung befreien, die Straßen, die nach der Stadt führten, in Ordnung zu halten, oder Kriegsnöte machten diese Leistung vergessen. Die oben zitierten Zeilen reden ganz einfach davon, wie der Leipziger Rat die Pflichten der umliegenden Dorfschaften auf Instandsetzung der Straßen und Brücken (die Stadt war ja von einem ziemlich breiten Graben umzogen) wieder neu festlegte. Damit wurden alle persönlichen Absprachen und Bestechungen über den Haufen geworfen.
Das Auffinden dieser Pergamente jedoch, ist in ganz anderer Hinsicht wichtig für unsere Historiker. Es ist ein Beleg darüber, dass die genannten Ortschaften zu jener Zeit bereits erblüht waren. Es gibt Aufschluss über die alten Namen und damit über die Herkunft der Dörfer.
Das Dokument tauchte im Übrigen erst im Jahre 1855 wieder auf, nachdem es sich in privaten Händen befunden hatte.
1372
Aus dem vollständigen Staats-Post- und Zeitungslexikon von Sachsen, erschienen im Verlag der Gebrüder Schumann in Zwickau 1824, sei folgende Notiz über Sommerfeld wieder gegeben:
„Sommerfeld, ein schriftsässiges Dorf im Königreich Sachsen, Leipziger Kreises und Leipziger Amtsbezirkes, dem Stadtrat zu Leipzig gehörig. Es liegt 1¾ Stunde östlich von Leipzig, ¾ Stunde von Taucha, an der Chaussee von Leipzig nach Dresden, in einer ebenen, etwas erhabenen Gegend, etwa 500 Fuß über dem Meere. Das Dorf hat nur 40 Häuser, gegen 240 Bewohner (1801 gab man 193 Konsumenten an), dehnt sich aber doch gegen Ost hin lang aus; zu den 27 Gütern (worunter 1655 fünf ganze und vier halbe Pfründnergüter waren) gehören nicht nur die ursprünglichen 29 Hufen des Dorfes, sondern auch die wüste Mark Wehrbruch mit 8¾ Hufen und der in Nordost gelegene angenehme Busch, der Willwisch genannt, auch gehört nach Sommerfeld der Teich an der Eilenburger Straße zwischen dem Heiteren Blick und Taucha.
Die hiesige Kirche ist im Filial von der ¾ Stunde entfernten Panitzsch, und sowohl hier als in dem kaum ¼ Stunde südöstlich entfernten Althen, dem anderen Filial von Panitzsch, hat der Pfarrer jeden Sonntag zu predigen. Zu bemerken sind noch der Gasthof, die Wohnung des Ratsförsters und die Windmühle.
Die Bewohner nähren sich fast durchgängig von der Landwirtschaft, wozu sie Felder von mittlerer, an einzelnen Punkten auch von mehrerer Güte haben; außerdem aber haben viele von ihnen das Recht, als Landfleischer Sonnabends und Dienstags in Leipzig (auf der Ritterstraße) mit Fleisch zu handeln, wofür sie theils einen bestimmten Kanon, theils von jedem Stück Vieh unterm Thore eine gewisse Abgabe geben; den Verkaufspreis haben die Landfleischer (zusammen 70, die meisten aus Seehausen, Panitzsch, Sommerfeld, Eutritzsch und Portitz) nach der jedesmaligen Taxe, welche die Stadtfleischer angeben, und etwas niedriger als die ihrige stellen zu halten; und um 4 Uhr müssen sie die Wage und Gewichte weglegen, können aber noch nach der Hand verkaufen.
Merkwürdig ist Sommerfeld als ehemaliger Wohnort des gelehrten Bauern Christoph Arnold, welcher hier am 17. Dezember 1650 geboren wurde und am 15. April starb. Er war Anfangs (gleich dem noch bekannteren Pahlitzsch in Prohlis-Dresden) nur Autodidakt, bildete sich aber nachmals besonders durch den häufigen Umgang mit Leipziger Gelehrten und betrieb mehrere Naturwissenschaften, besonders aber mit großem Eifer die Witterungskunde und Astronomie. Er baute sich auch eine kleine Sternwarte auf sein Haus, welche erst 1794 wegen Baufälligkeit abgetragen worden ist und beobachtete hier unter anderem fast zuerst die Kometen von 1683, 1686 und 1690, wodurch sein Name durch halb Europa berühmt ward. Der Leipziger Stadtrat verlieh ihm Freiheit von allen Abgaben und ein Ehrengeschenk, bewahrt auch im Bibliothekssaal sein Porträt; seine Handschriften kamen nach seinem Tode an die Universitätsbibliothek.
Das Pfarrhaus zu Sommerfeld (1928)
In einer Freiberger Urkunde kommt ein Johann von Sommervelt als Protonotar (geheimer Sekretär) des Markgrafen Balthasar im Jahre 1372 vor. Der Leipziger Stadtrat kaufte Sommerfeld als ein gewesenes Paulinerklosterdorf 1543 vom Kurfürsten Moritz mit beiderlei Gerichtsbarkeit.“
1500 – Werner Emmerich, stud. hist. (i.J.1925)
Wir alle haben es miterlebt, wie fieberhaft vor und besonders während des furchtbaren Weltkrieges gerüstet wurde, wie Tag und Nacht alle Kräfte eingesetzt wurden, um Kriegsmaterial in genügender Menge bereithalten zu können. Ein solcher Kampf unter äußerster Ausnützung aller technischen Hilfsmittel ist ja noch nie geliefert worden, und es ist nicht uninteressant zu erfahren, wie frühere Jahrhunderte Krieg vorbereiteten und erlebten.
Das abzuhandeln, würde Bände bedürfen, aber einen kleinen Ausschnitt können wir im Folgenden schon geben, vor allem, weil wir von unserem Kreis reden wollen.
Für das 15. und 16. Jahrhundert kommen uns die äußerst gewissenhaften Aufzeichnungen des Thomasklosters in Leipzig zu Hilfe, die in einer behäbigen Breite, die dem späten Mittelalter so eigentümlich ist, die Verhältnisse bis ins einzelne schildern.
Es wurde damals jeder, der über einem oder mehreren Gemeinwesen stand, vom Landesherrn (oder von der Stadt) zur Aufstellung des Heeres herangezogen, in unserem Falle das Kloster für seine Dorfschaften um Leipzig. Diese mussten nun ihrer Bevölkerungszahl entsprechend eine bestimmte Anzahl wehrhafter Männer in voller Ausrüstung (= geharnischt) zur Verfügung stellen und zur „Heerschau“, die wohl jedes Jahr einmal stattfand, nach Leipzig aufs Schloss, in die Pleißenburg, entsenden.
Das „Register.....des closters fancti thome zcu leyptzck“ (K.-Archiv Lpzg. 1; 86-88) berichtet uns darüber aus dem Jahre 1515, daß Daniel Stauffmel auf dem Schlosse Heerschau gehalten habe, zu der das Thomaskloster für seine Dörfer 12 Geharnischte hätte stellen müssen. „Erstlich haben sy must alle 12 gecleidt seyn in schwartze reck und hosen eyne farbe schwartz.“ Dazu mußte jeder haben ein „forder- und hynterteyl“ (= Brust- und Rückenpanzer), eine Armschiene, eine Pickelhaube (An derer Stelle spricht man von „Eisenhut“, was die Sache wohl besser trifft. Denn wir dürfen nicht an die Helmform denken, die wir unter Pickelhaube verstehen, sondern einen topfähnlichen eisernen Hut, den wohl jeder schon im Geschichtsmuseum gesehen hat.), einen Panzerkoller, ein Messer (= kurzes Schwert) und eine Hellebarde. „Dy von Sumerfeldt haben must rüsten zweene man, dy von balßdorf zweene man, dy von melcke eynen man.“
An dieser Stelle sei angefügt, dass um 1400 – 1500 alle Bauern Waffen trugen, auch die Unfreien und sogar bei der Feldarbeit. Stets trug man an der Seite ein „Kurzgewehr“ oder großes Messer, und es war natürlich, dass zufälliger Zwist auf der Straße oder beim Trinkkruge häufig mit „eym großen Messerstechen“ endete. Die Folge war das Verbot dieses Privilegs, und sogar der verfällt einer hohen Strafe, der in „geschliffener Wehre“ das Grundstück eines Nachbars betritt.
Neben den „Trabanten“, die also zum Kriegsdienst zu Fuß verpflichtet waren (Zur sogen. „Heerfahrt“, daraus der Familienname Herfurth!), hatten die Dorfschaften auch die vierspännigen Bagagewagen, die „Heerfahrtswagen“, zu stellen. So musste Mölkau um 1500 das vordere Handpferd mit seinem Geschirr halten. Später, 1545, hatte Mölkau diese Verpflichtung nicht mehr allein, sondern mit Cleuden zusammen. Dazu mussten „Melcka, Balsdorf und Sommerfeld schicken ein Futtersack, Sicheln und Riementeile“.
100 Jahre später! Mord, Raub und Brand .... Ein schrecklicher Krieg schreitet über Europa: der dreißigjährige Krieg. Und wie unsere Heimat damals zu leiden hatte, besonders 1640 – 44, ist ja bekannt. Wir denken nur an die „Wurzner Marterwoche“. Die dürftigen, aber inhaltsschweren Bemerkungen in damaligen Aufzeichnungen (siehe Vogels „Anales“) ergänzen das traurige Bild von der Not der schutzlos den Räuberbanden preisgegebenen Landbevölkerung. Fast nichts mehr war ihr zueigen. Demnach verlangte der schwedische Kommandant von der Stadt, die diese Lasten wieder auf ihre Dörfer verteilte, 10 Fuder Stroh und täglich 1 Fuder Holz. Mölkau sollte dazu beitragen mit 1 Klaster Holz und 12 Schütten Stroh. Aber damit nicht genug, verlangten die Schweden außerdem bares Geld! 200 Taler – welch ungeheure Summe zu jener Zeit, wo fast kein Geldstück mehr unter den Leuten war. Alles geraubt oder – vergraben und vergessen. ...
Wie groß die Not und der Schrecken gerade auch bei uns waren, das sagen folgende nüchternen Worte: „Gemeinen beschweren sich wegen futeragi zu geben, so ihnen unmöglich. Die Melkei (= Mölkauer) sagen, das sie abgebrandt. Kein grummet gewachßen wegen der Dörrungk“. Und ein Mölkauer Nachbar sagt in seinem damaligen Testament von seiner Frau, sie habe ihn „fleißig gewartet, auch in diesem schlechten Kriegswesen neben ihm viel ausgestanden, ja leib unde leben mit ihm aufgesetzet“.
Man weiß, wie unendlich lange es gedauert hat, bis Land und Leute sich von der Trübsal dieser Ereignisse wieder erholten, und wir müssen eines weiteren Krieges gedenken, der (wiederum ein Säkulum später) ähnliche Folgen für die wirtschaftliche Lage des ländlichen Bevölkerungsteiles in Sachsen und besonders auch um Leipzig hatte. Den wenigsten ist seine traurige Bedeutung für unsere Heimat bekannt. Das ist der siebenjährige preußisch-österreichische Krieg 1756 – 63.
Darum ging es in dem Krieg, indem Sachsen von den Preußen überrollt wurde und die bis zum heutigen Tage erhaltene Intimfeindschaft entstand:
Durch die Bemühungen des österreichischen Staatskanzlers Graf Kaunitz kam es zur Aussöhnung zwischen Österreich und Frankreich und damit zum Ende einer Jahrhunderte alten bourbonischhabsburgischen Feindschaft. Beide Mächte bildeten ein Bündnisgegen Preußen, dessen Machtzuwachs durch den Österreichischen Erbfolgekrieg auf dem ganzen Kontinent skeptisch betrachtet wurde. Friedrich II. war damit isoliert und suchte die Annäherung an Großbritannien. Im Januar 1756 schlossen Preußen und Briten die Konvention von Westminster, ein Defensivvertrag zum Schutz von Hannover. Der Umsturz aller Bündnisse, auch renversement des alliances genannt, war vollzogen. Dem französisch-österreichischen Bündnis traten im Mai 1756 Russland, Sachsen, Schweden und das Reich im Vertrag von Versailles bei. Sie planten für 1757 ein gemeinsames Vorgehen gegen Preußen.
Friedrich II. hatte von den Plänen der Alliierten erfahren und ergriff die Initiative. 70.000 preußische Soldaten marschierten am 29.8.1756 in Sachsen ein und besetzten am 10.9. Dresden. Ein österreichisches Heer, das zum Schutz Sachsens anrückte, wurde bei Lobositz von den Preußen geschlagen. Die sächsische Armee kapitulierte und wurde in die preußische integriert.)
Preußische Einquartierung, Stellung von Rekruten, Lieferung von Lebensmitteln und Pferden bedrückten das Landvolk hart, und wie schlimm seine Lage war, geht aus folgenden Sätzen, die der Friedensverkündigung entnommen sind, hervor:
„Die Preußischen Truppen werden des ehesten den hiesigen Kreyß evacuiren. Somit wäre denn nun der Friede geschlossen und den armen Untertanen wieder Zeit gegeben, sich zu erholen, wenn es noch möglich sein wird (!). Viele Familien werden von den geschlagenen Wunden noch zu Grunde gehen (!)“
Kaum zwei Menschenalter waren darüber hingegangen in friedlicher Arbeit, als wieder fremde Bedrücker des Landes erschienen: die Franzosen. Der Winter 1806/07 brachte sie nach ihren Siegen bei Jena und Auerstädt immer weiter ins Land herein zum Schrecken der Bevölkerung. Diese Jahre der Drangsal waren vielleicht noch schlimmer als das blutige Jahr 1813, in dessen Oktobertagen viel Blut der verschiedensten Völker unseren heutigen Heimatboden tränkte, manches traute Vaterhaus zu Asche wurde und sehnlichster Friedenswunsch in aller Herzen lebte. Wir brauchen auf die Ereignisse jener Tage nicht weiter einzugehen; sie brachten die Freiheit. Aber der qualvollen Monate des Unterjochtseins wollen wir uns an einem kleinen, aber eindringlichen Beispiel erinnern: an der Verordnung der französischen Militärbehörde über die Beköstigung der Truppen, von der an dieser Stelle schon früher gesprochen wurde.
Die garnisonierenden und durchmarschierenden Soldaten sollten erhalten: „Des Morgens: Suppe oder Käse und Brot, nebst einem Glas Brandtewein. Mittags: Suppe, ¾ Pfund Fleisch mit Gemüse nebst einer Kanne Bier. Abends: Gemüse, nebst einer Kanne Bier.“
Damit wollen wir unseren Streifzug durch die Kriegsnöte der Jahrhunderte beenden und nur hoffen, dass die Geschichte zu ihnen nicht neue gesellen möge, sondern der Heimat den Frieden erhalte...
Auf verschiedene Kriege und Schlachten, die hier bereits angerissen wurden, werden wir später detailliert eingehen.
1547
Eine wichtige Position hatten seinerzeit die Ortsrichter in Engelsdorf. Dass Herr Mühlberg 1929 von eben diesem Amte zurück trat, hat für uns in so weit große Bedeutung, als dass dadurch im Engelsdorfer Heimatboten ein historischer Rückblick auf die Engelsdorfer Ortsrichter unternommen wurde, bei dem wir uns nunmehr bedienen können. Autor seinerzeit war der Pfarrer Hager.
Mit Schreiben vom 27. November 1929 ist vom Amtsgerichtspräsident zu Leipzig der Rücktritt des Herrn Friedrich Reinhold Mühlberg von dem Posten eines Ortsrichters genehmigt worden. Es wurde Herrn Mühlberg für seine Tätigkeit zugleich Anerkennung und Dank ausgesprochen. Herr Mühlberg übernahm das Amt eines Ortsrichters im Juli 1904; hat es also 25 Jahre treu und gewissenhaft und selbstlos verwaltet.
Dem Ortsrichter liegt es ob, Orteinwohner vor den staatlichen Behörden, besonders vor dem Amtsgericht, zu legitimieren. Er ist also gewöhnlich bei Erbregelungen, bei Grundstückskäufen, Grundbuchseintragungen mit zugegen. Bei Todesfällen und Erbschaftsregelungen hat er den Nachlass aufzustellen und einzuschätzen.
Früher hatte freilich das Amt eines Ortsrichters noch größere Bedeutung. Er wurde bei allen privaten Angelegenheiten und Rechtsauskünften zu Rate gezogen; er musste sich verstehen auf Abfassung von Testamenten, von Kaufverträgen und dergleichen, er galt als Ortadvokat. Bei Einträgen in früheren Wohnbüchern ist auch stets die Bezeichnung „Richter“ mit beigefügt. – Sie waren gewissermaßen das Dorfoberhaupt.
Im Amtserbbuch von 1547 wird als Richter Hans Lang und nach ihm Hans Zenker genannt. Nach den Kirchenbüchern wird 1633 Hans Schroter als Richter aufgeführt. 1638 Andreas Huhn. 1667 Paul Huhn. 1688 starb als Richter Peter Tammenhayn; 1735 starb Michael Seydenzopff; 1763 starb Peter Böttiger; 1790 starb Johann Gottfried Boettger; 1813 starb Johann Christian Graul; von 18131857 Johann Friedrich Taugott Hößler; von 1857-1904 Friedrich Wilhelm Häßler.
1547
Der Begriff „Hufe“ stammt bereits aus dem Mittelalter und beinhaltete die bäuerliche Hofstätte, die einer Familie zum Leben reichen sollte. Bekam eine Familie vom Grundherren Land, welches zu beackern war, hieß dies im allgemeinen Zins- oder Diensthufe. Die öffentlich „Angestellten“ erhielten so genannte Steuerhufe. Wer eine Hufe besaß, durfte sich Vollbauer nennen, mitunter entstanden durch die Teilung solcher Länderein auch Halbbauern, Halbspänner oder Halbhufner. Dies soll der Erläuterung dienen, da wir in den nächsten Zeilen viel altdeutsches Wortgut erklingen lassen.
Bei einer Betrachtung des Erbbuches vom Jahre 1547 stellen wir fest, dass Engelsdorf 27 Hufe vernünftiges Ackerland besaß. Zum Dorf gehörten außerdem 54 Hufe Urland, dass wild bewachsen und nicht beackert war. Die Felder, wie wir sie in der Neuzeit kennen, sahen damals doch ein wenig ungejäteter aus, es gab mehr Wälder und weniger Straßen und Wege.
Der Richter des Ortes hatte eine Hufe Land, mit der er wer weiß was anstellte, es manchmal auch bewirtschaften ließ. Für diese Hufe Land brauchte er keinen Steuerzins zu zahlen, war also steuerbefreit. Seine Hufe wurde als Richterfeld bezeichnet. Auch die Kirche hatte eine Hufe Land, musste dafür jedoch, wie alle anderen auch, 20 Groschen Zinsen im Jahr berappen und an das zuständige Amt abführen. Frei übersetzt besagt dies, dass der Engelsdorfer Kirche das ihr zustehende zinsfreie Land entzogen und dem Erbrichter zugeschoben wurde.
Urkunden hierüber gibt es einige. So schreibt das Leipziger Amts-Erbbuch vom Jahre 1547 unter fol. 6. Ober und Erbgerichte zu Engelsdorf:
In diesem Orte stehen dem ampt die gerichte oberst und niederst zu mit aller bothmeßigkeytt.
G e r i c h t s s t u h l.
Das ampt mag darinnen wann es die Nottorst erfordert, dingen und gericht halten.
R i c h t e r a m t.
Hat darinnen ein walzende (d.h. abwechselnde) gerichte, welcher unter denn einwohnern zum ampt dienstlich, wirtt darzu geordnet und stehet dem ampt willkürlich in zu behaltenn, aber zu entsetzen. Kegen seinen ampt (für seine Arbeit) hat der Richter eine freye Lehenhufe, Jerlichen seines Gefallens zu gebrauchen welche sonst XXX (30) gr. erbzins wie andern tragen möchte, und darf der Richter hiervon kein Zins noch lehenwar nicht vorrichten. (Anm.: Eine Hufe war gewöhnlich 24. Acker bzw. 7-10 Hektar.) fol.7. In diesem Dorffe seint XXVIII (28) belassene wirthe haben auch alle zu ihren Güttern, wie hernach bey den Erbzinsen folget, wohin auch ein ider lehent liegende Gründe an Aeckern und Wiesenn. Und dorffen von ihren guttern allen, keine lehenwar nicht verrichten. Dann wann einer umb lehen bittet dem amptschöffer 1 gr. desgleichen dem Richter auch ein gr. verrichtenn. fol. 8. In diesem Dorffe seint XXVII (27) Hufen Landes und 54 wüste Acker so dem ampt auch lohnen und zinßbar seint, darein sie auch stewren, darunter 1 Hufe Landes so der Richter gebraucht, zinset nichts, auch 1 Hufe, die der Kirchen jährlich 20 gr. zinset, gehet von ampt zu lehen. fol. 139. und nachdem in diesem Dorffe 27 Hufen Landes seint, die Richterhuf aber frey, so werden also solcher universität jehrlichen 26 Hufen verzinset.
Selbstverständlich beharrte die Kirche auf ihrem Eigentum und meldete ihren Anspruch auf das Richterfeld an.
Schon Pfarrer Uticke erhob im Jahre 1768 bei der Kircheninspektion Einspruch gegen die Entziehung. Die Angelegenheit verlief damals im Sand. Von neuem wurde die Angelegenheit durch Pfarrer Wagenknecht und besonders durch den damaligen Gemeindevorstand Johann David Wiegner im Jahre 1841 aufgerollt. Bei diesen Ansprüchen seitens der Kirche stützte man sich auf die alten Visitationsakten und Pfarrmatrikeln.
In der Visitation des Jahres 1539 werden als zur Haushaltung der Pfarrer zu Engelsdorf 6 Hufen Landes gehörig bezeichnet.
Nach Ansicht der damaligen Eingabe ist das Richterfeld ursprünglich Kirchenhufe; die Kirche, d.h. das Kirchlehn hatte 1 Hufe Landes, d.h. 24 Acker. – Ironisch sagt die Eingabe: Ein Erdbeben kann auch nicht stattgefunden haben, so dass dabei 18 Acker Kirchenfeld verschwunden und 18 Acker Richterfeld neben dem der Küsterei zugeschlagenen Felde entstanden seien.
Das Kreisamt Leipzig, das die Streitfrage untersuchen ließ, empfahl der Kirchenbehörde, vom Prozess abzuraten. Die Angelegenheit wurde immer wieder angeschnitten. In einer Abhandlung über das Richterfeld kam Dr. Krebs aus Leipzig im Jahre 1927 zu dem Ergebnis, dass die Ansprüche der Kirche unbegründet wären; er nennt die Ansprüche des Pfarrlehns auf die Richterhufe geradezu lächerlich. Gründe: 1. Pfarrlehn und Richterhufe zu Engelsdorf sind ganz verschiedene Grundstücke. 2. Das später der Kirche überwiesene und dem Pfarrer 1574 zum Gebrauch überlassene Feld mit dem Namen Kirchenhufe ist ursprüngliches Gemeindeland, ja ganz wahrscheinlich die andere der üblich gewesenen 2 Richterhufen. – Zu diesem Ergebnis kann Dr. Krebs kommen, weil er zwischen Land und Lehen, das der Kirche und das der Pfarre gehört, keinen Unterschied macht, und weil er in die Angaben der Matrikel von 1574 ohne Grund Zweifel setzt.
Die Sachlage ist vielmehr eine andere, wenn man die Urkunden sprechen lässt:
Im Amtserbbuch vom Jahre 1547, Seite 8, wird bezeugt, dass damals 1 Lehns freie Richterhufe und eine Lehenshufe der Kirche zinsbar vorhanden war; von dieser Kirchenhufe wird in der Matrikel von 1574 gesagt: „Der Kirchenn daselbst gehörigk“. Anm.: Der Ertrag gehörte dem Unterhalt der Kirche, nicht dem Pfarrer.
In demselben Erbbuch fol. 137 heißt es: Pfarrlehn hatt in disen Dorfe ein Pfarkirche und Pfarhaus: dazu geheren 2 Hufen Landes und 1 Garthen zu seinen besten zu gebrauchen.
Es existierte also eine Richterhufe, eine Kirchenhufe, 2 Pfarrlehnshufen. Die Pfarrhufe wurde genützt von dem Dorfrichter; die Kirchenhufe war an Ortseinwohner gegen 20 Gr. Zins verpachtet, die der Kirche und später dem Einkommen des Pfarrers dienten. Davon berichtet die Matrikel 1574 fol. 9 des Kirchen- und Pfarrmatrikel vom Jahre 1574: Die Kirche hat 3 Hufen Landes, hallten die zusammen 24 Acker und 1 Viertel eines Ackers und sind die in 3 Felt geteilet, als ein Kirchfelt 8 ½ Acker und ein Viertel Acker, in Paunsdorfer Mark 7 ½ Acker, in Leipschen Felt 8 Acker. Sind ausgethan: erstlich Severo Schrotter ½ Hufe. Diese hat 3 ½ Acker und ¼ , zinset davon jerlichen Michaelis 5 Gr. Dann Lorenz Sperling und Heßler diesen beiden zusammen gewesen, auch ½ Hufen, die halt 5 Acker, geben beide zusammen 5 Gr. Zins. Desgleichen der Schenk hat wieder im Leipscher Felt 4 Acker, davon zinst er 5 Gr. und Martin Heßler und Lorenz Sperling auch 4, geben davon Zinsen 5 Groschen. Die Summe dieser Zinsen ist 20 Groschen.
fol. 22. Weil auch bißher die Leute zu Engelsdorf eine Hufen der Kirche daelbst gehörig, so inn drey Feldt getheilet, und in jeder Feldt 8 Acker hat, gebrauchet, und davon dem Gottes Haus jerrlich 20 Gr. gezinset, ist vorgutt angesehen wordenn, das solche Hufe forthin dem Pfarrherr des Ortes als der sunsten gering Einkommen hatte, umb solchen Zins gelassen, dieselbige seiner Gelegenheit und besten nach zu gebrauchen.
Die Frage, ob das Richterfeld dasselbe ist wie die Kirchhufe, ist somit zu verneinen. Es bliebe überhaupt, um die Sachlage zu klären, nur die Frage übrig, was mit der Kirchenhufe, mit diesen 18 Ackern Feld geschehen ist, denn die Kirche besitzt diese Acker nicht mehr. Das Pfarrlehn mit seinen 2 Hufen 48 Ackern ist noch vorhanden.
Nun wollen wir natürlich nicht den bereits angesprochenen Bericht des Herrn Dr. phil. Kurt Krebs aus dem Jahre 1908 fehlen lassen, der die gegenteilige Behauptung vertritt. Zudem verweist der Bericht des Zeitforschers auf recht bemerkenswerte Eckpunkte in der Geschichte unserer Ortschaften. Er zeigt außerdem die zwielichtige Rolle der Stadt Leipzig in der Gesamtentwicklung unseres Ortes auf.
Durch das königlich sächsische Landeskonsistorium ist bekanntlich angeordnet worden, die Kirchengeschichte jeder sächsischen Parchienei abzufassen, also auch die von Engelsdorf. Die hierzu nötigen umfänglichen Studien ließen die Hoffnung erwachen, dass auch Licht über das sogenannte Richterfeld daselbst bringen könnten, über eine Angelegenheit, die seit Jahrhunderten in der Gemeinde Gegensätze erzeugt, die Einwohnerschaft und das Pfarrlehn verfeindet, den Gemeindevorstand und den Ortsrichter zu Gegner gemacht, die Leipziger Rechtsanwälte Köchly und Schaffrath beschäftigte – ja sogar einen Bewohner des Ortes namens Graul eine mehrmonatige Gefängnishaft auferlegt. So bedauerliche Zustände einerseits der Gegensatz über das Richterfeld zu Engelsdorf geschaffen, so hängt andererseits mit ihr das hiesige Volkswort zusammen: „Wüsste Engelsdorf seine Rechte, jeder Bauer könnte seine Pferde mit goldenen Hofeisen beschlagen!“, ein Wort, das Licht über die Richterfeldangelegenheit als größten Segen erscheinen lässt.
Wäre zu dem von Otto dem Reichen (1156 – 1190) der Stadt Leipzig gegebenen Leipziger Stadtbriefe ein Seitenstück für Engelsdorf bekannt und daraus ersichtlich, wer was und wie einst verteilt wurde, so könnte es hier gar keine Meinungsverschiedenheit über den Besitzer und die Größe des Richterfeldes geben, es wäre bei Zwistigkeiten nur immer auf diesen Verteilungsbrief zurückzukommen und baldigst Klarheit geschaffen.
Da also altes Urkundenmaterial über Engelsdorf bis jetzt unbekannt und wohl überhaupt nicht existiert, so wird man für diesen Ort daran festhalten dürfen, was Eduard Otto Schulze in seiner von der fürstlich Jablonowskyschen Gesellschaft zu Leipzig preisgekrönten Schrift über die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen Saale und Elbe, über die Verteilung der Gemarkungen um Leipzig feststellt. Nach Schulze wurden 2 Hufen Landes für kirchliche und 2 für Gemeindezwecke vorbehalten, das übrige Gefild aber dem Privatbesitz zugesprochen, insgesamt zählte eine Dorfflur gewöhnlich 30 Hufen á 24 Acker.
Während das Pfarrlehn bis heute (1908) auf dem Lande erhalten worden und nur in den Großstädten aufgehört hat zu existieren, sind die Richterlehn meistenteils in den Privatbesitz aufgegangen, so dass das Richterfeld zu Engelsdorf mit wenigen anderen in Sachsen zu den einzigen gehört, die aus grauer Vorzeit auf uns gekommen sind.