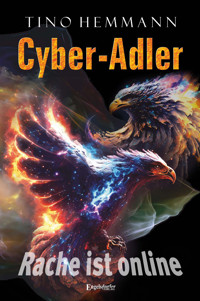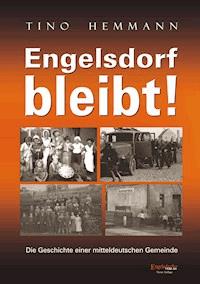Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kein Mensch dieser Spezies ist unfehlbar. Doch gibt es reichlich unter ihnen, die anderer Meinung sind, und damit ihre Fehlbarkeit mehr als nur verdeutlichen. – Vier Herren der feinen Gesellschaft werden von einem Irren gejagt, der sich für den Grafen von Monte Christo hält und sich in der geschlossenen Anstalt Rösen aufhält. Gab es überhaupt eine Intrige? Kriminaloberkommissar Holger Hinrich und die Kollegen der K1 sind auf der Suche nach der Wahrheit. Doch die versteckt sich im Leipziger Sumpf. Als ein Anschlag auf des Kriminalassistenten Englers Sohn verübt wird, ahnen die Kollegen, dass der Feind auch in den eigenen Reihen steht. Wahrheit und Lüge vermischen sich. Unbeweisbares zu beweisen erfordert besondere Maßnahmen. Spannung ist garantiert. – Hemmanns vierte Episode über die Kollegen der K 1 der Leipziger Kripo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Bibliografie Tino Hemmann
Tino Hemmann
QUOD ERAT DEMONSTRANDUM
Krimi
Diese Geschichte ist frei erfunden.
Eine Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder mit solchen, die einst lebten, wäre rein zufällig und unbeabsichtigt.
Bibliografische Information durch
die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eISBN: 978-3-86703-967-3
Copyright (2008) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor.
Kein Mensch dieser Spezies ist unfehlbar. Doch gibt es reichlich unter ihnen, die anderer Meinung sind, und ihre Fehlbarkeit damit mehr als nur verdeutlichen.
Leipzig. Vor einigen Jahren. Die Stadt der Freiheit ist im Umbruch. Marktwirtschaft zieht ein. Das Wetter hält sich tapfer, doch es ist kalt.
Auf dem Bürgersteig lief eine junge Familie. Gerade besuchte sie ein Leipziger Stadtteilfest.
Die Geschwindigkeit der Familie richtete sich nach dem kleinen Mädchen, das häufig stehen blieb oder lachend hinauf zu ihrem Luftballon sah, der an einem Zwirn befestigt lustig in der Luft tanzte. Unter der Mütze des Mädchens schauten freche Zöpfe hervor, ihre Nase war rot und an den Lippen klebte noch Zucker, der von der Zuckerwatte stammte, die es kurze Zeit vorher genüsslich aufgegessen hatte. Ihre Füße steckten in kleinen Lackschuhen, die mitunter auf dem Granit des Bürgersteiges klapperten. Die Knie der weißen Strumpfhose des Mädchens waren schwarz, unter der Jacke schaute ein rotes Kleid hervor.
Der Vater schob den Buggy, in dem ein etwa einjähriger Junge sitzend schlief. Stolz lief er, immer wieder kontrollierend, dass sein Kind gut eingepackt war. Von dem Jungen sah man nur das kleine Gesichtchen und die langen dunklen Wimpern über den geschlossenen Augen. Um den Mund des Sohnes zeigte sich mitunter ein kleines Lächeln, als erlebte er im Traum den Tag noch einmal. Einen dunklen Anzug hatte der Vater an, darunter ein helles Hemd. Seine Blase drückte, obwohl er es sich nicht anmerken ließ, denn auf dem Festplatz hatte er zwei halbe Liter Bier getrunken.
Die fünfundzwanzigjährige Mutter hielt die rechte Hand ihrer vierjährigen Tochter. Die linke Hand des kleinen Mädchens zog an dem herzförmigen Luftballon, als Aufdruck eine Mickymaus. Die Mutter wirkte sehr jung, war schlank, trug jedoch keinesfalls feierliche Kleidung, sondern bequeme Turnschuhe, eine Thermohose und einen dunklen Pullover unter der Jacke. Ein wenig zog sie das Mädchen mit sich, denn sie wollte nach Hause, auch wenn ihr der Familientag gefiel. Job und Pflichten überwogen, für die Familie selbst war wenig Zeit.
Der Vater sagte, dass er zu Hause den Sohn ins Bett bringen würde, die Mutter könnte sich dann um das Abendessen kümmern. Es war ein Samstag, die Luft unangenehm kühl, es begann bereits zu dunkeln. Die Kinder schienen glücklich, die Eltern um einiges Geld erleichtert, denn die Preise auf dem kleinen Festplatz erwiesen sich als unglaublich hoch, die Haushaltskasse erwies sich dagegen als klamm.
Ein älterer Herr trat auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus einem Haus. Er trug einen altmodischen Hut und einen langen Mantel. Er sah sich kurz um und lief anschließend gemächlichen Schrittes in Richtung Innenstadt.
Einen Moment war die vierjährige Tochter abgelenkt. Es galt, einem Hundehaufen auszuweichen. Kurz vor der Kreuzung, in der die Straße des Mietshauses der jungen Familie mündete, im Westen der Stadt Leipzig gelegen, entwich der Luftballon der Hand des kleinen Mädchens. Es riss sich augenblicklich von der Mutter los und rief: „Mein Luftballon!“
Wind und Thermik sorgten dafür, dass der Ballon in Richtung Fahrbahn der Hauptstraße flog. Das Mädchen rannte schreiend zur Straße, die Mutter folgte ihm, griff – bereits auf der Fahrbahn stehend – nach der Hand des Mädchens und zog es zurück auf den Gehweg. Schon traten Tränen in die Augen des Kindes, fast verzweifelt streckte es die Ärmchen nach dem verloren gegangenen Schatz aus. Doch die Mutter hielt es fest, beide standen auf dem Bordstein, direkt an der Straße.
In diesem Moment näherte sich ein silberfarbener Mercedes der gehobenen Klasse. Die beiden vorderen Plätze waren von zwei Herren besetzt. Das Fahrzeug verließ für einen Moment seine Spur in Richtung Gehweg, lenkte erst nach links, dann nach rechts, kam etwas ins Schleudern, geriet mit den rechten Rädern auf die Bordsteinkante, ohne dabei zu bremsen.
Das Mädchen wurde frontal erfasst, der kleine Körper schleuderte – begleitet vom kurzen Aufschrei des Kindes – einige Meter über die Straße und blieb dann leblos liegen. Auch die Mutter wurde von dem silberfarbenen Mercedes getroffen, eine Lampe zersplitterte, die Frau fiel hin, schlug mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante, ihr rechter Arm wurde von dem Fahrzeug überrollt. Der Mercedes kam erst zweiundsiebzig Meter hinter der Unfallstelle zum Stehen. Einzig und allein der ältere Herr, von der gegenüberliegenden Straßenseite, konnte den Unfallhergang beobachten und blieb wie angewurzelt und regungslos stehen. Schlagartig kehrte Stille ein. Es roch nach verbranntem Reifen.
Die Hände des Vaters hielten verkrampft den Kinderwagen. Er begann zu schreien wie in Trance. Der kleine Junge im Buggy erwachte und weinte ebenfalls.
*
Kontrollrundgang. Vor Dienstschluss besucht ein siebzehnjähriger Pfleger die Zimmer seiner Patienten in der Anstalt Rösen am Rande der Stadt Leipzig. Zwei der Patienten liegen ruhig gestellt auf ihren Betten. Eine Frau sitzt neben ihrem Bett und erzählt sich eine Geschichte. Ein Mann vollführt vor dem Pfleger ein wahres Theaterstück. Im Zimmer dieses Mannes verweilt der junge Pfleger, hört den Worten verwundert zu. Der Schauspieler vor ihm spricht klar und deutlich, als drehe man einen Film. Allerdings nähert er sich bedrohlich dem Pfleger.
Der Patient griff mit beiden Händen in den Stoff des weißen Anstaltskittels und riss den Pfleger fast um. „Es wird geschehen!“, schrie er wie wahnsinnig. „Heute wird es beginnen!“ Seine Augen rollten im Takt der Worte.
Neurot, der erst vor wenigen Tagen die Betreuung einiger Patienten der Pflegeanstalt Rösen übernahm, konnte sich gerade noch auf den Beinen halten. Selbst der Name dieses schizophrenen Patienten war ihm unbekannt. „Lass mich los, ganz ruhig, Mann!“ Der Pfleger versuchte den kräftigen Herrn abzuschütteln, der zweifellos nicht über vierzig war.
Tom Neurot war noch nicht einmal achtzehn Jahre alt. Er hatte rötliches Haar, war sehr schlank und wirkte eher jünger, fast noch etwas kindlich und unsicher.
„Er wird ihn nicht töten!“, schrie der Patient, der schon ewig in der geschlossenen Anstalt zu leben schien. Plötzlich lachte er laut auf, drückte die Wangen seines Pflegers mit einer Hand zusammen, näherte sich dem Gesicht des jungen Mannes und flüsterte: „Sie hätten es verdient. Sie hätten es wahrhaftig verdient.“ Dann ließ er Neurot los, setzte sich auf einen Stuhl und begann gleichmäßig mit dem Oberkörper zu schwingen.
Der junge Pfleger massierte sein Kinn. Einen Moment lang hatte er überlegt, die Klingel zu betätigen. Er bereute es nicht, dies unterlassen zu haben. Zum Gespött der Schwestern wäre er geworden!
Sein Blick traf den schizophrenen Mann. Armer Kerl. Was war nur mit diesem Menschen geschehen? Warum verhielt er sich so merkwürdig?
Der Patient hielt mit dem Schaukeln inne, erhob sich ruckartig und lief zum vergitterten Fenster, stand vor der weiß lackierten Scheibe und drehte sich um. Er hatte blaue Augen.
„Nun, wollen wir sagen, es handelt sich nicht um einen Verrückten. – Den Ersten hat er gefangen. Mit Säbeln und mit Zangen … Erbarmungslos ist es, will sagen, das Gesetz. Erbarmungslos. Kinderschänder, verruchter!“ Er kicherte vor sich hin. „Nun darf ER es erleben. Nun darf er ES erleben!“ Er hob seinen Zeigefinger, suggerierte einen Vortrag vor vielen Anwesenden. Neurot musste als Publikum herhalten. Ob er wollte oder nicht. „Wollen eher behaupten, dass es sich um eine Notwehr des Gewissens handelt. – Wie? Was? – Stehen Sie auf, wenn Sie eine Frage haben! – Notwehr des Gewissens … Man nennt es auch Rache. Rechtlich gesehen gibt es keine Rache. Rache ist verboten. Wir leben in einem demokratischen Land, niemand – wirklich niemand! – darf die Demokratie zerstören. Rache gibt es nicht, keine demokratische Rache. Demokratische Rache ist Selbstjustiz, demokratische Rache ist Terrorismus. – Nein, nein, er pfeift auf die Justiz! Macht, was sie will, verruchte demokratisch terroristische Justiz!“ Wieder folgte ein fast weinerlich anmutendes Lachen. Der Patient schritt den Raum ab. Einmal, zweimal. Neurot schaute ihm hinterher, wirkte etwas ängstlich. „Es gibt nur zwei Gelüste, die den Homo sapiens dazu bringen, dass er sich über gewisse Bereiche seines Gehirns hinwegsetzt.“ Der Mann hob einen Finger, schaute den Pfleger mit gläsernen Augen an. „Jene Bereiche, in denen die Normen gespeichert sind. Normen, die der Erziehung entstammen, Normen, die unsere demokratische Gesellschaft vorschreibt.“ Er betonte das Wort Normen und rollte das „R“, während er erneut mit übertrieben großen Schritten das Zimmer durchquerte. „Normen! – Zwei Gelüste. Wollen sagen, es ist einmal die triebgesteuerte Sexuallust. – Aha, aha … Erinnerten sich Täter nicht mehr der Handlung, als sie ein Kind vergewaltigten und töteten. – Abgeschaltet.“ Er lief zum Lichtschalter, knipste das Licht an und aus, an und aus. „Das Gehirn. Eine Lampe. An. – Aus.“ Neurot öffnete den Mund, um etwas zu sagen, wurde jedoch sogleich abgewürgt. „Unterbrechen Sie mich nicht, Sie Unterbrecher! – Natürlich. Die zweite Lust heißt Rache. Ein Trieb, der zu Tötungen führt. Im Einzelnen und in der Masse. Ob es die Demokratie nun wollte oder nicht …“ Plötzlich näherte sich der Mann mit zwei großen Schritten Neurot, der irritiert dreinschaute. „Die Demokratie konnte es nicht verhindern! Nicht verhindern … Manche schalten ihr Gehirn aus, so sie dem Rachetrieb folgen. – Strafbar, sehr, sehr, sehr strafbar! Das Gesetz kennt nämlich keine Rache. Rache ist nicht demokratisch. – Klick! – Aber ER? – Nein, nein! – ER nicht. Er macht das Gesetz zur Rache, fein unterroristisch demokratisch. – Die Lücken sind zweifelhaft sehr riesig. Will tun, will tun … Zu viel Zeit ist vergangen.“ Wieder lachte der Patient laut und übertrieben. „Egon Olsen? Schlappschwänze! Idioten! Sagt der immer. – Hatte viel Zeit, viel Zeit. Wollen sagen, Zeit für seine Pläne. Lausige Amateure! – Verlasse mich nicht auf jene. Viel Zeit. Und nun? – Es ist so weit. Er wird nicht Klick machen mit seinem Gehirn. Nein, das wird er nicht tun! Arbeitet damit, hält sich strikt an die demokratischen Normen. Dreht die Zeit zurück? – Ja, ja! – Das ist gut. – Dreht die Zeit zurück. – Und da hocken die Alten, zittern flehend um ihr niederträchtiges Leben. – Leben! Ist es Leben, was sie tun? Dachten, die demokratische Korruption macht sie unsterblich. Verdammte Terroristen.“ Er stand vor dem Bett, ließ die Arme rotierten mit den Worten: „Falsch … völlig daneben! Menschen werden niemals unsterblich sein. Niemals! Der Verschleiß ist hoch, die Anfälligkeit. Die Menschheit, die verdammte Menschheit, sie ist nicht fähig gemeinsam zu leben, ist nicht für das Rudel geeignet. Milliarden Einzelgänger bringen sich um, töten; töten ihre Kinder und fühlen sich im Recht. – Was ist schon Demokratie?“, fragt er. „Ein Staat voller Kindermörder ist demokratisch, wenn das Gesetz sagt, dass es keine Kindermörder geben darf. – Er wird es Ihnen zeigen. Die Zeit, die Zeit … sie ist gekommen. – Wie? Sie fragen, wie er es tut?“ Ganz leise wurde seine Stimme, er sprach geheimnisvoll. „Es werden Schmerzen sein, die für ihn schwer zu ertragen sind. Äußerst schwer. Muss schließlich zwei Leben aufwiegen. Zwei ganze Leben. – Nein! Was sag ich, drei ganze Leben oder vier, vergaß ihn selbst und seinen kleinen Jungen. So etwas Wichtiges vergaß, der Idiot! – Er, ohne Liebe, ohne Kind, ohne Frau! – Oh, oh! Ja, das Kind. Schmerzen … viele Schmerzen, das aufzuwiegen. Die Träume, in denen er es sah, das eine Kind, sich riss Wunden in die Wangen der Trauer wegen, da er nicht sehen konnte; die Gedanken zeigten das Mädchen, zerquetscht und tot, dass Tränen liefen. Er hatte vielfach eine Klinge am Arm und nicht den Mut diese Scheiß Pulsadern aufzuschlitzen. – Oh armes, Kind, armes anderes Kind. War ihnen gleich, war ihnen gleich. Diese Krämpfe in seinem Herzen, diese verfluchten Krämpfe, es nicht wachsen zu sehen, es fremd werden lassend. Oh, oh, ja! Viele Schmerzen. Armes anderes Kind.“ Er beugte sich über Neurot. „Hab’s doch gesehen, seither bleibt es an, das Licht. Verstehst du? So viele Nächte, so wahnsinnig viele Träume, immer und immer wieder! Haben ihn zerfressen wollen. Doch sie schaffen das nicht! Niemals!“ Er kicherte und seine Stimme wurde wieder ruhiger. „Den einen wird er denunzieren. Das tut nicht nur weh, nein, nein! Nur Schmerzen der Seele. Sollen alle mit Fingern auf ihn zeigen. Kinderschänder verfluchter! – Oh, ja, teuer ist die Schuld. Viele Euro, viele Cent. – Böse sagst du? – Sieh dich vor! Wer will schon einschätzen, was böse ist und was gut? Ein Vater, der zum Terroristen wird, weil Demokraten seine Kinder töten, da sie im Weg waren, als es galt, die Mächte der Demokratie durchzusetzen? Abgestempelt als Kollateralschaden? Tötet andere im Wissen, die eigenen Kinder zu rächen, tötet im Wissen, Gutes zu tun. – Ist er böse? Ist er gut? Recht wird er nicht bekommen. Niemals! – Er war nur Vater seiner Kinder. – Nein, nein!“ Er schrie in diesem Moment. „Es gibt kein Gut und kein Böse! Es gibt nur Richter und Gerichte! Verurteilt wird aus Ansichtssache, verurteilt der Gesetze wegen oder der Wiedergutmachung? – Gesetze geschrieben oder ungeschrieben! – Sieh nur, verblutet innerlich und kann nichts tun dagegen. – Oh diese Schmerzen! Ist das schön! Das Gehirn wird nicht mehr durchblutet. Jetzt sagt er es ihm! Schau, seine Augen rollend, als drücke man ihm die Luft zum Atmen ab. Und die späte Einsicht. Zu spät, mein Freund. Zu spät. Ist tot und denkt er lebt. – Merkwürdige Metapher. Sehr, sehr merkwürdige Metapher.“ Tränen traten in seine Augen. „Sieh, einen Anfall wird er bekommen! – Gehen Sie jetzt. Gehen Sie alle! Es ist vorbei. Es ist vorbei. – Nein, halt! Zurück! Sehe diesen kleinen Mann! – Will sagen, sein anderes Kind! Was tut er? Was tut er? – Nun gehen Sie doch endlich! – Raus!“
Der Mann setzte sich wieder auf einen Stuhl und begann gleichmäßig mit dem Oberkörper zu schwingen. Über seine bleichen Wangen rollten Tränen. Von der Stirn tropfte Schweiß. Vor … zurück. Vor … zurück …
Der Pfleger hatte die Luft angehalten. Nun erst wagte er es, wieder zu atmen, er schwitzte unter den roten Haaren, die in seiner Stirn hingen. „Wie heißen Sie eigentlich?“, flüsterte Neurot einige Zeit später und beugte sich zu seinem Patienten hinunter. Die kristallklaren, tränengefluteten, blauen Augen trafen ihn für einen Moment.
„Frag nicht Junge! Es gibt keinen Namen. Ein Niemand ist er, ein verfluchter Niemand!“ Dann griff er Neurots Hand und streichelte sie sanft. „Mein Name ist Lutz. Nenn mich einfach Lutz. Und vertrau mir nicht. Niemals! Ich bin gefährlich, Tom!“
Da war es wieder. Dieses Schwingen und das ewige Patientenlächeln.
*
Ein kühler, trockener Tag. Auf einem Fahrrad fährt ein junger Mann in aller Seelenruhe durch die halbe Stadt. Er erreicht hinter einem großen Krankenhaus eine Siedlung, die ruhig jenseits der Hauptstraße liegt. Nachdem er sich orientiert hat, verlässt er die Siedlung wieder, fährt entlang der Hauptstraße, bis diese von einem Viadukt überquert wird. Dort folgt er einem schmalen Weg unterhalb der Bahnlinie auf ein Feld, bis er ein Wäldchen erreicht. In diesem Wäldchen steigt er vom Rad und beginnt, ein dicht mit Unkraut bewachsenes Feld zu überqueren. Sein Ziel ist die zuvor besuchte Siedlung.
Schier anmutig standen die Einfamilienhäuser der Siedlung im Norden von Leipzig, umgeben von etlichen Laubbäumen, in vielen Gärten wuchsen zwölfjährige Kiefern, es gab akkurat verschnittene Hecken. Fast hatte man den Eindruck, hier wäre eine Musterhaussiedlung aus dem Boden gewachsen, denn Kinder sah man hier nur selten.
Im Jahre 1993 zogen die ersten Käufer ein. Stadtnah und gefördert, ruhige Lage und doch zentral. Mittlerweile patrouillierte ein privater Sicherheitsdienst einige Male täglich durch die Siedlung. Fast alle, die hier wohnten, erhielten damals die Ostzulage, kamen aus dem Westen Deutschlands, um den Aufbau Ost voranzutreiben. Etliche blieben, denn es stockte dieser Aufbau mit der Zeit.
Die schmalen Straßen hatte man nach Blumen benannt. Tulpenweg, Narzissenweg, Dahlienweg, selbst einen Sonnenblumenweg gab es – achtundvierzig Häuser, für Pärchen eher verschwenderisch wirkend. Die Staatskarossen, die am Sonntagmorgen zur Betrachtung aus den Garagen gefahren wurden, zogen eine zeitlang die Mitglieder einer rumänischen Diebesbande an, die sich bis zu ihrer Festnahme in der Siedlung bedienten. 1999 hörte diese Angstzeit auf, seitdem kam es nur noch gelegentlich zu kleineren Übergriffen.
Am Ende des Tulpenweges wohnte ein Ehepaar, das es aus dem Sauerland nach Leipzig verschlagen hatte. Es war das letzte Grundstück der Siedlung. Hinter der hohen Hecke, die einen Stacheldrahtzaun verdeckte, befand sich ein unbestelltes Feld, den Garten zierten etliche Rosenstämme, ein überdachter Freisitz, der terrassenförmig an die Rückseite des Hauses anschloss, war mittels dicht ineinander gewachsener, in zwei Meter Höhe gekappter Lebensbäumchen, gegen ungewollte Blicke geschützt. Dies hatte den Vorteil, dass der junge, mit einer Latzhose, wie es sie in jedem Baumarkt gab, bekleidete Mann, am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr, in aller Seelenruhe den Sicherheitsmechanismus der Terrassentür untersuchen konnte. Da dort kein Hineinkommen war, ohne größeren Schaden anzurichten, kontrollierte der kaum Siebzehnjährige die Kellerfenster der Nordseite des Hauses. So, wie er es erwartet hatte, hatte man das schmale Fenster zum Öllagerraum nicht verschlossen. Der Gast war recht schlank, so rechnete er sich aus, durch das Fenster zu passen. Nun hantierte dieser junge Mann einige Minuten, bis er das Fenster ausgehebelt hatte und es sich zum Inneren hin öffnen ließ. Sekunden später war der geheimnisvolle Besucher im Ölkeller verschwunden. Am Fenster verlor er das blaue Basecape, das er sich sogleich wieder aufsetzte und die roten Haare bedeckte. Er klappte das Fenster wieder ordentlich an und zwängte sich an den Ölbehältern vorbei. Er stieg über eine Mauer aus der Ölwanne, stand nun neben der Heizanlage auf sorgfältig geputzten Fliesen.
Der junge Mann fasste in die Brusttasche der Arbeitskombi und holte zwei weiße Putzlappen heraus. Nun zog er seine Schuhe aus, stellte sie hinter die Wand der Ölwanne und band sich die Lappen um seine Füße. Anschließend streifte er zwei dünne Handschuhe über die Hände. Die TÜV-gerechte Brandschutztür war nicht abgeschlossen, eine Treppe führte hinauf, auf der obersten Stufe stand ein Karton mit Zeitschriften. Nirgends waren Spinnweben zu finden. Der Mann kontrollierte den Karton und stellte fest, dass sich darin ausnahmslos Hochglanzzeitschriften für Frauen befanden.
Nun stand er auf dem unteren Flur des Hauses, blickte sich kurz um und stellte fest, dass es keine Überwachungsanlage gab. Er warf einen Blick in die Küche des Hauses. Alles war peinlichst gesäubert, nichts stand offen herum. Nur den Geschirrspüler hatte man leicht geöffnet.
Der Gast wusste, dass Marita und Friedrich Hommel über das Wochenende bei der einzigen Tochter weilten, die in Bad Wünnenberg im Sauerland wohnte. Sie würden nicht vor Sonntagabend zurück sein. Daher nahm er sich viel Zeit, prägte sich bei seinem Rundgang jede Stufe und die Lage eines jeden Zimmers genau ein.
In der Küche hing ein Wochenkalender, den der Besucher abnahm und durchblätterte. Nur im September hatte man einen roten Kreis um den achtzehnten Tag gemacht und darunter geschrieben: „Evi geb.“
Scheinbar kam dem Mann nun eine Idee, dass er schmunzeln musste. Er nahm einen Stift aus seiner Brusttasche, suchte den 14. Mai im Kalender, kreiste ihn ebenfalls rot ein und hängte den Kalender wieder auf. Er ließ die zweite Maiwoche offen hängen.
Neben dem Kalender sah er eine Pinnwand, an der ein größeres Foto befestigt war. Auf dem Foto erkannte er zwei ältere Leute – wahrscheinlich die Hommels – ein junges Paar und ein kleines Mädchen.
Nun vervollständigte der Gast seine Tour durch das Haus, gelangte in ein geräumiges Wohnzimmer, von dem aus er die Terrasse sah. Auch dieses Zimmer war vorbildlich aufgeräumt. Der Mann betrachtete sich einige Zeit die eingebaute Schrankwand, gefertigt aus einem rötlichen, hochwertigen Holz. Im Blickbereich befanden sich verschiedene Ablagen. Hier wurde Meißner Porzellan hinter einer gläsernen, staubfreien Vitrine gesammelt.
Auf einem flachen Bord, gegenüber einer flauschigen, mit großen Samtdecken belegten Couch, thronte ein riesiger Plasmafernseher, im Bord darunter standen etliche DVDs, im Fach daneben der DVD-Player.
Wieder griff der junge Mann in eine Tasche seiner Arbeitskombi und zog eine fabrikneue Porno-DVD der Gay-Szene heraus, deren Folie er vor dem Besuch bereits entfernt hatte. Er nahm die DVD aus der Hülle, öffnete den DVD-Player, nachdem er die Power-Taste berührt hatte und legte die DVD ein. Über eine weitere Berührung der Powertaste stellte er das Gerät wieder ab. Mit einer Hand nahm er nunmehr einen Stapel der bereits vorhandenen DVDs aus dem Fach, ließ die mitgebrachte Hülle dahinter gleiten und stellte die zuvor entnommenen Hüllen wieder davor. Er richtete die DVDs ordentlich aus. Nun erhob sich der Besucher, betrachtete sein Werk und nickte zufrieden.
Jetzt schaltete er eine Stereoanlage ein, startete die CD, die gerade darin enthalten war und suchte nach einem ruhigen Lied. Als er dieses endlich gefunden hatte, drehte er die Lautstärke auf, sodass die Musik deutlich zu hören war.
Anschließend öffnete er einen Schrank nach dem anderen, bis er endlich fand, was er suchte. Er nahm eine Videokamera heraus, prüfte, ob darin auch eine Kassette enthalten und der Akku noch geladen war. Die digitale Anzeige bewies ihm, dass die Ladung noch etwa dreißig Minuten Betrieb zulassen würde. So spulte der Besucher die Kassette einige Minuten zurück. Nachdem er auf PLAY gedrückt hatte, sah er für einige Momente einer Familienfeier zu. Er suchte einen geeigneten Platz für die Kamera, sodass die Couch im Bild war, stellte sie auf REC, ein rotes Lämpchen leuchtete und die Aufnahme begann. Hinter der Kamera zog der Besucher die Handschuhe aus und entfernte die Fußlappen. Lässig ließ sich der Junge auf die Couch fallen, blickte nicht direkt in die Kamera, sondern darüber hinweg, als hätte er die Filmszene einstudiert. Wer den Film ansehen würde, sollte denken, er war nicht allein.
„Was? – Ausziehen? Vor der Kamera? – Meinst du wirklich, Fritz?“, fragte der junge Mann, als wäre Friedrich Hommel anwesend. „Wenn du willst … Das kostet aber extra!“
Er grinste unverschämt, legte sich auf die Couch und begann, sich die Arbeitskombi abzustreifen. Lässig ließ er die Träger über seine braungebrannten Schultern gleiten, fuhr sich über die Haut. Unter der Latzhose hatte er nichts an. Er setzte sich nun auffällig breitbeinig hin und begann lächelnd das Glied zu massieren, bis es steif wurde, dann warf er die Arbeitskombi über die Kamera.
„Das reicht jetzt!“, rief der junge Mann und stoppte kurz darauf die Aufzeichnung.
In aller Ruhe zog er sich wieder an, auch die Handschuhe, spulte den Film an die Stelle, wo die alten Aufzeichnungen beendet waren, packte die Videokamera zurück in den Schrank, so, wie sie vorher gelegen hatte und schaltete die Stereoanlage aus.
Nun widmete er sich längere Zeit der Couchgarnitur, bis er der Meinung war, das Wohnzimmer wäre nun im gleichen Zustand, wie er es betreten hatte.
Es folgte ein Besuch in der oberen Etage. Hier fand er das Schlafzimmer mit getrennt stehenden Betten und einem großen Spiegelschrank mit Schwebetüren.
Diesen öffnete er, bis er die Unterwäsche des Herrn gefunden hatte. Hinter die Unterwäsche ließ er eine bereits geöffnete Packung Kondome gleiten und schloss anschließend die Schwebetür ordentlich.
Zurück in der Küche, klappte der junge Mann den Kalender auf Februar zurück, als wäre ihm sein Fehler aufgefallen, dass er den Mai noch geöffnet hatte. Daraufhin lief er in den Keller, zog die Schuhe wieder an, zwängte sich hinaus, schlich zu jener großen Hecke fand die vorher geschaffene Lücke, ließ sich über den Zaun gleiten und lief gebeugt und doch schnell über einen Feldweg in das kleine Wäldchen. Dort erst zog er die Handschuhe wieder aus, zog ein Fahrrad aus einem Gebüsch und radelte kurz darauf über einen anderen Feldweg davon.
*
Im Büro der Kripo-Zentrale mitten in Leipzig, unweit des Reichsgerichtes. Der Kriminaloberkommissar erhebt sich von seinem Drehstuhl, streicht die Hose glatt. Auch sein Assistent erhebt sich. Der Tag verlief ruhig, fast langweilig. Zeit, einige Dokumente für die Bürokratie aufzuarbeiten. Draußen herrscht Berufsverkehr. Das Wetter ist nicht schön, aber trocken. Ein Telefon klingelt. Kommissar und Assistent haben kurzen Blickkontakt. Nachdem der Kommissar eine unmissverständliche Kopfbewegung gemacht hat, geht der Assistent ans Telefon, übergibt den Hörer jedoch wieder an seinen Chef, dem ein Lächeln ins Gesicht fährt, als er hört, wer ihn sprechen will.
„In fünf Minuten fahr ich los, Mausi. Versprochen! – Bis gleich.“ Kriminaloberkommissar Holger Hinrich legte den Hörer vorsichtig auf. Er knipste seinen Bildschirm aus.
Assistent Toni Engler, deutlich jünger an Jahren, räumte die Kaffeetassen zusammen. „Was habt ihr heute noch vor?“
„Gewandhausanrecht“, antwortete Hinrich und griff nach seinem Mantel.
„Ich wusste nicht, dass gerade du so musikalisch veranlagt bist …“
„Was heißt hier veranlagt? Mein Frauchen ist das vielleicht. Sie ist es, die mich mitschleift. – Immerhin, danach fanden wir, dass es jedes Mal schön war.“
„Und was …?“
Hinrich zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung. Mir egal. Wenn es nicht gerade was Postmodernes ist, dann kann man Musik auch genießen. Einfach so.“ Der Kommissar wandte sich zur Tür. „Du solltest auch was für die Verbesserung deines Kulturempfindens tun, Toni.“
Das Telefon klingelte wieder. „Ich geh mit meinen Jungs zu Chemie. Das ist Kultur“, meinte Engler und hob den Hörer ab. „Kripo Leipzig – Kriminalassistent Toni Engler!?“
Der Kommissar hielt sich an der Türklinke fest und lauschte. – Als wäre Fußball Kultur! Noch dazu in Leipzig. Viertklassig!
„Wo? Fastin? Gerberstraße? – Ja, es kommt jemand vorbei.“ Englers Gesicht lief rot an, während er den Hörer barsch auflegte. Adé Feierabend.
„Was ist los, Toni?“
„Ich mach das schon, Holger, fahr du mit deiner Frau ins Gewandhaus.“
Hinrich schüttelte den Kopf. Seine Stimme klang energisch. „Ich habe dich nicht gefragt, was ich tun soll, ich habe gefragt, was los ist!“
„Man hat gerade ein Kind gefunden, gefesselt und geknebelt.“
„Hoffen wir, dass es sich um den kleinen Max handelt. Und? Wo?“
„Unter einem Hotelbett. Im Fastin.“
„Fastin? – Welches Hotel ist das?“ Hinrichs Stimme hatte sich wieder beruhigt.
Engler lächelte. „Das weißt du nicht? – Früher Hotel Merkur, Gerberstraße. Das große, weiße.“
„Fastin heißt das jetzt? – Komm, Toni, lass uns schnell hinfahren, ich schaffe das schon noch. – Und gib Schiller einen Wink, dass es was zu tun gibt.“
Volker Schiller, K3, Spurensicherung. Unverzichtbarer Bestandteil der Kripo Leipzig. Im Gang rief Engler mit dem Handy an. Unter dem Arm die Protokollmappe.
„Wie alt ist das Kind?“, fragte Hinrich, während Engler den BMW aus der Tiefgarage rangierte.
„Elf. Ein Junge.“
„So alt wie deine zwei Und so alt, wie der gesuchte Max. Ungefähr. – Und sonst noch was?“
„Mehr weiß ich auch nicht.“ Engler fuhr mit verbissenem Gesicht.
Der BMW wühlte sich durch Leipzigs Berufsverkehr. Staus und Baustellen waren allgegenwärtig. Als nichts mehr ging, öffnete Engler die Tür, heftete das mobile Blaulicht auf das Autodach, stieg wieder ein und ließ den Handballen auf der Hupe. Kurz darauf ging es vorwärts. „Hab ich von deiner Hamburger Psychologin gelernt.“
„Ich hab das natürlich nicht bemerkt. Nur falls es Ärger gibt.“ Hinrich grinste.
„Denk an deine Frau. Und irgendwo ist wahrscheinlich immer ein Leben in Gefahr.“
Rabiat und mit quietschenden Bremsen brachte Engler das Fahrzeug vor dem Eingang des Fastins zum Stehen. Ein Page lief auf das Fahrzeug zu und öffnete Hinrichs Beifahrertür. „Ich soll Sie bitten, möglichst wenig Aufsehen zu machen …“
„Ist schon gut, Junge, pass auf das Auto auf.“ Der Kommissar klopfte dem jungen Mann auf die Schulter. „Wer hat uns angerufen?“
„Die an der Rezeption wissen Bescheid.“
Engler war bereits im Hotel verschwunden. Auch Hinrich betrat die wohltuend ruhige Atmosphäre. Während der Assistent am Tresen ein kurzes Gespräch führte, zückte Hinrich seinen Ausweis. „Kripo Leipzig, ich muss mal telefonieren. Wir dürfen nämlich nicht privat mit den Diensthandys …“
Eine junge Dame schob ihm ein Telefon hin. „Mit der Null bekommen Sie ein Amt.“
Kurz darauf entschuldigte sich Hinrich bei seiner Frau. Er beendete das Gespräch gewohnheitsgemäß mit einem Kuss in den Hörer. Die Dame hinter dem Tresen lächelte.
„Kommst du, Holger?“ Engler wartete bereits. Und neben ihm stand ein Hotelmanager im korrekt sitzenden schwarzen Anzug.
„Würden Sie mir bitte folgen?“ Der Mann drehte sich um und lief zu den Aufzügen. Einige Momente später standen die drei Herren im Aufzug.
„Ziemlich vornehm hier“, meinte Hinrich. „Wer hat das Kind gefunden?“
Der Hotelangestellte räusperte sich. „Eine Dame vom Reinigungsdienst. Sie wollte die Bettwäsche wechseln, da …“
„Ist die Frau noch hier?“
„Wartet oben in der Etagen-Lobby.“
„Und der Gast?“
„Ähm …?“
„Der Gast, der das Zimmer gemietet hat. Wer ist das?“
Der Manager wischte sich Schweiß aus der Stirn. „Ach, der Gast, der das Zimmer … Ein gewisser Doktor Eberhard Kissling. Konnte noch nicht ausfindig gemacht werden.“
Hinrich blickte vom Spiegel weg und sah den kleineren Mann, auf dessen Rivers ein „Sigmund Hoffmann“ glänzte, mit bösen Blicken an. „Ohne unseren ausdrücklichen Wunsch, mein lieber Herr Hoffmann, wird hier niemand ausfindig gemacht. – Haben wir uns verstanden?“
Der arme Mann schwitzte umso mehr. „Aber natürlich, Herr Kommissar.“
„Kriminaloberkommissar Hinrich.“
„Sicher, sicher.“
Die Tür des Aufzuges öffnete sich geräuschlos.
„Bitte folgen Sie mir.“ Hoffmann durchquerte einen Gang. In einer schwarzen, ledernen Sitzgruppe hockte eine junge Frau mit dunklen Haaren und verweinten Augen. Mit beiden Händen hielt sie ihre Schürze fest.
Hinrich gab seinem Assistenten ein Zeichen. Der ließ sich neben der Frau nieder, während der Kommissar das bewusste Zimmer mit der Nummer 714 betrat. Es war leer. „Kommen Sie ruhig mit rein, Herr Hoffmann, und fassen Sie mir bloß nichts an.“
Hinrich lief durch das Zimmer. „Wo ist das Kind jetzt?“
„Kinderklinik, wir dachten es wäre das Beste, wenn …“
Hinrich klopfte Hoffmann auf die Schulter. „Da haben Sie völlig richtig gedacht. – Hiermit war der Junge gefesselt?“
„Ja, genau, Herr Kriminaloberkommissar …“
„Nicht so förmlich, Herr Hoffmann, sagen Sie einfach Hinrich zu mir. Dafür hat man ja seinen Namen. – Wer war heute alles in diesem Zimmer?“
„Das Zimmermädchen und ich. Frau Raabe rief mich über das Telefon zu Hilfe, als sie den Jungen entdeckt hatte. Wir haben ihn vorgezogen. Er war ganz nackt, die Füße und die Hände waren mit Hotelhandtüchern gefesselt. Und über seinem Mund war Paketklebeband. Er sah nicht gut aus.“
„Nicht gut?“
„Na, fertig eben.“
„Was hat er gesagt?“
„Nichts, gar nichts.“
„Und seine Sachen?“
Hoffmann zuckte mit den Schultern.
Hinrich klopfte mit den Fingernägeln auf den Schreibtisch. „Ist Ihnen noch etwas aufgefallen, Herr Hoffmann?“
„Er hatte eine Wunde, hier ungefähr, am Hinterkopf. Die von der SMH haben das auch gleich bemerkt.“
„Ach so …?“
„Wenn Sie bitte mal ins Bad gehen würden, Herr Kommissar …“
Hinrich öffnete gemächlich die Badtür.
Hoffmann versuchte über Hinrichs Schultern zu schauen. „In der Duschkabine, die Fliesen …“
„Ich sehe auch, dass da Blut dran ist.“
„Tach!“, rief in diesem Moment eine weibliche Stimme an der Tür. „Versuchen wir gerade, die Spuren zu beseitigen?“
Hoffmann drehte sich erschrocken um. Eine junge, große Frau, im weißen Kittel und mit weißen Handschuhen, stand in der offenen Tür.
„Gut, Herr Hoffmann, Sie können uns jetzt allein lassen. Unten tauchen gleich ein paar Kollegen auf, die werden diesen – wie hieß er – ja, diesen Dr. Kissling festnehmen, falls der Ihr Hotel betritt. Je eher die Kollegen erfahren, wer der Mann ist, desto reibungsloser wird die Festnahme über die Bühne gehen. Verstanden? Und dann benötige ich die Namen und Adressen der Gäste der benachbarten Zimmer. Klar?“
Hoffmann nickte und verschwand, während Franziska Hermann, Kriminalistin von der Spurensicherung, einen großen Koffer öffnete.
„Hier Hinrich! Ich brauche vier Mann in Zivil an der Rezeption des Fastin Hotels. Das ist das große, weiße Haus in der Gerberstraße. Dort muss ein gewisser Dr. Eberhard Kissling festgenommen werden. Außerdem sollen sie einen Haftbefehl mitbringen, Untersuchungshaft wegen Verdacht auf schwere sexuelle Kindesmisshandlung. Alles verstanden? Und schickt ein paar Streifenwagen her, die aber nicht gesehen werden dürfen, falls der Kerl was spitzkriegt. Und ich will alles über diesen Mann wissen. Klar?“ Hinrich steckte sein Handy ein. „Na, Franziska, wo ist dein Chef, schon Feierabend?“
Die junge Frau blickte zu Hinrich hinauf und lächelte. „Der hat doch Anrechtkarten fürs Gewandhaus.“
„Ach so? Der auch? – Seit wann ist Schiller denn ein Klassiker?“
„Der nicht. Aber seine Frau. – Was ist denn hier passiert, Herr Hinrich?“
„Ziemlich unschöne Sache. Die Medien werden wieder begeistert sein. Die Putzfrau hat einen Jungen gefunden, nackt und geknebelt. Da, unter dem Bett. Mit aufgeplatztem Hinterkopf, Blut findest du reichlich im Bad. Nimm das Bettzeug mit. Wenn wir Spermaspuren oder Haare finden, ist der Kerl geliefert. Eine Blutprobe brauchen wir auch. Und schau dich um, ob du Spuren eines Kampfes findest.“ Hinrich wollte das Zimmer verlassen. „Bevor ich es vergesse, die Sachen des Jungen müssen hier irgendwo versteckt sein.“
Franziska Hermann nickte. „Wie geht es dem Jungen? – Einen Tag brauchen wir. Dann ist alles bei Ihnen.“