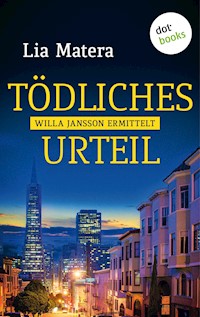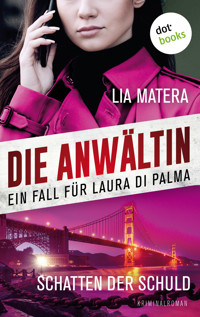4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Laura Di Palma
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Abgründe hinter der Idylle einer Kleinstadt: Der packende Kriminalroman »Die Anwältin – Flüstern der Rache« von Lia Matera als eBook bei dotbooks. Ein dunkler Tanz aus Wahrheit und Lügen … Ausgebrannt von den Intrigen und Machenschaften der Anwaltswelt von San Francisco ist Laura Di Palma in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Inmitten der urwüchsigen Redwood-Wälder Kaliforniens will sie wiederfinden, was sie einst dazu anspornte, Strafverteidigerin zu werden … Als ein Privatdetektiv, mit dem Laura ebenso alte wie komplizierte Gefühle verbindet, ihre Hilfe bei einem schockierenden Fall benötigt, ahnt sie jedoch, dass ihr die härteste Prüfung erst noch bevorsteht: Ted McGuin wird beschuldigt, seine Frau in den Selbstmord getrieben zu haben – er wiederum beschwört seine Unschuld. Als der Angeklagte selbst Opfer eines Verbrechens wird, beginnt für Laura ein Wettlauf gegen die Zeit! »Ein Krimi von Lia Matera ist wie ein exquisiter Brandy: samtig, reif, atemberaubend und mit dem gewissen Biss, der in Erinnerung bleibt.« Cleveland Plain Dealer Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Anwältin – Flüstern der Rache« von Lia Matera ist der dritte Band ihrer Krimi-Reihe um eine Frau zwischen zwei Welten: ihrer Heimat in den kalifornischen Redwood-Wäldern und den schillernden Anwaltskanzleien San Franciscos. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein dunkler Tanz aus Wahrheit und Lügen … Ausgebrannt von den Intrigen und Machenschaften der Anwaltswelt von San Francisco ist Laura Di Palma in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Inmitten der urwüchsigen Redwood-Wälder Kaliforniens will sie wiederfinden, was sie einst dazu anspornte, Strafverteidigerin zu werden … Als ein Privatdetektiv, mit dem Laura ebenso alte wie komplizierte Gefühle verbindet, ihre Hilfe bei einem schockierenden Fall benötigt, ahnt sie jedoch, dass ihr die härteste Prüfung erst noch bevorsteht: Ted McGuin wird beschuldigt, seine Frau in den Selbstmord getrieben zu haben – er wiederum beschwört seine Unschuld. Als der Angeklagte selbst Opfer eines Verbrechens wird, beginnt für Laura ein Wettlauf gegen die Zeit!
»Ein Krimi von Lia Matera ist wie ein exquisiter Brandy: samtig, reif, atemberaubend und mit dem gewissen Biss, der in Erinnerung bleibt.« Cleveland Plain Dealer
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
Sowie ihre Reihe um Willa Jansson mit den Kriminalromanen:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Hard Bargain« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Harte Bandagen« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Senyuk Mykola / Icarus66 / HolyCrazyLazy
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-913-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Anwältin 3« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Die AnwältinFlüstern der Rache
Ein Fall für Laura Di Palma
Aus dem Amerikanischen von Edith und Sonja Winner
dotbooks.
Kapitel 1
Der Bach war ein unübersichtliches Gewirr von kleinen Stromschnellen und plötzlichen Tiefen, stellenweise zu tief zum Waten. Wir gruben die Schuhspitzen zwischen die nassen Wurzeln, und das Wasser lief uns über die Gummistiefel. Mal kämpften wir uns am Ufer entlang, durch das dichte Schachtelhalmgestrüpp, mal balancierten wir über Steine, die aus dem Wasser ragten, oder über umgestürzte Baumstämme, die mit glitschigem Moos bewachsen waren. Dann sanken wir wieder knietief im Schlamm ein, einem grauen Morast, der noch ein paar Nuancen dunkler als der Himmel war. Unsere Unterhaltung beschränkte sich auf: »Der Stamm hier ist morsch, versuch’s über die Steine« oder »Halt dich an dem Ast fest und komm wieder ans Ufer«.
Für meinen Cousin war das normal, genauso normal wie das rauhe Vagabundenleben, das er seit seiner Entlassung aus dem Armeekrankenhaus 1973 geführt hatte. Wie seine letzten neunzehn Jahre – wenn man von den drei Jahren in dem schnieken Apartment absah, aus dem wir vor einem halben Jahr ausgezogen waren.
Ich warf Hal einen Blick zu. Er hatte mehrere Schichten alter Pullover an; der Wind hatte seine angegrauten Haare zerzaust, und er war von oben bis unten mit Schlamm und Wasser bespritzt. Er stand in der Mitte des Bachbetts, rechts von ihm ragte eine von Kletterpflanzen und Gesträuch überwucherte Steilwand auf, links war das Ufer unterhöhlt, von oben hingen tropfende Farnbüschel und loses Wurzelwerk, in dem Erdklumpen klebten, herab. Breitbeinig stand er da, auf zwei Steinen im Wasser, die Wellen teilten sich an seinen Fesseln – der Koloß von Hicksville. Ich griff in die dicken Stengel und Blätter der Pastinaken und zog mich die Böschung hinauf.
Er beobachtete mich mit vollkommen teilnahmsloser Miene. Das regte mich auf. Am liebsten hätte ich diesen Panzer mit Gewalt durchstoßen. Aber morgens war Hal empfindlich, morgens mußte man unbedingt Gewaltmärsche durch unwegsames Gelände mit ihm machen, damit er beweisen konnte, daß er (noch) kein behinderter Kriegsveteran war. Hinterher konnte er dann alle Schmerzen und Zipperlein als Folgen der morgendlichen Strapazen ausgeben und als etwas akzeptieren, das zum Ausruhen am Feuer eben dazugehört. Dann konnte er sogar akzeptieren, daß er sich in meiner Gesellschaft wohl fühlte.
Ich rutschte aus und mußte mich an der Böschung festkrallen wie eine tolpatschige Eidechse. Gleich würde Hal eine gehässige Bemerkung machen. Bloß kein Peace-and-Love-Gesäusel zwischen uns. Wir waren Einsiedler, keine Landkommunarden.
Manchmal kam ich mir vor wie in einem Überlebenscamp. Hal bestand derart verbissen auf diese langen Fußmärsche, auf diese Kletterpartien und Lagerfeuer im Regen, als ob eines Tages das Überleben unserer Sippe davon abhängen könnte.
Dabei wußten wir beide sehr gut, wovon unser Überleben abhing. Ich war die meiste Zeit meines Lebens eine gut verdienende Anwältin gewesen. Sechs Monatsgehälter als Abfindung und ein dickes Sparbuch, das war unsere Lebensgrundlage – nicht die Kunst, im strömenden Regen durch reißende Gebirgsbäche zu waten.
Das Überleben der Sippe – ein kurioser Gedanke, in unserem Fall. Wir waren ein Paar und zugleich Verwandte, Cousin und Cousine. In so großer Nachbarschaft zueinander aufgewachsen, daß wir erst einmal voreinander davonlaufen mußten, als wir aus unseren Familien ausbrachen, aber dann um so leidenschaftlicher wieder zusammenfanden, als wir beide Anfang Dreißig waren. Das war vier Jahre her. Mittlerweile war aus uns ein verschrobenes Pärchen an einem gottverlassenen Ort geworden. Seit einem halben Jahr bewohnten wir eine Hütte, die für meinen Geschmack zu primitiv und für Hals Geschmack noch immer zu vornehm war. Und mußten ständig darauf bedacht sein, uns seine Eltern vom Hals zu halten, die sich gerade durch ihre Scheidung quälten.
Mir war immer noch nicht klar, was uns eigentlich hierher verschlagen hatte. Ich war aus meinem Job gefeuert worden, als Hal gerade körperlich etwas angeschlagen war – ein Wiederaufflackern seines Kriegsleidens –, schätzungsweise hatte ich in der Panik geglaubt, ein bißchen Einsiedelei sei das Richtige, um neue Kräfte zu sammeln.
»Schau mal, Laura, da oben!« sagte Hal und riß mich aus meiner Grübelei.
Auch gut. Mir durch ständiges Hinterfragen der Beziehung die Nerven aufzureiben, davon hatte mich schließlich schon meine schiefgegangene Jungmädchenehe kuriert – bis vor kurzem wenigstens. Diesen Streß hatte ich mir bei keiner meiner Liebeleien nach der Scheidung mehr gemacht. Aber da hatte ich auch Anträge aufzusetzen, bei Gerichtsterminen zu erscheinen, Dokumente zu erstellen, Vorgesetzte bei Laune zu halten, Mandanten zu betreuen. Ganz zu schweigen von dem übrigen Alltagskleinkram, der einem die Nerven raubt und um den ich mich jetzt nicht mehr die Bohne kümmerte: regelmäßige Friseurbesuche, die Garderobe nach der neuesten Mode und das Equipment auf dem neuesten Stand der Technik halten etc. etc.
»Laura.« Hals Ton war eine Spur schärfer geworden. »Da oben.«
Ich folgte seinem Blick hinauf zu den Wipfeln der Redwoodbäume am Rand der Schlucht, ungefähr da, wo wir vorhatten, uns von dem steilen Abhang wieder auf ebene Erde zu hieven – ganz in der Nähe (im ländlichen Maßstab gesprochen) unserer Hütte.
Dort oben stand jemand, ein helles Hemd hob sich gegen den dunklen Wald ab. Vierhundert Meilen südwärts von hier, in dem Landesteil, der gemeinhin Nord-Kalifornien genannt wird, würde kein Hahn danach krähen, wenn in der Landschaft die Silhouette eines Fremden auftaucht. Aber diese Schlucht hier durchwanderte ich mit Hal mindestens einmal die Woche, bei Wind und Wetter, und wir waren nie einer Menschenseele begegnet. Wir hatten hier sämtliche Wiesen überquert, uns überall durchs Unterholz geschlagen, im tiefsten Kiefern-, Fichten-, Redwoodwald Picknicks abgehalten – aber nie war uns jemand über den Weg gelaufen. In den ganzen sechs Monaten nicht.
»Stadtvolk«, sagte ich entrüstet.
»Das ist Sandy.«
»Nie und nimmer.«
»Sag bloß, du erwartest ihn nicht.«
Als ob ich ihm das nicht gesagt hätte. So ein enger Freund, fast sechs Jahre hatte ich mit ihm zusammengearbeitet. Eine Weile waren wir sogar liiert gewesen.
Die Gestalt da oben wedelte mit den Armen, die lang wie Signalflaggen waren. Da Hal es gesagt hatte, und da ich es glauben wollte, war ich mir plötzlich ganz sicher, Sander Arkelett zu erkennen, wie er uns zuwinkte.
Bei unserer letzten Begegnung hatte er mir ins Gesicht gesagt, ich sei bescheuert, meinen Beruf an den Nagel zu hängen, um mich mit einem abgewrackten Depressiven abzugeben, der mich auch noch schlecht behandelte. Ich hatte ihm geantwortet, er solle gefälligst aufhören, das ganze als billige Romanze abzutun: Ich war gefeuert worden, verdammt noch mal. Ich war ausgebrannt. Ich hatte die Schnauze voll von der Arbeit, ich hatte die Schnauze voll von meinem Lebensstil. Und Hal war nicht der verschlossene Kerl, in dem es nur so brodelte – der er in Sandys Beisein immer wurde; wenn er mit mir allein war, trug er lediglich einen dicken Panzer.
Ein Echo hallte durch die Schlucht: »Laura!«
Ich legte die Hände zum Trichter an den Mund und schrie zurück: »Sandy?« Meine Stimme verschwand im Rauschen des Baches.
»Scheiße. Also los, gehen wir rauf.«
Die Verärgerung in Hals Stimme war nicht zu überhören. Lag es daran, daß man auf ebener Erde noch immer sehen konnte, wie er hinkte? Unter Sandys Augen schien ihm das wieder schmerzlich bewußt zu werden. Er hatte kein Selbstvertrauen: Noch vor acht Monaten, als sein Kriegsleiden wieder virulent geworden war, hatte es seine ganze rechte Seite lahmgelegt. Und vor sechs Monaten, als wir mangels Alternativen hierher gezogen waren, hätte ich mir nicht im Traum einfallen lassen, daß er jetzt schon wieder durchs Unterholz robben – an seinen guten Tagen, und an seinen schlechten immerhin über Wiesen und Felder wandern würde. Geschweige denn, daß ich mitwandern würde.
Kapitel 2
Mittags saßen wir beim Kaffee, frisch gebadet und in warme Flanellhemden gehüllt, die durch und durch nach Holzfeuer rochen. Auf einem Tablett trockneten ein paar Hefebrötchen mit Frischkäse vor sich hin.
Sandy nippte bedächtig an einer Tasse Kaffee mit einem Schuß Southern Comfort. Er saß nach vorn gebeugt, mit gespreizten Beinen, die Ellbogen auf die Knie gestützt – eine Art zu lang geratener Fred Astaire. Die sandfarbenen Haare fielen ihm in die Stirn. Schmales Gesicht, tiefe Grübchen, blaue Augen. Sein Blick ruhte eine Zeitlang auf dem Feuer, dann auf mir. Ein hübscher Cowboy. Gary Cooper im Stadtanzug.
Stadtkleider – ich vermißte sie. Oder das, was ich mit einem städtischen Outfit verband: keine Zeit zum Grübeln zu haben, immer ein Gesicht zu machen, als ob man genau Bescheid wüßte, als ob man permanent auf Zack wäre.
Ein Foto von mir in einer Zeitung fiel mir ein, im streng geschnittenen Armani-Fummel, die schwarzen Haare glatt nach hinten frisiert, und ein Gesichtsausdruck, aus dem jede Spur von italienischem Drama herausgebügelt war. In Jeans und Flanellhemd, mit der ungebändigten Lockenmähne sah ich anders aus, das wußte ich, für Sandy reichlich ungewohnt – vielleicht sogar besser, so wie ich seinen Geschmack kannte. Aber er kannte mich gut genug, um in mir nicht irgendeine Landpomeranze zu sehen, egal, wie ich heute aussah.
Wir unterhielten uns, gossen Kaffee nach und schürten das Feuer. Sandy arbeitete immer noch als Ermittler für mein altes Anwaltsbüro und erzählte mir den neuesten Klatsch.
Aber es gab nichts Interessantes. Als er schließlich zur Sache kam, sah es aus, als wäre er mit der Tür ins Haus gefallen.
»Ich bin wegen eines Falles hier. Um etwas über eine Frau herauszubekommen, die sich umgebracht hat – mit etwas Nachhilfe.«
Er griff tief in die Brusttasche seines weiten Hemds, dem man nie angesehen hätte, daß sich in einer seiner Falten eine Tonbandkassette verbarg. Dann hielt er das Band hoch und schaute mich fragend an.
Ich stemmte mich mühsam aus den Kissen hoch, die Glieder steif und müde vom Wandern, wie ich es inzwischen gewohnt war, und nahm Sandy die Kassette ab. Während ich zur Stereoanlage ging, spürte ich seinen Blick auf mir, vielleicht auch auf den teuren Möbeln, die nicht ganz hierher paßten, an diesen gottverlassenen Ort. (Aber das Zeug gehörte mir, ich hatte nicht eingesehen, warum ich es mitsamt meiner verschrotteten Karriere zurücklassen sollte. Schließlich hatte ich nun endlich mal die Muße, mich daran zu freuen; vorher hatte ich dazu keine Zeit gehabt, aber jetzt hatte ich ja sonst nicht viel zu tun.)
Ein Scheit knackte und brach in ein paar Stücke Holzkohle entzwei, das war das einzige Geräusch im ganzen Haus, einem großen Ein-Raum-Haus mit Dachschrägen bis zum Boden. Ich steckte die Kassette in den Recorder und drückte auf »Play«.
»Das Band stammt aus ihrem Anrufbeantworter«, sagte Sandy. Aus den Lautsprechern kam die Stimme einer Frau, die sich verlegen räusperte. »Die Ansage, die jeder Anrufer hören konnte.«
»Es tut mir leid.« Die Stimme klang zaghaft, leise. »Ich habe versucht, das durchzustehen, einen Weg zu finden, wie ich es aushalten könnte, mittendrin zu stecken. Aber ich merke, wie die Leute mich ansehen, und dann erinnere ich mich daran, wie die Leute mich früher angesehen haben, weil ich ein schönes Kleid anhatte oder gerade beim Friseur war, und mir wird klar, daß mir das genausowenig gefallen hat, auch wenn ich damals dachte, genau das wäre es, was ich wollte. In gewisser Weise war es sogar schlimmer, wenn die Leute mich anschauten, nur weil ich mich zurechtgemacht hatte. Oder wenn ich mich auf einer Party irgendwo im Spiegel sah, und dachte: Wow, sehe ich gut aus! Wenn ich glücklich bin, dann sehe ich schön aus! Aber dann war es sofort wieder weg – mein Gesicht verwandelte sich noch in der gleichen Sekunde, in der ich da stand und mich im Spiegel sah. Weil ich wußte, daß das Glücklichsein bloß eine kurze Anwandlung war, daß es eine Minute oder eine Stunde später schon wieder vorbei wäre. Und dann wäre ich wieder ich selbst, am grauenhaften Boden der Tatsachen zusammengesackt, mit meinem häßlichen Gesicht. Danach, wenn ich nicht mehr glücklich war, kam es mir fast wie eine Lüge vor. Eine Lüge, daß ich mich als das hübsche Ding ausgegeben hatte, das ich gar nicht bin.« Ein kurzes Lachen. »Vielleicht war das der Grund, warum ich ... den Eispickel genommen habe. Ich hatte es satt, meine Häßlichkeit zu verstecken, ich wollte mich öffnen, damit die Leute meine Häßlichkeit sehen und mich dafür hassen konnten. Wie ich mich selber hasse. Wie ich es verdiene.« Die Stimme verstummte einen Moment. Man hörte nur das Rauschen des Tonbands. »Ted hat mir so einen furchtbaren Deal aufgedrückt. Er legt mir jeden Tag, bevor er zur Arbeit geht, diese Kanone vor die Nase. Sie liegt hier vor mir auf dem Küchentisch, und ich starre sie an, als ob ich in den Spiegel starre, als ob sie mir was Neues zeigen kann. Ich starre sie an und denke dauernd nur das eine: wie naiv zu glauben, daß man die freie Wahl der Entscheidung hat. Vielleicht haben manche Menschen die Wahl; ich habe nur dieses Etwas in mir, das mich packt, so wie ein Habicht eine Maus schnappt.« Wieder eine Pause. »Ich werde die Pistole nehmen. Ich weiß, was ich tue, und ich weiß, es ist das beste so.« Ein wenig trotzig: »Das beste. Also, Ted, es tut mir leid. Wer auch immer anruft, es tut mir leid. Sie brauchen mir keine Nachricht zu hinterlassen, es ist zwecklos.«
Ein schriller Piepton signalisierte dem Anrufer das Ende dieser zwecklosen Ansage.
Ich schaute Sandy an und rätselte, warum er uns dieses Band vorgespielt hatte. Er selber hatte es bestimmt schon mehrmals gehört. »Was für einen Auftrag hat das Büro?«
Einen Augenblick gab Sandy keine Antwort. Er starrte Hal an, den Kopf im Nacken, die Brauen nachdenklich gesenkt.
Hal war grau im Gesicht, sein Mund stand offen, er saß da wie versteinert.
Sandy sagte: »Die Stimme gehört der Tochter eines Mandanten. Ihr Name ist Karen McGuin, Alter sechsunddreißig. Mädchenname Clausen. Sie ist hier aufgewachsen, für ein paar Jahre weggegangen, wieder zurückgekommen. Hat diesen Kerl, Ted McGuin, kennengelernt, eine Weile mit ihm zusammengewohnt und ihn dann geheiratet, vor zwei Jahren. Er ist jünger als sie, zweiunddreißig. Wohnt ein Stück außerhalb von Dungeness.« Eine kleine Gemeinde im Norden meiner Heimatstadt. »Dann, vor etwa einem Jahr, hat sie einen Selbstmordversuch gemacht. Hat sich Arme und Beine mit einem Rasiermesser aufgeritzt, hat sich mit einem Eispickel das Gesicht entstellt, sich dabei die halbe Nase abgehackt und ein Auge verloren.«
Um den Menschen die Häßlichkeit in ihrem Innern zu zeigen, hatte sie gesagt.
»Ein Rasiermesser ist ja schon schlimm genug. Aber ein Eispickel ?« Bei der Vorstellung fühlte sich die Kassette in meiner Hand grauenhaft kaltan. »Warum denn so grausam?«
Sandy hob die blonden Brauen. »Irgendeine Theorie, Hal?«
»Selbsthaß«, sagte Hal leise, leiser ging es nicht.
»Nun.« Sandy streckte wirkungsvoll seine schlanken Glieder. »Ja. Ich würde sagen, daß muß ein Faktor gewesen sein.«
»Und hat sie sich wieder erholt?« Ich wollte auf irgendeine taktvolle Weise fragen, warum er uns die Kassette mitgebracht hatte.
Ein Naserümpfen. »Sie muß wohl ziemlich übel ausgesehen haben. Aber – ja, sie hat sich wieder erholt.«
»Und dann hat sie beschlossen, abzuschließen, was sie angefangen hatte.«
»Nachdem sie wieder zu Hause war – erst war sie im Krankenhaus, dann in der Psychiatrie, dann noch mal im Krankenhaus –, hat sich anscheinend ihr Mann um sie gekümmert. So hört es sich für mich jedenfalls an.«
Ich gab ihm die Kassette zurück. Ich hätte gern den Kopf an Hals Brust gelegt. »Und er hat ihr wirklich jeden Morgen eine Kanone hingelegt?«
»Ihre letzten Worte. Hört sich an, als wollte er, daß sie sich beeilt und den Job zu Ende bringt.«
Weil er wußte, daß sie unglücklich war? Weil der Anblick am Frühstückstisch so abscheulich war? »Wie genau –«
Hal fiel mir ins Wort. »Ihre Familie hat dich hergeschickt, damit du was aus McGuin rauskriegst, ja?«
»Ja.« Ein Blick wie ein Laserstrahl in Hals Richtung. »Aus ihm und über ihn. Dachte, du könntest mir ein bißchen Hintergrund liefern.«
Ich weiß nicht, worüber ich mehr staunte, über Sandys letzten Satz oder über Hals Klar-doch-Nicken.
Kapitel 3
Eine Stunde später standen wir alle drei an Karen McGuins Grab. Hals stoppelige Wangen waren ganz eingefallen, die dunklen Brauen so krampfhaft gerunzelt, als müsse er ein Zucken im Zaum halten. Er sah beinahe so schlecht aus wie vor sechs Monaten, als er noch am Stock ging. Ich musterte sein Gesicht und wollte mir nicht recht eingestehen, daß ich, sobald ich eine Träne sehen würde, eifersüchtig auf die Tote wäre.
Eifersüchtig. Es war ziemlich lange her, daß ich dumm genug war, meinen Wert daran zu messen, wie sehr andere Leute mich mochten. Es war einfach unpraktisch bei meiner Art von Arbeit. Und es hätte mir auch nicht viel Trost gebracht, nicht bei einem so verstockten Liebhaber, wie Hal einer war.
Vielleicht war das Wiedersehen mit meiner Heimatstadt der Auslöser: daß plötzlich Gefühle in mir aufwallten, von denen ich glaubte, ich hätte sie bereits im Verlauf meiner jungen Ehe in Schutt und Asche gelegt, damals, als ich noch nichts hatte, worauf ich mir etwas einbilden konnte und deshalb zu viel darauf gab, was andere – allen voran mein damaliger Ehemann – von mir dachten. Hier in dieser Stadt, die ich danach, sobald ich erwachsen geworden war, tunlichst gemieden hatte.
Nur zweimal war ich hierher zurückgekommen. Das letzte Mal vor vier Jahren. Hal war zu der Zeit auch im Lande, zum ersten Mal nach dreizehnjähriger Abwesenheit. Er war in ein abbruchreifes Haus in einer verlassenen Wohnsiedlung gezogen – außer Reichweite seines Vaters, des Bürgermeisters. Ich war damals viel zu sehr mit mir selbst und dem Schmieden eines persönlichen Komplotts beschäftigt gewesen, um mich zu fragen, was Hal zurück in die Heimat getrieben hatte. Es sollte sich herausstellen, daß es die Frau gewesen war, vor deren Grab er nun kauerte.
Es war ein Familiengrab. In ein Betonbett, das offenbar angelegt war, um den Trauernden den nordpazifischen Küstenschlamm von den Schuhsohlen zu halten, waren Steinplatten eingelassen, die auf die Anordnung der Ruhestätten hinwiesen. In zwei buckligen Reihen lagen hintereinander die Urgroßeltern und die Großeltern der Frau sowie ein Onkel, der im Zweiten Weltkrieg gefallen war. Neben seinem Grab steckte in einer Bodenritze eine mickrige, etwas verwitterte Memorial-Day-Fahne. Drei Plätze waren noch frei in der Parzelle – zu wenig für die noch lebenden Mitglieder der Familie der Frau. Aber ihr Mann würde vermutlich woanders begraben werden – ein Ehemann, der seiner Frau unverblümt jeden Morgen, bevor er zur Arbeit ging, eine geladene Kanone auf den Küchentisch gelegt hatte. Jeden Morgen, seit dem Tag, an dem sie aus dem Krankenhaus wiedergekommen war, noch immer entstellt, für den Rest ihrer Tage entstellt.
Der Friedhof lag auf einem Hügel oberhalb von Dungeness, einem Molkereistädtchen, das fünf Meilen landeinwärts von dem Haus lag, wo die Tote gelebt hatte. Von dem Platz aus, an dem wir standen, konnte man ein paar schmucke viktorianische Landhäuser sehen und im Stadtkern die ehemaligen Futterhandlungen mit frisch getünchten Fassaden, hinter denen jetzt Antiquitätenhändler und Galeristen verhungerten. Außenherum lag auf allen Seiten saftiges, grünes Weideland, das sich bis zum Highway 101 erstreckte. Die nächste »größere« Stadt lag zehn Meilen südlich von hier – meine Heimatstadt, deren Bevölkerung von dreißig- auf fünfundzwanzigtausend zusammengeschrumpft war, nachdem mehrere Sägewerke dichtgemacht hatten und der Fischfang zehn Jahre lang stetig zurückgegangen war. Zu leere Kassen, um auch noch Redwood-Antiquitäten-Schnitzer und Art-Nouveau-Kleckser im Nachbarort über Wasser zu halten.
Sandy kehrte dem Grab den Rücken, legte die Hand über die Augen, weil ihn der helle Himmel blendete, und ließ den Blick über das Städtchen schweifen. »Was zum Teufel hast du hier bloß zu suchen?«
Ich trat einen Schritt an ihn heran. »Warum nicht hier?«
»Herrgott noch mal, Laura.« Sein Tonfall war weniger brüsk als seine Worte. »Steve Sayres würde dich sofort wieder einstellen. Du brauchst ihn nur zu fragen. Jetzt haben sie zwei neue Leute eingestellt, die zusammen nicht halb so viel schaffen wie du.«
»Sayres würde mir nie den Freiraum geben, den ich bei Doron hatte. Außerdem ist er immer noch sauer auf mich. Er würde mich erst mal zur Strafe mit Routine eindecken, tonnenweise Betreibungen.«
Dreimal hatte ich darauf bestanden, eine arbeitsaufwendige Strafverteidigung, bei der kein Cent zu verdienen war, übernehmen zu dürfen. Zweimal hatte ich mich durchgesetzt, weil es mir gelungen war, Doron White, den Seniorpartner der vornehmen Kanzlei White, Sayres & Speck, in meiner Begeisterung mitzureißen und auf meine Seite zu ziehen. Zweimal hatte er mich gegen seine aufgebrachten Partner in Schutz genommen, die den finanziellen Ruin der Kanzlei prophezeiten. Das dritte Mal hielt Doron zu seinen Partnern, und ich wurde gefeuert. Aber Sandy hatte recht. Nachdem Doron an einem Herzanfall gestorben war, brauchte das Büro Regenmacher. Sie würden mich wieder einstellen, wenn ich versprach, ein braves Mädchen zu sein und nur Zivilfälle zu übernehmen.
»Es gibt noch ’ne Menge anderer Büros in der Stadt, die dich einstellen würden. Das weißt du genau – vom Fall Wallace Bean wird man noch in hundert Jahren sprechen.«
Wallace Bean, Mörder zweier US-Senatoren, war mein hochkarätigster Mandant gewesen. Daß ich für ihn einen Freispruch errang, hatte mich berühmt gemacht. Bean hatte leider ein trauriges Ende gefunden, in einer dunklen Gasse niedergestreckt von der Selbstjustiz eines entrüsteten Bürgers.
Sandy zupfte mich am Ärmel. »Und du hängst hier herum und spielst Walden in den Wäldern.«
»Es ist ja nicht für immer.«
»Es geht aber jetzt schon ein gottverdammtes halbes Jahr so.« Er wies mit einer Kopfbewegung auf die ehemaligen Lagerhäuser der Futterhändler am Fuß des Hügels. »Das hier genügt dir, ja? Wofür hast du eigentlich Jura studiert?«
»Jedenfalls nicht dafür, um gefeuert zu werden, kurz bevor ich zum Partner aufgestiegen wäre.« Es wurmte mich immer noch. Ich wechselte das Thema. »Warum bist du in den Fall eingeschaltet worden?«
Sandy steckte die Hände in die Taschen seines Anoraks und blinzelte zu mir herunter. »Die Staatsanwaltschaft will keine Anklage erheben. Offenbar reicht ihnen die Beweislage nicht aus. Für den Nachweis eines Motivs nicht und nicht einmal für Totschlag.«
»Und was ist mit Beihilfe? Selbstmord ist doch ein Verbrechen; ihr Mann hat Beihilfe zu einem Verbrechen geleistet. Oder Anstiftung oder Mitwisserschaft, was ist damit?«
»Das Problem ist, daß du beweisen mußt, was er im Sinn hatte. Mit anderen Worten, du mußt den Nachweis erbringen, daß er ihren Selbstmord verursacht hat, indem er ihr die Kanone auf den Tisch gelegt hat. Ich schätze, das ist der springende Punkt für die Staatsanwaltschaft.«
»Quatsch. Gibt’s denn keinen energischeren Staatsanwalt in dem Amt?«
Er grinste. Ein alter Insiderwitz: Wenn es um meine Fälle ging, konnte mir nie jemand energisch genug sein.
»Und wenn sie Attila den Hunnen persönlich da drin hätten, die Frau, die den Fall bearbeitet, sagt: ›Keine Chance.‹ Und das will ihre Familie nicht schlucken. Sie wollen, daß ich Leute ausfrage, die McGuin kennen, daß ich Indizien für ein Motiv dingfest mache, die sie der Staatsanwaltschaft unterbreiten können.«
Ich spürte Hals Hände auf meinen Schultern, als er zu sprechen anfing: »Er legt jemandem eine geladene Kanone vor die Nase, der gerade einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Warum ist das nicht Beweis genug?«
»Wenn man energisch genug recherchiert und eine Argumentation aufbaut –«
»Nur diese Tatsache, warum reicht das nicht als Beweis?« Sein Ton war scharf, fast aggressiv.
Sandy und ich sahen uns an. Wir hatten lange genug zusammengearbeitet. Er wußte, wie satt ich es hatte, den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und geltendem Recht zu erklären. Die Leute reagierten darauf immer wütend, bombardierten mich mit Vorhaltungen, wie die Dinge sein sollten. Wen zum Teufel scherte es, wie die Dinge sein sollten?
»Der Nachweis einer kriminellen Handlung geschieht nach einem kodifizierten Muster. Dabei ist das Strafmaß –«
Der Griff seiner Hände an meinen Schultern wurde fester. »Warum redest du so von oben herab mit mir?«
»Das tue ich nicht.« Seine Hände glitten von meinen Schultern. Ich fröstelte, ihre Wärme fehlte mir.
Das nasse Weideland unter uns stellte eine weitaus angenehmere Realität dar. Kühe gaben Milch, oder sie gaben keine, ohne moralische Zweideutigkeit.
Sandy fragte: »Laura, tust du mir einen Gefallen? Kommst du mit, wenn ich den Mann interviewe?«
»Warum?«
»Nur um sicherzugehen, daß ich keine juristischen Feinheiten übersehe.«
Alte Zeiten. »Ich bin als Anwältin aus der Übung, Sandy.«
»Eine Stunde deiner wertvollen Zeit, Laura.« Er sah mich nicht an, blinzelte weiter in die Landschaft hinaus. »Es sei denn, du bist durch dringendere Angelegenheiten verhindert.«
»Du brauchst mich nicht. Sieh mich an.« Ich trat direkt vor ihn hin. »Sieh mir in die Augen, Sandy. Worum geht es? Wirklich.«
Ich hatte mich schon darauf eingestellt, gleich zu explodieren, denn ich rechnete damit, daß er mich wiedermal mit moralischen Appellen ins Anwaltsleben zurückpfeifen wollte. Aber zu meiner Überraschung grinste Sandy. »Du fehlst mir enorm, weißt du das?«
Ich hörte, wie Hal, der immer noch hinter mir stand, sich umdrehte und ging.
Sandy gönnte ihm einen Blick, bevor er fortfuhr: »Wenn der Staatsanwalt keine Anklage erhebt, wird Karens Familie möglicherweise eine Zivilklage anstrengen – widerrechtlicher Tod oder was weiß ich, was. Ich will also zwei Dinge aus dem Mann herauskriegen heute. Erstens, was war es, worüber seine Frau letztes Jahr deprimiert war, und zweitens, war es dasselbe, worüber sie dieses Jahr deprimiert war? Unabhängig von der Frage, warum der Mann ihr die Kanone hingelegt hat.«
»Du brauchst mich nicht.«
»Wir sind ein gutes Team – ich hätte gern deine Meinung. Ich wüßte gern, was du von dem Kerl hältst. Ob er dir glaubwürdig vorkommt.«
»Soll ich dich mit ihm bekannt machen?« Hal war wieder hinter mir aufgetaucht.
Sandys Kopf schnellte in die Höhe. »Ich wußte nicht, daß du ihn kennst. Hab nur gehört, daß du sie gekannt hast.«
»Ihn auch.«
Ich drehte mich um, gespannt, was Hal noch dazu sagen würde. Er sah zu mir herunter. Das war’s. Keine Silbe mehr. Nicht von Hal.
Kapitel 4
Ted McGuin war in diesem vorwiegend von bleichgesichtigen Hinterwäldlern bevölkerten Landstrich eine ziemlich exotische Erscheinung. Seine Hautfarbe war packpapierbraun, die Haare waren dunkelbraun wie Bitterschokolade, kurz geschnitten und stark gelockt; sein Gesicht war breit, mit mandelförmigen, moosgrünen Augen, und aus seinem getrimmten Schnurrbart spitzten hier und da blonde und rötliche Härchen – man durfte einen buntgemischten Stammbaum vermuten. Sein Gesichtsausdruck war introvertiert, aber von großer Intensität – er erinnerte mich an einen Jazzmusiker, den ich auf einem alten Plattencover gesehen hatte. Er war kräftig gebaut, seine Muskeln hätten einen einschüchtern können, wenn er nicht so klein gewesen wäre, nur ein paar Zentimeter größer als ich. Aber das Auffallendste an ihm war sein breites Lachen, bei dem sich die Haut um die Augen in tausend Fältchen kräuselte. Eine genial beherrschte Gesichtsmuskulatur, mit der er eine täuschend echte Illusion von Aufrichtigkeit und Warmherzigkeit erzeugte.
Ich mußte Sandy sagen, daß er seine Mandanten warnen sollte. Der Mann hatte ein Lächeln, mit dem er eiskalte Geschworene unter Garantie erwärmen würde.
Ich rief mir wieder in Erinnerung, daß dieser Mann seiner suizidgefährdeten Frau eine geladene Kanone vor die Nase gelegt hatte, Tag für Tag, bis sie sich damit das bißchen, was von ihrem Gesicht übrig war, weggepustet hatte.
Wir hatten ihn im Garten hinter seinem kleinen Haus angetroffen, vor einem großen Panoramablick auf die Felsenküste. Er steckte in einem hautengen, schwarzen Neoprenanzug – der Reißverschluß des Oberteils war noch offen – und wollte sich gerade die Preßluftflaschen auf den Rücken wuchten. Zu seinen Füßen spielte ein Kätzchen, das er lächelnd betrachtete, bis es unvermittelt auf seine Hand losging, als er seine Ausrüstung hochheben wollte.
»Du dummes Katzenvieh.« Eine überraschend tiefe Stimme. »Man soll nichts anbeißen, was man nicht aufessen will, weißt du das nicht? Hmmm?« Das Kätzchen ließ seinen Finger nicht aus den Zähnen.
Ich erhaschte Sandys Blick. Sandy grinste. Der Mann sah eindeutig wie ein Frauenmörder aus.
Hal trat auf ihn zu. »Ted.«
McGuin machte verdutzt einen Schritt rückwärts, die Oberschenkelmuskeln zeichneten sich deutlich unter der Neoprenhülle ab. »Autsch!« schrie er und zerrte an dem Kätzchen, das jetzt an seiner ausgestreckten Hand hing.
»Kennst du mich noch?«
»Tag, Hal.« Seine Brauen senkten sich. »Schätze, du hast davon gehört.« Er setzte das Kätzchen ab und sah dann mich und Sandy an.
»Das ist Sander Arkelett. Er ist Privatdetektiv, arbeitet für Karens Familie. Er möchte mit dir über das, was passiert ist, sprechen.«
Ted McGuin seufzte, sein Oberkörper knickte etwas ein. Er zog sich das Oberteil seines Taucheranzugs aus, wendete es und hängte es über die Preßluftflaschen.
Hal fuhr fort: »Und das ist meine ... das ist Laura.«
McGuin verschränkte die nackten Arme vor der Brust und sah mich an. Die Hose des Neoprenanzugs war hauteng, wie eine Skihose geschnitten, und lag glänzend schwarz auf der glatten, braunen Haut.
Sandy sagte: »Ich wäre Ihnen tatsächlich dankbar für ein kleines Gespräch. Karens Familie wüßte gern ein paar Details. Sie wissen ja, wie das ist.«
»Karens Familie«, sagte McGuin freundlich, aber bestimmt, »hat meine Telefonnummer.«
»Sie wissen ja, wie das ist«, wiederholte Sandy.
Eine Welle von Sympathie stieg in mir auf. Es hatte mir immer gefallen, wie Sandy an seine Arbeit heranging: Er verpackte sein Anliegen in eine Wolke von leeren Redensarten und brachte dadurch ein Gespräch in Gang, ohne das geringste preiszugeben. Eine kurze Minute lang sehnte ich mich nach meinem Job zurück, nach dem großen Spiel, in dem man den Hauptgewinn machen oder alles verlieren konnte.
»Allerdings.« McGuins Bariton wurde ein Spur unfreundlicher. »Die wechseln kein Wort mit einem Schwarzen, wenn es sich irgendwie vermeiden läßt. Nicht einmal, wenn es ein Verwandter ist, ein angeheirateter.«
»Tatsächlich?« fragte Sandy erstaunt, vielleicht sogar tatsächlich erstaunt. »Den Eindruck haben sie auf mich gar nicht gemacht.«
Ein Hauch von McGuins famosem Lächeln. »Wie sollten sie auch?«
Hinter dem kleinen Garten, der von Unkraut überwuchert war, fiel das Gelände ab, und man konnte einen Pfad sehen, der in das üppige Gebüsch geschlagen war und zu einer kleinen Bucht zwischen den Felsen hinunterführte. Der Morgentau war schon verdunstet, und es war fast warm. Der Ozean hatte eine trübe Färbung, die Wellen waren hoch, aber ohne Schaumkronen. Der Hillsdaler »Union-Messenger« sprach von einem »mediterranen« Juli – Temperaturen um die zwanzig Grad und ruhige See.
Ich fragte mich, wie es wohl unter Wasser aussah, was McGuin alles zu sehen bekam, wenn er tauchen ging. Vor meinem geistigen Auge erschien eine dunkle Brühe, Plankton und aufgewirbelter Sand, Felsbrocken unter dicken Polstern kleiner violetter Anemonen, wogender Tang. Zweifellos eine Erinnerung an irgendeinen alten Jacques-Cousteau-Film. Ich warf einen Blick auf McGuin und merkte, daß er mich anschaute. Einen Augenblick lang hatte ich das seltsame Gefühl, als ob er mir dieses Bild in den Kopf projiziert hätte, als ob er eine Vorstellung aus seinem Kopf in meinen herübergeschoben hätte.
»Eine phantastische Welt, da drunten«, sagte er. Er zwinkerte mir zu, aber er schien seinerseits ein wenig irritiert. »Also gut, kommt rein. Ich weiß zwar nicht, was Karens Familie wissen will, aber wir können uns meinetwegen unterhalten.«
Er machte eine steife Geste, die uns einladen sollte, ihm zu folgen, und ging voraus. Er hatte einen seltsamen Gang in seinen Neoprenschuhen, die Füße schulterbreit gespreizt – wie der König von Siam sah er aus.
Wir durchquerten den Garten und traten durch die offenstehende Hintertür direkt in die Küche. Sie war aufgeräumt und altmodisch eingerichtet, mit Linoleumboden und Resopalschränken. Ein runder Holztisch mit zerkratzter, aber gewienerter Platte beherrschte den Raum. Hier hatte er jeden morgen die geladene Waffe hingelegt.
McGuin blieb in der Mitte des Raumes stehen. Während er sich die Locken trocknete, starrte er unentwegt den Tisch an.
Ich hörte einen tiefen Seufzer von Hal.
»Wie ist es passiert?« Sandy legte Mitleid in seine Stimme.
»Am Anfang waren es nur gelegentliche Depressionen ...« Er stand reglos da, starrte noch immer den Tisch an. »Dann kamen sie häufiger. Immer öfter und öfter.«
»Und es gab keine Verbindung zu irgendeinem Erlebnis, das Ihre Frau zu der Zeit hatte?« Sandy brachte es fertig, skeptisch zu klingen, ohne dabei den Grundton von Mitgefühl zu verlieren.
»Sind Sie schon mal getaucht?« McGuin hob den Blick zu Sandy, seine Augen glänzten auf einmal.
»Nein.«
»Es ist, als ob man in einem riesigen, brodelnden Suppentopf wäre. Man muß sich darauf einlassen, daß man darin herumhopst, daß das Brodeln einen gehörig durchschüttelt.« Er gab eine kleine Demonstration, indem er mit leicht erhobenen Armen ein paar Schritte nach rechts, ein paar nach links torkelte. »Man muß es mit den eigenen Bewegungen ausgleichen. Wenn man da lang will und ein bißchen nach links geschwappt wird, muß man herumschwenken, aber stückchenweise, immer mit der Bewegung des Wassers mitgehen. Und man darf sich nicht darauf versteifen, genau auf eine besondere Stelle am Felsen zuzusteuern. Wenn man ihn erst mal erwischt hat, ist es kein Problem, sich genau zur Stelle X vorzuhangeln, aber bis dahin muß man sich mit dem Gefühl anfreunden, einfach Teil der Suppe zu sein, man muß lernen, das Spiel zu mögen, in der Suppe herumgewirbelt zu werden.«
Hal faßte die Tischplatte an. Ich spürte einen leichten Ärger und wußte im gleichen Moment, daß es Sandy nicht anders ging. Man muß vorsichtig sein, wenn jemand zu sprechen begonnen hat, daß man seinen Redefluß nicht stört. Einfach Teil der Gesprächssuppe sein.
Nun war McGuin abgelenkt. »Ihr habt gehört, was sie über die Pistole gesagt hat.«
Hal sagte: »Ja.«
Sandy versuchte den Faden wiederaufzunehmen. »Ihre Frau hat sich nicht mit der Strömung treiben lassen?«
»Ich hab versucht, ihr das Tauchen beizubingen, aber, o Mann ... Entweder hat sie mit aller Kraft dagegen angestrampelt, oder sie hat sich überhaupt nicht bewegt und sich einfach davontreiben lassen. Es war gefährlich, mit ihr da runterzugehen.«
Sandy versuchte ihn dazu zu bringen, daß er sein Thema weiter ausspann. Über die Jahre hatten wir die Erfahrung gemacht, daß sich das Herumreiten auf Metaphern oft gar nicht so schnell totlief, wie man erwartet hätte.
Aber Hal kam uns in die Quere: »Warum hast du –«
»Wer sind Sie genau?« McGuin musterte Sandy argwöhnisch, seine großen Augen wurden schmal. »Sind Sie ein Freund der Familie oder was?«
Verflucht. Sandy hätte diesen Augenblick hinausgezögert. Die Frage war unvermeidlich, aber ich hatte Sandy schon so raffiniert agieren sehen, daß sie erst in dem Moment kam, wo er sich wieder verabschieden wollte. Er beherrschte die Eröffnungstricks weit besser als ich. Ich war zu direkt. Wenn ich mich nicht in acht nahm, empfanden Frauen mich sofort als Konkurrenz und Männer als Bedrohung. Sandy hatte eine viel weichere Art, er war umgänglicher.
Auf der anderen Seite war meine Stärke das Kreuzverhör. Mit Sandys trickreicher Vorarbeit war ich im Gerichtssaal unschlagbar.
Mir wurde ganz sentimental zumute – durchaus untypisch für mich, solange ich nicht mindestens vier Wodkas in der Blutbahn habe. Ein halbes Jahr fern von Sandy. Ein halbes Jahr fern vom großen Spiel.
»Können wir uns vielleicht setzen?« Sandy wollte eine entspannte Atmosphäre, so entspannt wie möglich; das Thema, um das es ging, war heikel genug.
McGuin bat uns mit einer Geste, Platz zu nehmen, blieb aber noch einen Moment stehen, ehe er sich auch setzte.
Sandy wartete, bis auch er saß. Dann sagte er: »Die Umstände, unter denen ihr Selbstmord passiert ist ...« Ein freundliches Achselzucken. »Sie werden verstehen, wie das für ihre Familie aussah.«
»Ja, nun, die Dinge sind nicht immer so, wie sie aussehen.«
»Das ist alles«, sagte Sandy, »sie wollen es verstehen.«