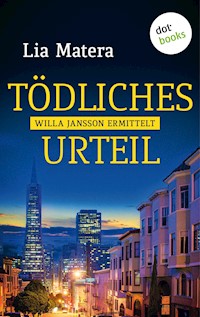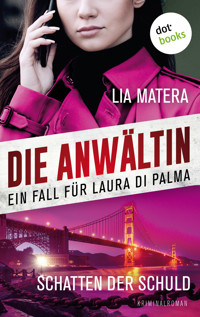Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Willa Jansson
- Sprache: Deutsch
Eine Anwältin im Netz der Intrigen: Der spannungsgeladene Justizthriller »Perfektes Verbrechen« von Lia Matera jetzt als eBook bei dotbooks. Eins hat die junge Anwaltsanwärterin Willa Jansson früh gelernt: in der Welt der Justiz regiert allein die Macht. Gerechtigkeit ist nur ein schönes Wort, mit dem sich die schillernden Kanzleien von San Francisco schmücken, dahinter lauern Abgründe. Als ein großes Wirtschaftsunternehmen ihr ein Angebot macht, ist Willa daher froh über die Chance auf einen Neuanfang – doch wer ist der einflussreiche Politiker Bud Hopper, der sie für den Job empfohlen haben soll? Niemand hat ihn je getroffen, und doch hält er seine schützende Hand über Willa, ermöglicht ihr einen sternstundengleichen Aufstieg in der Firma – und hüllt sich in Schweigen, als Willa verdächtigt wird, ein schlimmes Verbrechen begangen zu haben … »Materas gewohntes Markenzeichen: eine exzellente Handlung, erstklassige Charaktere und ein flottes Tempo.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Perfektes Verbrechen« von Lia Matera ist Band 3 ihrer Krimireihe um die toughe Anwältin Willa Jansson und den besonderen Flair von San Francisco in den 70er und 80er Jahren. Jeder Band kann unabhängig gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eins hat die junge Anwaltsanwärterin Willa Jansson früh gelernt: in der Welt der Justiz regiert allein die Macht. Gerechtigkeit ist nur ein schönes Wort, mit dem sich die schillernden Kanzleien von San Francisco schmücken, dahinter lauern Abgründe. Als ein großes Wirtschaftsunternehmen ihr ein Angebot macht, ist Willa daher froh über die Chance auf einen Neuanfang – doch wer ist der einflussreiche Politiker Bud Hopper, der sie für den Job empfohlen haben soll? Niemand hat ihn je getroffen, und doch hält er seine schützende Hand über Willa, ermöglicht ihr einen sternstundengleichen Aufstieg in der Firma – und hüllt sich in Schweigen, als Willa verdächtigt wird, ein schlimmes Verbrechen begangen zu haben…
»Materas gewohntes Markenzeichen: eine exzellente Handlung, erstklassige Charaktere und ein flottes Tempo.« Booklist
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera in ihrer Reihe um Willa Jansson die Kriminalromane:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
Sowie ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Originaltitel »Mörderische Kanzlei« bei Ballantine Books, USA.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Hidden Agenda« bei Econ.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1988 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by ECON Verlag GmbH, Düsseldorf und München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Andrew Zarivny
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-189-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Perfektes Verbrechen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Perfektes Verbrechen
Der dritte Fall für Willa Jansson
Aus dem Amerikanischen von Nicole Hölsken
dotbooks.
Für Ennio ‒ den besten Bruder der Welt
Kapitel 1
Die ganze Geschichte begann mit einem verdammten Anruf um sieben Uhr morgens. Im Hörer ertönte das typische Summen eines Ferngesprächs.
»Hier Willa Jansson«, knurrte ich.
»Und hier Thomas Spender!« Seine Stimme klang wie: Eins zu eins für mich! »Wir haben uns in Ihrem letzten Studienjahr kennengelernt, im Januar.«
Ich warf meinen nackten Zehen einen grimmigen Blick zu und stieß ein auf dem Bett liegendes Unterhemd beiseite. Wenn er jetzt glaubte, daß ich ein begeistertes »Wie schön!« von mir geben würde, hatte er sich geschnitten. Mein letztes Studienjahr gehörte wohl kaum zu den Phasen meines Lebens, an die ich mich am liebsten erinnerte.
»Inmitten dieser, hmm … Verwicklungen.«
Verwicklungen ‒ das Wort bahnte sich einen Weg durch meine verschlafenen Synapsen. Ich erinnerte mich daran, daß schon damals jemand dieses Wort benutzt hatte, jemand von ‒ »Wailes, Roth ‒«
»‒ Fotheringham and Beck. Ja, genau. Sie erinnern sich also an unser Gespräch!«
Obwohl ich für eine respektable ‒ will sagen radikale ‒ Kanzlei in San Francisco hatte arbeiten wollen, verabredete ich damals auch ein Vorstellungsgespräch bei zwei Leichenbestattern (zumindest sahen sie so aus) einer altehrwürdigen Wall-Street-Kanzlei. Langsam erinnerte ich mich wieder, und Thomas Spender Esq. nahm vor meinem geistigen Auge Gestalt an: ein verknöcherter Republikaner par excellence, dessen kräftige Statur seinen Nadelstreifenanzug zu sprengen drohte.
»Ich will gleich zur Sache kommen, Miss Jansson. Wir, hmm, wir haben gehört, daß die Kanzlei, in der Sie arbeiteten ‒ Sie waren doch bei Julian Warneke, oder nicht?« Seine Stimme klang jetzt ebenso zerstreut wie herablassend. »Nun ja, daß diese Firma jetzt, hmm, gewissermaßen erloschen ist?«
Gewissermaßen erloschen ‒ das logische Resultat aus dem Mord an zwei Partnern und einer Sekretärin. »Die Firma existiert nicht mehr«, bestätigte ich. Jeder, der Zeitung las, wußte Bescheid.
»Der Grund, warum ich das erwähne, ist folgender: Wir haben immer noch Ihre Bewerbungsunterlagen vorliegen. Und wir, hmm, dachten uns, daß Sie vielleicht Interesse hätten, uns einen aktualisierten Lebenslauf zu schicken.«
Ich rückte näher an mein Schlafzimmerfenster heran und zog das Rouleau hoch. Das helle Morgenlicht blendete mich. Als ich mich umsah, entdeckte ich Wäscheberge, Bücher, Zeitungen und Staubflocken: meine Wohnung. Also konnte es kein Traum sein.
»Ich soll Ihnen einen aktualisierten Lebenslauf schicken?« Seit wann hatte die größte und protzigste Kanzlei der ganzen Wall Street es nötig, Lebensläufe anzufordern? Und warum ausgerechnet den meinen? Ich hatte zwar ein ganz passables Examen gemacht, aber Malhousie war keineswegs eine Elite-Universität. Und Wailes, Roth etc. gehörte zu den Kanzleien, vor denen Studenten aus Stanford und Yale im Staub zu kriechen pflegten, nachdem sie als Assistenten am Obersten Gerichtshof gedient hatten.
»Ich will Ihnen sagen, warum wir ausgerechnet an Sie gedacht haben, Miss Jansson. Trotz der Publicity um diese Warneke ‒ hmm ‒«. Wahrscheinlich wollte er nicht schon wieder von Verwicklungen sprechen. »Eine unglückliche Geschichte, natürlich, aber ‒ sagen Sie, kennen Sie Bud Hopper?«
»Nein.«
»Ein ziemlich hohes Tier.« Der Manhattan-Akzent war jetzt beinahe verschwunden. »Gehört im Innenministerium wohl zu den einflußreicheren Persönlichkeiten. Genießt das Vertrauen des Präsidenten, der ihm angeblich oft sein Ohr leiht.«
»Ach, deshalb das Hörgerät?«
Eine kleine Pause. »Oh, ja. Haha. Wie auch immer. Bud hat ein paar Freunde bei der INS ‒ der Behörde für Immigration und Einbürgerung ‒«
»Ich weiß, wofür dieses Kürzel steht.«
»Natürlich, entschuldigen Sie!« Er sprach mit herablassender Herzlichkeit. »Wie ich höre, haben Sie einen hervorragenden kleinen Artikel über alternative Pläne zur Einwanderungsbeschränkung verfaßt.«
»Sprechen Sie von meinem Artikel aus Studienzeiten?« In dem ganz bestimmt nicht von »Plänen« die Rede gewesen war. Nicht ein einziges Mal.
»Bud sagt, daß einer der erfahrenen Berater des Weißen Hauses einen Blick drauf geworfen hat. Und er sagt sogar« ‒ beglückwünschte er mich in herablassendem Ton ‒, »daß die Leute des Präsidenten den einen oder anderen Gedanken aus dem Artikel aufgegriffen haben, als sie dem Kongreß die Sache mit der begrenzten Amnestie vorschlugen.«
Ich hätte beinahe laut aufgestöhnt. Der jüngste republikanische Vorschlag gestattete es Firmenbossen, ihre bereits anwesenden, billigen Gastarbeiter weiterhin auszubeuten, während sie zukünftigen Einwanderern die Tür vor der Nase zuschlugen. »Ich bin sicher, Sie haben Ihren Freund mißverstanden ‒«
»Nun, nun. Keine falsche Bescheidenheit! Ich hatte noch keine Gelegenheit, selbst einen Blick hineinzuwerfen, aber Bud Hopper hält den Artikel offenkundig für eine hervorragende studentische Leistung.« Und dann fügte er fröhlich hinzu: »Gut genug jedenfalls für die Reagan-Administration!«
Fast hätte ich mich neben das Bett gesetzt. Noch vor kurzem hatte ich mich nach einem Cop verzehrt. Wenn meine Eltern erfuhren, daß ich jetzt auch noch einen Beitrag zur republikanischen Politik geleistet hatte, würden sie nur noch in Sack und Asche herumlaufen.
»Und«, fuhr er fort, »einige meiner Partner waren ziemlich beeindruckt, als ich den Artikel erwähnte und vorschlug, Sie heute morgen anzurufen und um einen aktualisierten Lebenslauf zu bitten.«
»Ich danke Ihnen, Mr. Spender. Aber ich glaube nicht, daß ich nach New York ziehen möchte.«
»Nein, nein, Miss Jansson. Die neue Kraft brauchen wir in unserem Büro in San Francisco.«
»Ich wußte gar nicht, daß Sie hier ebenfalls eine Zweigstelle unterhalten.«
»Kürzlich gegründet. Gegenwärtig noch ziemlich klein ‒ im Grunde erst einmal nur eine Erweiterung unseres Büros in Los Angeles. Zwei Partner und vier Anwälte, aber wir haben vor, so schnell wie möglich weiter zu expandieren. Und natürlich wären wir bereit, Sie einzugliedern.«
»Mich einzugliedern?«
»Ihnen Ihre beiden Jahre bei Warneke anzurechnen.«
»In welchem Sinn?«
»Gehalt und Dienstrang«, sagte er in nachsichtigem Ton. »Ich glaube, unsere Leute bekommen im dritten Jahr etwa neunzigtausend. Im vierten Jahr geht es dann steil bergauf und immer so weiter, bis man im siebten Jahr Partner wird, wenn man Partner wird. Partner sind natürlich in einer ganz anderen Gehaltsklasse.«
Neunzigtausend Dollar! Und steil bergauf! Warneke, Karrey, Liberman & Flish, die Kanzlei meiner linken Träume, hatte mir fünfundzwanzigtausendfünfhundert bezahlt, bevor sie gewissermaßen erlosch.
»Ich werde Ihnen den Namen einer Kontaktperson in unserer Kanzlei in San Francisco nennen«, fuhr Spender in dem gleichen nachsichtigen Ton fort. »Falls Sie sich dazu entschließen können, rufen Sie uns an.«
Und mit dem atemlosen Gehorsam einer Nancy Reagan hauchte ich ins Telefon: »Ich hole mir nur schnell einen Stift!«
Kapitel 2
»Mutter«, sagte ich vorsichtig, während ich beobachtete, wie sie die Kurbel eines Vervielfältigungsapparates drehte, den selbst ein Gutenberg gemieden hätte. »Ich glaube, heutzutage sollten Frauen endlich ihre rechtmäßige Position im männlich dominierten Machtgefüge einnehmen. Findest du nicht auch?«
Ihre mit Krampfadern durchzogenen Beine bewegten sich rhythmisch vor und zurück, während sie die schmutzigen Kopien ihres jüngsten Traktats herauszog. Sie hörte gar nicht richtig zu, in unserer Familie gelten liberale Empfindungen als Frequenzstörung.
Ich versuchte es weiter. »Besonders, weil ‒« ‒ ja, warum? ‒ »Immerhin stehen die Wahlen vor der Tür.«
Mutter hörte auf zu kurbeln und nahm die oberste Kopie von dem Stapel herunter. Ihre Finger waren rot beschmiert, mit geschürzten Lippen sah sie den Stapel durch. Wie gewöhnlich war alles vollkommen zerknittert. Die Flugblätter kündigten die Gründung einer weiteren Medienallianz ‒ der People’s Media Alliance ‒ an.
»Deshalb habe ich einen neuen Job angenommen«, schloß ich etwas unbestimmt.
»›Macht Euch die Medien zunutze!‹« las meine Mutter laut. Wenn die Hippies ihr zwanzigjähriges Jubiläum feierten, würde meine ergraute Mutter immer noch an vorderster Front kämpfen.
»Ich habe einen neuen Job in einer Kanzlei, Mutter.«
Sie blinzelte. »Eine neue Firma? Legal Aid? Charles Garry?«
»Nicht so ganz.« Wie sollte ich ihr nur beibringen, daß ich in Zukunft Banken und Konzerne statt Einwanderer und Gewerkschaften vertreten würde? »Aber ich habe den Job wegen meines Artikels über die Immigration bekommen.«
Die blauen Augen meiner Mutter leuchteten vor Stolz. »Das Agricultural Labor Relations Board! Aber das ist ja wunderbar, Schatz!«
»Also, nein. Was ich eben über Frauen sagte, die ihren Platz in der Machtelite einnehmen müssen…« Ich sah mich in der spärlich möblierten und mit Kissen übersäten Wohnung um. Von jeder Wand blickten Poster auf mich herab, die mich aufforderten, den Hungrigen Brot zu geben und aus der Lektion, die Vietnam uns erteilt hatte, zu lernen. Ich seufzte. »Die Kanzlei nennt sich Wailes, Roth, Fotheringham and Beck.«
Mutter war irritiert: Alles jüdisch-protestantische Namen, keine renommierten Farbigen. Ob ich sie davon überzeugen konnte, daß Wailes ein afrikanischer Stammesname war? »Und welches Recht ‒?«
»Die Kanzlei vertritt ausschließlich Klienten aus dem Establishment, Mutter.« Ich sah, wie ihr die Kinnlade herunterfiel, und fuhr eilig fort. »Aber die Sache ist doch die. Seit über fünfzig Jahren ist dieser Bereich eine Bastion der alten Herren, und ich denke, es ist Zeit, daß auch Frauen anfangen…«
Viel Geld zu verdienen, schloß ich im stillen.
Mutter legte ihr Flugblatt beiseite und richtete sich kerzengerade auf. Wenn sie sich an ihr Yoga erinnerte, bedeutete das unweigerlich Ärger. »Hat er dir diese Flausen in den Kopf gesetzt?«
Er hatte seit zwei Monaten nicht auf meine Anrufe reagiert. Seitdem man ihm wegen seines Verhaltens in einem Mordfall ‒ dem Mord an meinem früheren Boß, Julian Warneke ‒ eine mündliche Rüge erteilt hatte. Für mich jedoch hatte sich sein Fehlverhalten als Segen erwiesen: Lieutenant Don Surgelato vom Morddezernat in San Francisco hatte einen unbewaffneten Mordverdächtigen erschossen. Wenn der »Verdächtige« (sprich: der Mörder) überlebt hätte, so wäre die Verbindung meiner Mutter zu einer Untergrundorganisation ans Licht gekommen. Sie hätte im Gefängnis landen können.
Nicht, daß Mutter etwas dagegen gehabt hätte, ins Gefängnis zu wandern. Das tat sie einfach hin und wieder, um die Beziehung zu ihren Schützlingen zu intensivieren.
Ich war diejenige, der es nicht gefiel, wenn sie hinter schwedischen Gardinen saß, und meine Dankbarkeit dem Lieutenant gegenüber (die ich nie hatte zum Ausdruck bringen können, weil er, wie gesagt, meine Anrufe nicht entgegennahm) grenzte beinahe an unerwiderte Liebe.
Die Gesetzesmaschinerie San Franciscos reagierte allerdings völlig anders. Angeführt von meinem früheren Strafrechtsprofessor forderte sie energisch die Suspendierung des Lieutenants vom Dienst.
Und meine Mutter, verdammt soll sie sein, hatte höchst persönlich zwei »Suspendiert Surgelato«-Kundgebungen auf den Stufen der Hall of Justice organisiert.
»Er hat wahrscheinlich noch nie etwas von Wailes, Roth etc. gehört, Mutter!« Ich unterdrückte den Impuls, sie anzuschreien ‒ das letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte, war eine ihrer schrecklichen Vorträge über das Familien-Chakra.
»Ich bin es nur einfach leid ‒«
»Was? Meine moralischen Prinzipien?« Zorn rötete ihre Wangen.
»Die schlechte Bezahlung! Legal Aid, ACLU und Ag Board, die bezahlen noch nicht mal genug, daß man sich von dem Geld in einer Stadt wie San Francisco eine Busfahrkarte leisten könnte! Ich bin es leid, dermaßen unterbezahlt zu sein! Und ich bin es leid, dauernd erzählt zu bekommen, wie glücklich ich mich preisen kann, weil es Hunderte von Linken gibt, die sich nach diesem Job die Finger lecken würden!«
»Geld!« Es hörte sich an, als hätte sie »Rattengift!« gesagt. »Willa June, im Leben geht es um erheblich Wichtigeres als um ‒ du mußt deinen Mitmenschen helfen! Glaubst du denn nicht ‒«
»Du meine Güte, die Welt wird schon nicht untergehen, wenn ich diesen Job annehme!« Ich kramte noch einmal mein einziges ideologisches Argument hervor: »Wir Frauen müssen endlich anfangen, das männlich dominierte Machtsystem zu unterwandern, Mutter!«
Einen Augenblick lang schien meine Mutter zu schwanken ‒ immerhin hatte sie die Angewohnheit, die meisten meiner Verhaltensweisen zu billigen.
Unglücklicherweise jedoch war es nur allzu durchschaubar, wie sehr ich mir in die eigene Tasche log. Meine Mutter mochte ja vielleicht ein weiches Herz haben, keineswegs aber eine weiche Birne.
»Oh Wiiiilla!« stöhnte sie. »Du hast dich verkauft! Ich hätte niemals geglaubt, daß ausgerechnet dir so etwas passieren würde!«
Und dann bekreuzigte sie sich und betete leise für meine abtrünnige, schwarze Seele.
Kapitel 3
William K. Mott sah mit seinem stämmigen Körper, dem schwarzen, streng zurückgekämmten Haar und dem langen Gesicht voller Sorgenfalten aus wie ein Leichenbestatter. Er trug einen nachtblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine bordeauxrote Fliege. Sorgfältig entfaltete er eine Halbbrille aus Horn, während er auf meinen Lebenslauf hinabblinzelte.
»Malhousie«, murmelte er mit leichter Verachtung in der Stimme. Bloß Malhousie ‒ dieses Attribut wurde in Verbindung mit meiner alten Universität häufig benutzt ‒ stand auf der Liste der »besseren« Universitäten an letzter Stelle. Es kam gleich nach Minnesota. Ganz gut, aber keineswegs zur Elite gehörend. Nicht Stanford, Harvard oder Yale ‒ aber auch nicht Temple, Memphis State oder People’s College.
Für neunzigtausend im Jahr konnte ich mich sogar mit der Schmähung meiner Alma Mater abfinden. »Ich war unter den ersten fünf meines Jahrgangs. Und ich habe ein paar Semester in Stanford studiert.« Und dann, weil Mott immer noch unbeeindruckt dreinblickte: »Außerdem habe ich eine Weile als Chefherausgeberin einer juristischen Fachzeitschrift gearbeitet.« Plötzlich plagten mich Schuldgefühle. Früher hatte ich mich über den glühenden Ehrgeiz jener, die sich um diesen Job rissen, nur lustig gemacht. Ich selbst hatte ihn nur durch eine Verkettung von Zufällen bekommen.
Mit der Halbbrille auf der Nase widmete sich Mott weiterhin meinem Lebenslauf. Nervös blickte ich mich in seinem Büro um. Es war ganz in Grau, Dunkelblau und Pflaume gehalten. An den Wänden hingen abstrakte Landschaftsbilder in passenden Farben. Hinter Mott prangte eine gerahmte Fotografie von Gerald Ford, die eine Bildunterschrift wie »Was, ich und Sorgen?« hätte tragen können. Auf seinem Schreibtisch lagen ein ordentlicher Stapel Akten und eine geöffnete Aktentasche. Die grauen, ledernen Bürostühle hatten wahrscheinlich mehr gekostet als die gesamte Einrichtung des Fünfraumbüros meines alten Chefs. Hinter Mott gaben zimmerhohe Fenster den Blick auf das farbige Treiben des Finanzdistrikts frei. Ganz im Hintergrund erhob sich ‒ durch Scheinwerfer in strahlendes Licht getaucht ‒ der Coit Tower. In meinem alten Büro hatte ich Ausblick auf ein paar Garagen gehabt.
Schließlich resümierte Mott: »Die ersten fünf, Chefherausgeberin, mm-hm, mm-hm. Und natürlich der Artikel, den Bud Hopper erwähnte. Sagen Sie, welche Art von Arbeit haben Sie für Mr. Warneke verrichtet?«
»Prozeßabwicklung.« Ich war froh, mich auf das konzentrieren zu können, was ich getan hatte ‒ nicht, für wen ich es getan hatte. »Vornehmlich die Bearbeitung von Anträgen, aber auch von eidesstattlichen Erklärungen, Anhörungen des Verwaltungsausschusses, Vertragsverhandlungen ‒«
»Prozeßerfahrung?«
»Ein Geschworenenprozeß«, gab ich zögernd zu. Er hätte den Klagegrund nicht gutgeheißen. Und außerdem hatte ich verloren.
»Als Assistentin von Mr. Warneke?«
»Nein.« Ich konnte spüren, wie ich immer tiefer in das Leder sank. »Es war kurz nach seinem, hmm… Tod.«
»Ah ja.« Er warf erneut einen grimmigen Blick auf meinen Lebenslauf, während er die Knöpfe seines futuristischen Telefons bearbeitete. Einen Augenblick später kam eine geklonte Lauren Hutton ins Büro. »Jaclyn, ich denke, Robert wird Miss Jansson als nächster sehen wollen.« Mott schob den Stuhl zurück und verschränkte seine Finger auf dem Schreibtisch. Als ich mich zum Gehen erhob, erklärte er mir: »Ich halte mir dieses Büro nur für gelegentliche Spritztouren in den Norden. Mein Erstsitz ist unsere Kanzlei in Los Angeles. Robert LeVoq« ‒ ein schwaches Lächeln ‒ »ist in dieser Filiale der Seniorpartner.« Und dann fügte er grimmig hinzu: »Ich bin der geschäftsführende Partner!«
Der Blick, den er und Jaclyn miteinander tauschten, schien geradezu Funken zu sprühen.
Kapitel 4
Robert LeVoq sprach gerade in seine Gegensprechanlage ‒ die Füße auf dem Tisch, einen Block voller geometrischer Kritzeleien vor sich. Er war etwa Mitte Dreißig, also in meinem Alter. Das braune, locker gefönte Haar und das pockennarbige Gesicht, das an ein Streifenhörnchen erinnerte, vermittelten den Eindruck jungenhaften Charmes. Er trug einen gewagten hellen Anzug, gemusterte Socken in den gleichen Tönen und eine große, sportliche Uhr. In seinen dicht beieinander stehenden Augen glomm ein durchtriebener Funke.
»Marty, Marty! Aber nein!« bellte er die Gegensprechanlage an. Er winkte mich in das Büro, warf zunächst einen Blick auf meine Brüste, dann auf meine Beine, dann auf mein Haar und nickte schließlich wohlwollend: eine süße kleine Blondine. (Wenn er mich einstellte, würde er bald merken, daß er sich getäuscht hatte.) »Wir können diese Sache jederzeit weiterverfolgen!«
Eine jüdisch klingende Stimme mit New Yorker Akzent knackte aus dem Lautsprecher zurück: »Aber Bobby, welchen verdammten Unterschied soll das denn noch machen? Wenn du es jetzt erledigen kannst, wirst du es auch im nächsten Monat können! Wenn du es jetzt erledigen kannst!«
»Wenn!« ›Bobby‹ lachte, ein rollendes Glucksen, das wie einstudiert klang. »Sag deinem Klienten, daß er den Maserati genießen soll, solange er ihn sich noch leisten kann, Kumpel! Und vergiß die Verlängerung!« LeVoq blinzelte mir zu, als ich mich ihm gegenüber setzte. »Du mußt es mal so sehen, Marty ‒ deiner Frau wird es in Italien sicher besser gefallen, wenn sie alleine fährt!« Er drückte auf einen Knopf und beendete damit das Gespräch. »Wir machen schließlich auch keine Ferien, nicht wahr?«
Keine Ferien? Ich hoffte, daß er Witze machte. »Ich bin Willa Jansson. Mr. Mott hat mich geschickt.«
Er schüttelte mir die Hand, hielt sie einen Augenblick zu lang fest und warf erneut einen Blick auf meine Brüste. »BobLeVoq! Setzen Sie sich. Jackie«, sagte er zu der geklonten Lauren Hutton, »warte ein Minütchen!«
Während LeVoq die auf seinem Schreibtisch verstreuten Aktenordner zu einem Stapel aufschichtete, sah ich mich um. Das Büro war fast genauso groß wie das von Mott. Es war in Creme, Schwarz und Rot gehalten, wobei abstrakte Skulpturen weiblicher Torsos mit breiten Hüften einen besonderen Akzent setzten. Auch von hier aus konnte man den Coit Tower sehen.
LeVoq reichte Jaclyn den Aktenstapel. »Sei so nett und gib die an Melinda weiter! Und sag ihr, daß wir bei der Transport-Trust-Geschichte noch lange nicht in Verzug sind.«
Jaclyn nahm den Stapel. Ein leichtes Stirnrunzeln zeigte sich auf ihrem ebenmäßigen Gesicht. LeVoq gluckste erneut vor sich hin. Als Jaclyn sich zum Gehen wandte, beugte er sich über seinen Schreibtisch und streckte den Arm aus, als ob er ihr den Hintern tätscheln wollte. Im letzten Augenblick schnippte er statt dessen eine zerknüllte Papierkugel vom Tisch. Und lachte.
»Sooooo.« Seine Stimme nahm einen geschäftsmäßigen Ton an. »Erzählen Sie mir von Ihrem letzten Fall.«
Verdammt. »Ich habe einen Jungen verteidigt, der den Wehrdienst verweigert hat.«
Auf LeVoqs pausbäckigem Gesicht spiegelte sich weder Billigung noch Mißbilligung. Statt dessen schien er ganz wild darauf zu sein, mit mir über den Fall zu diskutieren. »Worauf baute Ihre Verteidigungsstrategie auf?«
»Ob eine Wehrdienstverweigerung durch moralische Einwände gerechtfertigt wird ‒«
»Gesetzlich gerechtfertigt? Das Gesetz sieht eindeutig vor, daß männliche Personen im Alter von achtzehn Jahren den Wehrdienst beginnen müssen! Punkt!« Seine Stimme dröhnte, seine Hand fuhr durch die Luft: Jetzt lief er eindeutig zu seiner Anwalts-Hochform auf. »Wer seinen Wehrdienst verweigert, verletzt eindeutig das Gesetz!«
»Das Gesetz sieht individuelle Gewissensentscheidungen nicht vor, das stimmt ‒ aber die Geschworenen tun es, zumindest manchmal.«
LeVoq lachte. Er genoß diese Diskussion eindeutig mehr als ich. »Sie wollen also sagen, die rechtlichen Fakten standen gegen Sie? Aber Sie haben trotzdem weitergemacht?« Er beugte sich vor, wobei er die Arme auf einem Stapel Akten kreuzte. »Wissen Sie, Willa, ich sage meinen Leuten immer: Zur Hölle mit dem rechtlichen Sachverhalt! Wenn die Fakten gegen dich sprechen, zieh das Gesetz in Zweifel. Wenn das Gesetz gegen dich spricht, zieh die Fakten in Zweifel! Wer hat den Vorsitz geführt?«
»Richter Rondi.« Ich versuchte, ein Schaudern zu unterdrücken.
LeVoq gluckste. Scheinbar hatte auch er schon einmal mit dem alten Faschisten zu tun gehabt. »Oh, gut. Es sollte eigentlich keine Rolle spielen, wer die Verhandlung führt! Was wichtig ist ‒« Er blickte über meine Schulter, ein verschlagenes, fast geringschätziges Glitzern in den Augen. »Melinda! Darf ich dir Willa vorstellen!«
Ich drehte mich um. Eine große Frau in einem schwarzblauen Kostüm stand an LeVoqs Bürotür. Ihr braunes Haar war zu einem schulterlangen Bubikopf geschnitten, und sie trug ‒ wie ich ‒ kein Make-up. Sie schien eine intelligente, humorvolle Frau zu sein. Um ihren Mund ‒ mit beträchtlichem Überbiß ‒ zeigten sich jede Menge Lachfältchen. Aber im Augenblick zog sie ihre Augenbrauen zusammen, und ihr Kiefer arbeitete. »Hast du irgend etwas wegen Transport Trust unternommen?«
»Komm heute abend wieder. Dann überlegen wir uns was«, antwortete er munter.
Melinda wog den schweren Aktenstapel in ihrer Hand. »Ein sechzigseitiges Beweispapier, ein Antrag auf Einsicht derjenigen Unterlagen, mit deren Hilfe man Transport hochgehen lassen könnte, und nur ein Tag, um den Antrag abzulehnen.«
Mit der anderen Hand schlug sie auf die Akten. »Ich bitte dich seit Monaten, mir diesen Fall zu übergeben! Was hast du eigentlich davon, das Ganze in einen Papierkrieg zu verwandeln? Ich dachte, du wolltest Marty anrufen und ihn darauf ansetzen.«
»Er hat mich gerade um Verlängerung gebeten.« Wieder trat dieser verschlagene Ausdruck in LeVoqs Blick. »Ich dachte mir, zur Hölle, wenn er nicht fertig ist ‒! Dann sind wir doch im Vorteil! Wir werden die Sache schon rechtzeitig schaukeln, keine Sorge!«
»Wir? Was machst du denn heute abend, Bob?«
Er lächelte liebenswürdig. »Du kannst mich zu Hause erreichen, wenn du irgendwelche Fragen hast.«
Unattraktive rote Flecken bildeten sich auf ihrem Gesicht. Ihr Mund bewegte sich lautlos. Wenn ich ihre Lippen richtig las, erteilte sie sich selbst einen ‒ angesichts der Situation völlig berechtigten ‒ Tadel.
»Komm schon, sag Willa guten Tag!« schlug LeVoq gutgelaunt vor. Wenn er ihren stummen Fluch mitbekommen hatte, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken.
Die Frau blickte zu mir hinüber. »Ein Vorstellungsgespräch?«
»Ja.«
»Nun, ich hoffe inständig, daß sie Sie einstellen!« explo dierte sie. »Wir brauchen wirklich dringend neue Leute!«
Kapitel 5
»Sie« entpuppten sich als zwei komplette Etagen in einem Hochhaus in Los Angeles ‒ hundert Anwälte und ihre Mitarbeiter ‒ die im allgemeinen nur als das »kalifornische Büro« bezeichnet wurden.
Während des Studiums hatten meine Kommilitonen immer über ganztägige Vorstellungsgespräche außerhalb der Stadt gestöhnt. Dabei beschlich mich regelmäßig ein Gefühl selbstgefälliger Überlegenheit: Ich hatte vom ersten Tage an gewußt, daß ich für Julian Warneke arbeiten würde. Julian hatte meine Eltern verteidigt, als sie in einen Militärstützpunkt eingedrungen waren, um die Raketenspitzen der Cruise Missiles mit einem Vorschlaghammer zu zerstören, und als sie den Haupteingang zu Dow Chemical besetzt hatten, um gegen deren Produktion von Napalm zu protestieren, und als sie das Unterlassungsurteil für Streikposten von Firmen mißachtet hatten, denen sie noch nicht einmal angehörten. Julian hatte meine Eltern so häufig verteidigt ‒ oder besser gesagt: in ihrem Namen eine politische Show abgezogen ‒, daß er so etwas wie ein Onkel ehrenhalber für mich wurde.
Während meines Studiums hatte ich mitbekommen, wie Studenten kratzige Anzüge oder Kostüme anlegten und über ihren Lebensläufen brüteten, und immer hatte ich Erleichterung und sogar (wie ich zugeben muß) leichte Verachtung für sie empfunden. Und jetzt war ich an der Reihe, den ganzen Tag zu lächeln wie bei einem Schönheitswettbewerb, mich den hochmütigen Fragen meiner Gesprächspartner zu stellen, die nur dazu dienten, mich als Dummchen zu entlarven (wie es sämtliche Fragen über die Artikel 7 und 9 des Uniform Commercial Code getan hätten), mich erklären zu lassen, warum ich erst im fortgeschrittenen Alter von dreiunddreißig meinen Abschluß gemacht hatte (ohne die Jahre zu erwähnen, die ich in Mokassins und mit Blumen im Haar umhergezogen war) und vor allem mich die Speichelleckerin spielen zu lassen, nur damit ich ans große Geld kam.
Ich hatte das Gefühl, mich langsam als Republikanerin zu entpuppen.
Am Ende des Tages wurde ich in einen Club eingeladen, der wie die Imitation eines römischen Tempels aussah und sich L.A. Athletic nannte. Begleitet wurde ich von vier Männern und einer Frau. Zwei der Männer sahen wie Bob LeVoq aus, nein, eigentlich sahen sie den Anwälten aus den Vorabendserien sogar noch ähnlicher als ihm. Sie protzten damit, daß sich in ihrer Anwaltslounge zwei Skilanglaufmaschinen befanden (Parris, Black im Stockwerk darunter hatten nur eine). Die beiden älteren Partner sahen etwas bodenständiger aus. Einer von ihnen, ein Mann mittleren Alters in roter Weste, erzählte mir von der Kanzlei in San Francisco, während die anderen voller Enthusiasmus über die Weinkarte diskutierten.
»Die Mehrheit der Fälle, die wir in San Francisco behandeln, stammen von der California Bank and Trust. Wir stellen ihnen im Jahr zirka ‒ hmm ‒ anderthalb oder zwei Millionen in Rechnung. Die Bank beklagt sich natürlich immer, aber sie wissen, daß wir es wert sind.« Er warf Milward Wie-auch-immer, dem ältesten Partner am Tisch, einen Blick zu.
Milward nippte an seinem Wasser (mit Eis und einem Limonenstück) und lächelte hölzern.
Die Frau, die links von mir saß, war locker in ungefähr hundert Quadratmeter Rohseide gehüllt (meinem Eindruck nach würde die wollverarbeitende Industrie pleite gehen, wenn sie sich auf Frauen aus L.A. verließ) und leckte etwas Salz von ihrem Margaritaglas ab. »Wie ich gehört habe, hat CBT einen besonders wichtigen Fall gerade Millet, Wray and Weissei übertragen.«
Jonathan Rotweste sah verärgert aus. »Wir befassen uns ja auch nicht mit all ihren Fällen ‒ aber wir bekommen die meisten. Crosby hat mir gestern einen Fall übertragen, bei dem es um einen Inkassobescheid über mehrere Millionen Dollar geht. Man kann also mit Fug und Recht annehmen«
‒ seine Stimme nahm einen sarkastischen Ton an ‒, »daß die Bank mit Bobs Arbeit zufrieden ist!«
Die Frau studierte ihre Karte. »Hannah ist ganz bestimmt zufrieden mit Bobs … ›Arbeit‹.«
Einer der Lounge-Skifahrer kicherte.
Jonathan wog sein Buttermesser in der Hand, als ob er gegen die Versuchung ankämpfte, es ihr entgegenzuschleudern. »Bob ist ein Regenmacher! So jemanden brauchen wir einfach in unserer Kanzlei!« Er warf mir einen Blick zu. »Wir möchten, daß unsere Mitarbeiter in San Francisco sich auf den Kundenservice konzentrieren! Man erwartet von Ihnen, daß Sie unsere Kunden aktiv hofieren
‒ Sie wissen schon, individuelle Verhandlungsvorbereitung, Klientenseminare, Geschäftsessen, solche Dinge.«
»Oh, natürlich«, stimmte ich begeistert zu und fand die Idee abscheulich. Dann hatte ich, weil alle mich weiter ansahen, das Gefühl, stärkeres Interesse heucheln zu müssen. »Ist Mr. LeVoq eigentlich der einzige Partner in der Zweigstelle in San Francisco?«
Einen Augenblick lang gab niemand eine Antwort. Die in Seide gehüllte Frau starrte Milward mit unverhohlener Neugier ins Gesicht.
Und Milward, scheinbar der Stammesälteste, antwortete: »Außer Bill Mott? Im Augenblick noch ‒ ja!« Er sah sich am Tisch um, sein Blick duldete keinen Widerspruch. Die Skiläufer und die Frau tauschten vielsagende Blicke. Ruhig wandte sich Mil ward wieder der Speisekarte zu.
Jonathan nickte zufrieden und fuhr fort: »Wir haben hier in S.F. einige gute Leute. Bob kommt von Boalt, Melinda von Georgetown, Aasgar ist hier aus der Gegend ‒ University College Los Angeles, und dann noch die beiden neuen Leute.«
»Harvard und Columbia«, fügte die Frau hinzu.
Ohne mich anzusehen, fragte Milward: »Und wo kommen Sie her?«
»Malhousie.« Und in Windeseile fügte ich hinzu: »Unter den ersten fünf. Studiensemester in Stanford.«
Kapitel 6
Der Job brachte mir ein vierzig Quadratmeter großes Büro, vier Lederstühle, zwei Eichenschreibtische, einige Topfpflanzen und einen piekfeinen Sekretär namens Andrew McNee ein. McNee war ein muskulöser Mann von etwa fünfundfünfzig Jahren mit Bürstenschnitt, einem gestutzten Schnurrbart und einem gereizten Gesichtsausdruck. Ohne anzuklopfen betrat er mein taupe- und pfirsichfarbenes Büro und ertappte mich dabei, wie ich liebevoll meinen Ledersitz tätschelte.
»Willkommen bei Wailes, Roth etc., Miss Jansson.«
»Nennen Sie mich doch Willa.«
»Ich ziehe es vor, Mr. McNee genannt zu werden.«
Ich nahm an, daß er auch etwas dagegen hatte, unter mir zu arbeiten. »Gut.«
»Ich sollte vielleicht erwähnen, daß ich schwul bin«, fügte er mit mürrischer Würde hinzu.
Da ich nicht die Absicht hatte, mich in ihn zu verlieben, nahm ich die Neuigkeiten gefaßt entgegen. »Gut«, sagte ich wieder.
»Ich will bei meinen Kollegen nicht den Eindruck erwecken, daß ich es zu verbergen suche.« In seinem Tweedanzug, seiner einfachen wollenen Weste und den Straßenschuhen sah er wie ein reicher Landedelmann aus. Tatsächlich war er viel zu gut gekleidet, um als heterosexuell durchzugehen: So gut kleiden sich Männer für Frauen gemeinhin nie.
»Oh, hmm, danke. Wissen Sie vielleicht ‒ ob es hier irgendwo eine Kaffeemaschine gibt?« Nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit war es eine Qual gewesen, um sieben Uhr in der Frühe aufzustehen. Wenn ich nicht bald meinen Kaffee bekam, würde ich schlichtweg vom Stuhl auf den Boden gleiten und einschlafen.
McNee deutete auf mein Telefon, das dem Cockpit eines Spaceshuttles glich. »Klingeln Sie Rhonda an. Sie wird Ihnen jedes Getränk oder Nahrungsmittel bringen, das Sie wünschen.«
Rhonda war McNees Sekretärin. McNee erledigte, wie es den Anschein hatte, sämtlichen Schriftverkehr, und Rhonda war für die Kopien und die Ablage zuständig. (Wahrscheinlich nannte sie McNee »Sir«.)
Ich fragte mich, was Mutter davon halten würde, daß mir eine Sekretärin Kaffee holte. Mutter achtete sehr auf die Würde der Angestellten. In Restaurants versuchte sie sich immer selbst zu bedienen. »Ich kann mir meinen Kaffee selbst holen, wenn ‒«
»Klingeln Sie Rhonda an«, wiederholte McNee und beendete so das Gespräch.
Eine Kanzlei mit Zimmerservice. Nun, damit konnte ich leben.