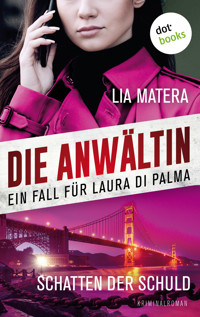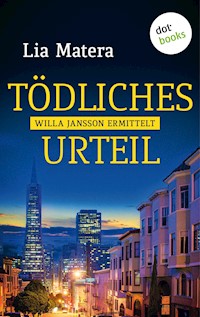
4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Willa Jansson
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine Frau kämpft für Gerechtigkeit: Der fesselnde Kriminalroman »Tödliches Urteil« von Lia Matera jetzt als eBook bei dotbooks. Die junge Anwaltsanwärterin Willa Jansson kennt nur ein Ziel: Ihr Examen mit Bestnoten bestehen und direkt in eine der Top-Kanzleien San Franciscos einsteigen. Ihre Arbeit für ein juristisches Fachmagazin soll ihr dafür den Weg ebnen – doch all das gerät plötzlich ins Wanken, als die Redaktionsleiterin ermordet aufgefunden wird: Susan Green, die stets perfekt auftrat, nur Spitzenergebnisse lieferte … genau wie Willa. Wer kann so eine grausame Tat begangen haben? Sensationsreporter, undurchsichtige Professoren, die schillerndsten Anwälte der Stadt – wie Aasgeier drehen sie ihre Kreise um den Fall und scheinen alle eine eigene Agenda zu haben. Dann geschieht ein weiterer Mord – und wieder ist Willa ihm gefährlich nahe … »Lia Matera sollte niemand verpassen – eine der besten zeitgenössischen Krimiautorinnen.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Justizthriller »Tödliches Urteil« von Lia Matera ist der Auftakt ihrer spannungsgeladenen Reihe um die Anwältin Willa Jansson und den besonderen Flair San Franciscos in den 70er und 80er Jahren. Jeder Band kann unabhängig gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die junge Anwaltsanwärterin Willa Jansson kennt nur ein Ziel: Ihr Examen mit Bestnoten bestehen und direkt in eine der Top-Kanzleien San Franciscos einsteigen. Ihre Arbeit für ein juristisches Fachmagazin soll ihr dafür den Weg ebnen – doch all das gerät plötzlich ins Wanken, als die Redaktionsleiterin ermordet aufgefunden wird: Susan Green, die stets perfekt auftrat, nur Spitzenergebnisse lieferte … genau wie Willa. Wer kann so eine grausame Tat begangen haben? Sensationsreporter, undurchsichtige Professoren, die schillerndsten Anwälte der Stadt – wie Aasgeier drehen sie ihre Kreise um den Fall und scheinen alle eine eigene Agenda zu haben. Dann geschieht ein weiterer Mord – und wieder ist Willa ihm gefährlich nahe …
»Lia Matera sollte niemand verpassen – eine der besten zeitgenössischen Krimiautorinnen.« Booklist
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera in ihrer Reihe um Willa Jansson die Kriminalromane:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
Sowie ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1987 unter dem Originaltitel »Where lawyers fear to tread«
Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Studentenfutter« im Rotbuch Verlag
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1987 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 Rotbuch Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/F11photo, OlegRi
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-187-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tödliches Urteil« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Tödliches Urteil
Der erste Fall für Willa Jansson
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Dietze
dotbooks.
Kapitel Eins
Juristische Fakultäten haben keine Football Teams. Sie haben Fachzeitschriften. Fachzeitschriften sehen zwar wie überdimensionale Taschenbücher aus, aber sie sind Kampf-Arenen. Rechtswissenschaftler rempeln sich gegenseitig in höflichen Fußnoten an, und Studenten intrigieren und liebedienern für Redakteursposten. So stillt sich der Blutdurst von Rechtsprofessoren. Rah. Rah.
Rechtszeitschriften werden von Studenten des Rechts gemacht. Nachdem sie drei Jahre um Noten, Jobs und sogar um Süßigkeiten aus dem Automaten konkurriert haben (nichts geht über einen Marsriegel nach vier Uhr), würden Jurastudenten buchstäblich alles tun, wenn das bedeutet, daß jemand anderes es nicht fertigbringt. ›Unter den besten zehn Prozent eines Studienjahrgangs plus Mitarbeit an der Rechtszeitschrift‹, das ist die magische Formel. Jedenfalls wenn man nicht in Puyallup im Staate Washington oder in Lawton, Oklahoma, landen will, sondern einen Job in einer Kanzlei einer großen Stadt mit einem ordentlichen Gehalt oder eine Anstellung in einer Regierungsbehörde oder einer ehrenwerten Vereinigung wie der American Civil Liberties Union erlangen will. Dafür sollte man unter den besten zehn Prozent sein und an der Rechtszeitschrift mitgearbeitet haben. Und wenn man nicht von Harvard, Yale oder Stanford kommt, muß man wenigstens Chefredakteur gewesen sein.
Ich war für eine Weile Chefredakteurin einer Uni-Rechtszeitschrift, obwohl es nicht mein persönliches Verdienst war. Ich bin nur auf den Sessel einer unendlich besser qualifizierten Frau namens Susan Green nachgerückt.
Hiermit teile ich mit, was ich über Susan Green, ehemalige Chefredakteurin der Malhousie Law Review, weiß: Susan Green wurde 1960 als Tochter von Dr. Sidney und Mrs. Greta Green geboren, im selben Jahr, als ich, Willa Jansson, die Grundschule begann. Während ich mit Räucherstäbchen spielte und in einer der ersten alternativen Schulen San Franziskos angeleitet wurde, mein Mantra zu werfen, lernte Susan Green, Superbaby, das Alphabet von pädagogischen Schaukärtchen, die ihr eine überqualifizierte Kinderschwester zeigte. Als ich meinen ersten Job als Tellerwäscherin in einem vegetarischen Restaurant bekam, gab Susan Green schon Klavierkonzerte und nahm Ballettunterricht. Während ich an der High School Antikriegsdemonstrationen organisierte und mich weigerte, die amerikanische Flagge zu grüßen, benutzte Susan Green ihr eidetisches Gedächtnis dazu, patriotische Gedichte auswendig zu lernen. Als meine Eltern sich dem Peace Corps anschlossen, brachen Mr. und Mrs. Green zu ihrer Ruhestandskreuzfahrt auf und schickten Susan nach Washington D.C. in ein elegantes Internat. Somit waren Susan Green und ich zum ersten Mal in unserem Leben in derselben Stadt, nämlich als ich damals dorthin trampte, um mit weiteren fünfzehntausend Demonstranten vor dem Weißen Haus zu kampieren.
In den nächsten vier Jahren hielten wir uns nicht mehr am selben Ort auf, bis wir beide an der Stanford Universität landeten. Ich nach ein paar Jahren mittellosen Herumzigeunerns (was meine Noten in der Zulassungsprüfung nicht beeinträchtigte) und sie nach einem Prädikatsabschluß an einer der härtesten Eliteschulen im Land. Nicht nur, daß wir zeitgleich in derselben Universität gelandet waren, unsere Eltern stießen ebenfalls am Universitäts-Aufnahmetag aufeinander. Mein Vater sah zwar nach zwei Jahren Diarrhö in Liberia abgezehrt und krank aus, aber meine Mutter war wie stets rosig und birnenförmig und trug schwer an zwanzig Pfund afrikanischem Schmuck. Susans Eltern sahen aus wie fürs Fernsehen zurechtgemacht und dufteten schwach nach dem Leder ihres neuen Jaguars. Wir trafen an einem Picknicktisch auf der Terrasse vor der Cafeteria zusammen. Am Nebentisch diskutierten zwei Studentinnen ihre Vergewaltigungen, und Mrs. Green erblaßte und flüsterte meiner Mutter zu, sie hoffe sehr, die würden damit aufhören.
»Ich bin selbst vergewaltigt worden«, sagte meine Mutter mit ihrer schrillen und weittragenden Stimme. »Zweimal. Und es ist eine gute Therapie, darüber zu reden.«
Es folgte eine schockierende Stille. Mrs. Green raffte ihren Pelzkragen zusammen und rutschte näher zu ihrem schmallippigen Ehemann. Wie immer hatte meine Mutter kein Gefühl dafür, wenn sie jemanden in Verlegenheit gebracht hatte, dafür entdeckte sie den Kragen gemordeten Tierlebens um den Hals von Mrs. Green. Ich wußte, was jetzt kommen würde. Ich hatte nämlich heute morgen schon den Spruch: ›Liebe die Tiere ‒ iß sie nicht und bekleide dich nicht mit ihren Fellen!‹ gehört, als ich mir einen Cheeseburger bestellte.
Als meine Mutter mit »Liebe die Tiere …« ansetzte, tat ich Mrs. Green einen Gefallen und warf schnell ein: »… denn sie sind köstlich.«
Mein Vater lachte, aber niemand lachte mit. Die Greens knabberten hastig noch ein wenig am Salat und flohen die Szene. Susan Green und ich hatten in dem Jahr ein gemeinsames Seminar, und ich schrieb sie als wandelnde Strategie von ›wie komme ich zu einem beeindruckenden Lebenslauf‹ ab, ein Amalgam von langweiligen Fertigkeiten in einer untadeligen Eliteschulmuschel. Sie war ein Mädchen, das im Hörsaal eine Perlenkette trug und zwei Dollar für eine pH-neutrale Seife ausgab, damit ihre Wangen genauso leuchteten wie die ihrer Verbindungsschwestern. (Ihr Verbindungsmotto war: ›Lerne von den Erfolgreichen und inspiriere die vom Glück Verlassenen.‹ Glücklicherweise ist Inspiration ein preiswertes Gut.)
Ich kam trotzdem nicht umhin, Susans Verstand zu bewundern. Sie behielt alles mit Hilfe eines fotografischen Gedächtnisses. Und sie sprach in druckfertigen Absätzen: Einleitung, Ausführung und Zusammenfassung. Sie hatte viel Detailwissen und wenig Durchblick, ich dagegen habe ein schlampiges Gehirn, das sich in romantischen Assoziationen verliert und sich weigert, auswendig zu lernen.
Im Laufe der Jahre besuchten Susan und ich gemeinsam noch ein paar Kurse mehr, und ich hatte nie so gute Noten wie sie, beeindruckte meine Professoren nie, und handelte mir einen Haufen Ärger ein mit ein paar Artikeln, die ich in der Studentenzeitung schrieb. (Ich hatte den Stifter der Universität Leland Stanford einen blutsaugerischen Piraten genannt und dabei gelernt, daß eine solche Behauptung nicht unwidersprochen hingenommen wurde.)
Das Schicksal hatte also Susan Green und mich zusammen in das Jurastudium, die Rechtszeitschrift und in die Redaktionsleitung derselben gebracht.
Aber eines hatten wir nicht gemeinsam. Am selben Tag, als ich mich mit Larry Tchielowicz über den Krieg in Vietnam stritt, zerschmetterte irgend jemand Susans Kopf, gerade als sie sich über ein Manuskript beugte.
Kapitel Zwei
»Schau dir doch an, was die Kommunisten mit Vietnam angestellt haben ‒ ein Jammer, daß ihr Radikalen keine Ruhe gegeben habt und Nixon den Krieg gewinnen ließt.«
Ein halbes Dutzend weiterer Redakteure im Büro der Zeitschrift füllten sich schläfrig die Tassen mit schalem Kaffee aus dem Thermosbehälter nach. Sie ließen Tchielowicz die Vietnamsottisen mit müder Ungläubigkeit durchgehen. Bis zu den Prüfungen waren es noch vier Wochen; ich war wieder mal die einzige, die man zum Führen alter Kriege anstacheln konnte.
»Du hättest auch demonstriert, wenn die Regierung vorgehabt hätte, deinen Arsch in irgendwelchen fremden Ländern aufs Spiel zu setzen.« Tchielowicz war fünf oder sechs Jahre jünger als ich und in den Jahren von Spaltung der Nation, Tod und Entlaubung noch ein Kind gewesen.
»Keine Republikaner in die Schützengräben?« Tchielowicz’ dünne Lippen ‒ der einzige dünne Teil an dem muskelbepackten Mann mit dem mächtigen Schädel ‒ verzogen sich zu einem Lächeln. »Die Armee zahlt mein Studium. Das wollte ich euch nur noch mal gesagt haben. Und die Armee hat auch das College bezahlt. Ich habe die Grundausbildung hinter mir und schulde ihnen sechs Jahre nach der Zulassungsprüfung zum Anwalt.« Er kratzte sich an seiner kleinen, krummen Nase. »Wie ihr also seht, habe ich bereits eingewilligt, daß die Regierung mit meinem Arsch machen kann, was sie will.«
Ich beglückte Tchielowicz mit meiner offenherzigen Meinung über dieses Arrangement.
Susan Green trommelte auf die Glaswand des inneren Büros, um mich zum Schweigen zu bringen. Sie hatte die Univerwaltung davon überzeugt, ein paar verglaste Sperrholzwände einzuziehen zwischen unserem Arbeitsbereich und der studentischen Ruhe- und Arbeitszone mit durchgesessenen Plastikcouchen und fleckigen Kaffeeautomaten. Die Trennwände gewährten eine gewisse Illusion von Abgeschlossenheit, konnten aber den Lärm der Gespräche auf der anderen Seite nicht dämpfen, da sie wegen dicker Rohre und Klimakästen nicht bis zur Decke reichten.
Allerdings waren es auch sechzehn Leute, die sich mit Fahnenkorrektur, Leute-Verunglimpfen und konstantem Herumnörgeln befaßten, eben jenen Tätigkeiten, die man gemeinhin Redaktionsarbeit nennt, und wir taten es alle im äußeren Büro. Insofern war Susans inneres Heiligtum alles andere als ruhig, auch nicht zur günstigsten Zeit. Aber ich respektierte Susans Bitte um mehr Ruhe und kam weitaus leiser und freundlicher als geplant zu dem Schluß, daß Tchielowicz die Hure einer kryptofaschistischen Kriegsmaschine war.
Bevor Tchielowicz mir antworten konnte, schneite Jake Whittsen rein und verstrubbelte mein Haar. Ich habe keine Ahnung, warum die Leute kleine blonde Frauen wie junge Hunde behandeln. »Gehst du zur Rede von Jane Day?« Sogar die Stimme von Jake war umwerfend, bestimmt eine Oktave tiefer als die von anderen Männern und so ruhig, daß alles wie Bettgeflüster klang, egal, was er sagte.
Jane Day war eine dieser verdammten republikanischen Feministinnen. Weg mit den Frauen von Heim und Herd und rein in den Mercedes, um sie zu Arbeitsessen wie ›Ladies gegen Drogenmißbrauch‹ zu chauffieren. (»Sehr verehrte Frau Präsidentin, ich erlaube mir, das Glas auf die vollständige Abschaffung des Drogenkonsums zu erheben.«)
Sie gehörte zu jeder nur denkbaren juristischen Standesvereinigung, und es war schon ein wenig gespenstisch, wo man überall in Fachzeitschriften auf ihren Namen stieß. Sie war im Moment auf der Ochsentour, um zu versuchen, die Nominierung ihrer Partei für das Amt des Generalstaatsanwalts des Staates Kalifornien zu erreichen. Die juristische Fakultät, die auch ihre frühere Alma Mater gewesen ist, gab ihr diesen Nachmittag einen Empfang. Die Herausgeber der Rechtszeitschrift waren eingeladen; der Rest der studentischen Körperschaft wurde nicht für würdig befunden, mit unseren herausragenden Professoren das Brot zu brechen.
Ich war sehr versucht, das Angebot von Jake anzunehmen ‒ es war schließlich eine Chance, an seiner Seite zu sitzen und von seinem Cologne betäubt zu werden (höchstwahrscheinlich ausgesucht von seiner hinreißend geistvollen Gattin, aber was soll’s).
Als Tchielowicz aber damit anfing, daß Jane Fonda höchstwahrscheinlich viel zu beschäftigt gewesen sei, ihre Brustmuskulatur zu stärken, als sich darüber Sorgen zu machen, daß die Vietnamesen nun von den Sozialisten statt von den Kapitalisten geschlachtet wurden, brachte ich es nicht mehr über mich, den Tumult zu verlassen. Ich lehnte Jakes Einladung ab.
Ein paar Studenten schlürften den Kaffeesatz aus und zogen mit quietschenden Nikes in die Vorlesung ›Finanz- und Aktienrecht‹ und diskutierten dabei in tiefem Ernst die jeweiligen Vorzüge von Squash und Raquettball. Professor Haas, ein Professor für Vergleichende Rechtswissenschaften, mit einem lispelnden schwedischen Akzent und einem scheuen, aber zauberhaften Lächeln, kam rein, um sich die neue Nummer der Zeitschrift zu holen, die druckfrisch in großen Stapeln neben Susans Schreibtisch lag. Professor Miles, die so lange Treuhand- und Erbrecht gelehrt hatte, bis sie mumifiziert war, stelzte ebenfalls herein, um sich eine Nummer zu schnappen. Ich konnte durch die Sperrholzwand hören, wie sie Susan ankreischte, daß wir ihre akademischen Titel auf der Kopfzeile vor ihrem Artikel über anonymisierte Treuhandfonds nicht vollständig aufgezählt hätten. Und das war auch das letzte, was ich jemals wieder irgendeinen zu Susan Green sagen hörte.
Ich brach zu meiner Bundeseinkommenssteuer-Vorlesung auf. Eigentlich hatte ich keine Lust, aber in mir keimte der Verdacht, daß Larry Tchielowicz fand, ich sei hinreißend, wenn ich wütend bin.
Und während mein Steuerprofessor lüstern über seine Lieblings-Steueroasen diskutierte, stand jemand hinter Susan Green, hob eine Waffe und ließ sie zweimal auf ihren Hinterkopf krachen.
Kapitel Drei
John Hancock Henderson, ein entfernter Abkömmling dieses Kerls mit der riesigen verschlungenen Unterschrift unter der Unabhängigkeitserklärung, schwebte über meinem Schreibtisch. »Das Impressum ist ein eindeutiges Muster aufsteigender Rangfolge«, stieß er hervor, als stritten wir uns schon seit Ewigkeiten darüber.
»Wie die Jakobs-Leiter?«
»Es geht so: Chefredakteur in der ersten Zeile, in der nächsten dann Chef vom Dienst auf der linken Seite und Verantwortlicher Redakteur auf der rechten.«
»Also sitze ich zur rechten Hand Gottes.«
»Nein! Also doch, ja, es soll nur klarmachen, daß der Chef vom Dienst in der Hierarchie nach dem Chefredakteur der wichtigste ist.«
»Ich hoffe, du kannst das in deinem Lebenslauf gut zur Geltung bringen.«
Henderson sah ausgesprochen verdrossen aus, selbst für seine Verhältnisse. Er war mittelgroß, wurde jedes Jahr stämmiger und bekam um die Examenszeit Pickel. Er hatte ein großflächiges Gesicht mit weit auseinandergezogenen Gesichtszügen (Mary West nannte ihn Mr. Kartoffelkopf). »Ich weiß, daß du jetzt denkst, ich hätte einen schlechten Geschmack. Aber diese Rechtszeitschrift existiert seit achtundachtzig Jahren, und wir sind verpflichtet, sie angemessen fortzuführen! Es gibt keine Entschuldigung dafür, die Standards aufzugeben …«, in seiner Stimme schwang todernster Schrecken, »… also müssen wir festlegen, wer das Sagen hat.«
»Niemand muß das Sagen haben. Ich redigiere die Artikel auf Stil und Aussage, und du machst weiterhin die abschließende Herstellung, den Abgabetermin machen wir dann untereinander aus. Als einzige verbleibende exekutive Entscheidung hat Susan die Artikel für die Sommernummer auszuwählen. Die anderen drei Nummern sind entweder schon beim Drucker oder fertig zum Abschicken.«
Was ich nicht sagte, war, daß es eine Massenrevolte von Redakteuren gäbe, wenn John Henderson anfangen würde, die Peitsche zu schwingen. Susan hatte die Hälfte ihrer Arbeitszeit damit zugebracht, die John untergeordneten Hersteller zu besänftigen und von einer Meuterei abzuhalten. Er war ein guter Hersteller ‒ er konnte einen Wortabstandsfehler in einer Fußnote aus einer Entfernung von hundert Metern erkennen ‒, aber das war schon alles, was ihn einem menschlichen Wesen ähnlich machte.
Jedenfalls wurde die Unterhaltung langsam aberwitzig.
»Herr im Himmel, Henderson, kannst du nicht einen anderen Gegenstand für deine Obsessionen finden? Ich muß diesen Artikel noch zu Ende lesen und dann in die Treuhandrecht-Vorlesung.«
Mary West kam rein und sah aus wie dem Artikel »Warum Leder mich heiß macht« aus »Die Wahrheit über den Sex« entsprungen.
Mary hatte taillenlanges schwarzes Haar und eine Figur, die ihr bleiches dreieckiges Gesicht als irgendwie fehl am Platze erscheinen ließ. Sie hatte die Angewohnheit, die Finger hinter dem Nacken zu verflechten, um einen Busen zur Schau zu stellen, der keine Fanfaren benötigt hätte. Sie gab außerdem gern mehr Geld aus, als sie hatte, wie die engen Lederhosen und die hochhackigen italienischen Schuhe bewiesen, und legte scharenweise Erstsemester flach, die es noch nicht besser wußten.
Man muß ihr jedoch zugute halten, daß sie kein Blatt vor den Mund nahm: »Wichst du schon wieder überm Impressum, Henderson?«
Er lief rosa an wie ein geöltes Schweinchen und verließ das innere Büro mit der Drohung: »Das werde ich mit unserem Vertrauensprofessor diskutieren, vielen Dank.«
Mary schlenderte zu Susans Schreibtisch, den die Polizei von allen Habseligkeiten freigeräumt und den ich saubergescheuert hatte. (John hatte dem Hausmeister diese Aufgabe dermaßen kalt und herrisch befohlen, daß ich mich verpflichtet fühlte, es selbst zu tun.)
»Gott, wer will schon Baumwollunterhöschen bumsen? Sauber, weiß und praktisch«, das war Marys Einschätzung von Susan gewesen.
Ich habe einen sehr langen blonden Pony. Wenn ich mein Kinn auf die Brust senke, kann ich die graue Strähne, die sich auf der rechten Seite entwickelt, genauerer Prüfung unterziehen. Das tat ich in diesem Moment.
»Du nimmst doch nicht etwa an, daß John Susan umgebracht hat, damit er Mr. Große Fußnote sein kann?« Sie lächelte ihr ›Hab-ich-alles-schon-erlebt‹ Lächeln. »Was soll der Scheiß, daß er zur Fakultät geht? Die werden ihn doch nicht etwa zum großen Boß machen?«
Ich schüttelte den Kopf. John und ich hatten viel mit der Fakultät zu tun. Ich hatte die Gespreiztheit der Amtsträger schnell erkannt und mich um sie herumgearbeitet. John war ihnen mit der gleichen Gespreiztheit begegnet, was sie für respektlos zu halten schienen. Wenn die Fakultät einen Ersatz für Susan suchte, würde es nicht John sein.
»Verdammt soll er sein«, brauste ich auf, »wenn ich wegen ihm Chefredakteurin werde, bring ich ihn um!«
Mary hob das in die Höhe, was von ihren sorgfältig gezupften und gepinselten Augenbrauen übrig war.
Kapitel Vier
Ich rannte die Stufen zu den hinteren Rängen des Hörsaales hinauf und schlüpfte auf den Sitz neben Harold Scharr. Harold ist einer dieser schlanken europäisch aussehenden Typen mit schmalem aufmerksamem Gesicht, schwarzseidenen Haaren und einem Ausdruck in den Augen, der auf eine böse Zunge schließen läßt. Er drehte sich um und blitzte mich mit seinen weißen Zähnen an.
Professor Miles rief uns mit den Worten: »Verkauf von Treuhand-Vermögenswerten« zur Ordnung. Sie nahm ihre charakteristische Stellung ein: breitbeinig, in schwarzen Pumps, die Hüfte vorgestreckt, die knochigen Arme in die Seite gestemmt. Ihr Blick glitt durch die Reihen. Ich hatte das Gefühl, daß sie mich ins Visier nahm.
»Ms. Willa Jansson«, sie sprach meinen Namen trocken aus. »Palvers v. Executor.«
Ich öffnete meine Fallsammlung und stellte sie aufrecht auf den Tisch, als wollte ich darauf Bezug nehmen. In Wirklichkeit blätterte ich durch die vorfabrizierten Fall-Spickzettel, die die meisten Rechtsstudenten benutzten.
Ich las die fettgedruckte Fallerklärung laut vor: »Dem Anwalt der Nachkommen des Treuhänders ist es untersagt, auf Auktionen zu bieten, die Vermögenswerte des Trustes betreffen, um sich seine Kosten zu erstatten.« Beinahe hätte ich auch noch die nächste Zeile vorgelesen, die aber leider nicht den in Frage stehenden Fall betraf.
»Kosten, die bei der Treuhandvermögensverwaltung anfallen, natürlich.« Eine halbgare Antwort.
Ich überflog die Kladde noch mal, doch das war alles, was über den Fall drinstand, aber ich wußte, daß da noch was sein mußte. Also riet ich ins Blaue. »Die Ehrenordnung der Anwaltskammer dieses Staates verbietet Anwälten, Gebote für gerichtliche oder andere Zwangsversteigerungskäufe des Besitzes ihrer Klienten zu machen, unabhängig davon, ob ihre eigenen Verwaltungskosten schon bezahlt sind oder nicht. Andernfalls könnten Rechtsanwälte die Prozeßkosten in der Hoffnung in die Höhe treiben, das Eigentum ihrer Klienten in Notverkäufen zu erwerben.« »Was ist denn falsch an ein bißchen unternehmerischer Initiative«, murmelte mir Harold ins Ohr.
Mir war damals nicht klar, daß dieses abstrakt-ethische Problem einer der verblüffendsten Aspekte von Susan Greens Ermordung sein würde.
Nach der Vorlesung wäre ich für eine Tasse Kaffee gestorben. Seit ich mit dem Rauchen aufgehört hatte, war das Zeug wie Muttermilch für mich. Harold und ich drängelten uns zur Cafeteria. (Wir waren eintausendfünfhundert Leute und fühlten uns wie Sardinen in diesem innerstädtischen Gebäude. In den Malhousie-Prospekten nannte man das »Intime College Atmosphäre«.) Wir spekulierten gerade über Professor Miles’ offensichtliches Mißbehagen an meiner korrekten Antwort, als Dekan Sorenson, ein gertenschlanker und federleichter Zweimeterriese, seine Katzenkrallen-Finger in meinen Arm schlug und über den Lärm hinwegbrüllte. »Ms. Jansson, kann ich Sie einen Moment sprechen?«
Harold schmolz dahin wie Schnee auf einem frischen Scheißhaufen.
»Ich habe schon mit John Henderson gesprochen.« Zur Ehre des Dekans muß gesagt werden, daß er darüber nicht allzu glücklich schien. »Ich möchte gern wissen, wie die anderen Redakteure der Rechtszeitschrift über die Neuernennung eines Chefredakteurs denken.«
Ein eiliger Student schubste mich an den Dekan, wobei er fast einen ganzen Korridor voll Leute in eine fallende Dominoreihe verwandelt hätte. »Zu spät zum Vertragsrecht«, rief er über die Schulter zurück. Erstsemester sind pathologisch pünktlich.
Ich schrie zum Dekan rüber: »Ich glaube nicht, daß wir zum derzeitigen Zeitpunkt die Position besetzen müssen.«
Dekan Sorensons ausgemergeltes Gesicht schien sich noch weiter in die Länge zu ziehen, als er seine schwarzen Augenbrauen hob. Er versuchte, sich einen trauernden Gesichtsausdruck zu geben, wirkte aber völlig unseriös dabei: »Susan war eine der großartigsten jungen Frauen, denen ich die Ehre hatte zu begegnen.«
»Das finde ich auch.« Mir war es ziemlich zuwider, den Gang mit einem Gespräch darüber zu blockieren, wie großartig Susan Green gewesen war, aber der Dekan machte keine Anstalten, sich von der Stelle zu bewegen.
»Man hat mir gesagt, daß Sie und die anderen Studenten mit den Detectives von der Mordkommission gesprochen haben.« »Das stimmt.« Ich hoffte, daß mein Gesichtsausdruck nichts von der Verachtung verriet, die mir die Mordkommissions-Cops mit ihrer durchsichtig trickreichen Fragerei eingeflößt hatten.
»Ähem, Ihnen ist nichts aufgefallen?«
Ich schüttelte den Kopf.
Er runzelte die Stirn und schob seine Unterlippe vor (Harold Scharr konnte das wunderbar nachmachen). Langsam fühlte ich mich wie ein Schmetterling, der auf eine Tafel gespießt worden ist ‒ ohne eine schnelle Infusion von Koffein würde ich auf der Stelle tot umfallen.
»Also, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, Mr. Henderson scheint der Auffassung zu sein, daß man einen neuen Chefredakteur bestimmen solle. Ich möchte das nicht per Anordnung regeln. Was halten Sie davon, wenn die Redakteure sich selbst einen neuen Chef wählen? Klingt das nicht einleuchtend?«
Was sollte ich dazu sagen? Im Büro fand ich eine wahlfähige Versammlung von Redakteuren beim Mittagessen vor. John Henderson saß mit dem Rücken zu mir. Er hatte eine Nummer der Zeitschrift auf der Impressumseite geöffnet und deklamierte: »Ich glaube, damit ist alles klar.«
Die höflicheren Redakteure unterdrückten ein Kichern.
Ich war viel zu übel gelaunt, um taktvoll zu sein. »Herrgottnochmal, Henderson. Es ist eine einzige Zeile in deinem Lebenslauf. Gibt es irgendeine Erniedrigung, die du nicht für ein paar tausend Dollar mehr im Jahr auf dich nehmen würdest?«
John wirbelte herum, um mich direkt anzugehen. Tchielowicz dröhnte aus der Ecke: »Chef vom Dienst ist die Position Nummer zwei in der Hierarchie. Willa sollte Chefredakteurin sein, wenn es denn jemand sein muß.«
»Halt bloß den Rand, Tchielowicz.« Ich drängelte mich an John vorbei, fand meine Tasse und füllte sie mit der Plörre aus der Kaffeemaschine. »Der Dekan hat gesagt, daß wir eine gottverdammte Wahl abhalten sollen.«
Henderson erbleichte tatsächlich. »Ich habe ihm gesagt, daß ich an zweiter Position stehe.«
»Du und Richard der Zweite.« Mary West saß auf Jake Whittsens Schoß. Mary saß niemals auf einem Stuhl, so lange ein männlicher Schoß zur Hand war. Keinem fiel es noch auf. »Machen wir’s uns leicht. Ich nominiere Willa.«
Tchielowicz sekundierte, und ich sagte gerade: »Ich möchte da nicht reingedrängt werden« ‒ als eine Abstimmung per Zuruf exakt das besiegelte.
»Du Armleuchter!« beschwerte ich mich in Richtung des aufgebrachten Henderson: »Bist du jetzt zufrieden?«
Er schoß aus dem Büro und schmiß ein Heft auf den Boden. Tchielowicz begann zu summen: »For He’s a jolly good fellow«, aber ich riet ihm, damit aufzuhören, bevor er mit seinem Jaulen einen weiblichen Elch angelockt hätte.
»Das Impressum bleibt, wie es ist. Ihr könnt mich meinetwegen nennen, wie ihr wollt …« Aus dem Publikum kamen Gejohle und ein paar Vorschläge.
Mary fragte: »Werde ich jetzt Chefin vom Dienst?«
»Ein Versuch kostet nichts.« Wir hatten Mary bei der Truppe, weil sie quietschkomisch war, aber es hat nie eine faulere Redakteurin gegeben.
Ich betrachtete ›meinen Stab‹ über den Rand meiner Kaffeetasse. Susan hatte die überarbeitete Gruppe dazu gebracht, für sie zu schuften, weil sie ihren Intellekt respektiert und ihre Fähigkeiten anerkannt hatten, obwohl sie sie nicht besonders gemocht hatten. Ich wußte, daß meine Mitredakteure mich mochten, aber ich war nicht sicher, ob sie mich respektierten, und ich war nicht sicher, ob sie meinen Anordnungen folgen würden. Ich sandte Stoßgebete nach droben, daß ich es nicht würde herausfinden müssen.
Kapitel Fünf
Ich verbrachte den Nachmittag mit der Durchsicht unverlangt eingesandter Manuskripte, um welche herauszufischen, die für die Jahresendnummer geeignet waren. Ich hatte eine große Auswahl, weil jeder junge Rechtsdozent des Landes im Jahr drei oder vier Artikel zusammenschusterte, in der Hoffnung, eine Festanstellung zu ergattern. Das Zufallsprinzip sollte eigentlich garantieren, daß ein paar davon publizierbar waren, aber ich vermutete, daß alle guten Rechtsartikel bei der Harvard Law Review landeten. Jedenfalls schafften sie es nicht bis zu meinem Schreibtisch. An diesem besonderen Nachmittag hatte ich einen Haufen Artikel mit Eröffnungssätzen wie diesem: »Nirgendwo tritt die krasse gerichtliche Dichotomisierung aussichtsloser zutage als in der Konzeptualisierung von Festnahmeszenarios ohne Haftbefehl in Berufungsgerichtsmodellen.«
Die Artikel von praktizierenden Anwälten waren sogar noch schlimmer. Rechtsanwälte lieben redundante Wortpaarungen, (einstellen und aufgeben, fällig und bezahlbar bis, Testament und letzter Wille) und sie wissen nicht, wie man Gesetzbücher benutzt (dafür sind ja ihre Rechtshelfer zuständig). D.h. wenn man ihre Artikel lektoriert, bedeutet das, sie vollständig neu zu schreiben. Und wenn man bis morgens um vier aufbleibt, um einen Artikel durchzuarbeiten mit dem Titel: »Paragraph 10 (b) 5 und seine Anwendung auf Wechsel und anonym erworbene Vorzugsaktien in Eigentümergesellschaften«, dann ist das ein Alptraum, das können Sie mir glauben.
Also saß ich mit hängenden Schultern im inneren Bürotrakt an einem der sechs Schreibtische der leitenden Redakteure und stopfte Ablehnungsbriefe in Briefumschläge.
Sehr bald wurde mir die Anwesenheit eines Fremden hinter meinem Rücken bewußt. Genaugenommen wurde mir klar, daß eine Unterhaltung mit einem einleitenden Schweigen begonnen hatte. Ich drehte mich um und sah einen schlaksigen jungen Mann zögernd an der Bürotür stehen.
»Mir wurde gesagt, daß ich den Chefredakteur hier finden kann?« Er war kein Jurastudent. Das sah ich gleich. Er war falsch angezogen, in verknitterten Köperhosen, mit einem fadenscheinigen Kordjackett und schiefsitzender Krawatte. Das war die Arbeitskleidung eines lockeren Berufes.
»Sie sind Reporter«, riet ich.
Sein entschuldigender Gesichtsausdruck ‒ lange Nase, breitgezogener Mund und eng zusammenstehende Augen ‒ wandelte sich in Überraschung. Er wischte seine rechte Hand an der Hüfte ab und streckte sie mir entgegen. »Manuel Boyd, San Francisco Express.« Ein gutes Klatschblatt, das man als Freiexemplar in Eingangshallen von Avantgardetheatern und in Gesundheitsläden mitnehmen konnte.
Ich schüttelte ihm die Hand. »Willa Jansson.«
Pause. »Ich recherchiere für einen Artikel über, ähem … Susan Green?« Er sprach den Namen aus, als fürchte er, ich hätte nie von ihr gehört.
»Setzen Sie sich.« Ich deutete auf einen der leeren Stühle. Es arbeiteten nicht mehr sehr viele Redakteure im inneren Büro.
Er setzte sich linkisch hin, wie ein Storch, der seine Beine nicht sortiert kriegt. »Könnten Sie mir vielleicht ein bißchen von ihr erzählen, wie sie war, wie sie gelebt hat?«
»Sie war ungeheuer klug und sehr konventionell. Und sie schrieb gut.« Ich schob ihm die letzte Nummer rüber. »Sie hat einen Artikel hier drin.«
Er schickte einen freundlich neugierigen Blick in meine Richtung: »Haben Sie einen Verdacht, wer sie umgebracht haben könnte?«
Ich war amüsiert: »Natürlich nicht.«
Pause. »Könnten Sie mir zeigen, wo sie gesessen hat? Und was sie in dem bewußten Augenblick getan hat?«
Ich rollte meinen Bürostuhl zu Susans Schreibtisch. »Sie las gerade ein unverlangt eingesandtes Manuskript.«
»Von wem?«
Ich starrte auf Susans Schreibtischplatte, die noch blind von dem Reinigungsmittel war. Ja, was, zum Teufel, hatte sie denn gelesen? Das Manuskript war völlig blutgetränkt gewesen, und die Polizei hatte es mitgenommen. Ich stand auf und ging zum Aktenschrank. Ich nahm eine Akte aus der ersten Schublade. Sie mußte eigentlich die Begleitbriefe von allen Artikeln enthalten, die in dieser Woche eingesandt worden waren. Wir trennten die Briefe immer von den Artikeln, um sicherzugehen, daß wir die Rücksendeadressen nicht verschlampten, wenn wir die Artikel in Umlauf gaben.
Die Manuskripte selbst waren nach Themen geordnet. Wir unterhielten eine Art Reptilienfonds von unpublizierter Forschung als Ideen-Pool für ›qualifizierte‹ (die besten zehn Prozent) Studenten, die daran interessiert waren, Artikel in der Zeitschrift zu veröffentlichen. Natürlich durften die Studenten nicht plagiieren, aber die abgelehnten Manuskripte wurden sehr selten anderswo publiziert, und es schien uns eine Verschwendung von guter (oder oft weniger guter) Forschung, wenn wir den Studenten nicht erlauben würden, die Fußnoten für brauchbare Einzelideen zu durchkämmen.
Die Manuskripte, die in der Woche von Susans Ermordung eingetroffen waren, mußten irgendwo im Aktenschrank sein ‒ außer denjenigen, die die Polizei mitgenommen hatte.
Neugierig sortierte ich Begleitbriefe und Manuskripte zusammen. Der Reporter gab keinen Laut von sich. Ich begann, mich wie ein Tier in der Wildnis zu fühlen, das von einem nervösen Naturforscher beobachtet wird.
Ich brauchte fünf Minuten, bis ich die Briefe zu den Artikeln gefunden hatte. Alle waren vorhanden. Das war beunruhigend. »Ich weiß nicht, was sie gerade gelesen hat. Es hatte keinen Begleitbrief, also muß es persönlich abgegeben worden sein.« Manuel Boyd rutschte an die Stuhlkante und sah mich erwartungsvoll an.
Ich gab den Blick zurück.
»Glauben Sie, daß derjenige, der den Artikel gebracht hat, Susan Green ermordet hat?«
Ich zuckte die Schultern. »Es ist gefährlich, eine Rechtszeitschrift herauszugeben.«
Kapitel Sechs
Am nächsten Morgen hatte ich noch mehr Besucher. Jedesmal wenn ich von einer Vorlesung oder einer Besorgung zurückkam, fand ich jemanden vor, der sich verdächtig benahm. Vielleicht war es aber auch nur typisch für meinen Geisteszustand, der sich immer mehr dem Verfolgungswahn annäherte.
Mein erster Überraschungsgast war niemand anderes als Jane Day, brillante Rechtsanwältin, Anwärterin auf den Job des Generalstaatsanwaltes von Kalifornien und Gattin des reichsten und bekanntesten Anwaltes der Stadt, wenn nicht des Bundesstaates.
Clarence Day hatte sich einen Namen gemacht, als er für die Angehörigen eines Penners, der schon lange nichts mehr mit seiner Familie zu tun hatte und von einem herunterfallenden Gerüstteil eines öffentlichen Gebäudes erschlagen worden war, auf zwei Millionen Dollar Schadensersatz ‒ 1959 ein Vermögen ‒ geklagt hatte. Damals war Day noch ein gutaussehender junger Mann mit gepeinigten blauen Augen und einem nervösen Tic im Mundwinkel gewesen (unser Prozeßführungs-Professor riet uns dringlich, Tics dieser Art zu kultivieren). Day hatte die Jury mit dem Wert von Mr. Jedermann, der einer schändlichen Pflichtvergessenheit zum Opfer gefallen war, zu Tränen gerührt. Seitdem hat Day über eine Milliarde Dollar für persönliche Entschädigungen und bei Gruppenklagen herausgeholt. Sein Erfolgshonorar war niemals geringer als ein Drittel der zugesprochenen Summe, und selbst nach Abzug seiner Spesen konnte sich der Mann in grüne Scheine einwickeln. Er besaß ein Schloß in Pacific Heights und fuhr einen babyblauen Rolls, der seine Augen vorzüglich zur Geltung brachte. Ich hatte ihn schon in der Stadt gesehen und mußte zugeben, sogar mit sechzig und erschlaffender Kinnlinie sah er immer noch aus wie ein gut gealterter Errol Flynn.
Jane Day hatte als Teilhaberin in seiner Kanzlei angefangen, eine Ehre, die nur den außergewöhnlich eloquenten Standesvertretern zuteil wurde. Sie hatte ein paar seiner »unmöglichen« Fälle gewonnen, und Day hatte sie nach nur drei Jahren Zusammenarbeit mit der Partnerschaft belohnt. Sie war eine kleine Frau mit geraden Augenbrauen, Stubsnase und einem feinen Mund, dessen Ausdruck ständig zwischen einem schwachen Lächeln und mildem Unbehagen hin- und herschwebte. Sie war unauffällig elegant gekleidet, bevorzugte Kaschmirkostüme und Seidenblusen mit Spitzenschleifen, und sie sprach so leise, daß die Geschworenen sich anstrengen mußten, sie zu verstehen ‒ eine clevere Methode, den gegnerischen Anwalt rüpelhaft angriffslustig erscheinen zu lassen. Vor Jahren hatte ein Leitartikler sie einmal Lady Jane genannt, und der Name war an ihr hängengeblieben. Als sie und Clarence ein Jahr nachdem er sie zur Partnerin gemacht hatte heirateten, war es die Königliche Hochzeit des Jahres in San Franzisko. Das gemeine Volk stand am Straßenrand, als zehn weiße Rolls Royce die Hochzeitsgäste zur Grace-Kathedrale kutschierten.
Niemand war überrascht, als Lady Jane ihre Kandidatur zur Generalstaatsanwältin bekanntgab. In den zehn Jahren, die sie verheiratet waren, hatten sie und Clarence sich eine gewisse Reputation als Königsmacher erworben. Jane Day hatte sowohl das Geld als auch das Charisma, die Wahl zu gewinnen.
Ich traf sie im Büro an, wie sie ruhig durch Akten blätterte. Ich erinnerte mich daran, daß sie am Tag von Susans Ermordung auf dem Campus gewesen war, und hatte plötzlich diese Art von Eingebung, die Karrieren beflügelt.
»Ms. Day?«
Sie drehte sich um, noch immer durch die Akten blätternd. »Eine kleine Reise durch die Erinnerung.« Nostalgie durchwehte ihre Stimme. »Wußten Sie, daß ich früher auch Redakteurin war?« Ein Lächeln kräuselte die durchsichtige Haut um ihre Augen. »Ich dachte, Sie hätten vielleicht noch meinen Studentenartikel, aber ich nehme an, sie bewahren sie nicht so lange auf?«
Wenn man Redakteurin der Rechtszeitschrift wird, muß man sich nicht nur »hochnoten« (unter den besten zehn Prozent seines Jahrgangs bleiben) sondern auch »hochschreiben« (einen selbstverfaßten Artikel einreichen und ihn zur Publikation akzeptiert bekommen).
Ich spähte zum Bücherregal neben dem Aktenschrank. Es waren sämtliche bislang erschienenen Nummern der Zeitschrift der verflossenen achtundachtzig Jahre dort aufgereiht. Mir wäre es natürlicher vorgekommen, wenn Jane Day nach der publizierten Fassung ihres Artikels Ausschau gehalten hätte. Aber ich sagte nur: »Nein, wir behalten unpublizierte Manuskripte nur ein oder zwei Jahre und werfen die anderen sofort weg, wenn sie gedruckt worden sind.«
»Dieser abgetrennte Bereich ist neu«, steuerte sie als Beobachtung dem Gespräch bei.
Ich nickte: »Ja, aus diesem Jahr.«
»Also, ich möchte Sie nicht aufhalten. Ich habe eine Verabredung mit Ihrem Dekan. Er müßte jetzt da sein.«
Ich nickte wieder. Als sie an mir vorbeiging, konnte ich Oscar de la Renta riechen, so zart wie zerdrückte Blütenblätter.
Ich wartete einen Augenblick, bevor ich die Akten hervorzog, die sie durchgeblättert hatte. Es waren edierte Fassungen von Susan Greens Artikel, auch von dem, der gerade frisch aus der Druckerpresse gekommen war. Wenn alles normal verlaufen wäre, wäre er an dem Tag weggeworfen worden, an dem die neue Nummer ausgeliefert wurde. Aber das war der Tag von Susans Ermordung gewesen, und nichts war seinen gewohnten Gang gegangen.
Ich nahm den Papierstapel mit zu meinem Schreibtisch und setzte mich. Es waren zwei Fassungen, und obwohl im Prinzip die gleichen, zeigten sie zwei verschiedene Stadien des Lektorats.
Die erste Fassung war auf sachliche Richtigkeit gelesen worden. Ich erkannte Mary Wests Anmerkungen am Rand. Es waren nur sehr wenige. Susan machte nie Fehler, wenn sie einen Fall interpretierte, und selbst wenn sie welche gemacht hätte, wäre Mary zu träge gewesen, sie zu finden. Trotzdem war die Fassung stilistisch heftig überarbeitet worden. Mary haßte Eigenschaftswörter und liebte Tätigkeitswörter, so daß ihre Prosa und auch jedes Manuskript, das sie edierte, sich wie eine Sportreportage las.