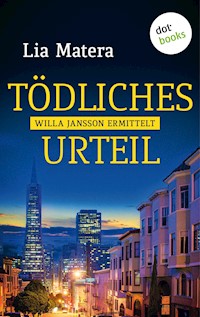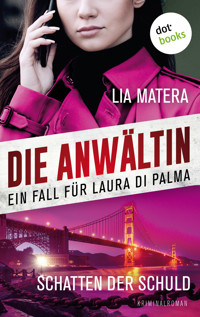Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Willa Jansson
- Sprache: Deutsch
Ein hochbrisanter Fall – eine verschwundene Zeugin: Der Justiz-Thriller »Stiller Verrat« von Lia Matera jetzt als eBook bei dotbooks. Willa Janssons erfolgsgekrönte Karriere als Anwältin war ihrer Hippie-Mutter schon immer ein Dorn im Auge – doch nun ist es das einzige, was ihr Leben retten könnte: Als sie von einem Ausflug mit ihrer Frauenaktivistengruppe von Kuba nicht zurückkehrt, reist Willa sofort nach Havanna. Dort erwarten sie bereits sensationshungrige Reporter und ein gefährliches Netz aus Lügen und Verschwörungen, in das sowohl die amerikanische Regierung als auch die kubanische tief verwickelt scheinen. Als dann auch noch Willas Exfreund von der San Francisco Police Force dort auftaucht, gerät Willa mitten ins Kreuzfeuer … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Stiller Verrat« von Lia Matera ist der fesselnde Abschluss ihrer Krimireihe um die toughe Anwältin Willa Jansson und den besonderen Flair der 70er und 80er Jahre. Jeder Band kann unabhängig gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Willa Janssons erfolgsgekrönte Karriere als Anwältin war ihrer Hippie-Mutter schon immer ein Dorn im Auge – doch nun ist es das einzige, was ihr Leben retten könnte: Als sie von einem Ausflug mit ihrer Frauenaktivistengruppe von Kuba nicht zurückkehrt, reist Willa sofort nach Havanna. Dort erwarten sie bereits sensationshungrige Reporter und ein gefährliches Netz aus Lügen und Verschwörungen, in das sowohl die amerikanische Regierung als auch die kubanische tief verwickelt scheinen. Als dann auch noch Willas Exfreund von der San Francisco Police Force dort auftaucht, gerät Willa mitten ins Kreuzfeuer …
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera ihre Reihe um Willa Jansson mit den Kriminalromanen:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
Sowie ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Juli 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »Havana Twist« bei Simon & Schuster Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Havanna Twist« bei Ullstein.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH und Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Celso Diniz
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-193-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Stiller Verrat« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Stiller Verrat
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Nicole Hölsken
dotbooks.
Für Judith Kelman, Lisa Jensen, Judy Greber, Jan Burke, Carla Norton, Pete Hautman, Avar Laland, Joan Hess, Bob Morales und Andi Shechter.
E-Mails mit Euch auszutauschen hat mir die Couch des Psychiaters erspart. Ich hoffe, Ihr gewährt mir Preisnachlaß.
Handelsbeziehungen mit dem Feind
(Auszug aus dem Gesetzbuch der Vereinigten Staaten)
Abschnitt 16 (1) Wer wissentlich gegen die Bestimmungen dieses Artikels verstößt ... wird zu einer Geldstrafe von ... nicht mehr als $ 100 000 oder einer Haftstrafe von nicht mehr als 10 Jahren oder beidem ... verurteilt.
Kapitel 1
Wie oft muß ich mir anhören, daß andere Menschen sich über ihre Mutter beklagen! Ich hingegen würde es geradezu genießen, wenn die meine mich mit guten Ratschlägen verfolgen oder mit Schwänken aus ihrem Leben langweilen würde. Ich finde nämlich, daß jeder sich glücklich schätzen sollte, der seine Mutter noch nie aus einer Gefängniszelle voller Demonstranten holen mußte. Und jeder, der ohne Schuldgefühle eine zynische Bemerkung machen oder hin und wieder mit einem Republikaner verkehren kann, ist ebenfalls ein Glückspilz. Meine Mutter hingegen verfaßte sogar einmal eine Petitionsschrift, damit der Mann meiner Träume seines Amtes enthoben wurde. (Ich brauche wohl kaum zu betonen, daß dies unsere Beziehung beträchtlich abkühlte.) Und keiner der Jobs, die ich nach meinem juristischen Examen annahm, fand Gnade vor ihren Augen – abgesehen natürlich von denen, die nicht genug Geld einbrachten, als daß ich davon hätte leben können. Selbst heute, da ich meine eigene Kanzlei habe, kann ich sie um keinen Preis der Welt davon überzeugen, daß ich nicht zu jenen gehöre, die »die kapitalistischen Strukturen aufrechterhalten«. Aber erst die Ereignisse des letzten Jahres setzten dem Ganzen die Krone auf: Meine Mutter flog mit einer Schar grauhaariger Brigadistas nach Kuba und versäumte es anschließend, auch wieder mit ihnen nach Hause zurückzukehren.
Als die vierzehn netten und unauffälligen Anhängerinnen der Friedensbewegung aus dem Flugzeug stiegen, sah ich schon an ihren Gesichtern, daß irgend etwas nicht stimmte. In den Organisationen Global Exchange und Women’s International League for Peace and Freedom hatten sich – durch einen natürlichen Ausleseprozeß – eine Handvoll enthusiastischer Frauen zusammengerottet, die jederzeit in ekstatische Lobeshymnen über die Revolution auszubrechen bereit waren. Eigentlich hätten diese Frauen jetzt – auf dem Flughafen – einen wahren Freudentanz über die hinter ihnen liegende Vereinigung aufführen müssen. Wer sich mit anderen Revolutionären getroffen hatte, dessen Antlitz war gemeinhin verklärt. Statt dessen jedoch blickten sie besorgt und verwirrt drein. Und Mitglieder der WILPF sahen nur sehr selten verwirrt aus. In der Regel handelte es sich um Frauen jüdischer Abstammung, Mütter von Politikern, die die gesamte Dritte Welt mit Suppenküchen versorgt hätten, wenn sie gekonnt hätten. Mir war also sofort klar, daß irgend etwas schiefgegangen war. Aber töricht, wie ich war, dachte ich zunächst, daß man ihnen vielleicht ihre Illusionen genommen hatte. Ich glaubte, daß irgend etwas die rosarote Brille, mit der sie die Revolution betrachteten, zerbrochen hatte.
Ich hätte es besser wissen müssen! Einmal hatte ich meine Mutter auf einer politischen Reise begleitet, auf der wir lauter Frauen getroffen hatten, die gar nicht damit aufhören konnten, die Vorzüge des kubanischen Schul- und Gesundheitssystems zu preisen und sich über die Warmherzigkeit der Kubaner und die Tatsache, daß es dort keinerlei Rassentrennung gab, auszulassen. Meine leise Frage nach den dort einsitzenden politischen Gefangenen hatte einen Wutanfall über unsere von der CIA infizierte Presse zur Folge gehabt. Außerdem klärte man mich darüber auf, was für eine Heuchelei es darstellte, daß Kuba von den USA boykottiert wurde, während die Verbindung mit Ländern, in denen Folter an der Tagesordnung war, aufrechterhalten wurde. Ich hakte nach – womit ich den Ruf meiner Mutter aufs Spiel setzte – und schilderte ein paar Einzelheiten über eine Schriftstellerin, die man kürzlich inhaftiert hatte. In den Jahren zuvor war sie unermüdlich als Verkörperung des Kubanischen Geistes gefeiert worden. Immer wieder hatte Castro argumentiert, daß ein repressives System wohl kaum eine Schriftstellerin von Weltrang hervorbringen konnte. Doch dann plötzlich hatte sie die Gunst der Regierung verloren.
»Das ist doch ein typisches Beispiel dafür, wie Tatsachen durch eine voreingenommene Presse verzerrt werden können«, schnaubte eine der Fidelistas. »Als wir unsere kubanischen Gastgeber danach fragten, erklärten sie uns, daß die USA den Kubanern mit einer Kriegserklärung drohten. Angesichts dieser Entwicklung sind einige Dinge, die diese Schriftstellerin getan hat, gleichbedeutend mit Verrat.«
Auf die Kriegsdrohungen gegen Kuba wollte ich nicht weiter eingehen. Also fragte ich: »Was für Dinge?«
»Nun, sie hat sich mit fremden Journalisten unterhalten.« Die Stimme der Frau klang gedämpft vor lauter Mißfallen. »Sie hat Flugblätter verteilt.«
Flugblätter. Jede Frau in dieser Versammlung wäre in ein brennendes Haus zurückgekehrt, um statt der Familienfotos ihren Stapel mit WILPF-Pamphleten zu retten. Meine Mutter stach mir in die Rippen. »Du mußt die ganze Sache im Zusammenhang sehen, Schatz – schließlich ruiniert unsere Regierung ihre ganze Wirtschaft! Es ist nur recht und billig, wenn sie versuchen, das zu verhindern.«
Flugblätter waren mächtige Waffen, na gut: Man brauchte sich ja nur anzusehen, wie die Traktate der WILPF die Republikaner in die Knie gezwungen hatten.
Seit diesem Abend war ich mit Artikeln der alternativen Presse zum Thema Kuba förmlich überschwemmt worden. Die Freundinnen meiner Mutter konnten es einfach nicht ertragen, daß ich subversive Gedanken über dieses Land hegte. Die normale Presse hingegen berichtete genüßlich über den Zusammenbruch der kubanischen Wirtschaft. Seht ihr, sagte sie, der Sozialismus kann eben nicht funktionieren. Daß Castros »letztes Stündlein« nun schon seit sage und schreibe zehn Jahren schlug, schien den meisten entgangen zu sein.
Doch als die WILPF-Veteraninnen heute aus dem Flugzeug stiegen, trug keine von ihnen den für sie typischen, selbstgerechten Gesichtsausdruck zur Schau – kein gutes Zeichen! Sie steckten die Köpfe zusammen und blieben abrupt stehen, als sie mich sahen. Auch kein gutes Zeichen.
»Wir mußten abreisen«, platzte eine von ihnen heraus. »Wegen der Visa und anderer Verpflichtungen und so. Es tut mir so leid.«
Mein erster Gedanke war, daß sie sich dafür entschuldigte, nicht zum Feind übergelaufen zu sein. »Natürlich«, murmelte ich. »Wo ist meine Mutter?«
»Wir wollten auf sie warten, ehrlich.«
Mittlerweile standen sie nah genug, daß ich ihren Gesichtspuder riechen konnte.
»Sie ist dageblieben? Warum? Was tut sie dort?«
Plötzlich war ich von den Frauen umringt, mütterliche Hände tätschelten mir den Rücken.
»Das wissen wir nicht. Gestern abend ist sie allein weggegangen und nicht ins Hotel zurückgekehrt. Heute morgen haben wir an allen möglichen Stellen nach ihr gesucht.«
Sarah Swann, die Ober-Oma, fügte hinzu: »Unsere kubanischen Gastgeber waren untröstlich. Sie werden nichts unversucht lassen, um sie zu finden.«
Eigentlich hätte ich es mir denken können. Meine Mutter war wie eine Kanonenkugel, die man in einer dermaßen kontrollierten Gesellschaft nicht so einfach frei herumfliegen lassen wollte.
»Ich weiß, daß du aus den westlichen Medien ein paar seltsame Ansichten über Kuba aufgeschnappt hast«, fuhr Sarah fort. »Aber, ganz ehrlich, eine offenere Gesellschaft habe ich selten erlebt. Und auf eins kann man sich hundertprozentig verlassen: Die Regierung fährt keine krummen Touren. Dort geht es nicht zu wie in anderen Ländern – Ländern, die unsere eigene Regierung im übrigen unterstützt –, wo Menschen einfach verschwinden.«
Ich setzte mich auf einen der harten Plastikstühle in der Flughafenlounge. Meine Mutter war schon häufig aus meinem Leben »verschwunden«, war verhaftet worden, weil sie Personalakten von Wehrdienstpflichtigen mit Blut beschmiert hatte, weil sie versucht hatte, die Raketenspitzen von Cruise Missiles zu zerstören, weil sie den Zugang zu Kernkraftwerken versperrt hatte und – noch vor kurzem – weil sie Nägel in die Stämme alter Redwood-Bäume getrieben hatte, um den Kettensägen, mit denen die Bäume gefällt werden sollten, den Garaus zu machen. Die Regierung der Vereinigten Staaten war stets bemüht gewesen, sie zu inhaftieren. Und sie hatte stets ebenso beharrlich darauf hingearbeitet, im Gefängnis zu landen. Ich konnte mir nicht vorstellen, warum eine fremde Regierung barmherziger mit ihr umgehen sollte.
Ich blickte zu den besorgten Gesichtern der Frauen hinauf, die meiner Mutter so ähnlich waren: rüstige Seniorinnen mit ungefärbten Haaren und intelligenten Augen. Der Anblick tröstete mich. Genau wie sie glaubte auch meine Mutter an die kubanische Revolution. Sie betrachtete alles, was die Kubaner taten – auch die Inhaftierung von Dissidenten und die Umweltverschmutzung an der Küste – als das bedauernswerte Resultat der US-Politik. Also würde sie sich ihren zivilen Ungehorsam für ihr eigenes Land aufsparen. Eine objektive Sichtweise, die die Berichterstattung und die Politik auf Kuba und den USA gleichermaßen relativierte, lag ihr fern.
»Du hast recht«, sagte ich schließlich. »Ich kann mir keinen Grund denken, warum die kubanische Regierung ihr Schwierigkeiten bereiten sollte.«
»O nein! Es ist so herrlich dort, das kannst du dir gar nicht vorstellen.«
Solange man nicht homosexuell war. Solange man keine Flugblätter verteilte.
Aber meine Mutter hätte diesen Frauen zugestimmt. Zumindest dieses eine Mal hätte sie keinen ideologischen Wind gemacht. Also, wo war sie?
»Die Kriminalitätsrate ist dort sehr, sehr niedrig«, tröstete mich Sarah. »Nur für den Fall, daß du jetzt denkst, daß sie ... überfallen wurde.«
Der Gedanke war mir tatsächlich gekommen.
Andererseits konnte ich mir durchaus vorstellen, daß meine Mutter mit irgendwelchen neuen Freunden durch die Gegend zog und deshalb ihr Flugzeug verpaßt hatte.
Und schlimmstenfalls stellte sich die Frage, wie schwierig es wohl war, eine blasse, blonde Amerikanerin auf Kuba wiederzufinden.
Berühmte letzte Worte.
Kapitel 2
Das einzige, was in dem Flugzeug noch fehlte, waren ein paar Hühner und Ziegen – Gott ist mein Zeuge, es roch wirklich wie in einem mexikanischen Überlandbus. In dem hätte man allerdings mehr Beinfreiheit gehabt: Als ich mich bewegte, schrie die Frau vor mir auf. Aber vielleicht hatte sie in diesem Augenblick ja auch nur die flackernden Leuchten gesehen, die an Drähten von der Decke herabbaumelten, oder die offenen Schränke über unseren Köpfen, in denen sich die Sauerstoffmasken türmten, oder die Schicht Pappe, die unter dem dünnen Überzug der Sitze sichtbar wurde. Ich sah zum Fenster hinaus, betrachtete die vom Flugzeug abblätternde Farbe und die lose mit dem Flugkörper verbundenen Tragflächen und erwog, einfach aufzustehen und auszusteigen. Dieser Gedanke war mir in den letzten drei schweißtreibenden Stunden im übrigen schon mehrfach gekommen, während ich dem Quietschen des Motors und seinen ständigen Fehlzündungen lauschte.
Hin und wieder wanderte ein mit einem Schraubenschlüssel bewaffneter Mann das Mittelschiff entlang. In der Ferne, auf der anderen Seite der Rollbahn, lagen die feuergeschwärzten Einzelteile einer weiteren Maschine der kubanischen Fluggesellschaft Cubana de Aviación. Es beunruhigte mich, daß man sie dort einfach so liegengelassen hatte. Mein Flugzeug sollte mich von Mexico City nach Kuba bringen – waren Unfälle hier etwa so sehr an der Tagesordnung, daß sich keiner mehr die Mühe machte, die Wrackteile wegzuräumen? War das Kubas Methode, kapitalistische Softies zu piesacken? Wenn ja, dann wirkte es.
Die Einreise nach Kuba (vorausgesetzt, das Flugzeug schaffte es) gestaltete sich dank des U.S. State Department – des amerikanischen Außenministeriums – sowieso schon kompliziert genug. Von Miami aus wurde sie nur denjenigen gestattet, die angaben, zu »Forschungszwecken« ins Land zu wollen. Wahrscheinlich nahm man an, daß Akademiker Castros faszinierendem Charme widerstehen konnten. Doch selbst diese Personen wurden lang und breit durchleuchtet und auf Herz und Nieren überprüft. Normalerweise gab es viele Pauschalreiseangebote, bei denen derlei Papierkram automatisch für die Reisenden erledigt wurde, aber für die nächsten Tage war keine derartige Reise im Angebot. Doch dann hörte ich von einer Gruppe, die alsbald von Mexico City aus losfliegen wollte, und versuchte in aller Eile, mich ihnen anzuschließen. Zu diesem Zweck hatte ich wie eine Wilde Eilbriefe und Faxe verschickt, um noch einen schrecklich teuren Business-Class-Flug zu bekommen, doch selbst dieser hätte mich beinahe zu spät nach Mexico City gebracht. Dort hatte ich diesen kubanischen Schwitzkasten bestiegen, in dem ich nun seit drei Stunden hockte. Vom Fliegen hatte ich deshalb die Nase jetzt schon gestrichen voll.
Außerdem erinnerte mich mein Aufenthalt am Flughafen daran, wie eingerostet und peinlich mein Spanisch mittlerweile war. Ich bin in Mexiko geboren, weil meine Mutter wollte, daß ich zweisprachig aufwachse. Und es gab einmal eine Zeit, in der ich tatsächlich zwei Sprachen beherrschte. Aber seit meinen Collegetagen war ich nicht mehr in Mexiko gewesen. Inzwischen wurde ich ausgelacht, wenn ich Spanisch sprach. Und wenn ich mich unfähig fühle, bekomme ich grundsätzlich schlechte Laune.
Hinzu kam, daß ich frustriert darüber war, daß ich meinen Vater nicht erreicht hatte – nach der Abreise meiner Mutter hatte er beschlossen, sich auf die San Juan-Inseln im Staate Washington zu flüchten. Er und eine Flottille verschrobener Anhänger arbeiteten zusammen mit einem Physiker-Guru an einem Computerprojekt, von dem meine Mutter absolut nichts hielt. Unglücklicherweise lebte »Bruder Mike« – Gurus und Rockstars können scheinbar nie ihren normalen Namen verwenden – auf einer Insel, die so abgelegen war, daß die Telefonverbindung mal wieder nicht funktionierte. Daher mußte ein Telefondienst auf der Hauptinsel die Botschaften buchstäblich mit dem Schiff dorthin bringen. Ich fand es schrecklich, meinem Vater die Neuigkeiten durch eine knappe, unpersönliche Notiz übermitteln zu müssen, aber meine Versuche, ihm auf den Anrufbeantworter zu sprechen oder eine E-Mail zu schicken, waren erfolglos verlaufen, deshalb blieb mir keine Wahl. Ich mußte die Situation einer erstaunt klingenden Telefonistin erklären. Ich würde versuchen, meinen Vater von Kuba aus zu erreichen – ich betete, dann gute Neuigkeiten für ihn zu haben, bevor er in Panik geriet.
Aber als die kubanische Maschine den vielleicht zwanzigsten Abflugversuch machte – diesmal mit Erfolg –, fragte ich mich, ob ich den Flug überhaupt überleben würde. Ich blickte mich um und versuchte abzuschätzen, ob die anderen Passagiere ebenfalls gleich schreiend aus dem Flugzeug stürmen würden. Auf den Sitzen neben mir saß ein hochgewachsenes Paar, das kein Wort miteinander wechselte, sondern nur unaufhörlich etwas in irgendwelche Notizbücher kritzelte. Sie schienen etwa in meinem Alter zu sein – Mitte Dreißig –, sie mit kurzen, braunen Haaren, die sie hinter die Ohren gestrichen hatte, er mit längeren, graumelierten, die ebenfalls hinter den Ohren lagen. In ihrer khakifarbenen Baumwollkleidung wirkten sie ebenso zerknittert wie intellektuell, und sie machten keinesfalls den Eindruck, als wollten sie die Flucht ergreifen, bloß weil irgendwelche Einzelteile herunterfielen.
Die übrigen Mitglieder meiner Reisegesellschaft sahen auch nicht allzu besorgt aus. Sie waren allesamt zu alt, um als Studenten durchzugehen, die gerade frisch von der Uni kamen und sich jetzt ein paar Mark als Zuckerrohrschnitter dazuverdienen wollten. Einige waren Mexikaner, andere vielleicht Amerikaner, Kanadier oder Europäer, durchaus sonnengebräunt, aber keineswegs wettergegerbt. Auch fehlte ihnen der ernste und feierliche Gesichtsausdruck, wie er für junge Sozialisten charakteristisch ist, die ins Land der Verheißung reisen.
Als wir schließlich auf Kuba landeten, wäre ich beinahe in Tränen ausgebrochen, so erleichtert war ich.
Der Flughafen von Havanna war ein niedriges Gebäude, dessen architektonischer Stil an die Toilettenhäuschen auf Campingplätzen erinnerte. Während wir am Zoll warteten, schwatzte das khakifarbene Paar mit mir über die Reise. Ein kleines Filmfestival hatte die Reisegruppe hergeführt. Sie freuten sich darauf, neue Filme aus einem Dutzend lateinamerikanischer Länder zu sehen.
Als der Zollbeamte auf Englisch zu mir sagte: »Filme?« nickte ich unbestimmt. Er stempelte ein Stück Papier ab und überreichte es mir – in meinem Paß würde sich kein Stempel befinden, der mir beim amerikanischen Zoll Schwierigkeiten bereiten könnte. Offensichtlich waren sie daran gewöhnt, daß Amerikaner in ihr Land strömten, Embargo hin oder her.
Glücklicherweise fuhr der Bus, den die Reisegruppe angemietet hatte, zu einem bekannten Hotel, übrigens dem gleichen, in dem auch die WILPF-Brigade meiner Mutter gewohnt hatte. Nirgends war ein Taxi zu entdecken, und ich war dankbar, daß man mich mitnahm.
Während der schmierige, alte Bus über die mit Schlaglöchern übersäten Straßen fuhr, entdeckte ich zwischen den Palmen zahlreiche niedrige Gebäude, die schon einmal bessere Tage gesehen hatten. Wir fuhren an Reklametafeln vorbei, auf denen lächelnde Gesichter für Gleichheit und soziale Sicherheit warben und dafür plädierten, daß alle Macht beim Volke liegen sollte. Aufschriften auf den Gebäuden – die viel zu gleichmäßig und künstlerisch waren, um tatsächlich Graffiti zu sein – verbreiteten in grellen Farben die Parole »Sozialismus oder Tod«. Gelegentlich entdeckte ich die hellen Umrisse der tatsächlichen, wenn auch unverständlichen Graffiti, die durch die Farben überdeckt worden waren. Sie lauteten »8A«.
Als wir in der Innenstadt Havannas ankamen, war ich wegen der stickigen Hitze der Nacht in Schweiß gebadet. Aber das Wetter schien der Szenerie angemessen zu sein. Die Häuser hatten mit blühenden Weinreben überwucherte Veranden und waren der Inbegriff kolonialherrschaftlicher Pracht – wenn man davon absah, daß keines von ihnen in letzter Zeit frisch gestrichen worden war. Selbst jetzt, in der Nacht, konnte man große Löcher und klaffende Risse unter den alten Schichten der verblassenden Farbe erkennen.
Und obwohl auf der Straße keine Autos zu sehen waren, standen die Parkplätze in der Nähe des Hotels voller vorbildlich restaurierter amerikanischer Autos aus den vierziger und fünfziger Jahren. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn am Pool der Pate neben Meyer Lansky gesessen hätte.
Meine Mitfahrer im Bus schienen an den Anblick gewöhnt zu sein. In lautem Spanisch unterhielten sie sich darüber, daß sie hofften, diesmal fließend heißes Wasser in den Hotelzimmern vorzufinden.
Obwohl sämtliche Mitglieder der Reisegruppe sich im Hotel ein Zimmer reserviert hatten, war auch noch ein Zimmer für mich frei. Man bat mich, in Dollars zu bezahlen, aber das amerikanische Finanzministerium hatte befunden, daß es sich um »Handelsbeziehungen mit dem Feind« handelte, wenn man auf Kuba mit Dollars bezahlte. Dafür konnte ich entweder ins Gefängnis wandern (die Höchststrafe betrug zehn Jahre), oder eine Strafe von 100 000 Dollar aufgebrummt bekommen. Außerdem wäre meine Lizenz als Juristin in Gefahr gewesen. Deshalb überredete ich sie, statt Dollars mexikanische Pesos zu akzeptieren.
Ich fragte die Rezeptionistin, eine junge, schwarze Frau in billiger Polyesteruniform, ob sie die Person, die ich hier treffen wollte, schon einmal gesehen hätte, und zeigte ihr ein Bild von meiner Mutter.
Die Rezeptionistin schenkte mir ein breites Lächeln und beugte sich dicht zu mir herüber. »Sie hat versucht, uns Seife zu schenken! Aus ihrem Zimmer, wissen Sie, Seife, die sie nicht verbraucht hat. So etwas dürfen wir natürlich nicht annehmen.« Sie sah sich nach einer älteren Rezeptionistin mit strengem Gesicht um, die sie beobachtete. »Wir haben hier alles, was wir brauchen. Sie hat sich geirrt. Aber sie war nett, eine nette Dame.«
Dieser peinliche Versuch, eine unparteiische Umverteilung von Toilettenartikeln vorzunehmen, war wieder einmal typisch für meine Mutter.
Ich lehnte die Hilfe eines der Hotelpagen ab (denn ich konnte ihm sein Trinkgeld schließlich nicht in Dollars geben) und schleppte meine Reisetasche die Treppe hinauf. Das Zimmer war klein, es stank modrig, und die Möbel waren allesamt in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand. Das Waschbecken war fleckig und das Wasser lauwarm. Meine Mutter war angesichts des Mangels an Luxusgütern sicher in sozialistische Ekstase geraten. Ich hingegen hätte eine kochendheiße Dusche und eine fröhlichere Umgebung durchaus vorgezogen – aber schließlich beleidigte ich sie ständig mit meinen bourgeoisen Bedürfnissen.
In dem Zimmer gab es kein Telefon, also ging ich in die Lobby zurück, um meinen Vater anzurufen. Man sagte mir, daß internationale Gespräche momentan nicht möglich seien. Ja, es gäbe wohl Telefonzellen in der Nähe, aber außerhalb des Hotels koste es häufig acht bis zehn Stunden beständigen Neuwählens, bis ein internationales Gespräch zustande komme. Ich versuchte, es positiv zu sehen – vielleicht hatte sich meine Mutter ja bemüht, zu Hause anzurufen, und es aufgrund dieser Umstände auch nicht geschafft.
Ich war nervös und frustriert, und da ich an diesem Abend keine sinnvolle Aufgabe hatte, beschloß ich, einen Spaziergang zu machen. Aber ich kam zunächst gar nicht aus der Lobby heraus, denn ein Mann in hellblauem Hemd und dunkler Hose trat mir in den Weg. Er trug eine Marke, auf der »Touristenpolizei« stand.
Er warf mir ein breites Lächeln zu. »Wenn Sie eine Wegbeschreibung brauchen oder Empfehlungen, was hierzulande besonders sehenswert ist, oder Hilfe, wenn Sie von irgend jemandem belästigt werden – was hoffentlich nicht vorkommen wird –, können Sie sich an jede Person wenden, die so etwas hier trägt.« Er deutete auf seine Marke.
Ich nahm an, daß die meisten Touristen dieses hohe Maß an Service durchaus zu schätzen wußten. Aber ein alter Hippie wie ich wird beim Anblick einer Uniform immer nervös.
»Es ist schließlich unsere Aufgabe, Ihnen zu helfen, Señorita.« Hinter ihm warfen die Topfpalmen große Schatten auf Wände aus geöltem Holz. Plötzlich hatte ich das Gefühl, mich mitten in einem alten Film zu befinden. Titel: Unser Hippie in Havanna.
Ich murmelte meinen Dank und stürzte dann zur Tür. Ich wanderte ein paar von Palmen gesäumte Straßenzüge entlang in Richtung Meer, wobei ich an ein paar weiteren Hotels im Kolonialstil vorbeikam. Ich konnte den Ozean riechen – nicht die erfrischende Luft der Pazifikküste, sondern etwas, das fast an Gestank grenzte: Schleim auf den Felsen, salzige Gischt auf ungereinigten Küstenstraßen, Fisch in der feuchten Luft.
Eine dicke, taillenhohe Mauer säumte die gewundene Straße. Junge Kubaner in alten, schlecht sitzenden Klamotten saßen darauf oder lehnten daran, unterhielten sich, umarmten sich, kicherten miteinander und beobachteten den Verkehr. Ein paar jedoch wandten mir den Rücken zu und angelten.
Ich sah über die Mauer hinweg auf das Meer hinaus, das drei oder vier Meter unter mir gegen die Felsen schlug. Plötzlich wurde ich durch eine Stimme neben mir aufgeschreckt.
»Sie sind Amerikanerin!«
Ich zögerte. Im Gegensatz zu der Rezeptionistin und dem Angehörigen der Touristenpolizei sprach dieser junge Mann hier Spanisch, ein sehr schnelles Spanisch, bei dem er die n’s und m’s nur andeutete und die s gleich ganz fallenließ. Ich versuchte, jenen wenig genutzten Teil meines Hirns zu aktivieren, in dem diese Sprache gespeichert war.
Der Junge rückte augenblicklich wieder von mir ab. »Wenn man sieht, daß ich mit Ihnen rede, werde ich gleich verhaftet. Also sehen Sie mich nicht an, sehen Sie geradeaus.«
»Wer wird Sie verhaften?«
»Die Touristenpolizei. Sie lassen nicht zu, daß wir mit Amerikanern reden. Sie wollen nicht, daß wir Amerikaner belästigen. Haben Sie Dollars? Für meine Familie? Ich wechsele Ihnen das Geld in Pesos um.«
»Ich habe nur Pesos.«
Er schnaubte. »Pesos sind wertlos. Etwa kubanische Pesos? Wie sind Sie an kubanische Pesos gekommen? Man verhindert doch, daß Amerikaner kubanische Pesos in die Finger bekommen. Sie haben spezielles Touristengeld für Amerikaner eingeführt. Ist es das, was Sie haben? Die Touristen-Pesos?«
»Mexikanische Pesos.«
»Mist. Nur mit Dollars kann man sich heutzutage alles kaufen. Was unser Land so hergibt, kann man nur in den Touristenläden kaufen, und die nehmen nur Dollars. Wir Kubaner können mit Pesos nichts kaufen. Dollar-Apartheid.« Als Scheinwerfer auf der Straße sichtbar wurden, machte er noch ein paar Schritte von mir weg. »Nur die Polizei fährt Autos. Kein Benzin. Alles für Fremde reserviert, damit sie die Autos mieten und zur Varadero Beach fahren können, um dort Dollars auszugeben.«
Ich war überrascht, daß er so bereitwillig einen Vortrag über die Mißstände des Landes hielt. Immerhin wußte er doch gar nicht, wer ich war.
»Erzählen Sie mir von Amerika«, fuhr er fort. »Von hier aus sind es nur hundertachtundvierzig Kilometer bis Florida. Wenn ich ein Floß bauen würde, könnte ich Amerika innerhalb weniger Tage erreichen.«
Das klang zumindest sicherer als eine Reise mit der kubanischen Fluggesellschaft.
»Ich habe einen Cousin in Miami«, fuhr er fort. »Wenn ich doch nur zu ihm könnte! Aber das Wasser ist wie ein Gefängnis. Wir alle hier am Malecón« – mit einer Handbewegung deutete er auf die jungen Menschen, die an der Mauer herumlungerten – »wir alle könnten im nächsten Augenblick verschwunden sein! Was gibt es denn hier schon zu tun? Wir sind gebildet, ja, aber damit läßt sich in diesem Land nicht allzuviel anfangen. Wir schneiden Zuckerrohr, um dem Staat die Kosten für unsere Collegeausbildung zurückzuzahlen, und danach? Ich bin zudem auch noch ein hervorragender Gitarrist, aber in einer Rock-’n’-Roll-Band darf man hierzulande nicht ohne Lizenz spielen, und Lizenzen werden nur an Salsa-Bands verliehen – die alten Männer hassen uns roqueros.«
»Könnten Sie vielleicht etwas langsamer sprechen?« (Und vielleicht ein paar Konsonanten einfügen?)
Aber er schien zu erregt zu sein, um meiner Bitte nachzukommen. »In La Habana haben wir nichts. Keine Vergnügungen, keine Bücher. Alles, was wir produzieren, wird exportiert – Zucker, Fisch, Fleisch. Und wir bleiben auf der Strecke, hungrig, ohne Strom, ohne Benzin, ohne Busse, ohne Computer. Aber das Schlimmste ist eigentlich, daß es keine Seife gibt – ich sage Ihnen eins, wenn es einmal einen Aufstand gibt, dann nicht wegen des Essens. Kubaner sind an Hunger gewöhnt. Wir kochen uns eben stärkeren Kaffee und versuchen, den Hunger nicht weiter zu beachten. Aber wir werden uns nie daran gewöhnen, daß wir keine Seife haben. Wenn es einen Aufstand gibt, compañera, dann, weil wir alle klebrig und verschwitzt sind und unseren eigenen Geruch nicht mehr ertragen können!«
Kein Wunder, daß meine Mutter versucht hatte, dem Hotelpersonal welche zu schenken. Gerade wollte ich sie zur Sprache bringen, als er schon weiterredete – immer noch in doppelter Geschwindigkeit.
»Mädchen haben es besser. Sie können zu den Touristen gehen, zu den alten, dicken Männern aus Venezuela oder Kanada, und können ihre Dienste gegen eine Flasche Shampoo und eine Nacht in den Touristenclubs eintauschen, zu denen wir sonst keinen Zutritt haben. Dort können sie etwas trinken und Musik hören und kommen mit gut gefüllten Taschen von den Diplotiendas zurück, den großen Dollarläden. Aber welche Möglichkeit haben wir Männer? Wir können nur am Malecón herumstehen und angeln. Wir können versuchen, Pesos in Dollars umzutauschen und derweil zusehen, wie unser Leben vorbeigeht.«
»Haben Sie hier unten vielleicht eine ältere, blonde Dame gesehen?« Meine Mutter hätte diesem jungen Mann mit Sicherheit spontan sämtliche Dollars aus ihrer Geldbörse gegeben, obwohl sie sich angesichts seiner Schilderung möglicherweise Sorgen gemacht hätte, weil es der glorreichen Revolution offenbar immer noch nicht gelungen war, die hiesige Bedürftigkeit zu beseitigen.
»Viele ältere amerikanische Frauen in der letzten Woche«, sagte er ebenso vage wie hilfsbereit.
»Ich zeige Ihnen ein Bild von ihr.«
Die Scheinwerfer ließen ihn erneut einen Schritt beiseite treten. »Touristenpolizei. Wenn Sie das Bild auf die Mauer legen und dann fortgehen, kann ich einen Blick darauf werfen. Wir können unsere jetzigen Positionen ja danach gleich wieder einnehmen.«
Ich zog das Foto aus der Brieftasche. Zweimal in einer Stunde – so oft hatte ich es wahrscheinlich in den letzten zwanzig Jahren nicht hervorgeholt. Wenn man in der Nähe der eigenen Eltern lebt, hat man eben kaum Gelegenheit, sie zu vermissen.
Ich schlenderte davon und zog die neugierigen Blicke einiger kubanischer Gigolos auf mich. Sie warteten, bis die Touristenpolizei vorbeigefahren war. Dann flüsterte mir einer zu: »Amerikanische Lady, haben Sie Dollars? Wollen Sie einen netten Begleiter? Richtigen afro-kubanischen Jazz hören?«
Ein Radfahrer sauste vorbei und streckte die Hand aus, als ob er mir die Handtasche entreißen wollte, die ich gar nicht bei mir hatte.
Nach einer Weile nahm ich meinen Platz an der Mauer wieder ein und ließ das Foto in meine Jackentasche zurückgleiten. Der junge Mann stand jetzt etwas weiter entfernt und auf der anderen Seite. Trotz der Tatsache, daß die Touristenpolizei fort war, kam er nur zögernd zu mir herüber.
»Vielleicht habe ich sie ja tatsächlich gesehen«, sagte er. »Ich habe viele Freunde hier, die ich fragen könnte. »Aber ...« – er zuckte die Achseln – »wir brauchen unbedingt Dollars.«
»Ich werde für Informationen über sie bezahlen – wenn sie sich als zutreffend erweisen.«
»Dann frage ich mal herum. Ich frage jeden!« Er lächelte mich an und sah in seinem ausgebeulten T-Shirt und seinen viel zu großen Shorts unglaublich jung und liebenswert aus.
Nachdem ich also meinen ersten Spion auf die Sache angesetzt hatte, kehrte ich ins Hotel zurück. An der Tür hielt mich der Touristenpolizist erneut auf.
»Wurden Sie von den Kindern am Malecón auch nicht belästigt?« Sein Lächeln war liebenswürdig, doch seine Augen waren hart wie Stahl. Ich fragte mich, woher er wohl wissen mochte, daß ich am Malecón gewesen war. Ob er mich verfolgt oder jemanden mit meiner Verfolgung beauftragt hatte? »Die Jugendlichen dort sind glücklich, wenn sie die Nacht mit Herumstreunen und Reden verbringen können«, fuhr er fort. »Sie sind verliebt und turteln dort miteinander herum. Aber bei allem Glück können sie auch – wie sagt man doch bei Ihnen? – wahre Klatschmäuler sein.«
»Ich habe keine Klatschmäuler getroffen«, versicherte ich ihm.
Die WILPF-Kameradinnen meiner Mutter hatten immer wieder betont, daß sie überall hatten hingehen können – ohne jegliche Beschränkung. (»Fidel will doch schließlich, daß man seine Stadt genießen kann!«) Aber keine von ihnen war, wie sich schon bald herausgestellt hatte, in die Nähe des Malecón gekommen oder in die Touristenzone aus Geschäften, Museen und Restaurants.
Morgen würde ich versuchen, durch eine Seitentür des Hotels hinauszuschlüpfen, um dem Späherblick des Touristenpolizisten zu entgehen – nur für alle Fälle.
Ich bestieg den Aufzug, in dem es roch wie in einem Katzenklo und der in krampfartigen Schüben nach oben taumelte. Eine grimmig dreinblickende Frau, die wie ein Zimmermädchen gekleidet war, kam gerade aus meinem Zimmer. Ich war verblüfft – die Zimmer wurden hier um zehn Uhr abends gereinigt?
Sie blieb stehen und sah mich an. Dann hielt sie eine Plastiktüte mit Hotelseife in die Höhe und schüttelte sie.
Aha, also eine spätabendliche Seifen-Auffüllaktion – sie hatten ja auch so viel davon übrig.
Ich konnte nicht erkennen, ob mein Zimmer durchsucht worden war oder nicht. Alles war mehr oder weniger noch an seinem Platz. Nur eine tote Motte und eine große Staubflocke lagen mitten auf meinem Bettüberwurf. Die waren mir vorher nicht aufgefallen. Ich blickte zur Decke hinauf, wo die Lampe leicht schräg hing.
Wenn dies nicht das Land des magischen Sozialismus gewesen wäre, hätte ich ja vermutet, daß dort soeben eine Wanze untergebracht worden war. Egal. Ich hatte nichts dagegen, wenn El Comandante mir diese Nacht beim Schnarchen zuhörte.
Kapitel 3
Auch wenn das Frühstück kostenlos war – ich brachte es einfach nicht über mich, etwas davon herunterzuwürgen. Es handelte sich um ein Buffet mit altem Fleisch in fetterstarrter Sauce. Glücklicherweise vertrieben ein paar Tassen Kaffee, der so stark war wie Zuckerrübensirup, meinen Appetit. Nachdem ich erfolglos versucht hatte, ein Telefonat nach Übersee zu führen, verließ ich das Hotel durch eine Seitentür, die zu einem Pool hinausführte, in dem ein paar kreischende kanadische Kinder spielten. Vor dem Hotel standen Reisebusse, die aussahen wie Greyhounds aus den Zeiten der Depression und die Menschen aufnahmen, die (wie ich glaubte) allesamt zum ersten Tag des Filmfestivals wollten. Nur das intellektuell zerknitterte Paar, das im Flugzeug neben mir gesessen hatte, fuhr im eigenen Auto – einer seltsamen Plastiklimousine, wie ich sie noch nie gesehen hatte.
Ich behielt die Touristenpolizei im Auge – an diesem Morgen waren einige von ihnen unterwegs, denn momentan gab es zahlreiche Touristen. Ich schlüpfte vorbei und bog so bald wie möglich in eine Seitenstraße ein.
Ich stellte mir vor, wie meine Mutter hier durch die Gegend geschlendert war, wie sie mit den Menschen auf den Veranden ins Gespräch gekommen war, wie sie sich gegenseitig Geschichten erzählt hatten, wie Mutter ein paar Teenagern Dollarscheine in die Hand gedrückt hatte, wie sie Babys in ihren Kinderwagen geküßt hatte. Irgend jemand mußte sich einfach an meine Mutter erinnern, eine Amerikanerin mit einem Mundwerk wie ein Maschinengewehr, die vor gutem Willen nur so strotzte – und vor Geld.
Innerhalb weniger Minuten war ich so weit vom Hotel entfernt, daß jegliche Spur von Tourismus verschwunden war. Bei den umliegenden Gebäuden handelte es sich um verfallene, alte Landhäuser, deren Fenster kaputt und deren Türen ausgehängt waren. Als ich durch die dunklen Öffnungen spähte, konnte ich Matratzen und Bettdecken erkennen, die einen Großteil des Bodens bedeckten.
Die Passanten waren dünn und trugen fadenscheinige Hosen und Hemden aus den sechziger und siebziger Jahren. Sie zeigten keinerlei Bereitschaft, sich mit mir zu unterhalten. Im Gegenteil: Die meisten gingen auf die andere Straßenseite, sobald ich mich näherte.
Ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Normalerweise legte man bei Fremden doch eine gewisse Neugier an den Tag, und mit meinen blonden Haaren und der hellen Haut war ich eindeutig keine Kubanerin. Warum also wandten alle die Augen ab? Warum versuchten alle so offensichtlich, Abstand zu wahren?
Sie hatten Angst davor, beim Gespräch mit einer Amerikanerin ertappt zu werden. Eine andere Erklärung ergab keinerlei Sinn.
Je weiter die Zeit voranschritt, um so schmackhafter kam mir im nachhinein das fette Fleisch auf dem Hotelbuffet vor. Aber in dieser Gegend war kein Restaurant zu finden. Und die paar Läden, die ich entdeckte, waren geschlossen und leer. Auf Tafeln waren Namen und Rationen verzeichnet. Als ich schließlich einen Laden entdeckte, der geöffnet hatte, stellte ich fest, daß die Schlange der davor anstehenden Menschen bis um die Ecke ging. Diese Leute warteten mit stoischer Ruhe und sahen viel zu gelangweilt aus, um sich miteinander zu unterhalten. Auf den Schildern stand: »Mehl morgen« oder »Orangen – eine pro Familie«.
Langsam träumte ich von einem Lokal, in dem ich etwas hätte essen können. Ein paarmal ließ ich mich von Fenstern mit bunten Postern ins Bockshorn jagen. Aber jedesmal handelte es sich um politische Slogans – Viva Cuba Libre! Oder Viva Nuestra Revolución Socialista! Die Initialen CDR – Comité de Defensa de la Revolución, also Komitee zur Verteidigung der Revolution – und Poster über die Revolution gab es hier genauso viele wie Werbeplakate in einem Geschäftsviertel in den USA. Vielleicht war das die Erklärung dafür, daß niemand anhalten und sich mit einer amerikanischen Fremden unterhalten wollte.
Vollkommen enttäuscht und demoralisiert kehrte ich ins Hotel zurück. Wenn ich weiterhin ziellos in der Gegend herumlief und nach Kubanern suchte, die mit meiner Mutter Freundschaft geschlossen hatten, würde ich wohl kaum auf eine Spur stoßen.
Ich würde ihre Schritte zurückverfolgen müssen. Die unermüdliche WILPF-Gruppe hatte ein Krankenhaus, eine Schule und ein Frauengefängnis besichtigt, außerdem in der Nähe liegende Strände und Kurorte. Sie war von der Schriftstellervereinigung und der Filmschule der Universität eingeladen worden, sie war sogar in einem Nachtclub gewesen und hatte ein Zuckerrohrfeld besichtigt.
Diese Stationen würde ich abklappern, in der Hoffnung, daß meine Mutter dort irgend jemandem erzählt hatte, was für Pläne sie sonst noch hatte. Vielleicht hatte sie ja noch eine Verabredung getroffen, oder man hatte ihr irgend einen Ort besonders ans Herz gelegt.
Wenn mir das nicht weiterhalf, würde ich gezwungen sein, mich mit den Bürohengsten der Stadt auseinanderzusetzen, und zwar sowohl mit Kubanern als auch mit Amerikanern. Je weniger einflußreiche Personen aus der Politik Wind von der Sache bekamen, um so besser standen die Chancen, daß meine Mutter nicht im Gefängnis landete. Vor dem Hintergrund einer Höchststrafe von zehn Jahren oder 100 000 Dollar würde ich den Kontakt zu derlei Persönlichkeiten mithin so lange wie möglich hinauszögern. Aber letzten Endes würde ich alles Notwendige unternehmen, um sie wiederzufinden.
Kapitel 4
Auf der Veranda des Hotels traf ich das Khaki-Paar.
Die Frau sagte: »Haben Sie Lust, mit uns zu Mittag zu essen? Wir sind auf dem Weg in die Altstadt Havannas, La Habana Vieja.«
»Ja,« fügte ihr Begleiter hinzu, »kommen Sie doch mit.«
»Sie waren früher schon einmal in Havanna?« erkundigte ich mich ausweichend.
»O ja.« Die Stimme des Mannes klang trocken. Tatsächlich war alles an ihm in gewisser Weise trocken. Ich wischte mir den Schweiß ab, den mir die Mittagshitze auf die Stirn getrieben hatte. Sein langgezogenes Gesicht hingegen sah kühl aus, und seine Kleider waren zwar zerknittert, aber ohne jegliche Schweißflecken. »Wir sind jetzt schon zum vierten Mal hier.«
»Sie sind Amerikaner?« Das hatte ich unserer kurzen Unterhaltung am Zoll entnommen.
»Journalisten. Für die Associated Press. Ich heiße Dennis, das ist Cindy.«
»Willa. Ja, ich würde gern mit Ihnen zu Mittag essen.« Obwohl ich mich fragte, warum sie mir das angeboten hatten, konnte ich auf meinem Weg durch die Stadt durchaus ein paar Fremdenführer gebrauchen.
Cindys sommersprossiges Gesicht verriet keinerlei Gefühlsregung, als sie sagte: »Wir warten auf das Auto. Wir haben es heute morgen jemandem gegeben, damit er für uns einen Parkplatz sucht ... wir geben uns Mühe, ein paar Dollars unters Volk zu bringen.«
»Wo kommen Sie her?«
»Die letzten beiden Jahre haben wir in Mexico City gewohnt. In ein paar Monaten ziehen wir nach Rußland.«
Dennis sagte etwas auf Russisch zu ihr. Als sie die Stirn runzelte, erklärte er: »Wir bemühen uns schon seit längerem, diese Sprache zu erlernen, aber das ist nicht einfach.«
Ein junger Mann kam herangetrabt. Das Paar gab ihm eine Fünf-Dollar-Note. Er geriet beinahe in Ekstase.
Während wir uns in das Auto quetschten, machte ich die Klopfprobe.
»Ja, es ist aus Plastik«, bestätigte Dennis. »Ein Auto aus Moskau. In der guten alten Zeit, bevor die UdSSR zusammengebrochen ist, haben sie Tausende davon importiert.«
»Sind Sie wegen der Filmfestspiele hier?« Ich hielt die Hand über meine Augen, um sie vor dem gleißenden Licht der Mittagssonne zu schützen.
»Theoretisch schon. Journalisten erhalten in aller Regel keine Einreiseerlaubnis für Kuba – zumindest ist es uns nie gelungen, eine zu ergattern. Also schließen wir uns so oft wie möglich Reisegruppen wie dieser hier an und kommen als mexikanische Touristen ins Land, nicht als amerikanische Reporter.« Er runzelte die Stirn, weil sich der Gang verklemmt hatte. »Leider können wir jedes Jahr eine weitere Geschichte zum Thema ›Verödung der kubanischen Wirtschaft‹ schreiben. Letztes Jahr fuhren immerhin noch ein paar Autos auf den Straßen. Dieses Jahr gibt es für die Einheimischen gar keinen Treibstoff mehr, nur für uns Touristen und unsere Mietautos. In den meisten Gegenden gibt es nur weniger als zwei Stunden am Tag elektrischen Strom. Sehen Sie die schwarze Rußschicht auf den Gebäuden? Sie kochen jetzt mit Holz und Kohle ...«
Ein paar Fahrräder sausten an uns vorbei.
»Aus China«, kommentierte Cindy. »Die fliegenden Tauben. Sie haben wahrscheinlich eine Million chinesischer Fahrräder auf Pump importiert. Im Gegenzug wimmelt es hier mittlerweile von ranghohen chinesischen Militärangehörigen. Wir hoffen, daß sie ihre Arbeitslager für Strafgefangene nicht ebenfalls exportieren.«
»Mm«, stimmte der Mann zu. Er parkte neben einer gepflasterten Plaza. Wir waren jetzt von schloßähnlichen Gebäuden mit Torbögen, Säulen und Säulengängen sowie schmiedeeisernen Balkongittern umgeben. Es sah aus wie im alten Spanien.
Wir gingen durch schmale Straßen und Gassen mit Kopfsteinpflaster, überholten gutgekleidete Familien, bei denen es sich offensichtlich um Touristen handelte. An den Geschäften prangten Schilder mit englischer Aufschrift, die Tische auf den Veranden waren mit weißen Tischtüchern gedeckt.
An einem dieser Tische setzten wir uns nieder. Meine Begleiter bestellten Mojitos und Hummer. Ohne zu wissen, was ein Mojito ist, bestellte ich das gleiche. Man brachte uns Rumcocktails, die stark nach Pfefferminze und Zucker schmeckten und einen Schuß Limone enthielten. Die Luft roch nach heißen Steinen und nach Spalierpflanzen.
»Also,« sagte Dennis, »was führt Sie nach Havanna?«
Cindy nippte geziert an ihrem Getränk, aber ihre Augen waren unverwandt auf mein Gesicht gerichtet.
Jetzt hatte ich die Wahl: Ich konnte ihnen die Wahrheit anvertrauen und versuchen, sie womöglich bei meiner Suche zu Verbündeten zu machen. Oder ich konnte diesem Paar, das mich einfach in der Lobby eines Hotels in Havanna aufgegabelt hatte, mit Mißtrauen begegnen. Ich war leider nicht in der Position, zu entscheiden, was die bessere Alternative war.
»Meine Mutter ist gerade auch vor kurzem hier gewesen«, sagte ich ausweichend. »Sie war von diesem Land sehr beeindruckt.«
»Ist sie mit einer Gruppe gereist?«
»Ja.« Wieder wich ich aus. »Grauhaarige Globetrotter, wissen Sie? Alte Damen auf der Reise.«
Dann wurde uns der Hummer serviert, dessen Fleisch so saftig und fest war, daß wir uns vorübergehend in einer Orgie des Genusses verloren. Mit einem zweiten Mojito in der Hand und einem Stapel Hummerschalen auf meinem Teller lehnte ich mich schließlich zurück und ließ den Blick über die spärlich bevölkerte Plaza gleiten. Die Luft war schwül und mit allerlei Gerüchen angereichert. Die Touristen, die an uns vorbeigingen, sahen wohlhabend und glücklich aus.
»Nun«, sagte Dennis. »Wir haben eine Verabredung mit dem Yum King.«
»Young urban Marxist«, erklärte Cindy. »Die ausländische Presse nennt sie Yummies – in Anlehnung an die Yuppies in den Staaten – es sind allesamt junge, selbstbewußte Parteimitglieder. Der Yum King ist Funktionär im Innenministerium und soll bald zum Mitglied des kubanischen Politbüros avancieren. Er hat ziemlich viel Ausstrahlung, ein faszinierender Mensch.« Sie beobachtete mich. »Wir geben uns als Kinofans aus, die eine Nachricht von einem gemeinsamen Freund in Mexico City für ihn haben. Um keinen Preis der Welt möchte ich ein Zusammentreffen mit ihm verpassen.«
Gespannt beugte ich mich vor. Wollte sie mich etwa bei diesem Treffen dabeihaben?
Mein Instinkt warnte mich und riet mir, ins Hotel zurückzukehren. Aber ein Innenminister, der bald sogar ein Mitglied des Politbüros sein würde ... vielleicht war er ja zugänglich für ein paar Fragen über verschwundene Touristen – selbstverständlich rein allgemeiner Natur. Nach einem Plausch über gemeinsame Freunde war er möglicherweise in freundlicher Stimmung. Vielleicht bot sich hier eine Abkürzung für meinen beschwerlichen Weg.
»Ich nehme nicht an ...« Gefahr, Will Robinson, Gefahr. »Ich würde Sie gern begleiten.«
»Nun, wenn Sie auch noch dabei wären, würden wir wirklich wie Touristen aussehen.« Cindy sah Dennis an.
Und der zuckte die Achseln. Es hätte beinahe lässig ausgesehen.
Kapitel 5
Wir fuhren durch ein Viertel, in dem nur einfache Hochhäuser aus den fünfziger Jahren standen, und hielten vor einem Gebäude, das einer vorstädtischen Grundschule glich: niedrig und L-förmig. »Wenn sie sich mit Außenstehenden treffen, dann nie in den eigenen Büroräumen«, erklärte Cindy. »Sie behaupten stets, daß sie noch woanders zu tun haben und daß man sie dort treffen soll.«
Auf dem beinahe leeren Parkplatz empfing uns ein kubanischer Schriftsteller – ein Bestsellerautor aus den Tagen, als es noch Papier gab, wie er erklärte. Er führte uns in einen Konferenzraum. Dort standen ein paar Reihen rostiger Klappstühle aus Metall vor einem einzelnen, größeren Holzstuhl. Er bat uns, in der ersten Reihe Platz zu nehmen, und bot uns Ananassaft in winzigen Bechern an. Dennis gab ihm ein halbes Dutzend Stifte und tauschte Adressen mit ihm aus.
Dann betrat der Mann den Raum, den Cindy und Dennis als den Yum King bezeichneten.
Seine langen Locken ergossen sich über beide Schultern wie eine Perücke von Ludwig dem Vierzehnten. Er war groß, hatte eine blasse Haut, einen arroganten Mund, und die Ungeduld sprang ihm aus den Augen. Er trug ein Guayabera-Hemd mit vier Taschen, wie man es häufig auf Fotos sieht. Es war gestärkt und gebügelt und beeindruckte vornehmlich durch sein blendendes Weiß. Es schien neu zu sein. Außerdem trug er eine Armbanduhr und einen roten Siegelring. Dies war das erste Mal, daß ich einen Kubaner Schmuck tragen sah.
Er gab uns die Hand und verzog dabei das Gesicht.
»Ach, was bin ich froh, daß Sie uns empfangen konnten, Señor Emilio«, schwärmte Cindy. »Martin schickt Ihnen seine Grüße. Er freut sich schon darauf, durch uns von Ihnen zu hören. Das hier ist übrigens unsere Freundin von den Filmfestspielen.« Sie nannte keinen Namen. »Martin legt besonderen Wert darauf, daß Sie wissen, daß seine Frau ein Kind erwartet. Und er möchte unbedingt erfahren, was es in Ihrem Leben Neues gibt.«
Der Yum King nickte, als ob Martins Interesse das Mindeste sei, was man erwarten konnte. »Sagen Sie Martin, daß alles in Ordnung ist. Das Politbüro hat meinen Rat hinsichtlich der Erhaltung unserer kulturellen Traditionen aufgegriffen. Und unsere literarische Gemeinschaft weiß Martins Unterstützung sehr zu schätzen.«
Cindy blinzelte unschuldig. »Er liebt Menschen, die mit Literatur zu tun haben! Martin wird sich freuen, wenn er hört, daß die Gerüchte völlig unbegründet sind.«
»Gerüchte?« Er lächelte ironisch. »Wann gibt es mal keine Gerüchte über Kuba? Und was sollen wir jetzt schon wieder getan haben? Die freie Rede unterdrückt haben? Das ist doch lächerlich, finden Sie nicht auch? Sie haben unsere brillanten und international anerkannten Filme auf den Festspielen schließlich gesehen! Das einzige Hindernis für die freie Rede ist der Mangel an lebenswichtigen Gütern, der durch das Embargo Ihrer Regierung verursacht wird.«
Cindy nickte. »Wie wahr. Aber Sie wissen doch, wie sehr die Amerikaner dazu neigen, die Dinge mißzuverstehen. Und die Regierung macht natürlich das Beste aus Berichten wie dem über Lidia Gomez.«
Emilio runzelte die Stirn. »Was für Berichte?«
»Daß sie vor ihrem Haus vom Mob angegriffen wurde – einem Mob, der vom Innenministerium angestiftet wurde, gegen ihre Literatur zu demonstrieren. Daß man sie gezwungen hat, ihre Gedichte zu verbrennen, und daß man sie durch die Straßen getrieben und zusammengeschlagen hat. Und daß Sie sie jetzt unter Hausarrest gestellt haben.«
Seine Augen verengten sich. »Wo haben Sie derlei Gerüchte gehört? Bestimmt nicht von Martin?!«
»O nein«, versicherte sie ihm. »Diese Geschichten kursieren eben.«
Señor Emilio machte eine ungeduldige Handbewegung. »Das sind lediglich Gerüchte.«
Cindys Lächeln wirkte etwas verkrampft. »Und wie sind diese Gerüchte in die Welt gesetzt worden? Ich nehme an, daß Gomez offiziell Beschwerde eingelegt hat?«
»Ich vermute, daß ausländische Journalisten ihre Aussage ausgeschmückt und falsch wiedergegeben haben, um der Sensationslust, die in Ihren sogenannten Nachrichtenagenturen vorherrscht, gerecht zu werden.« Abrupt stand er auf. »Ich bedaure, daß ich noch einen anderen Termin habe. Bitte sagen Sie Martin, daß ich erwarte, daß er das Kind nach mir benennt.« Er lächelte gnädig. »Sagen Sie ihm, daß ich bislang noch nicht die richtige Frau gefunden habe, aber daß eine Bedingung für unsere Ehe sein wird, daß sie den Namen Martin mag.«
Er bot uns seine Hand dar, als ob er erwartete, daß wir seinen Ring küßten. Es folgte ein schlaffer Händedruck, und er verließ uns.
Cindy und Dennis lächelten fröhlich vor sich hin. »Was für ein liebenswürdiger Mensch, was für ein schönes Land«, versicherten sie in einem fort, bis wir im Auto saßen.
Dann sagte Dennis: »Mein Gott, was für ein Arschloch.«
Cindy blickte besorgt drein. »Es ist schlimmer, als ich vermutet hatte. Ich frage mich, wie schlimm sie wirklich dran ist.«
»Die Schriftstellerin?« fragte ich.
Dennis erklärte: »Wenn es ihr gutginge, hätte er alles abgestritten und uns gesagt, daß wir uns jederzeit mit ihr unterhalten könnten. Natürlich hätte er sie verschwinden lassen, damit wir nicht wirklich mit ihr sprechen können, aber er hätte uns zumindest den Eindruck vermittelt, daß es möglich sei. Und daß das, was sie zu sagen gehabt hätte, uns beruhigt hätte.«
»Ich frage mich, ob sie gefoltert wird.« Cindy klang erschüttert. »Und ob man sie zu Hause oder im Gefängnis festhält.«
»Wie auch immer,« überlegte Dennis, »es ist schon seltsam, daß er sich nicht wieder aufs Abstreiten verlegt hat. Wenn wir wirklich harmlose Freunde von Martin wären, hätten wir keine Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Und keine Möglichkeit, seine Worte nachzuprüfen.« Er fuhr langsam die palmengesäumte Straße hinab.
»Es ist fast, als ob sich kürzlich schon jemand anders nach ihr erkundigt hätte«, stellte Cindy fest. »Vielleicht hat Emilio dabei wie üblich alles abgestritten, aber die betreffende Person hat trotzdem Nachforschungen angestellt. Man hatte beinahe den Eindruck, als befürchte er, man würde ihm seine Pressemitteilung in Sachen Gomez ohnehin nicht abnehmen.«
Ich beugte mich nach vorn. Hatte ich nicht über just diese Schriftstellerin jede Menge Wind bei den Freunden meiner Mutter gemacht? War vielleicht sogar sie es gewesen, die Nachforschungen angestellt hatte? Hatte sie sich auf die Suche nach Lidia Gomez gemacht, wie üblich wild entschlossen, zu beweisen, daß ich mich irrte?
Dennis bog nach links ab. Wir fuhren an zahllosen ungestrichenen Häusern vorüber, auf denen noch der Geist früherer Farben zu sehen war. »Dann wollen wir doch mal sehen, wer oder was sich im Augenblick so vor ihrem Haus herumtreibt.« Er drehte sich zu mir um. »Sie haben doch nichts gegen einen kleinen Umweg einzuwenden?«
»Absolut nicht.«
Cindy warf mir einen Blick zu. Als ob sie meine Gedanken lesen könnte, sagte sie: »Eigentlich kann ich es Ihnen auch sagen ... Wir wissen über Ihre Mutter Bescheid.«
Da saß ich nun. Die feuchte Brise aus ihrem geöffneten Fenster peitschte mein Haar zurück.
»Die Jungs unten am Malecón sind ziemlich aufgeregt wegen einer vermißten Amerikanerin. Sie glauben, daß es eine Belohnung in Höhe von hundert Dollar gibt, wenn sie sie finden.« Sie lächelte. »Sie haben mit einem von ihnen geredet und ihm das Bild einer blonden Frau gezeigt. Das heißt, wir nehmen an, daß Sie das waren. Sie sind schließlich ebenfalls blond. Und Sie haben erwähnt, daß Ihre Mutter auch dieses Land bereist hat.«
Ich wußte nicht, ob ich alles zugeben sollte.
»Hier«, sagte sie und wühlte in ihrer Handtasche. Dann gab sie mir ihre Brieftasche. »Sehen Sie selbst – mein Führerschein, mein Presseausweis. Ich bin keine kubanische Spionin oder so etwas. Nur Journalistin.«
Ihr Führerschein lautete auf den Namen Cindy Corlett, wohnhaft in Houston.
Dennis sagte: »In Wirklichkeit sind wir hier, um das Tunnelsystem in Augenschein zu nehmen.«
»Das Tunnelsystem?«
»Bei unseren letzten beiden Besuchen hat unser Kontaktmann uns von gewissen Schächten und unterirdischen Explosionen berichtet. Wir haben uns ein bißchen umgesehen und dabei sogar Wachen am Eingang einer solchen Grube in einem Vorort der Stadt entdeckt.«
Cindy war ganz aufgeregt. »Es geht das Gerücht, daß unter Havanna eine Art Labyrinth errichtet wird. Wir nehmen an, eine Art kubanische Version der Vietkong-Tunnel. Sie wappnen sich für den Fall eines militärischen Angriffs durch die Vereinigten Staaten, bei dem sie erwarten, daß er entweder von der Regierung, von der Mafia – die will ihre Casinos zurückhaben – oder von kubanischen Exilanten ausgeht.«
»Sie meinen, falls Kuba angegriffen wird, flüchtet sich Castro unter die Erde?«
»Wir glauben zumindest, daß er sich auf einen weiteren Guerilla-Krieg vorbereitet«, bestätigte Dennis. »A la Vietnam. Denn wir Amerikaner halten ja nicht gerade den Rekord im Gewinnen solcher Kriege.«
»Fahr etwas langsamer«, sagte Cindy. »Vielleicht solltest du hier besser abbiegen, damit sie uns nicht sehen.«
Sie sah jetzt durch das Fernglas.
Dennis bog um die Ecke und parkte am Bordstein.
»Chinesische Soldaten als Wachen«, sagte Cindy. »Sie scheint sich in ihrem Haus aufzuhalten.«
»Das ist doch gut, oder? Zumindest besser als im Gefängnis?« wagte ich zu vermuten.
»Schon möglich, vielleicht ist das tatsächlich ein gutes Zeichen. Es kann aber auch bedeuten, daß sie in sehr schlechter Verfassung ist und daß man das unter keinen Umständen publik werden lassen will. Castro läßt sehr selten jemanden von seinen Soldaten abführen – das sieht zu sehr nach Bananenrepublik aus. Statt dessen rotten sich die CDR’s – die Comités de Defensa de la Revolución – zu einer ›Demonstration‹ gegen die betreffende Person zusammen. Das soll den Eindruck erwecken, derlei Aktionen gingen von der Basis aus. Natürlich wird es vermerkt, wenn man an solchen Aktionen nicht teilnimmt. Es ist nicht illegal, genau wie es nicht gegen das Gesetz verstößt, in die Kirche zu gehen. Aber man bekommt keinen Job, wenn man nicht mitmacht.«
»Sie haben gesagt, daß man Lidia Gomez durch die Straßen geschleift und geschlagen hat?«
»Wir haben gehört, daß die Demonstrationen drei Tage dauerten, daß sie getreten, mit Steinen beworfen und mit Stöcken geschlagen wurde und daß man sie gezwungen hat, ihre Gedichtbände zu essen.«
»Wenn meine Mutter hier war, um das zu überprüfen« – Cindy wandte sich abrupt um, sie sah erschrocken aus – »wenn sie aus irgendeinem Grund etwas in der Art getan hat, was wäre ihr dann zugestoßen?«
»Warum sollte Ihre Mutter etwas Derartiges tun? Wer sind Sie?« Cindys Stimme klang scharf.
»Es ist nicht die Frage, wer ich bin, sondern wer sie ist. Sie ist ihr Leben lang Aktivistin gewesen und im Rahmen einer Studienfahrt der Women’s International League for Peace and Freedom hierhergekommen. Aber ich ...« Ich fuhr mir mit den Händen durchs Gesicht und wischte mir den Schweiß ab. »Ich habe versucht, ihr bei allem revolutionären Enthusiasmus ein gewisses Maß an Realitätsbewußtsein zu vermitteln. Ich hatte gerade einen Artikel über eben jene Schriftstellerin gelesen und stellte ihrer WILPF-Gruppe Fragen darüber. Sie haben sich ungeheuer ereifert und alles abgestritten. Und jetzt frage ich mich, ob meine Mutter einfach nur beweisen wollte, daß ich der kapitalistischen Propaganda auf den Leim gegangen bin.«
»Seit wann wird sie vermißt?«
»Die anderen sind vorgestern nach Hause geflogen. Sie war nicht im Flugzeug.«
»Sie haben bislang noch keine kubanischen Beamten oder Funktionäre nach ihr gefragt?«
»Nein.«
Cindy nickte. »Gut so. Sie hätten sowieso keine Informationen bekommen, aber Sie könnten jede Menge Staub aufwirbeln und Ärger kriegen.«
Selbst Dennis sah jetzt verschwitzt aus. In der Nachmittagshitze war die Luft feucht wie in der Sauna. Niemand war auf der Straße. Unser billiges russisches Auto stank nach minderwertigem Plastik und verkrustetem Dreck.