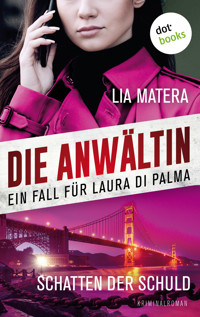Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Willa Jansson
- Sprache: Deutsch
Dunkle Familienbande, die den Tod bedeuten könnten: Der Justizthriller »Zornige Anklage« von Lia Matera jetzt als eBook bei dotbooks. Die Spezialität von Anwältin Willa Jansson scheint es zu sein, zielgenau auf brandgefährliche Fälle zuzusteuern: Als sie Zeugin eines bewaffneten Überfalls wird, weiß Willa, dass sie besser auf die Polizei warten sollte – doch stattdessen stürzt sie sich mitten in die Gefahr … denn Willa kennt den Täter: Arthur Kenna ist ein Freund ihrer Familie, ein bekannter Pazifist und Aktivist. Warum sollte er nun einen völlig Fremden mit einer Waffe bedrohen, und warum wirkt er dabei wie ein in die Enge getriebenes Tier? Um mehr herausfinden zu können, verhilft Willa ihm kurzerhand zur Flucht – und ahnt nicht, dass sie sich damit in ein perfides Spiel verstrickt, das bald all ihr Wissen um Abgründe der menschlichen Seele fordert … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Zornige Anklage« von Lia Matera ist Band 5 ihrer Krimireihe um die toughe Anwältin Willa Jansson und den besonderen Flair von San Francisco in den 70er und 80er Jahren. Jeder Roman kann unabhängig gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Spezialität von Anwältin Willa Jansson scheint es zu sein, zielgenau auf brandgefährliche Fälle zuzusteuern: Als sie Zeugin eines bewaffneten Überfalls wird, weiß Willa, dass sie besser auf die Polizei warten sollte – doch stattdessen stürzt sie sich mitten in die Gefahr … denn Willa kennt den Täter: Arthur Kenna ist ein Freund ihrer Familie, ein bekannter Pazifist und Aktivist. Warum sollte er nun einen völlig Fremden mit einer Waffe bedrohen, und warum wirkt er dabei wie ein in die Enge getriebenes Tier? Um mehr herausfinden zu können, verhilft Willa ihm kurzerhand zur Flucht – und ahnt nicht, dass sie sich damit in ein perfides Spiel verstrickt, das bald all ihr Wissen um Abgründe der menschlichen Seele fordert …
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
Sowie ihre Reihe um Willa Jansson mit den Kriminalromanen:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Last Chants« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Dunkle Gesänge« im Econ Verlag
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Econ Verlag GmbH, Düsseldorf
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Jose Luis Stephens
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-191-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Zornige Anklage« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Zornige Anklage
Der fünfte Fall für Willa Jansson
Aus dem Amerikanischen von Nicole Hölsken
dotbooks.
Kapitel 1
Ich verbrachte drei endlose Jahre damit, ein Stück Papier zu erwerben, auf dem steht: »Willa Jansson, Doktor des Rechts, ausgestattet mit allen damit verbundenen Rechten und Privilegien«. Es überraschte mich nicht, daß die Leute danach von mir erwarteten, daß ich als Anwältin arbeitete. Ich widerstand der Versuchung, ihre Erwartungen zu enttäuschen (ganz zu schweigen von der Versuchung, mein Studiendarlehen nicht zurückzuzahlen), wurde zunächst Anwältin für Arbeitsrecht, dann Anwältin für Körperschaftsrecht, dann Hilfsrichterin. Aber nachdem ich mich jahrelang mit Haarspaltereien, mit akribisch-pingeliger Arbeit und in sachlichem Ton abgefaßten Bestätigungen des Widersinnigen befaßt hatte, machte ich mir über meine Arbeit nur noch wenige Illusionen ‒ ebensowenig wie über die damit verbundenen Rechte und Privilegien. Nachdem ich in vier Jahren drei Jobs geschmissen hatte, diente ich häufig eher der allgemeinen Aufmerksamkeit als dem Recht. Und als es auch nichts Neues mehr für mich war, immer bei Kasse zu sein, stellte ich fest, daß mich der Beruf der Anwältin immer stärker anödete. Unglücklicherweise waren meine Gläubiger von der Idee jedoch nach wie vor begeistert.
Aber ich hatte noch keine Gelegenheit gehabt, meines neuesten Jobs überdrüssig zu werden, als ich die Market Street überquerte, um meinen ersten Tag als Anwältin für Multimediafragen zu beginnen. Ich hatte keine Ahnung, ob ich diese Arbeit mögen würde, aber ich mochte zumindest schon mal den Klang dieses Wortes. Es war so modern, klang nach den Neunzigern: eine Karriere, die wie geschaffen war für eine Frau, die den Ballast der sechziger Jahre aus dem Fenster geworfen hatte, um scharf auf die Datenautobahn abzubiegen.
Aber an diesem Morgen, in der nichtvirtuellen Realität, ging ich zu Fuß.
Wie üblich schien die Market Street vor ungeduldigen Autos geradezu überzukochen. Ich liebte meinen Honda zu sehr, um ihn einem Moloch aus aufheulenden Motoren, kreischenden Bremsen und der Jagd nach einer Parklücke aussetzen zu wollen. Außerdem war ich eine nervöse Fahrerin, besonders in der Rushhour. Also hatte ich den Bus von Haight nach Market genommen.
Wie es schien, hatten sich Unmengen von Büroangestellten für die gleiche Strategie entschieden. Die Fußgängerüberwege waren beinahe zu schmal für all die Anwälte, Börsenmakler und Bankangestellten, die mit hochgezogenen Schultern und in ihren Regenmänteln vergrabenen Fäusten dort entlanghasteten. Wir waren eine mürrische Armee, die nun das Bankenviertel stürmte ‒ und die Grenze zwischen Warenhäusern und Wolkenkratzern, zwischen dem spanischen Geschnatter und dem schrulligen Schweigen der angloamerikanischen Bevölkerung, zwischen dem billigen Bier und den schicken Weinbars.
Ich blieb an der Ecke stehen und wartete darauf, daß die Ampel auf Grün sprang. Ich sah meinem Job mit einiger Sorge entgegen, denn ich verfügte keineswegs über das ideale Leistungsprofil. Es war mir nie gelungen, mich als Teil eines Teams zu verstehen. Vielleicht lag es ja an mir. Aber ich fand meine früheren Kollegen zumeist bestenfalls konventionell und humorlos. Schlimmstenfalls kamen sie mir herzlos und anmaßend vor. Meine Eltern hatten mich oft zum Wahnsinn getrieben, aber sie hatten mich immerhin an bessere Gesellschaft gewöhnt.
Auf der Market Street nahmen sich lediglich die Obdachlosen Zeit. Gauner ließen vor den Augen der Menschen, die in die Geschäfte strömten, Juwelen aufblitzen. Teenager boten ihren Körper feil. Mürrische Flüchtlinge bettelten um Geld. San Francisco bot nicht viele Möglichkeiten, um ohne Anstellungsverhältnis seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Und da ich zu den wenigen Anwälten gehörte, die nicht an einem Justizthriller arbeiteten, brauchte ich diesen Job.
Als die Ampel also auf Grün sprang, ließ ich mich vom Yuppie-Strom über die Straße spülen. Als der zu beiden Seiten von Hochhäusern begrenzte Korridor vor mir auftauchte, hatte ich das Gefühl, mit dem Floß durch den Grand Canyon zu treiben. Tausende von dahineilenden Büroangestellten ähnelten dem tosenden, weiß aufschäumenden Wasser. Ich versuchte, nicht daran zu denken, wie lange es noch dauern würde, bis ich das nächste Mal Urlaub hätte.
Ich hatte die letzte Woche damit verbracht, einen gewissen Arbeitsenthusiasmus zu entwickeln. Wenn ich jetzt so weitermachte wie letzte Woche, würde meine positive Einstellung ungefähr bis zum Mittagessen andauern. Zumindest war man mit diesem Job mitten drin. Ich hatte meine zur Boheme gehörenden Eltern schon einmal schockiert, als ich mich vor zwei Jahren bei einem erfolgreichen Konzern in L. A. bewarb. In einem eleganteren Umfeld hatte ich mich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie abgemüht, aber es dauerte kein Jahr, bis mein innerer Antrieb dahin war.
Ich war nun schon seit fünf Monaten arbeitslos und das, ohne eine Erklärung dafür zu haben, warum ich eine solch große Firma verlassen hatte. Ich hatte meine Ersparnisse aufgebraucht. Und ich war zu einer unangenehmen Schlußfolgerung gekommen: Wenn ich eine weniger gut bezahlte Arbeit angenommen hätte, die ich gern tat, statt zu versuchen, Geld durch einen Job zu scheffeln, den ich haßte, dann wäre ich jetzt nicht stellungslos. Ich wäre finanziell flüssig, und mein Lebenslauf makellos. Keine Frau von sechsunddreißig Jahren sollte vor sich selbst zugeben müssen, daß ihre Eltern recht gehabt hatten.
Und als ob das nicht genug wäre, verdankte ich meinen neuen Job meinem Vater. Es begann, als er sich in die Idee einer Online-Demokratie verliebte. Er fing an, mit seinen Freunden am Computer zu spielen. Dann entdeckte er einen latenten künstlerischen Zug. Beinahe hätte er sogar einen bewußtseinserweiternden Posterkünstler adoptiert, der Computerkurse für Graphikprogramme gab. Tagelang hockte er mit einem dieser miesen Kybernetik-Gurus, dem berühmten »Brother Mike« aus San Francisco, zusammen. Er begann, längst vergessene, entfernte Bekanntschaften aufzufrischen, nur weil auch sie gerade damit beschäftigt waren, wie verrückt ihre Computer aufzurüsten.
Die Wohnung meiner Eltern in der Haight Street machte eine Verwandlung durch. Die Poster, auf denen zum Boykott von Waren aus der Dritten Welt aufgerufen wurde, wurden durch Fraktale ersetzt. Die alte Druckmaschine, eine Veteranin, die den Druck von Millionen von Flugblättern überstanden hatte, wurde von einem Farbtintenstrahldrucker verdrängt. Stapelweise wurden Flugblätter verschickt, und die Menge wurde nur noch durch die der Petitionen und polemischen Schriften übertroffen, die sie per E-Mail weiterleiteten und die sich andere Teilnehmer aus dem Netz herunterladen konnten. Meiner Mutter war schnell klargeworden, was für Möglichkeiten in den Tausenden von Mailboxen steckten, und sie gewöhnte sich an, ihre Bekehrungsversuche auf elektronischem Wege vorzunehmen.
Zuerst glaubte ich, daß es sich um einen besonderen Tick meiner Eltern handelte, einen von Tausenden. Aber ich war überrascht, welcher Strom von Menschen sich durch ihre Wohnung zog. Bald hatte ich erkannt, daß sich viele alte Freunde der Familie, Aktivisten und Spinner, dem Computer ebenso wie sie sich vormals der Flower Power verschrieben hatten. Sie nutzten den PC, um Comics zu verfassen, Collagen anzufertigen, Videofilme zu schneiden und ihre eigene Musik damit zu komponieren. Eine ganze Generation hatte sich in den Cyberspace aufgeschwungen.
Ein Freund, der schon für ein paar Programme sein Patent angemeldet hatte, berichtete meinem Vater von einer Kanzlei aus »Technohippies«, wie er sie nannte. Er hatte gehört, daß sie auf der Suche nach einem geeigneten Mitarbeiter waren.
Da sich auf meinem Bankkonto nur noch ein paar hundert Dollar befanden, rief ich sofort bei der Firma an. Ich sammelte all meine Zeugnisse und absolvierte ein paar Crashkurse. Ich sah mir Videos über Computergraphiken an, bis ich die stilistischen Tricks kannte. Ich riskierte ein Koma, weil ich Fachzeitschriften zum Thema Software-Copyright las.
In meinen Vorstellungsgesprächen versuchte ich mich als Computerexpertin zu profilieren, indem ich von Programmen und Patenten vor mich hin brabbelte, als ob ich mich schon seit langem ‒ und nicht erst seit ein paar Stunden ‒ für dieses Thema interessierte. Ich betonte, daß L.A. noch keine adäquaten Media-Connections besitze. Ich ließ den Begriff Datenautobahn fallen. Nach zwei Wochen und vier Vorstellungsgesprächen mit den Partnern von Curtis & Huston wurde ich eingestellt.
Erst jetzt, in diesem kritischen Augenblick, da ich an einem nieseligen Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit war, begann ich, mir zu wünschen, wieder im Bett zu liegen. Ich eilte die Montgomery Street hinauf, die in das Herz des Finanzdistrikts führte. Bei den meisten meiner Jobs in San Francisco hatte ich näher am Einkaufszentrum gearbeitet, in einem von diesen geschmacklosen Löchern, die von irgendwelchen Wohnungsbauprojekten umgeben waren. Die Umgebung meiner neuen Arbeitsstelle war blitzblank gewienert und mit Blumen geschmückt. Sie roch nach Brezeln und Espresso, nach Küstenwind und Abgasen. Um mich herum fügte die wabernde Menge der Büroangestellten gelegentlich noch einen Hauch von nasser Wolle oder Haargels hinzu.
Ich machte einen großen Bogen um den diensthabenden Cop, der in seinen Walkie-talkie sprach. Die übrigen Fußgänger, die jetzt in der Rushhour unterwegs waren, machten es genauso ‒ es war viel zu feucht, um stehenzubleiben und Maulaffen feilzuhalten. Als ich an dem Polizisten vorbeiging, sah ich in die Richtung, in die er seinen Blick gewandt hatte. Auf der anderen Straßenseite, etwa einen Häuserblock entfernt, stand ‒ zu meiner Überraschung ‒ ein alter, teurer Freund meiner Eltern.
Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich daran, zu ihm hinüberzugehen. Ich liebte keineswegs alle Freunde meiner Eltern, insbesondere nicht die meiner Mutter, aber ich liebte Arthur Kenna.
Im nächsten Augenblick jedoch sah ich, was auch der Cop gesehen hatte: Arthur hielt eine Waffe in den Händen.
Eine Waffe. Ich blieb stehen und schüttelte den Kopf. Arthur mit einer Waffe in der Hand? Ich wäre weniger schockiert gewesen, wenn ich gesehen hätte, wie meine eigene Mutter ‒ ihres Zeichens Pazifistin, Vegetarierin und überzeugte Gandhi-Anhängerin ‒ mit einer Waffe herumgefuchtelt hätte.
Aber innerhalb weniger Sekunden entdeckte ich etwas noch viel Erschreckenderes: Arthur richtete die Waffe auf einen Menschen. Ein anderer Fußgänger, der mir den Rücken zuwandte, stand mit erhobenen Händen da ‒ die klassische Pose des Opfers in einem Raubüberfall.
Nur, daß Arthur nie im Leben einen anderen Menschen berauben würde. Arthur Kenna war Mythologe, Ethnobotaniker und Anthropologe, ein liebenswerter alter Wissenschaftler, der praktisch immer wie ein Onkel für mich gewesen war. Er hatte mir erzählt, daß er als Kind geschlagen worden war, weil er sich geweigert hatte, auf die Jagd zu gehen. Er hatte sogar damals schon das Gefühl gehabt, daß jemand, der eine Waffe bei sich trug, um einen Sport auszuüben, »die Große Mutter beleidigte«. Seine bekannteste Theorie basierte auf einer neunstündigen Sondersendung im Fernsehen und besagte, daß die gewalttätigsten Handlungsweisen eine kulturelle Indoktrination erforderten, eine Kriegermythologie, daß Gewalt ihren Ursprung nicht in den normalerweise brachliegenden Trieben habe. Ironischerweise verhöhnten die gleichen Menschen, die unsere Kultur als »Kultur der Opfer« verspotteten, seine Thesen als naiv. Sie waren einhellig der Meinung, daß Brutalität natürlich, Klagen darüber jedoch unnatürlich seien.
Arthurs Widerlegung war zu durchdacht, um mit einem höhnischen Grinsen abgetan werden zu können. Und er meinte es ehrlich, er glaubte nicht an Gewalt, und genausowenig glaubte er daran, daß sie ein Bestandteil unserer Persönlichkeit ist. Und nun stand er hier und hielt einen anderen Menschen mit einer Waffe in Schach?
Ich konnte es nicht glauben. Ich glaubte es einfach nicht. Dieses eine Mal vertraute ich dem, was ich wußte, mehr als dem, was ich sah.
In Arthurs Umgebung blieben die Leute stehen, offensichtlich waren sie bestürzt. Dann traten sie ängstlich zurück. Arthur schien sich vollkommen auf die Waffe zu konzentrieren, als ob es sich um ein Reptil handelte, das sich in seiner Hand verwandelt hatte. Der Mann, der seine Hände in die Höhe hielt, jammerte vor sich hin. Ich konnte nicht verstehen, was er sagte, ich vernahm nur den Ton seiner Stimme: voller Panik und sehr hoch klingend. Ich wirbelte herum: der Cop! Gerade rief er nach Verstärkung, bevor er vorwärtspreschen und Arthur verhaften würde.
Arthur Kenna hatte vor dreißig Jahren an den mittlerweile berühmten LSD-Experimenten in Harvard teilgenommen. Als prominenter Ethnobotaniker war es nur natürlich, daß man ihn an dem Experiment hatte teilhaben lassen. Er hatte damals an einer Studie über den Einfluß von Pflanzen auf eine Kultur gearbeitet. Er hatte brasilianischen Eingeborenen Kostproben von Ayahuasca und Yagetee gegeben und psychoaktive Pilze bei den sibirischen Bauern gegessen. Er hatte sich die gesamte Speisekarte botanischer Highlights im Wortsinne einverleibt ‒ und sich erheblich häufiger erbrochen, als es in jedem anderen Beruf notwendig gewesen wäre. (Das war im übrigen ein wichtiger Faktor, warum er sein Forschungsinteresse von der Ethnobotanik zu Anthropologie und Mythologie verlegt hatte, wie er mir sagte.) Unglücklicherweise war Arthur nicht im Land gewesen, als der Besitz von LSD für gesetzwidrig erklärt wurde. Er wurde verhaftet, und ihm drohte eine Anklage, falls er sich noch einmal dazu überreden ließe, damit herumzuexperimentieren.
Und vor ein paar Jahren wurde er erneut verhaftet und vorbestraft ‒ weil er meine Eltern auf eine Demonstration gegen Lockheed begleitet hatte. Arthur hatte gar kein Interesse an Politik, aber als meine Eltern sich auf den Weg machten, hatte Arthur gerade ein Gespräch mit ihnen begonnen. Also begleitet er sie auf die Demo, um die Sache zu Ende diskutieren zu können.
Kürzlich hatte ich mit meiner Mutter eine leidenschaftliche Debatte gehabt. Kalifornien hatte ein Gesetz verabschiedet, das besagte, daß eine dritte Vorstrafe mit mindestens fünfundzwanzig Jahren Gefängnis geahndet werden sollte, gleichgültig, ob das fragliche Vergehen nun gewalttätiger Natur war oder nicht. Meine Mutter, eine kämpferische Aktivistin und leidenschaftliche Botschafterin der Friedensbewegung, hatte bereits mehr als drei Vorstrafen. Noch eine weitere, und sie würde ihr Lebtag nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden. Sie würde im Gefängnis sterben.
Jetzt beobachtete ich unseren lieben alten Freund, wie er kurz davor war, verhaftet und eines weiteren Verbrechens angeklagt zu werden. Und wenn es nicht eine Erklärung gab, die sich meinem Verständnis entzog, würde er verurteilt werden.
Ich hatte selbst schon einmal zwei Monate im Gefängnis verbracht. Ich wünsche es keinem, schon gar nicht einem siebzigjährigen, grundanständigen alten Wissenschaftler.
Aus welchem Grund das hier jetzt auch geschehen mochte, ich konnte den Gedanken nicht ertragen, daß Arthur für den Rest seines Lebens eingesperrt sein würde. Ich konnte nicht einfach so zusehen.
Ich hatte nur einen Augenblick zur Verfügung, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und selbst dann war er vielleicht gar nicht schnell genug, um vor einem jungen Polizeibeamten davonzulaufen. (Wenn meine Mutter ihn damals nur nicht zu dieser Demonstration mitgeschleppt hätte!)
Ich überquerte die Straße und hatte den Verkehr vollkommen vergessen, obwohl mir der Klang quietschender Bremsen sagte, daß der Verkehr mich nicht vergessen hatte. Als ich Arthur erreichte, war es bereits zu spät, um ihn zu warnen. Der Cop war genau hinter mir. Ich konnte das an Arthurs nervösem Ruf erkennen.
»Officer«, stieß er hervor. Dieses eine Wort, das weder von Panik noch von Feindseligkeit begleitet wurde, zerstreute meine letzten Zweifel. Auch wenn der äußere Anschein dagegen sprach, Arthur war nicht gefährlich.
Wenn ich zu den Leuten gehört hätte, die sich einen Abschluß als Jurist erkauft haben, dann hätte ich vielleicht eine »Gib-auf-und-laß-mich-dein-Anwalt-sein«-Rede von mir gegeben. Aber mein Vertrauen in die Gerechtigkeit unserer Gesetzgebung konnte man in Mikron messen.
Ich wußte, daß der Distrikt-Staatsanwalt aus dieser Situation eine Straftat machen würde, wie auch immer die Entschuldigung oder die mildernden Umstände aussehen würden.
Arthur für immer im Gefängnis. Das durfte ich nicht riskieren. Ich mußte irgend etwas tun.
Ich stand dem Officer im Blickfeld. Aus dieser Tatsache zog ich meinen Vorteil und wirbelte herum, so daß es schien, als ob Arthur mich ergriffen hätte, um mich hinter seine Waffe zu schieben.
Es war kein besonders schönes Gefühl.
Ich vermutete, daß ‒ wo dieses Gerät auch herkommen mochte, und aus welchem Grunde auch immer er es in Händen hielt ‒ Arthur die Waffe wahrscheinlich nicht entsichert hatte ‒ vielleicht wußte er noch nicht einmal, wie man das anstellte. Er würde mich keinesfalls erschießen. Zumindest nicht mit Absicht.
»Treten Sie zurück, bitte«, rief ich dem Cop zu. »Er bedroht mich mit der Waffe.« Ganz sicher klang meine Stimme falsch und dümmlich, vielleicht war mein Englisch noch nicht einmal richtig zu verstehen.
Hinter mir begann Arthur, alles abzustreiten. Glücklicherweise war er aufgeregt und stotterte.
»Er wird mich umbringen«, stieß ich hervor. Ich blickte über meine Schulter. Arthur machte ein verblüfftes Gesicht. »Lassen Sie ihn entkommen.« Ich versuchte, Arthur meine Absicht verständlich zu machen. »Er wird mich erschießen, wenn Sie uns aufzuhalten versuchen!«
Ich hatte das Gefühl, im falschen Film zu sein. Arthur ging es ähnlich: »Ich würde niemals jemanden verletzen, ich würde ‒«
»Wenn Sie Zurückbleiben, wird er mir nichts antun«, unterbrach ich ihn. Ich warf einen Blick auf Arthurs Opfer. Er sah noch erstaunter aus als alle anderen.
»Aber Willa«, protestierte Arthur.
»Aber willst du was? Mich umbringen? Bleiben Sie zurück!« drängte ich den Cop. Arthur kam absolut nicht mehr mit. »Vielleicht läßt er mich laufen, wenn Sie ihn laufenlassen!«
Ich mußte mich nicht besonders anstrengen, um kläglich zu klingen.
Der Cop verwandelte sich in einen Macho: »Zurücktreten. Alles zurücktreten. Machen Sie ihm Platz.«
Die Umstehenden hatten beinahe Bocksprünge übereinander hinweg gemacht, um außer Reichweite zu gelangen. Und die Menschen, die sich uns näherten, blieben stehen, als sie den gestikulierenden Cop sahen. (Ich habe mich immer gefragt, was Büroangestellte auf dem Weg zur Arbeit eigentlich aufhalten kann.)
Ich begann zurückzugehen, denn ich war sicher, daß Arthur wie angewurzelt stehenbleiben würde, wenn ich mich vorwärts bewegte. Wodurch ich zur am wenigsten bedrohten Geisel aller Zeiten gemacht würde …
Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn dazu hätte bringen können, meinen Hals zu umschlingen. Deshalb schob ich meinen Arm nach hinten und verdrehte ihn so, als ob er ihn mir auf dem Rücken festhielte. Ich vergaß zusammenzuzucken, aber egal. Ich versetzte Arthur einen Stoß nach hinten.
»Lassen Sie uns gehen«, sagte ich zu Arthur, während ich den Cop ansah. »Er ist gefährlich.«
Durch meinen Stoß bekam Arthur zwar nicht vermittelt, was ich wollte, aber doch etwas Schwung. Als er zurücktaumelte, paßte ich mich seinen Schritten an. Ich hielt mich so nahe an ihn wie Ginger an Fred. Ich griff nach seinem Trenchcoat, dann schwenkte ich um ihn herum und versuchte, uns eine andere Richtung zu geben. Ich hoffte, daß es so aussah, als ob er dieses Manöver initiierte.
Dank meiner strategisch geschickten Umklammerung seines Mantels drehte Arthur sich mit mir. Aber er protestierte, und seine Stimme war laut und ungläubig. »Was tust du denn da?«
Der Cop sagte: »Nichts. Beruhigen Sie sich. Sie brauchen Ihrer Geisel kein Leid anzutun. Das bringt Ihnen gar nichts.«
»Bleib bei mir.« Ich glaubte, Arthur diese Worte zugeflüstert zu haben. Aber wahrscheinlich hatte ich sie geschrien, so nervös wie ich war.
Denn immerhin hatte mich der Polizist gehört. »Machen Sie sich keine Sorgen, Lady. Behalten Sie einfach nur einen kühlen Kopf.« Er schrie Arthur zu: »Verstärkung ist im Anmarsch! Sie kommen nicht weit! Ergeben Sie sich!«
Mit meiner freien Hand streichelte ich die Arthurs, in der er keine Waffe hielt, dann griff ich danach. Ich zog ihn hinter mir her und versuchte mich so zu verhalten, als ob er mich vorwärts stieß.
Als ich loslief, hatte ich keinen besonders ausgeklügelten Plan. Ein paar schreckliche Augenblicke später erschien mir mein Verhalten geradezu lächerlich. Ich hätte das sinkende Schiff beinahe verlassen.
Wenn da nicht immer wieder der eine Gedanke gewesen wäre: Noch eine Straftat, und Arthur würde niemals mehr aus dem Gefängnis entlassen werden.
Dieser Gedanke wurde von einem sogar noch unwillkommeneren gefolgt. Wenn die Cops uns erwischten ‒ und das war ziemlich wahrscheinlich ‒, wenn man in Betracht zog, daß Arthur völlig verwirrt war und mir jegliche Strategie fehlte, würde man bald herausfinden, daß ich mit Arthur befreundet war. Vor dem Hintergrund dieser Information würde man diese Szene neu interpretieren und das Offensichtliche erkennen: daß ich mit Arthur zusammenarbeitete. Außerdem würden sie mir wohl kaum glauben, daß meine Beteiligung die Folge unangemessenen Samaritertums war. Sie würden mich als Begünstigerin der Tat betrachten ‒ um was für eine Tat es sich auch handeln mochte. Vielleicht würden sie sogar annehmen, daß ich an Arthurs »Verbrechen« teilhatte. (Ich konnte mir immer noch nicht vorstellen, daß irgend etwas Arthur veranlaßt haben konnte, eine Waffe in die Hand zu nehmen!) Sie würden mich für Arthurs Komplizin halten.
Bestenfalls würde ich an meinem ersten Arbeitstag zu spät kommen.
Arbeit: Ich hatte nach meinen Vorstellungsgesprächen die Nachbarschaft erkundet. Ich hatte das nächste Café: und Pasta-Restaurant, das nächste Lokal, Buchhandlungen, Reinigungen und Supermärkte ausfindig gemacht.
Ich war ganz beeindruckt gewesen, als ich all die Hinterhofbistros, die Mini-Plazas mit den Delikatessengeschäften im Untergeschoß, die engen Parkauffahrten, die labyrinthähnlichen Verbindungen zwischen den Wolkenkratzern entdeckt hatte. Wenn man durch die Straßen eilte, und insbesondere, wenn man in dem Bankenviertel abtauchte, hatte man das Gefühl, sich lediglich zwischen großen unpersönlichen Gebäuden zu bewegen. Aber wenn man dahinschlenderte, enthüllte dieser Teil der Stadt seine architektonischen Grotten und Enklaven, seine hoch hinaufführenden Treppen und blitzblank gefegten Gassen.
Im Augenblick standen wir vor einer kleinen Plaza. Sie befand sich inmitten zweier Wolkenkratzer wie zwischen den Hälften eines Sandwiches und sah aus wie der mit Blumenkübeln verzierte Eingang zu einem U-Bahn-Schacht. Rolltreppen führten hinauf zu einem Friseur und einem Reisebüro und hinunter zu einem Supermarkt und einem Delikatessengeschäft. Der Supermarkt besaß eine Hintertür. Ich hatte sie letzte Woche irrtümlich geöffnet und dahinter einen Lagerraum mit einem Ausgang entdeckt.
Ich zog Arthur zu der Rolltreppe und zwang ihn, mir die Treppen hinab zu folgen. Hinter uns konnte ich eine Bewegung und Flüche hören, vielleicht hatten wir ein paar Leute, die eilig weiterkommen wollten, angerempelt. Mit etwas Glück würden sie auch dem Cop im Weg sein.
Ich zog Arthur in den Supermarkt. Zwar ließ ich seinen Trenchcoat los, aber ich hielt seine Hand fest. Ich zerrte ihn eilig durch das Geschäft und zur Hintertür wieder heraus, sehr zum lautstark artikulierenden Befremden der chinesischen Besitzer. Ich glaubte die Rufe des Polizisten zu hören, der uns befahl, stehenzubleiben, aber er war uns nicht nahe genug, als daß wir ihm hätten Beachtung schenken müssen. Ich öffnete die Tür zum Lagerraum, auf der TREPPE stand.
Ich nahm an, daß der Cop irgendwo hinter uns war, aber ich sah mich nicht um. Zu Arthur sagte ich: »Wir müssen vor ihm weglaufen! Komm mit.«
»Aber Willa ‒«
»Komm mit!« Ich ließ seine Hand fallen. Ich wollte, daß er mit mir Schritt hielt.
Ich rannte die Treppen hinauf und erreichte eine Tür, auf der AUSGANG stand, und stieß sie auf. Sie führte auf eine schmale Gasse hinaus. Diese überquerte ich schnell, passierte die Hintertür einer Bank (zu offensichtlich) und betrat ein Restaurant. Ich rannte hindurch, vorbei an verärgerten Männern in Smokinghemden, und hinten wieder hinaus. Ich rannte über die Straße und in ein weiteres Bankhaus hinein. Es gelang mir, während der ganzen Zeit oft nach hinten zu schauen, Arthur anzusehen, die beschwörende Panik meines Blickes auf ihn zu richten.
Arthur folgte mir.
Er hatte immer noch die Waffe in der Hand. »Gib mir das!
Um Himmels willen.« Ich steckte sie in meine Kombination aus Hand- und Aktentasche. Es war ein Wunder, daß nicht noch viel mehr Menschen Jagd auf uns machten.
Ich hoffte, daß der Polizist zu langsam gewesen war, um mitzubekommen, in welches Haus wir uns geflüchtet hatten.
Wir rannten drei Etagen hinauf, dann durch einen weiteren Notausgang. Wir fanden uns auf einem mit Teppich ausgelegten Korridor wieder. Auf einer Tür in der Nähe stand DAMEN.
Ich zog meine Jacke aus und sagte: »Zich deinen Mantel aus. Sofort!«
Als Arthur gehorchte, stieß ich die Tür zur Toilette auf.
»Arthur, du mußt dich ein paar Minuten lang verstecken, ja?«
»Aber Willa, ich habe doch versucht, es zu erklären, das ist alles ein ‒«
Ich griff nach seinem Trenchcoat. »Ich werde in zwei Minuten wieder mit dir zusammentreffen«, versicherte ich ihm. »Vertrau mir. Versteck dich.«
Ich ging in den Waschraum, stopfte unsere Jacken in den Papierkorb und bedeckte sie mit Papiertüchern. Dann machte ich mir die Hände naß. Ich befeuchtete meine Haarspitzen. Die Hippie-Jugend, nach der ich mich auf meine alten Tage sehnte, schien plötzlich zum Greifen nahe zu sein, so sehr wie sich meine Haare kräuselten. Ich drehte sie zu einem dünnen Zopf, den ich mir in die Bluse stopfte. Die Bluse hatte einen hohen Kragen. Ohne Jacke, so hoffte ich, würde es so aussehen, als arbeitete ich in dem Gebäude. Wie eine Sekretärin mit Kurzhaarfrisur.
Ich fand Arthur, der müßig die Namensschilder an der Eingangstür einer Anwaltskanzlei las. Er stand direkt gegenüber der Rolltreppe. So viel zum Thema »Verstecken«.
»Wir haben keine Zeit zu verlieren«, warnte ich ihn. »Sicher ist überall Polizei. Wir müssen uns trennen. Du nimmst die Rolltreppe, ich die Treppe. Wir treffen uns auf der Straße.«
Ob ich ohne Jacke bei der Arbeit auftauchen konnte?
»Was ist mit deinem Haar passiert, Willa?« Er schien über die Veränderung meines Erscheinungsbildes erstaunt zu sein.
»Mach dir darüber keine Gedanken.« Ich drückte für ihn auf den Knopf, der die Rolltreppe in Gang setzte. »Geh in Richtung Supermarkt. Ich stoße dann an der Ecke zu dir.«
Ich schoß die Treppen wieder herunter. Ein kurzer Gang führte in die mit Alabaster verkleidete Lobby. Ein paar Menschen warteten auf Aufzüge und warfen dabei einen Blick auf ihre Uhr. Andere stießen die Glastüren zum Haupteingang auf. Der Cop, der Arthur und mir gefolgt war, beobachtete sie.
Er sprach intensiv mit seinem Walkie-talkie. Ich versuchte, mit lässigem Schritt an ihm vorbeizugehen, aber mein Herz raste. Es ist nun mal eine Realität, daß Männer keine besonders gute Beobachtungsgabe besitzen. Aber wenn dieser hier die Ausnahme von der Regel war, würde man mich den Hunden zum Fraß vorwerfen.
»He!« bellte der Polizist. »Haben Sie jemanden auf der Treppe ‒?« Noch bevor er zu Ende reden konnte, schüttelte ich den Kopf ‒ vielleicht zu schnell. Er knurrte und hob den Walkie-talkie wieder an die Lippen. Glücklicherweise war er seiner Spezies treu. Er hatte mich als langhaarige Blondine in Erinnerung, nicht als Frau mit einem spezifischen Gesicht.
Ich verließ das Gebäude und tauchte im Strom der anderen Angestellten unter. Überhitzt vom Rennen und vor Sorge und naß vom Nieselregen auf meiner Bluse, hatte ich plötzlich kein Vertrauen mehr in Arthur. Was, wenn sie ihn allein schnappten ‒ wenn er einem Polizeibeamten in die Arme gelaufen war, sobald ich ihn verlassen hatte? Würde er ihnen meinen Namen nennen? Würde er ihnen sagen, was ich getan hatte, weil er fest an seine Freilassung glaubte? (Wenn ich als Anwältin eines gelernt habe, dann, wie wenig Polizisten bereit sind, einem zu glauben. Und warum sollten sie auch.)
Mein Vertrauen in Arthur wurde weiterhin durch die Tatsache geschmälert, daß er mit meiner Mutter befreundet war. Ich wußte, wie meine Mutter darauf reagierte, wenn sie oder jemand anders verhaftet wurde. Sie war stets sicher, daß sie ihr Gegenüber überzeugen konnte, denn schließlich war sie ja im Recht. Zwei Dutzend Verhaftungen und fünf Verurteilungen später glaubte sie immer noch daran, die Ansicht der Polizei und der Geschworenen beeinflussen zu können: daß sie sich davon überzeugen ließen, nach links abzubiegen und wieder auf die große Straße zurückzukehren, wenn man nur logisch und leidenschaftlich genug zu ihnen sprach. Es bestand kein Zweifel: An Arthurs Stelle würde meine Mutter ihre Mitschuld zugeben, als ob es sich um eine Ehre handelte. Und ich wußte aus eigener schmerzhafter Erfahrung, daß ihre wohlmeinendsten Freunde die größte Bedrohung für meine Sicherheit und Geborgenheit darstellen konnten.
Als ich mich Arthur wieder anschloß, der nervös und verwirrt an der Ecke auf mich wartete, wußte ich, daß ich ihn im Auge behalten und dringend von hier wegschaffen mußte. Ich hoffte, daß das nicht allzulange dauern würde. Dieses eine Mal war ich ungebührlich optimistisch.
Kapitel 2
Wir brauchten ewig, um aus dieser Gegend zu kommen. Die Straßen wimmelten nur so vor uniformierten Polizisten. Wir duckten uns in die Gebäude, wir wanden uns durch die Gassen in dem Versuch, sie zu umgehen. Nur wenige Augenblicke nachdem ich die Waffe in eine Mülltonne geworfen hatte, sahen wir, wie die Polizei einen älteren Herrn, der mit einer jüngeren Frau des Weges ging, anhielt.
»Wir sollten besser auf verschiedenen Straßenseiten gehen«, sagte ich besorgt. »Also achte darauf, wo ich bin. Bleib genau gegenüber.«
Bald danach schien ein weiterer Polizist drauf und dran zu sein, sich Arthur zu nähern, obwohl dieser allein ging. Glücklicherweise warf Arthur mir einen Blick zu. Ich deutete ‒ diskret, wie ich hoffte ‒ auf den Cop. Er ging in eine nahegelegene Bank. Der Polizist schien ihm folgen zu wollen, doch dann ging er auf das nächste Dezember-Mai-Pärchen zu.
Als ich mich Arthur wieder angeschlossen hatte, waren wir beide nervös wie Katzen. Als wir einen Augenblick in der Ecke des Foyers stehenblieben, schnappte ich: »Was zum Teufel ist in dich gefahren? Warum hast du das getan?«
»Was getan?«
Was getan! »Diesen Kerl mit der Waffe bedroht!«
»Ihn damit bedroht? Ach du Schande, nein. Nein, bestimmt nicht.«
Arthurs faltiges Gesicht wurde ganz glatt vor lauter Erstaunen.
»Das glaubst du also? Ich nahm an, daß du bemerkt hättest ‒ ich konnte mir gar nicht vorstellen, warum du so etwas getan hast.«
»Ich?« Die Menschen in unserer Umgebung drehten sich zu uns um. Ich senkte die Stimme. »Warum ich so etwas getan habe?«
»Ja! Sich auf mich zu stürzen, mich wegzuziehen und zu dieser Hasenjagd zu zwingen.« Sein Gesicht zog sich in Falten wie zerknittertes Papier. »Wirklich, ich war dermaßen überrascht. Aber du schienst wild entschlossen zu sein. Ich dachte mir, daß du wahrscheinlich einen Grund hattest. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich dich aufhalten konnte.«
»Mich aufhalten? Du wärest jetzt im Gefängnis, Arthur!«
»Oh, nein.« Seine Stimme klang onkelhaft. »Ich bin sicher, daß wir die Sache aus der Welt geschafft hätten.«
»Aber du standest da und hieltest ‒« Ich zwang mich zum Schweigen. Das war nicht der richtige Ort für Diskussionen.
»Ich habe keine Ahnung, warum er sie mir in die Hand gedrückt hat. Ich denke, der Polizist hätte ihn gefragt.«
»Wer hat sie dir in die Hand gedrückt?«
»Der Gentleman mit dem Schal.«
Ich hatte keinen Schal bemerkt. Ich fragte mich, ob wir über verschiedene Dinge sprachen. Wie so viele Wissenschaftler neigte Arthur dazu, sich auf die kleinen Details zu konzentrieren, die für andere unsichtbar waren.
»Wir sollten gehen«, bemerkte ich. »Halte dich immer in Richtung Market Street.« Sein Gesicht war so faltig wie das eines Hundes und spiegelte meine eigene Entmutigung wider. Wir hatten während der gesamten vergangenen langen Stunde versucht, zur Market Street zu gelangen. Statt dessen hatten wir das Innere verschiedenster Gebäude gesehen und Dutzende von Umwegen durch kleine Gassen genommen.
»Warum reden wir nicht einfach mit ihnen, Willa?«
Er hatte das schon vorher vorgeschlagen, aber ich hatte es als Wunsch, sich zu ergeben, gewertet. So langsam wurde mir klar, daß er tatsächlich annahm, daß die Polizei ihm glauben würde.
»Bestimmt nicht«, wiederholte ich. »Sie haben gesehen, wie du eine Geisel genommen hast. Sie haben beobachtet, wie du geflohen bist. Sie werden dir niemals glauben.«
»Ich werde es darauf ankommen lassen.« Auf seinem Gesicht lag der gleiche Ausdruck naiver Zuversicht, den ich bei meiner Mutter vor ihren katastrophalen Verhaftungen gesehen hatte.
»Nun, ich nicht. Sobald sie merken, daß wir befreundet sind, werden sie mich für deine Komplizin halten.«
»Wie kannst du meine Komplizin sein? Ich habe doch gar nichts getan.«
»Doch, jetzt schon. Du hast dich deiner Verhaftung widersetzt. Ebenso wie ich.«
»Aber ‒«
Ich wandte mich ungeduldig um. »Ich bin Anwältin. Vertrau mir.«
Eine solche Äußerung disqualifiziert sich vielleicht selbst, aber Arthur nahm sie für bare Münze. Er folgte mir nach draußen. Wir kamen kaum einen halben Häuserblock weiter, als sich ihm erneut ein Polizist näherte. Diesmal schlüpfte Arthur in ein Haus, ohne daß ich ihn dazu ermutigen mußte. Ich nehme an, daß ich Eindruck auf ihn gemacht hatte. Ihm war klargeworden, daß er mich jetzt ebenfalls beschützte.
Ich wartete ein paar Minuten, dann folgte ich Arthur, um ihm zu bedeuten, daß »die Luft rein war«. Wir gingen abermals auf parallelen Wegen durch das Bankenviertel. Als wir die Market Street erreichten, entdeckten wir ein Polizeiauto an der Ecke. Ich blickte zu den Embarcaderos hinüber. Ein weiterer Wagen stand an der nächsten Ecke. Ich blickte zum Behördenviertel hinab. Auch dort stand ein Auto. Sie nahmen den Mann mit der Waffe und seine Geisel ernst, soviel war sicher.
Selbst südlich der Market Street an den Hauptverkehrsstraßen mit Warenhäusern und Großhändlern war die Präsenz der Polizei offensichtlich. Die Menschen auf der Straße hielten sich im Hintergrund, sie drückten sich in Eingängen herum, warfen verstohlene Blicke auf die blauen Uniformen. Ich sah, wie ein Cop eine Gruppe von Männern in schmutzigen Anzügen befragte. Wir gingen einen verschlungenen Weg durch ein trist anmutendes Viertel, dessen Bauten eher funktional als beeindruckend aussahen.
Schließlich schien es sicher, wieder gemeinsam gehen zu können. Aber selbst jetzt noch blickte ich so häufig über meine Schulter, daß mir der Nacken weh tat.
»Was meintest du eben eigentlich, Arthur?« Ich versuchte, meine schlechte Laune nicht an ihm auszulassen. Ich sollte schon seit zwei Stunden eifrig in der Arbeit vergraben sein. Aber ich hatte mich in das hier gestürzt, und es war ganz allein meine Schuld, nicht Arthurs. »Erzähl mir von dem Mann mit dem Schal.«
»Ich war noch nie erstaunter, Willa. Nicht hier jedenfalls. Etwas anderes war es natürlich, als der alte Juavaro-Häuptling seinem Rivalen das Ohr abschnitt und es dazu benutzte ‒«
»Erstaunt worüber?« So faszinierend die Umgangsformen der Eingeborenen des tropischen Regenwaldes auch sein mochten, im Augenblick interessierte ich mich mehr für uns beide in der Gegenwart. »Was hat er getan? Der Mann mit dem Schal?«
»Er gab mir die Waffe.« Arthur war stehengeblieben. Er zwinkerte, als ob er ein etwas dümmlicher Student wäre.
»Jemand hat dir die Waffe gegeben?«
Er nickte. »Und dann hob er die Hände in die Luft.« Er imitierte die Geste und sah aus, als ob ich ihn ausrauben wollte.
»Du machst Witze. Dieser Typ« ‒ ich bemühte mich, mir seine Gesichtszüge ins Gedächtnis zu rufen, seine Haarfarbe, irgend etwas ‒ »der Typ mit den erhobenen Händen war derjenige, der dir die Waffe gegeben hat?«
»Das stimmt. Er gab sie mir, legte den Knauf in meine Handfläche, weißt du. Und dann …« Er hob seine Hände noch höher. »Witzig.« Er ließ die Arme wieder sinken. »Ich dachte, daß es sich vielleicht um eine Art Scherz handelte, weißt du, wegen seiner Wehklagen.«
»Seiner was?«
»Wehklagen.« Er gab ein paar leise jaulende Laute von sich.
»Ich kann mich nicht erinnern, daß er das von sich gegeben hat.« Aber ich war mir nicht sicher, wie lang diese Szene schon im Gange gewesen war, bevor ich am Schauplatz ankam.
»Doch nicht so. Nicht ›huhuhuhu‹, sondern amerikanische Wehklagen. Du weißt schon, ›Hilfe, Hilfe, nicht schießen‹. Etwas in der Art.«
»Er hat dir die Waffe in die Hand gedrückt und angefangen, herumzuschreien?« Ich hatte das Gefühl, als hätte mir jemand alle Energie geraubt. Als ich versuchte, Arthur zu retten, hatte ich den Mann mit dem Schal entkommen lassen. Ich hätte am liebsten losgeheult. Normalerweise pflege ich mich nicht so schnell einzumischen. Und jetzt, da ich mich zum ersten Mal in meinem Leben öffentlich eingemischt und in Gefahr gebracht hatte, war der Schuß nach hinten losgegangen. Das war einfach zuviel für mich.
»Ja.« Er nickte nachdrücklich und sah in seinem Rollkragenpullover und seiner Wolljacke nun wirklich aus wie ein Professor. »Außerordentlichungewöhnlich.«
»Soviel zum Thema Timing.« Der Mann hatte diese Situation vor den Augen eines Polizisten provoziert. Wenn das ein Zufall war, dann war es ein riesiger. »Kam der Mann dir entgegen, als er dir die Waffe gab?«
»Nein.« Arthur zuckte die Achseln. »Er kam von hinten. Er legte die Waffe in meine Hand, und das nächste, was ich weiß, war, daß er vor mir stand und wehklagte.«
»Er muß den Polizisten gesehen haben. Er ist dir wahrscheinlich gefolgt, bis er einen im Visier hatte.« Ich war überrascht angesichts der Autorität meiner Stimme. Was wußte ich denn schon? Ich hatte noch nicht einmal den Schal bemerkt. »Was für einen Schal trug er denn?«
»Trug?« Arthur machte ein Gesicht, als ob ich plötzlich begonnen hätte, chinesisch zu sprechen. »Der Mann?«
»Ja.«
»Trug er denn einen Schal?«
Ich hatte das Gefühl, mitten in einer Komödie zu sein. »Das hast du doch gesagt.«
»Nein, nein, er hatte ihn nicht an! Er hatte seine Waffe darin. Ich spürte ihn auf meiner Hand, bevor ich die Waffe spürte. Ich fühlte, wie er von meiner Hand herunterglitt.«
»Hast du ihn gesehen?«
»Hmm.« Er schien nachzudenken und schüttelte dann leicht sein dichtes Haar. »Und kurz zuvor hatte ich das Gefühl, ein Adler zu sein.«
»Was hattest du? Das ›Gefühl, ein Adler zu sein‹?«
»Ja, ja. Ich habe den Schal nicht gesehen, aber ich konnte das seidige Gefühl auf der Haut spüren, das er hinterläßt, und ich erinnere mich, daß ich das Gefühl hatte, ein Adler zu sein.«
Ich schritt aus. Ich hatte keine Vorstellung, wie ein Adler sich fühlen mochte. Im Augenblick war ich auch stärker an einer Tasse Kaffee interessiert.
Eine meiner größten Ängste an diesem Morgen war, daß der Kaffee bei Curtis & Huston vielleicht zu dünn war. Ich hoffte, nicht so spät zu kommen, daß ich das nie erfahren würde. Unterdessen konnte ich allerdings erst einmal einen dreifach starken Espresso brauchen.
»Wir gehen in meine Wohnung.« Ich hatte schon vernünftigere Vorschläge gemacht. »Ich werde in der Kanzlei anrufen. Wir werden gemeinsam nachdenken.«
Wir beschrieben einen großen Halbkreis durch den Mission District und überquerten schließlich erneut die Market Street. Wir befanden uns jetzt nördlich des Verwaltungszentrums und mußten etwa noch eine Meile zum Panhandle und eine weitere halbe Meile nach Haight laufen, wo ich wohnte.
Ich hatte mich entschlossen, zu Arthur zu halten, in guten wie in schlechten Tagen. Ich sagte mir, daß das am sichersten sei: Ich traute ihm nicht, befürchtete, daß er sich letztlich doch der Polizei stellen würde. Ich vertraute nicht darauf, daß er paranoid genug war, um sich selbst zu schützen und unangenehme Situationen zu meiden. Immerhin war er nicht, wie ich, zum Juristen ausgebildet.
Kapitel 3
Ich stellte fest, daß das Licht meines Anrufbeantworters wütend blinkte. Vier der Botschaften waren von Curtis & Huston. Die ersten beiden waren höflich, fast bedauernd: Mensch, hatte ich denn keinen Blick auf die Uhr geworfen? Die dritte klang besorgt: Sie hatten einen Termin festgesetzt, den ich bald verpassen würde. Die vierte war kurz angebunden ‒ ich sollte sie bitte zurückrufen.
Meine Mutter hatte zwei Nachrichten hinterlassen. Sie hatte bei Curtis & Huston angerufen, um mit mir zu reden. Ihre quieksende Stimme informierte mich darüber, daß ich nicht an meinem neuen Arbeitsplatz war, daß die Sekretärin nicht wußte, wo ich war, und daß sie nicht gerade glücklich darüber zu sein schien. Ihre zweite Nachricht war ein atemloser Vortrag: »Willa June, es ist fast Mittag, du hast dir diesen Job doch so sehr gewünscht, wohin bist du gegangen? Warum hast du sie nicht angerufen? Bist du in Ordnung?«
Ich hätte schon früher in der Firma anrufen sollen, hätte irgendeine Entschuldigung Vorbringen sollen. Ich war nur einfach nicht in der Lage gewesen, mir eine auszudenken.
Ich ging in die Küche und setzte Wasser auf, um Kaffee zu kochen. Mir fiel immer noch keine ein. Ich hatte verschlafen? War ohnmächtig geworden? Hatte mich verirrt? Obwohl ich die perfekte Entschuldigung für meine Verspätung hatte ‒ Tut mir leid, ich bin als Geisel genommen worden ‒, konnte ich sie nicht verwenden.
Ich hätte beinahe die Kaffeetasse fallenlassen, als das Telefon erneut klingelte. Ich kehrte gerade rechtzeitig in mein Wohnzimmer zurück, um Arthur davon abzuhalten, abzuheben. Nach dem Signalton hörte ich die Stimme meines Vaters.
»Willa, deine Mutter ist sehr besorgt, daß du heute morgen nicht zur Arbeit gegangen bist. Sie ist auf dem Weg zu dir.« Eine Pause. »Wir hoffen natürlich, daß es dir gutgeht.«
Ich überlegte, ob ich abnehmen sollte. Ich wollte nicht, daß er sich Sorgen machte. Andererseits wußte ich nicht, wie die Wahrheit ihn hätte trösten sollen, und ich konnte meinen Vater nicht anlügen. Jeden, aber nicht ihn.
»Willa, bist du zu Hause?« Die Beunruhigung in seiner Stimme überredete mich beinahe, ihm meine Sorgen anzuvertrauen. Ich suchte im Wohnzimmer nach meiner Uhr. Überall lagen Zeitschriften verstreut, ebenso wie Kleider von der eiligen Anprobesitzung dieses Morgens. Ich entdeckte eine Ecke meiner Schreibtischuhr unter ein paar Zeitschriften zum Thema Computergraphiken. Ich fegte sie beiseite. Es war fast ein Uhr. Die Digitaluhr auf meinem Computer ‒ der seit letzter Nacht immer noch eingeschaltet war ‒ sagte mir dann auf die Sekunde genau, wie spät ich dran war. Wir waren langsamer vorangekommen als ich angenommen hatte.
Aber eine Frau meines Alters sollte ein paar Stunden »verschwinden« können, ohne daß ihre Eltern vor Sorge den Verstand verloren. Hatten sie sich nicht im Jahre 1976 dem Friedenscorps angeschlossen, ohne mir etwas davon zu erzählen? Hatten sie mich nicht für zwei Jahre verlassen, ohne mir auf Wiedersehen zu sagen? Meine Mutter konnte mit ihren Sorgen wohl leben.
Plötzlich begann es zu klingeln. Eine ganze Minute lang klingelte es unaufhörlich, dann begann es in der Wohnung unter mir zu klingeln. Meine Mutter versuchte es wohl bei meinem Vermieter Ben. Ich horchte auf seine, dann wieder auf meine eigene Türklingel. Scheinbar war Ben nicht zu Hause.
»Wir sollten deine Mutter hereinlassen«, sagte Arthur sanft. »Kaum zu glauben, aber ich habe sie nicht mehr gesehen seit, o mein Gott, war es wirklich vor Alaska und British Columbia? Ich denke vor den ›Jägern‹?«
»Du bist auf die Jagd gegangen?« Das schockierte mich noch mehr, als ihn mit einer Waffe in der Hand zu sehen. Ich hatte nicht ganz an die Waffe geglaubt, aber jetzt hörte ich es von seinen eigenen Lippen.
»Nein! Guter Gott, Willa! Die Jäger ‒ ich spreche von ihnen immer als von den ›Jägern‹ ‒ sind Haida-Indianer. Es handelt sich um eine Familie aus Künstlern und Malern, die von den Queen Charlotte Islands stammt. Mein Assistent hat sie mir vorgestellt.« Sein Gesicht hellte sich auf. »Ach, was ist das doch für ein Kerl! Ein wahrer Künstler. Ein Schamane, ein Waldbewohner, ein Schnitzer von Wappenpfählen mit ungewöhnlich scharfem Verstand! Und sein Geist übertrifft meiner Meinung nach sogar Rolling Thunder und Black Elk. Er ist ein Segen. Wirklich, für mich ist er ein Segen.«
»Hm.« Das Klingeln an der Haustür hatte aufgehört. Das war alles, was mich im Augenblick interessierte.
Ich fegte einigen Krempel von der Couch und bat Arthur, sich hinzusetzen. Dann kehrte ich in die Küche zurück. Ich stand ein paar Minuten vor dem tropfenden Handfilter. Vielleicht hätte Arthur die Sache mit der Waffe erklären können, vielleicht auch nicht. Vielleicht hatte ich das Richtige getan, als ich ihn »rettete«. Vielleicht hatte ich die Sache falsch gehandhabt.
Ich war besorgt. Ich ließ Arthur allein in meinem Wohnzimmer sitzen und trank eine Tasse Kaffee. Hunderte von Sorgen blühten und gediehen in meinem Inneren. Schließlich entschloß ich mich, in der Firma anzurufen. Ich würde eine unspezifische persönliche Notfallsituation als Entschuldigung angeben. Wenn sie mich hinauswarfen, dann warfen sie mich eben hinaus. Wenn ich noch länger zögerte, würde das auch keinen Unterschied machen.
Arthur saß da und las eine Zeitung, deren einzelne Seiten er zu einem ordentlichen Stapel zusammengefaltet und neben sich gelegt hatte.
Ich ging zum Telefon hinüber, das auf dem Regisseurstuhl stand. Meine Inneneinrichtung entsprach, wie eine Freundin es einmal formuliert hatte, der einer Studentin im ersten Semester. Ich hatte gelegentlich versucht, mich für meine Umgebung zu interessieren. Aber das bedeutete zu häufiges Putzen und Einkaufen und nicht genug Lesen und zielloses Umherstreifen.
Ich begann, die Nummer von Curtis & Huston zu wählen. Dann gewann meine Angst die Oberhand. Ich sagte mir, daß ich zuerst die Furcht meiner Eltern beschwichtigen sollte, daß ich meine Ausrede erst mal an ihnen austesten sollte.
Mein Vater nahm schon nach dem ersten Klingeln ab. »Willa!« rief er als Antwort auf meine Begrüßung. »Wo bist du?«
»Zu Hause.« Ich beobachtete, wie Arthur zurückprallte, als ob er von einer Überschrift auf der Seite mit den Lokalnachrichten erschrocken worden wäre. »Das ist eine lange Geschichte …«
»O mein Gott, ich frage mich, ob ich deine Mutter noch abfangen kann?«
»Abfangen? Bevor sie was tut?«
»Bevor sie zur ‒ du mußt das alles im Zusammenhang sehen, Willa.«
Seine Stimme war beschwichtigend. In den letzten Jahren hatte er die Aufgabe übernommen, zwischen mir und meiner Mutter zu vermitteln. Er hatte versucht, ihr meine praktische Art näherzubringen und mir ihre Politik weniger lächerlich erscheinen zu lassen.
»In was für einen Zusammenhang? Hat sie Probleme? Was hat sie getan?« Ich wurde plötzlich ganz schwach. Ich hatte sie gewarnt, bis ich nicht mehr konnte, ich glaubte, mich deutlich genug gemacht zu haben. »Sie läuft doch nicht schon wieder Gefahr, verhaftet zu werden?«
»Nein. Nein. Du bist es, sie macht sich Sorgen um dich.«
Ich ging meine Liste der Möglichkeiten durch, die schlimmstenfalls eintreffen konnten. Ob sie wegen einer Sache, die mit mir in Zusammenhang stand, jemanden belästigte? Widerrechtliche Maßnahmen zu ergreifen? Eine Pressekonferenz einzuberufen? »Und?«
»Weil sie wußte, wie glücklich du darüber warst, daß du diesen Job bekommen hast, weißt du?«
»Also, was hat sie getan?«
»Sie hat den ganzen Morgen versucht, dich zu erreichen, dann ist sie zu deiner Wohnung gegangen.«
Er wandt sich, versuchte mich zu beschwichtigen. Arthur gab gurgelnde Laute von sich. Ich warf ihm einen Blick zu. Es schien nicht so, als ob er gerade an irgend etwas erstickte. Ich legte die Hand über mein freies Ohr, um die Geräusche abzuschirmen.
»Komm auf den Punkt, Daddy, ja? Sie ist doch nicht in Schwierigkeiten, oder?«
»Nein. Aber sie glaubt, daß du es bist.«
Ich verstand es immer noch nicht. Warum zögerte er derartig?
»O mein Gott!« Plötzlich ging mir ein Licht auf. »Sie ist zu.«
»Nun, weil sie sich solche Sorgen macht. Und er ist der einzige Polizist, den sie wirklich kennt.«
»O nein, bitte nicht.«
Arthurs Kopf war inzwischen gegen das Futonkissen gesunken, die Zeitung lag zu seinen Füßen. Seine Augen waren glasig. Ich hoffte, daß er mir jetzt nicht einschlief. Wenn ich meinen Vater richtig verstanden hatte, mußten wir hier verdammt schnell wieder verschwinden.
»Sie ist also zu Don Surgelato gegangen.« Ich wartete darauf, daß mein Vater mir widersprechen würde. »Nicht wahr?«
»Sie machte sich Sorgen. Sie glaubte, daß er vielleicht, du weißt schon, Berichte über Verletzte oder ähnliches hätte.«
Ich hatte mich vor längerer Zeit einmal in den Leiter der Mordkommission von San Francisco verliebt, eine dumme und peinliche Geschichte. Zu dem Zeitpunkt, da ich meinen Mut zusammengenommen hatte, um mich vor ihm zum Narren zu machen, hatte er sich mit seiner Exfrau versöhnt. Man ist nicht ganz unten angekommen, bevor man nicht einmal zum Haus eines Mannes gegangen ist, um ihm seine Liebe zu erklären, und einem seine Exfrau im Bademantel die Tür öffnet.
Ich hätte kein Problem damit gehabt, den Namen Don Surgelato nie wieder in meinem Leben hören zu müssen.
»Ich sage es noch mal, Baby, du mußt das im Zusammenhang sehen. Sie wußte, wie sehr du dir diesen Job gewünscht hast, und doch bist du nicht … Warum bist du heute nicht in der Firma erschienen? Warum bist du immer noch zu Hause? Weißt du, wir haben ganz oft versucht, dich zu erreichen, aber ‒«
»Arthur Kenna. Er wäre beinahe verhaftet worden, und das einzige, was mir einfiel, um ihn davor zu bewahren, war vorzugeben, seine Geisel zu sein.« Ich machte mir niemals die Mühe, meinen Vater anzulügen. Er war klug und unvoreingenommen, deshalb hatte es keinen Zweck.
»Was?«
Ich machte mir wegen Arthurs merkwürdiger Körperhaltung Sorgen. Hoffentlich hatte er keinen Herzanfall bekommen.
»Die Polizei glaubt, daß er eine Geisel genommen hat, nur wissen sie noch nicht, daß er der betreffende Geiselgangster ist. Daß es Arthur war. Er wird allerdings denken, daß ich die Geisel war.«
»Surgelato wird das glauben, meinst du?«
»Ja. Er wird die Beschreibung der kleinen blonden Geisel im blauen Kostüm gehört haben, und wenn Mutter ihm sagt, daß ich nicht an meinem Arbeitsplatz erschienen bin, dann wird er wissen, daß ich die Geisel war.«
»Welchen Grund hattest du, so zu tun, als ob du Arthurs Geisel wärst? Habe ich das richtig verstanden?«
»Ich muß Arthur hier herausschaffen. Wenn die Polizei vorbeikommt, um nach mir zu sehen ‒« Ich brauchte eine Sekunde, um die Tragweite zu erfassen. »Ich will nicht, daß die Polizei uns zusammen sieht, wir passen genau auf die Beschreibung des Gangsters und seiner Geisel ‒ zumindest nehme ich an, daß wir es tun, denn wir waren es ja schließlich auch. O Gott, man muß eine Sache nur Mutter überlassen, sie wird das Kind schon schaukeln.«
»Aber sie hat doch nur versucht ‒«
»Tut sie das nicht immer? Ich muß Arthur hier herausschaffen. Und es ist besser, wenn ich bei ihm bleibe.« Ich hatte Angst, daß er zur Polizei gehen würde, aber das wollte ich nicht in seiner Gegenwart sagen. »Ich habe keine Erklärung dafür, daß ich noch nicht in der Firma war ‒ ich werde mich also nur verhaspeln. Ich verhalte mich in Dons Gegenwart sowieso immer komisch.«
»Und was ist mit Arthur passiert?«
»Der Polizist glaubte, daß er jemanden mit einer Waffe bedroht hat. Ich hatte keine Ahnung, was da wirklich vor sich ging, deshalb gab ich vor, seine Geisel zu sein, um ihn ‒ uns ‒ von dort fortzuschaffen.«
»Weiß er von Billi Seawuit?«
»Wovon?«
»Billy Seawuit.« Er buchstabierte den Nachnamen.
»Wer ist das?«
Ich bemerkte, daß Arthurs Augen fest geschlossen waren. Seine Schultern zitterten.
»Sein Assistent ist ermordet worden. Ich habe es heute morgen in den Internet News gelesen.«
»O nein. Ich glaube, er hat es gerade eben erfahren.«
Ich hatte das Gefühl, von einer Lawine überrollt zu werden. Ich war wie gelähmt, und um mich herum brach alles zusammen. »Deine Mutter hat Surgelato vielleicht gar nicht angetroffen. Ich werde hingehen und versuchen, sie aufzuhalten.« Eine kurze Pause.
»Willa, bist du in Sicherheit?«