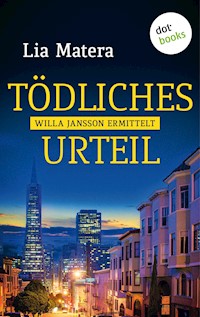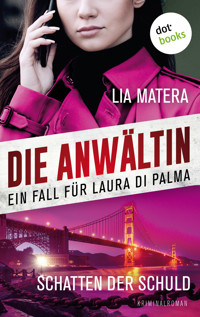4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Laura Di Palma
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine glanzvolle Karriere – und tödliche Leidenschaften: Der Kriminalroman »Die Anwältin – Zeichen des Verrats« von Lia Matera als eBook bei dotbooks. Laura Di Palma hat sich ihren Platz in der illustren Welt der Top-Anwälte von San Francisco hart erkämpfen müssen – nun hat sie ihr Ziel endlich erreicht: ein luxuriöses Apartment, den Respekt ihrer Kollegen und ihre eigene Kanzlei. Doch all das steht plötzlich auf Messers Schneide, als ihr neuer Klient beschuldigt wird, einen FBI-Agenten ermordet zu haben. Jeder andere Strafverteidiger würde die Finger von diesem hochbrisanten Fall lassen, aber Danny Crosetti ist ein alter Freund von Laura und sie ist fest von seiner Unschuld überzeugt. Ihr bleibt nur ein Ausweg: Sie muss den wahren Killer selbst finden … und Laura hat bereits den dunklen Verdacht, dass dieser in ihrer eigenen Vergangenheit zu finden ist! »Laura Di Palma gehört in dieselbe Liga außergewöhnlicher Frauen wie Sue Graftons Kinsey Millhone und Sara Paretskys V.I. Warshawski, wenn es um Cleverness, Kampfgeist und Schneid geht.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Anwältin – Zeichen des Verrats« von Lia Matera ist der zweite Band ihrer fesselnden Krimi-Reihe um eine Frau zwischen zwei Welten: ihrer Heimat in den kalifornischen Redwood-Wäldern und den schillernden Anwaltskanzleien San Franciscos. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Ähnliche
Über dieses Buch:
Laura Di Palma hat sich ihren Platz in der illustren Welt der Top-Anwälte von San Francisco hart erkämpfen müssen – nun hat sie ihr Ziel endlich erreicht: ein luxuriöses Apartment, den Respekt ihrer Kollegen und ihre eigene Kanzlei. Doch all das steht plötzlich auf Messers Schneide, als ihr neuer Klient beschuldigt wird, einen FBI-Agenten ermordet zu haben. Jeder andere Strafverteidiger würde die Finger von diesem hochbrisanten Fall lassen, aber Danny Crosetti ist ein alter Freund von Laura und sie ist fest von seiner Unschuld überzeugt. Ihr bleibt nur ein Ausweg: Sie muss den wahren Killer selbst finden … und Laura hat bereits den dunklen Verdacht, dass dieser in ihrer eigenen Vergangenheit zu finden ist!
»Laura Di Palma gehört in dieselbe Liga außergewöhnlicher Frauen wie Sue Graftons Kinsey Millhone und Sara Paretskys V.I. Warshawski, wenn es um Cleverness, Kampfgeist und Schneid geht.« Booklist
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
Sowie ihre Reihe um Willa Jansson mit den Kriminalromanen:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »The Good Fight« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Der aufrechte Gang« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1990 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Senyuk Mykola / Luciano Mortula – LGM / HolyCrazyLazy
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-902-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Anwältin 2« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Die Anwältin Zeichen des Verrats
Ein Fall für Laura Di Palma
Aus dem Amerikanischen von Ekkehart Reinke
dotbooks.
Prolog
Hal Di Palma kletterte aus dem Bett. Das dauerte einige Zeit. Sein rechtes Bein gehorchte ihm nicht. Es war wie aus Gummi. Den rechten Arm konnte er anheben und drehen, die Hand öffnen und schließen. Aber es kribbelte noch in der Hand, und in den Fingern war kein Gefühl. Wenn er etwas aufhob, mußte er genau hinsehen, ob er auch kräftig genug zugegriffen hatte, sonst wäre es ihm wieder entglitten. Aber das war okay. Das würde keinem auffallen.
Er tastete sich durchs Zimmer. Nahe der halb offenen Tür glänzte im weichen, fluoreszierenden Licht ein trapezförmiges Stück Linoleum. Auf dem Flur war niemand zu sehen. Sein Zimmer befand sich weit entfernt vom Aufnahmeschalter und dem Empfangssaal mit den Couchs. Es lag in der Nähe der Küche. Mehrmals am Tage hörte er Geschirr klappern. Jetzt war es dort noch still. Er hatte es fertiggebracht, lange vor dem Frühstück wachzuwerden.
Er schloß sich im Badezimmer ein und schaltete das Licht über dem Spiegel an, einer Leichtmetallplatte, in der er fast lila aussah. Die Haare waren noch vom Schlafen zerzaust. Es überraschte ihn, so viele weiße Haare zu sehen. Er konnte sich entsinnen, daß sie vorher fast schwarz gewesen waren. Im übrigen sah er so elend aus, wie er erwartet hatte.
Die Augen waren gerötet und wäßrig, besonders das rechte. Im Militärlazarett (mein Gott, war das schon sechzehn Jahre her?) hatte es monatelang gedauert, bis er das Lid richtig schließen konnte. Wie viele Monate würde es diesmal dauern?
Außerdem war die rechte Gesichtshälfte etwas schief. Die rechte Wange wirkte schmaler als die linke, und der Mundwinkel hing leicht herab. Hal fuhr sich über die Bartstoppeln am Kinn. Rechts hatte er noch ein ziemlich taubes Gefühl.
Er zog den Wandschrank auf und schaute hinein. Ein schnurloser Elektrorasierer. Er hatte schon einmal hineingeschaut, aber damals nicht gewußt, was für ein Ding das war. Gott sei Dank erkannte er es jetzt.
Er hatte sich noch nie mit einem elektrischen Apparat rasiert. Lange fummelte er daran herum, bis er den Einschaltknopf fand. Das plötzlich einsetzende Summen erschreckte ihn so, daß er das Ding beinahe fallengelassen hätte. Dann fuhr er sich mit dem konturierten Rasierknopf ruckartig übers Kinn.
Danach wusch er sich. Das Wasser lief ihm aus der rechten Hand und spritzte über den Pyjama bis auf den Fußboden. Er machte die Haare naß und strich sie mit den Fingern aus der Stirn.
Im Spiegel sah er sich noch einmal scharf in die Augen. Er mußte sich vergewissern, daß er noch derselbe Mensch war: siebenunddreißigjährig, einigermaßen kräftig, von robustem Gemüt. Bei Gott, er sah zum Erschrecken aus. Ausgezehrt und zornig. Ihm fiel eine Bar irgendwo im Südwesten ein. Da hatte so ein verrückter, gespenstisch hagerer Betrunkener eine Münze auf den Tisch geschmettert und geblökt: »Ein Dollar, daß ich jedem hier die Fresse polieren kann!«
Dem sah er jetzt ähnlich. Angeekelt wandte Hal sich ab.
Im Dunkeln die Kleidungsstücke aus dem Schrank zu nehmen, erwies sich als knifflige Angelegenheit. Noch kniffliger wurde das Anziehen. Der Gang durch das kleine Zimmer hatte ihm das Mark aus den Knochen gesogen. Es war harte Arbeit, Pyjamaoberteil und Hose loszuwerden und in seine steifen, weniger nachgiebigen Klamotten zu steigen.
Als Hal es hinter sich hatte, legte er sich für ein paar Minuten aufs Bett. Sein Herz hämmerte, und von der Anstrengung war ihm der Schweiß ausgebrochen. Das Zähneputzen hatte er vergessen, aber jetzt kam es ihm vor, als wäre das Badezimmer meilenweit weg, und die erforderlichen Tätigkeiten – Zahnbürste festhalten, Tube drücken, die Zähne putzen, selbst das Ausspucken nachher, und zwar so, daß er sich keinen Fleck auf dem Pullover machte, traute er sich nicht mehr zu.
Da hörte er Schritte auf dem Flur. Weil es sein mußte, nahm er alle Energien zusammen, konzentrierte sich und brachte es fertig, die Bettdecke über sich zu ziehen – bis zum Hals, damit der Zopfmusterpullover nicht zu sehen war. Keinen Augenblick zu früh. Denn da sagte schon eine Schwester: »Oh je, hab’ ich Sie aufgeweckt!«
Sie waren hier alle so verdammt fröhlich. Man kam sich vor, als wäre man in einem Kaufhaus eingesperrt.
»Macht nichts«, krächzte er.
Sie lächelte. »Junge, Sie machen aber rasche …« irgendwas. Wahrscheinlich Fortschritte. Dann sagte sie noch etwas anderes. Es ging ihm zu einem Ohr hinein und zum anderen hinaus, ohne daß er begriff, was sie meinte. Sie klopfte an die Plastikflasche, die seitlich am Bett an einem Haken hing.
»Nein.« Vor Verlegenheit verfiel er in einen barschen Ton. Wenn er jetzt einen Wunsch frei hätte, dann würde er sich wünschen, nie wieder in eine Flasche pinkeln zu müssen, die ihm ein fremder Mensch hinhielt. Dieser Wunsch war so stark, daß ihm beinahe übel wurde.
Sie nickte, lächelte wieder und hielt ihm eine kleine weiße Tablettenschale hin. »Zeit für die Medikamente.«
Verdammt! Wenn er sich aufsetzte, würde sie sehen, was er anhatte.
Er reckte den Kopf und machte den Mund auf.
Sie reichte ihm die Schale und streckte den anderen Arm aus, um seinen Kopf anzuheben. Mit Lippen und Zunge bugsierte er die Pillen in den Mund und schluckte sie runter. Dann machte er den Mund auf, um ihr zu zeigen, daß er sie eingenommen hatte.
Die Schwester war richtig erschrocken. »Na, so was! Warten Sie, ich hole Ihnen Wasser.«
Er wußte nicht genau, ob sie Wasser gesagt hatte, aber das ergab jedenfalls einen Sinn. »Kein Wasser«, erwiderte er.
Die Pillen waren ihm in der Kehle steckengeblieben, und beinahe hätte er sich übergeben. Er war so verdammt müde. Mehr als das – überanstrengt. Heißer Schweiß, Angst. Erschrocken fragte er sich, welche Wirkung die Pillen hätten. Würde er irgendwo ohnmächtig werden? Oder noch schlimmer, hielten nur sie ihn am Leben? Würde er ohne sie einen Anfall bekommen?
Er redete sich selber gut zu. Mensch, denk doch an die ganzen Pharmaka, die man dir im Lazarett in den Hals gestopft hat! Alles, von Antibiotika bis zu Antipsychotika. Kein Wunder, daß er da mehr als ein halbes Jahr nur vegetiert hatte.
Ohne diesen ganzen Scheiß würde er jetzt im Leben zurechtkommen. Nicht gerade eine große Rolle spielen, aber eben zurechtkommen. Als Mensch anerkannt werden.
Und sein jetziges Leiden war doch nur so was wie ein Rückfall. Die Ursache? Er erinnerte sich, daß er aufgewacht war und mit dem Gesicht nach unten auf einem Teppich lag. Keine Ahnung, wie er da hingekommen war. Ein Schlag von hinten?
Was zum Teufel auch passiert war, jedenfalls hatte er nicht wie damals eine Kugel in den Kopf gekriegt. Wie schlecht ging es ihm eigentlich?
Die Schwester winkte ihm fröhlich zu und ging.
Er redete sich ein, er wolle vorsichtshalber warten, bis sie ihre Runde gemacht hatte. Aber er wußte besser, warum er noch liegenblieb. Menschenskind, wenn ihn das Rasieren und Waschen schon so anstrengte, wie zum Teufel sollte er dann hier rauskommen?
Er dachte an Orte, die er einmal als sein Zuhause angesehen hatte – einen durchgerosteten Kleinbus, ein windiges Stück Strand, Waldgegenden jeder Art, von Zuckerahorn über Mangroven bis zu nasser Macchia. Er würde es schon schaffen. Hatte es ja immer geschafft.
Den Bruchteil einer Sekunde glaubte er in einer Sinnestäuschung gefirniste Holzwände und den Gully der Hintergasse zu riechen: wie in seinem Kinderzimmer. Er lag ganz still und trotzte der Erinnerung – der Erinnerung und allem, was damit zusammenhing. Wie seine Mutter ihn ausschimpfte, weil er den Sohn ihres Arztes zum Abendessen eingeladen hatte. Wie sein Vater ihm diesen demütigenden Sportwagen gekauft hatte. Wie sein Foto jedesmal in der Zeitung erschienen war, wenn er wieder eine Scheißurkunde bei einem Schwimmwettkampf oder sonstwas Tolles gewonnen hatte.
Luxus machte aus einem Ort noch kein Zuhause. Luxus war nichts als ein Lockmittel, wenn du oder andere Leute große Erwartungen in dich setzten.
Sieh dir Laura an! Sieh dir an, was sie für ihre handgewebten Teppiche und signierten Lithografien tun muß! Ihre Laufbahn war ein endloser Kasernendrill – eins, zwei, drei, vier – und sie sah einfach nicht ein, daß es sich nicht lohnte. So was tat man bestenfalls für seine Ehre, aber nicht für leblosen Besitz.
Er drückte die Augen zu, sonst wären ihm Tränen gekommen. Laura… Nein, er würde nicht wegen einer Frau sentimental werden, die ihn in einem Hundestall eingepfercht hatte.
Oh, es war ein luxuriöser Hundestall, ganz sicher – Einzelzimmer, erstklassiges Essen, Designertapeten an den verdammten Wänden. Der Ort hatte wahrscheinlich auch einen Klassenamen, Green Oaks oder so. Laura warf ihren Problemen immer einen Haufen Geld nach.
Und dann ihr Mercedes und die Schränke voller Anzüge – sie ließ sich von all diesem Zeug blenden. Begriff sie denn nicht, daß es unwichtig war, wie die Vorhänge aussahen oder ob auf dem gemeinsamen Eßtisch Blumen standen? Begriff sie denn nicht, daß dieses Krankenhaus im Grunde nicht anders war als das verdammte Lazarett?
Wie die Ärzte im Lazarett – wie alle Ärzte, denen er begegnet war – hatte Laura ihn aufgegeben.
Ach, Scheiß auf Laura! Er war früher allein auf sich gestellt gewesen, und er konnte es wieder sein. Aber diesmal würde er nicht erst abwarten, bis ihm diese Hirnklempner ihren Segen gaben. Vor sechzehn Jahren hatten sie ihm eingeredet, er brauche für sein ganzes ferneres Leben ›tatkräftige Hilfe‹. Aber in dem Augenblick, als sie ihm seine Packtasche, die Entlassungspapiere und – als wäre das eine große Ehre – das Verwundetenabzeichen ausgehändigt hatten, hatte er sich auf eigene Füße gestellt. Ja, wirklich auf eigene Füße. Außer in dem einen Monat im Gefängnis. Und in den drei Jahren mit Laura.
Mit Mühe setzte er sich auf. Im Magen rumorte es, und Kopfschmerzen hatte er auch. Das Zimmer war dunkel, und er fühlte sich ausgehöhlt und unsicher. Wo genau war eigentlich die Tür? Schwankend stand er auf und tastete sich, die linke Hand an die kühle Tapetenwand gestützt, durchs Zimmer. In zwei Stunden würde die Schwester den Rollstuhl bringen. Die Schwestern waren strikt dagegen, daß jemand herumspazierte, es sei denn, unter fachmännischer Aufsicht im Übungssaal. Wahrscheinlich war Laura auf ihrer Seite. Als Anwältin verstand sie, daß sie sich gegen eventuelle Schadenersatzklagen absicherten.
Plötzlich gab das linke Bein unter ihm nach. Er konnte sich gerade noch an der Holzverkleidung festhalten. Sein Herz pochte. Was für einen Krach er gemacht hatte! Er massierte kurz das Bein und spürte zu seiner Genugtuung harte, durchtrainierte Muskeln. Na also, körperlich war er gut in Form. Das Problem war sein Gehirn. Es sandte nicht die richtigen Signale aus.
Der Trick war: zu bewegen, was sich bewegen ließ, und dann zu beten, daß der Schwung ausreichte. Das hatte er in den Lazarettagen gelernt.
Sitzt du in der Falle, beiß die eingeklemmte Pfote ab und hinke davon!
Auf einen Nachttisch gestützt, arbeitete er sich zur Tür vor. Wieviel Konzentration er brauchte, um etwas zu tun, was früher automatisch ging!
Jetzt spähte er in den Flur. Der Kopf brummte ihm, und die linke Stirnseite war so empfindlich, daß sie zu brennen schien. Sie hatten ihn ein dutzendmal im Rollstuhl diesen Flur entlang geschoben, hin und her. Warum also, zum Teufel, konnte er sich nicht mehr erinnern, welche Richtung er einschlagen mußte? An einem Ende erblickte er die von den Innenarchitekten verordneten Couchs. Am anderen zusammengeklappte Rollstühle, ineinandergeschoben wie Einkaufskarren im Supermarkt. Nichts kam ihm bekannt vor.
Er entschloß sich, nach links zu gehen, an den Rollstühlen vorbei. Mit der Linken packte er das rechte Bein und schleppte es wie ein an die Hüfte geschnalltes Gewicht mit sich.
Als er um die Ecke bog, wäre er beinahe mit einem bärtigen jungen Mann zusammengeprallt. Offenbar überrascht, sah ihn der Mann blinzelnd an. Hal stand da, spürte, wie sein Herz raste, fühlte, wie sich der Schweiß im Nacken sammelte und bis zum Gürtel hinunterrann.
Er überlegte, wer der Mann war. Jemand, den er aus dem Gemeinschaftsraum kannte? Vielleicht sogar ein Arzt?
Im siebten oder achten Monat seines Lazarettaufenthalts hatte er eine ähnliche Begegnung gehabt, eine mitternächtliche Kraftprobe mit einem Mann im weißen Kittel. Sie hatte damit geendet, daß man Hal gewaltsam ins Bett zurückbrachte und mit Beruhigungsmitteln in einen Schwebezustand versetzte. Danach einen Monat lang Thorazin, um seinen Gemütszustand zu ›verbessern‹. Es war, als würde man gewürgt, ständig langsam gewürgt.
Jetzt sagte der Bärtige etwas zu ihm. Es hörte sich an wie japanisch. In der Zeit, als Hal die Drecksarbeit für einen Landschaftsgestalter machte, hatte er viele Japaner sprechen hören. Aber wahrscheinlich hatte der Mann eben englisch gesprochen.
Hal hoffte das beste und sagte lächelnd: »Ja, das stimmt.«
Der Mann erwiderte sein Lächeln und ging weiter.
Hal schleppte sich durch den hell erleuchteten Flur und spürte sein rechtes Bein. Um die Hüfte zu entlasten, lehnte er sich beim Weitergehen mit der Schulter an die Blümchentapete der Wand.
Endlich kam er an eine offene Tür. Der Saal für Physiotherapie sah aus wie ein Basketballspielfeld ohne Körbe. Auf den gebohnerten Holzfußboden waren farbige Linien gemalt. An der hinteren Wand lag ein Stapel Matten. Hier war er selber, einen Arm schwer auf die Schulter eines anderen Mannes gestützt, die Linien entlang gegangen. Hatte rücklings auf einer Matte gelegen, das Bein anzuheben versucht und dabei das widerliche Ermunterungssalbader des Therapeuten vom Tonband erduldet.
Oh Gott, dachte er, bring mich hier raus!
Am anderen Ende des Saals führten Glasschiebetüren auf eine kleine Terrasse.
Geduckt schlich er hinein. Sein Atem ging jetzt keuchend. So weit war er nun gekommen. Er durfte nicht zulassen, daß sie ihn einfingen und in dieser Wattebauschhölle weiter festhielten.
Der Saal war leer, aber so groß, daß Hal schwindlig wurde, wenn er darüber hinblickte. Er studierte den Fußboden wie eine Landkarte. Die weiße Linie schien die kürzeste Route zu sein. Er stellte den linken Fuß auf die Linie und zerrte den rechten mit. Keine Wand zum Anlehnen. Rasender Schwindel erfaßte ihn. Eine Zeitlang erwog er sogar, auf allen vieren weiterzukriechen.
»Scheiße!« hörte er sich sagen. Dann krampfte er die linke Hand um das rechte Bein, um es zum Weitergehen aufzufordern.
Gegenüber rahmten die Glastüren die fahle Morgendämmerung ein. Er erblickte eine zementierte kleine Terrasse, die von einer halbhohen Mauer umgeben war, und bewegte sich darauf zu. Er wollte gehen wie andere Leute, für die Gehen etwas Selbstverständliches war. Und schließlich trugen ihn die Beine auch hin. Allerdings war er weit von der weißen Linie abgewichen und auf eine rote geraten.
Die Stirn an die Glastür gelegt, ruhte er sich mit einem dankbaren Seufzer aus. Durch Zufall bemerkte er, daß sein Hosenschlitz offenstand. Er ließ ihn so. Es könnte ihn zuviel Zeit kosten, den Reißverschluß zuzumachen. Und er hatte Angst vor einer ungeschickten Bewegung, wobei er womöglich die Glasscheibe mit dem Ellbogen zertrümmerte.
Erleichtert merkte er, daß sich die Tür leicht aufschieben ließ. Wahrscheinlich war es dem Personal noch nie in den Sinn gekommen, daß ihnen die Schlackerbeine mit den schlaffen Gesichtern davonlaufen könnten.
Die frische Luft kühlte angenehm sein heißes Gesicht. Er nahm an, daß es bald anders sein würde, daß der kalt gewordene Schweiß ihm Übelkeit bereiten würde. Aber er hatte winterliche Schneeregen in Washington und Britisch-Columbia gut überstanden. Und wie oft war er zwischen Ost- und Westküste nachts aufgewacht, wenn seine schneebedeckte Wange am Schlafsack anzufrieren drohte! Okay, ihm würde schon nicht übel werden.
Nach den verstreuten Ansammlungen kahler Baumwipfel hinter der Hohlziegelmauer zu urteilen, ging die Terrasse auf einen neugestalteten Parkplatz hinaus. Hal stolperte an einem Steingarten mit Bonzaibäumen vorbei. Er blickte auf eine verkrüppelte Zypresse hinab, und Entsetzen schnürte ihm die Brust zusammen. Aber es war ja nur ein Baum und kein Symbol. Der panikartige Adrenalinstoß half ihm jedoch, sich über die Mauer zu wälzen. Er landete hart auf Schulter und Hüfte und spuckte Kies aus.
Eine Zeitlang hockte er schlapp an der Mauer. Auf dem Parkplatz standen nur wenige Autos, alle dicht beieinander und in seiner Nähe. Dahinter, wo der Teerbelag endete, erstreckte sich ein langsam ansteigendes Feld, auf dem hier und da eine knorrige Eiche oder ein Haufen Kojotensträucher standen. Entschieden eine Landschaft, die nicht an San Francisco denken ließ. Wo zum Teufel war er denn?
Er rieb sich die Stirn, als wollte er ihr einen Geistesblitz entlocken. Abrupt hörte er damit auf und verbarg die gekrümmte Hand zwischen den Oberschenkeln. Im Lazarett hatte er zu den Stirnreibern gehört. Auf der Station für Kopfverwundete war eine ganze Horrorschau von Ticks zu besichtigen gewesen – Kinnkratzer, Nasenklopfer, Ohrläppchenzupfer.
Schwankend stand er auf. Am Ärmel seines Anglerpullovers war auf einmal ein rotbrauner Fleck. Er zog den Ärmel hoch. Aus einem blutgetränkten Wattebausch, der mit Klebeband in der Ellbogenbeuge befestigt war, tropfte es. Er riß den Verband ab. Er fühlte sich gezeichnet: der gelbe Stern des Patienten. Das Zeug fiel auf einen zerdrückten Seven-eleven-Kaffeebecher und trockene Eichenblätter.
Dann schaute er sich um. Hinter ihm lag das Rehabilitationscenter, und vor ihm erstreckte sich ein etwa hundert Meter großer Parkplatz. Am anderen Ende erhob sich ein langes zweistöckiges Gebäude mit quadratischen Schildern, den Symbolen für das Rote Kreuz und für Krankenwagen. Ein Krankenhaus.
Gleich neben Hals Standort war der Parkplatz zu Ende. Hier begann hügliges Gelände mit zottigen Sträuchern. Im ersten Morgenlicht trugen sie die stumpfgelbe Farbe von Papiertüten.
Einmal war er mit Laura an einer ähnlich aussehenden Landschaft vorbeigefahren; niedrige dürre Hügel mit Eichen und Gebüsch. Sie waren aus der Stadt gekommen, wo Laura Einkäufe gemacht hatte.
Er sah die Szene vor sich: Laura in einem Geschäft, wie sie dem Angestellten ihre Kreditkarte gab. Er roch das Duftgemisch von hundert verschiedenen Parfüms. Der Angestellte verstaute Lauras Einkäufe in einer Tüte. Hal erinnerte sich an irgend etwas mit Fransen. Er wußte nicht mehr, was alles in der Tüte war. Nur, daß er gemekkert hatte, weil sie das Geld zum Fenster hinauswürfe. Laura hatte ihm geantwortet, nur schäbige Leute würfen Geld zum Fenster hinaus. Dann hatten sie gefrorenes Joghurt gegessen, auf einem mit Keramikfliesen ausgelegten Innenhof, der dem Einkaufsviertel für die Snobs unter den Kunden einen Hauch von Klasse verleihen sollte.
Ja, das paßte zusammen. Städtische Krankenhäuser sehen wie Krankenhäuser aus. Also hatte ihn Laura hierher in den Süden der Stadt verfrachtet, dort, wo sie ihre Partykleider gekauft hatte (er konnte sich noch entsinnen, daß es im Süden gewesen war). Wenn sie in einem Pseudopark einkaufte, war es nur folgerichtig, daß sie ihn in eine Pseudopension mit Frühstück eingeliefert hatte.
Er näherte sich dem schmalen kiesigen Streifen zwischen Teerbelag und Gras, den linken Arm balancierend hochgereckt wie ein Hochseilakrobat.
Nachdenken konnte er später. Jetzt mußte er hier erst mal schleunigst verduften.
Das feuchte Gras gab unter seinen Schritten nach und näßte ihm die Stiefel und die umgekrempelten Hosenbeine der Jeans. Das Gehen auf dem unebenen Boden fiel ihm schwer. Das eine Bein wollte nicht so wie er. Er mußte es erst dazu überreden, ihn den Hügel hinaufzutragen.
Er stellte sich die Landkarte, die Laura im Wagen hatte, vor. Sie zeigte das Land rund um die San-Francisco-Bucht. Im Südwesten flachten die graugrün eingezeichneten niedrigen Hügel ab. Dort lagen ein Dutzend Städte, die ineinander übergingen. Vor seinem geistigen Auge zeichneten sich keine Namen ab. Dennoch fiel ihm ein Name wieder ein: Stanford.
Außer Atem blieb er mit pochendem Herzen stehen. Gott sei Dank! Jetzt wußte er wenigstens, wo er war. Er hatte seinen Standpunkt im Weltraum gefunden.
Stanford.
Das lag etwas über fünfzig Autominuten südlich der City. Was bedeutete: sechs, sieben Stunden zu Fuß. Wenn er überhaupt in der Verfassung war, so weit zu laufen.
Jetzt war er über den Hügel hinweg. Es ging abwärts. Daher war er vom Parkplatz aus nicht mehr zu sehen. Fast unauffindbar. In einer immergrünen Eiche mit niedrig hängenden Ästen ganz in seiner Nähe trippelte und hüpfte ein Zwerghäher von Zweig zu Zweig. Wenn er es bis zu dem Baum schaffte und sich dort eine Weile hinsetzte, würde alles okay sein.
Hal faßte an seinen Unterarm und fühlte, daß immer noch Blut aus dem Einstich in der Ellbogenbeuge tropfte. Er hatte Schmerzen in der Brust, und in seinem rechten Bein zogen sich die Muskeln – er spürte jeden einzelnen – von Zeit zu Zeit krampfartig zusammen.
Drei Meter vor dem Baum sank er zu Boden.
Früher einmal hatte er gewußt, wie man aus dem Sonnenstand die Nordrichtung bestimmen konnte. Doch jetzt hatte er den Trick vergessen.
Er legte sich lang ins Gras und ließ die Beinmuskeln zucken. Sein ganzer Körper war ermattet, schwer wie Blei. Er starrte zu den flockigen Wolken am heller werdenden Himmel hinauf. Sechzehn Scheißjahre. Was zum Teufel hatte den Rückschlag bewirkt?
Er erinnerte sich an Streitgespräche mit Laura. Es ging immer um dasselbe: um ihren übertriebenen Konsum, ihre gedankenlose Verschwendung, ihre Neigung, sich auf andere zu verlassen, die sich für sie abrackerten – ihre Putzfrau, ihren ›persönlichen Einkäufer‹, ihren Gärtner, ihren Lieferanten. Danach konnte er sich nur noch erinnern, daß er allein auf dem Teppich lag und eine Körperhälfte gelähmt war.
Oh Himmel! Sie hatten eine schlimme Zeit miteinander verbracht. Zank und Streit. Sie nannte ihn arrogant, zynisch, grausam. Er wollte gar nicht daran denken, wie er sie bezeichnet hatte.
Aber das konnte nicht die Ursache für seinen Rückschlag sein. Oder?
Plötzlich krümmte er sich. Die Tabletten kamen ihm hoch. Er richtete sich auf, und das trockene Aufstoßen schüttelte ihn durch.
Es wäre nicht das erstemal, daß eine Frau ihm das Leben versaut hatte.
Er kroch etwas näher an die Eiche heran, bis er zusammenbrach. Mit der Wange schürfte er über trockene Blätter und nadelscharfe Roggen- und Schwingelgrassamen. Der Geruch der dumpfen Erde stieg ihm in die Nase.
Als er damals aufgewacht war, lag er mit dem Gesicht nach unten auf dem Teppich. Mutterseelenallein. Und wenn Laura noch so wütend auf ihn gewesen und im Zorn zu allem möglichen fähig gewesen wäre, niemals hätte sie ihn so liegen lassen. Oder doch? (Er hatte ihr allerdings schlimme Sachen ins Gesicht gesagt!)
Blinzelnd betrachtete Hal die zarten, tausendfach sich überkreuzenden Grashalme. Es war wie ein surreales Bild. Und plötzlich überkam ihn kalte, lähmende Furcht.
Vielleicht würde er es diesmal nicht schaffen.
Kapitel 1
Dan Crosetti spielte den Cleveren, und seine sogenannten Freunde benahmen sich echt niederträchtig. Das Schlimmste war, daß er mich als seine Anwältin betrachtete, und ich war völlig durcheinander. Ich ging auf dem Zahnfleisch und überließ alles dem Zufall.
Schuldbewußt sah ich Danny an. Aber das half mir auch nicht weiter.
Zuerst hatte er in meinem Büro gewartet, um mich zu sprechen. Aber ich war schon weg gewesen. Der Tag hatte mit einer Auseinandersetzung mit meinem Seniorpartner Doron White begonnen.
Es war nicht einfach für Crosetti, irgendwohin zu gehen – ein Lastwagen der Nationalgarde hatte ihm 1972 beide Beine abgefahren. Als er mein Büro leer fand, ließ er sich von einem seiner Radikalinski-Kumpels zu meiner Wohnung fahren. Der half ihm, sich auf Krücken und einer Prothese schwankend die zwei Treppen hochzuquälen.
Jetzt stand Crosettis selbsternannter ›Kamerad‹ in steifer Haltung neben einem Erkerfenster und umarmte die Krücken wie Scrooge in Dickens’ Weihnachtsgeschichte. Von meinem Belutschistan-Teppich und den Sesseln mit Daunenbezug hielt er sich so weit wie möglich fern. Finster blickte er auf die Eukalyptusbäume und die dunstigen Rasenflächen des Presidio hinunter. Das ungepflegte dünne Kerlchen tat so, als könnte er sich an meinen extravaganten Luxusmöbeln schmutzig machen.
Dan Crosetti saß auf einem Sessel wie auf einer Riesenwolke. Seine Beine reichten nicht einmal bis zur Vorderkante der Sitzfläche. Neben dem halben Meter des leeren Drillichhosenbeins wirkte das künstliche Bein klotzig und überlang. Mit der faßbreiten Brust, den schwellenden Armen und dem Vollbart unter dem runden Kopf schien er viel zu schwer für das Möbel aus Gußstahl und zwei Holzdreiecken zu sein. »Laura«, brummte er, »du bist nicht okay. Was ist passiert?«
Typisch Crosetti. Als ob er selber nicht genügend verdammte Probleme hätte, wollte er sich auch noch mit meinen belasten. Zur Zeit war nicht viel nötig, um mich in Tränen ausbrechen zu lassen, aber ich wollte mich nicht an Dannys Schulter ausweinen. Nein, nicht bei Danny.
»Tut mir leid, daß du quer durch die Stadt fahren mußtest. Ich hatte angenommen, ich würde den ganzen Tag im Büro sein. Ich…« Ich was? Ich habe für dich noch nicht das Geringste getan? »Ich bedaure das wirklich sehr.«
Sein Blick von unten herauf ließ mich nicht los. In der ledernen Haut um seine Augen erschienen Fältchen, die Mitgefühl verrieten. Hoffentlich roch er den Wodka nicht, der gestern abend Ringe auf dem Beistelltisch hinterlassen hatte und auf den Fußboden gekleckert war.
Wenn aber doch, so ließ er sich nichts anmerken. Nicht wie meine Klienten von den Banken, die bedeutungsvoll auf die zwei Finger breite Laufmasche in der Strumpfhose, auf die herausgerutschte Bluse, auf die zerzauste Frisur und auf die Schuhe, die ich quer durchs Zimmer geschleudert hatte, geblickt hätten. Ich sah aus, als hätte ich einen Ringkampf mit Doron White ausgetragen. Was bestimmt besser gewesen wäre als die mit brandheißer Höflichkeit geführte ›Konferenz‹, an deren Ende ich mir vorkam, als hätte er mich auf Zwergengröße zurechtgestutzt.
Crosetti beugte sich vor, und sein Bauch quoll fast über den ihm verbliebenen Unterkörper. Seine Augen hatten die Farbe von brauner Milchschokolade, warme Augen voller Intelligenz und Einfühlungsvermögen. »Ich dachte, es wäre vielleicht was passiert, worüber wir sprechen müßten. Ich meine – wir sind doch Freunde, stimmt’s?«
Freunde … Ich wandte mich ab. Was Crosetti brauchte, war der fachkundige Rat eines guten Anwalts. Er mußte aufhören, sich um andere zu kümmern, und endlich an sich selber denken.
»Was möchtest du trinken?«
»Irgendwas.« Noch immer klang seine Stimme besorgt. »Was du gerade da hast.«
Ich konnte ihm doch nicht gut einen Stoli anbieten, nicht um zehn Uhr morgens. Auch wenn ich gern einen getrunken hätte.
Verdammtes Krankenhaus mit seiner stur befolgten ›Hausordnung der Besuchszeiten‹! Es konnte noch Stunden dauern, bis ich hinfahren und Hal besuchen durfte.
Rasch begab ich mich in die Küche und verscheuchte das Bild, das in meiner Erinnerung auftauchte: den Ausdruck vorwurfsvollen Erstaunens in Hals Augen, die Art, wie er die Hand aufmachte und wieder schloß, wie um mir zu beweisen, daß er wohl und gesund wäre.
Oh, mein Gott.
Ich brachte drei Tassen, absichtlich nicht zueinander passend, um Crosettis Kameraden milde zu stimmen. Wenn Tassen mit abgebrochenen Henkeln dagewesen wären, hätte ich die genommen.
Ich redete mir ein, ich täte es Crosettis wegen. Er sollte meinetwegen nicht noch mehr Kummer mit seinen Freunden haben. Aber eigentlich war es hauptsächlich Schuldgefühl. Crosetti verdiente etwas Besseres für sein Geld als signierte Tassen.
Ich goß Kaffee von gestern ein und machte ihn in der Mikrowelle heiß. Ich fühlte mich nicht imstande, Kaffeebohnen zu mahlen.
Crosetti nahm den Kaffee entgegen. Der andere machte, ohne mich eines Blickes zu würdigen, eine abwehrende Handbewegung. Ich wußte, warum er etwas gegen mich hatte. Weil ich, um Freispruch für Massenmörder zu erreichen, gerade aufgekommene neue Verteidigungsmethoden anwendete, was die üblichen legitimen Methoden in Mißkredit brachte. Weil ich es ›politisch auf der richtigen Linie liegenden‹ Anwälten unmöglich gemacht hatte, eine angemessene Verteidigungstaktik zu entwickeln. Das unterschied sich übrigens kaum von Doron Whites Vorhaltungen, so ungern die beiden es auch sehen würden, etwas miteinander gemein zu haben.
Aber in einer Hinsicht hatte ich Crosetti reinen Wein eingeschenkt. Ich hatte ihm gesagt, daß die düsteren Medienberichte über zwei Mordprozesse in der öffentlichen Meinung den Eindruck erweckt hatten, Laura Di Palma wäre eine käufliche Waffe für schuldige Mandanten, nicht für unschuldige. Der Gegenpol zu Perry Mason.
Crosetti hatte darauf nur gesagt: »Kann für uns beide nur gut sein.«
Und vielleicht wäre es auch so, wenn ich etwas unternommen hätte. »Ich habe in deinem Fall nur Scheiße gebaut, Danny.«
Hinter mir räusperte sich der Kamerad. Crosetti setzte die Tasse mit dem bitteren Kaffee ab.
»Bist du wirklich okay?« Der besorgte Klang in Crosettis tiefer Stimme war wie ein Messer, das sich noch tiefer in die Wunde meiner Schuld bohrte. Er machte sich Gedanken um mein Wohl! Er hatte mir seine Freiheit anvertraut, und ich hatte mir nicht mal die Zeit genommen, frischen Kaffee zu kochen.
»Ich bin okay. Aber ein anderer Anwalt hätte vielleicht …« Ich dachte daran, welchen anderen Anwalt Crosetti wahrscheinlich wählen würde. Einen politischen Schaumschläger. Es würde wehtun mitanzusehen, wie der Prozeß in die Binsen ging.
Politische Erklärungen abzulegen, war gut, wenn man mit zwei Monaten oder sogar zwei Jahren Haft für eine Übertretung oder Beschädigung von Regierungseigentum zu rechnen hatte. In solchen Fällen zählte vornehmlich Publicity. Aber Crosetti stand unter der Anklage, seinen engsten Mitarbeiter ermordet zu haben – einen Mann, der sich als FBI-Agent entpuppt hatte.
Crosetti stellte die Tasse auf dem Beistelltisch ab. Schnurrbart und Vollbart wuchsen zu einem wilden Gemisch zusammen. »Wir haben Zeit, uns alles zurechtzulegen.«
Ich sank auf die Couch, auf der ich die letzten sechs Nächte verbracht hatte. In den dicken Kissen hatten sich Dauerfalten gebildet. Glättend strich ich darüber hinweg. Mir war nicht klar, was ich mit Crosetti anfangen sollte. Meine Entschuldigung wollte er nicht. Mit meinen Problemen durfte ich ihn nicht belasten. Es hätte gegen die Berufsehre verstoßen, und keinem wäre damit gedient gewesen. Vor allem nicht Hal – solange es pro Tag eintausendvierhundert Dollar kostete, ihm sachkundige Pflege angedeihen zu lassen. Entweder angelst du weiter, oder du schneidest den Köder ab.
Ich blickte Crosetti an. Rund und beinlos wirkte er wie ein bärenhafter Humpty Dumpty. Bei allen Pferden des Königs und allen Männern des Königs: Die Bundesregierung hatte angeordnet, daß ihre Fahrzeuge die auf der Straße liegenden Demonstranten überrollen sollten, und einige Bundesgerichte hatten bereits entschieden, daß Crosetti (der einzige Protestler, der wirklich liegengeblieben war) dieses Risiko bewußt eingegangen war.