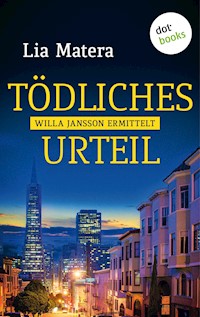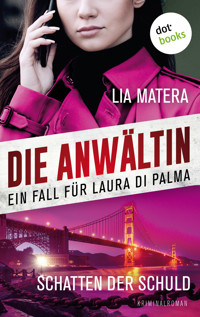Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Willa Jansson
- Sprache: Deutsch
Eine junge Anwältin im Angesicht des Verbrechens: Der fesselnde Kriminalroman »Kalte Strafe« von Lia Matera jetzt als eBook bei dotbooks. Willa Jansson weiß, dass der Weg zur erfolgreichen Anwältin harte Kompromisse erfordert – und bisweilen auch einen Pakt mit dem Teufel: Als Julian Warnake ihr einen Job in der berüchtigtsten Kanzlei von San Francisco anbietet, könnte dies entweder der Beginn einer steilen Karriere sein … oder der Weg in den Abgrund, denn schließlich haben Warnakes aufsehenerregende Aktionen und seine Verbindung zu ihrer Familie sie schon einmal in Gefahr gebracht. Doch dann geschieht das Unfassbare: Bei einem Business Lunch wird Warnake vergiftet – und Willa steht plötzlich als Verdächtige da. Als der ermittelnde Polizist Don Surgelato ihr mit Charme auf den Zahn zu fühlen beginnt, ahnt Willa, dass es für sie nur einen Ausweg gibt: Sie muss den wahren Schuldigen finden … »Scharfzüngig, unterhaltsam und entwaffnend zynisch.« San Francisco Examiner Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Justizthriller »Kalte Strafe« von Lia Matera ist Band 2 ihrer Reihe um die toughe Anwältin Willa Jansson und den besonderen Flair von San Francisco in den 70er und 80er Jahren. Jeder Roman kann unabhängig gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Willa Jansson weiß, dass der Weg zur erfolgreichen Anwältin harte Kompromisse erfordert – und bisweilen auch einen Pakt mit dem Teufel: Als Julian Warnake ihr einen Job in der berüchtigtsten Kanzlei von San Francisco anbietet, könnte dies entweder der Beginn einer steilen Karriere sein… oder der Weg in den Abgrund, denn schließlich haben Warnakes aufsehenerregende Aktionen und seine Verbindung zu ihrer Familie sie schon einmal in Gefahr gebracht. Doch dann geschieht das Unfassbare: Bei einem Business Lunch wird Warnake vergiftet – und Willa steht plötzlich als Verdächtige da. Als der ermittelnde Polizist Don Surgelato ihr mit Charme auf den Zahn zu fühlen beginnt, ahnt Willa, dass es für sie nur einen Ausweg gibt: Sie muss den wahren Schuldigen finden…
»Scharfzüngig, unterhaltsam und entwaffnend zynisch.« San Francisco Examiner
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera in ihrer Reihe um Willa Jansson die Kriminalromane:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
Sowie ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Originaltitel »A Radical Departure« bei Bantam Books, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 unter dem Titel »Facelifting« im Rotbuch Verlag
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1988 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 Rotbuch Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/IM_photo
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-188-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Kalte Strafe« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Kalte Strafe
Der zweite Fall für Willa Jansson
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Dietze
dotbooks.
Kapitel 1
Julian Warneke bestrich den Rand seiner Dessertschale mit einem Orangenschnitz. Die Partner der Rechtsanwaltskanzlei zur Rechten und zur Linken folgten seinem schicklichen Beispiel. Wir waren in einem dieser Restaurants mit rosanen Tischdecken und silbernen Weinausschenkern, das sich Rene’s nannte; eins von der Sorte, die zwischen den Gängen Sorbets servieren, »zur Gaumenreinigung«. Ich vermutete, daß diese Orangenschnitzprozedur eine weitere Maßnahme zum Heil unseres kostbaren Gaumens darstellen sollte. Der Duft der großen weiten Welt durchwehte diese Örtlichkeit so deutlich, daß ich nicht mit der Wimper gezuckt hätte, falls Julian auf die Idee verfallen wäre, ein Kruzifix in seine Amarettomousse zu stecken und sie mit seiner Krawatte aufzutunken.
Julian Warneke war weißhaarig und trug eine herablassende Miene zur Schau, seine Nase war krumm wie eine kleine Banane, und seine sahnige, faltenlose Haut sackte unter den Augen und an den Wangen etwas ab. Er wirkte immer taufrisch und gelassen und war unseren beiden Sekretärinnen gegenüber fast lächerlich aufmerksam, während er mich und andere niedere Chargen aus der Kanzlei wie Leibeigene triezte.
Julian war 1963 sehr berühmt geworden, nachdem ihn ein rassistischer Richter wegen Mißachtung des Gerichts hinter Gitter gebracht hatte, weil er eine Klage gegen die Rassentrennung in öffentlichen Schulen in Mississippi angestrengt hatte. Von da an hatte sich seine Anwaltskarriere sachte verschoben von der Verteidigung politischer Hippies, Wehrdienstverweigerer und Black Panther-Führer zur Wahrnehmung der Verlags- und Copyrightinteressen für ihre Memoiren, Fitness-Bücher und Meditationen über Jesus.
Ich arbeitete für Julian. Ich machte den albernen Klein-Klein-Rechtskram: die Scheidungen, die Mietsachen und die Alkohol-am-Steuer-Verteidigungen. Die anderen Teilhaber der Kanzlei waren ein radikaler Anlagenberater (Investiere nicht in die Apartheid), ein hochangesehener Arbeitsrechtler mit einer unverbesserlich stumpenrauchenden Klientel und ein weiteres Mitglied, das hauptsächlich damit beschäftigt war, auf seinem Weingut im Napa Valley Einladungen für demokratische Kongreßabgeordnete zu geben. Aber so liberal, daß sie ihrer neuen Kollegin einen interessanten Fall abgegeben hätten, waren sie auch wieder nicht.
Nicht daß ich mich beklagen würde. Die ehrenwerten Linken von Warneke, Kerrey, Lieberman & Flish hatten zweifellos eine schwarze, spanischsprechende Navajofrau aus Vietnam im Auge. Unter normalen Umständen hätten sie sehr gezögert, eine kleine, nach allgemeiner Ansicht recht hübsche Blonde einzustellen. Aber meine Eltern hatten für Clement Kerrey Mahnwache geschoben und für Julian Warnekes eingekerkerte Klienten die letzten fünfzehn Jahre Tonnen von Bananenbrot gebacken.
Als ich meiner Mutter erzählte, daß ich diesen Job nur über »Beziehungen« bekommen hätte, wären ihr vor Entsetzen beinahe die Sinne geschwunden.
»Willa, wie kannst du so was sagen? Du hast einen ausgezeichneten Abschluß gemacht und warst sogar Chefredakteurin einer juristischen Fachzeitschrift!« Meine Mutter hielt gerade einen geschwollenen Fuß in das Küchenwaschbecken; nach der Teilnahme an einem ›Hungermarsch‹ mußte sie ihn kühlen. »Damit will ich natürlich nicht sagen, daß Julian versessen auf formale Qualifikationen ist, in einer Zeit, wo so wenige junge Leute die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zu …«
»Mutter, Julian würde mit niemandem ein Bewerbungsgespräch führen, der nicht zu den besten zehn Prozent seines Jahrgangs gehört. Ich habe ihn nie darüber nachdenken hören, daß etwa die anderen neunzig Prozent die Möglichkeit haben sollten …«
»Schon richtig, Baby, er braucht eben die Allerbesten, um die Mittellosen und Unterprivilegierten zu verteidigen.«
»Aaron Bancroft« – einst ein berühmter Anarchist –»kriegt hunderttausend Dollar, um eine Videokassette über ›Wie verschafft man sich Beziehungen?‹ zu machen! Julian hat den Vertrag ausgehandelt.«
Meine Mutter blinzelte zu ihrem knotigen und entzündeten Zeh hinunter. »Aaron war so ein großartiger Redner; es ist zu schade.« Sie bekreuzigte sich. Diese Angewohnheit hatte sie sich kürzlich zugelegt, wenn sie über gefallene Linke sprach. (Zur Rettung konservativer Seelen war es augenscheinlich zu spät.)
»Julian bezahlt seine Angestellten schlechter als jede andere Kanzlei, hast du das gewußt?«
»Aber das tut er sicher, weil …«
»… er damit durchkommt, aus keinem anderen Grund, wie jeder x-beliebige Kapitalist …«
»… er macht so viel pro bono. Dein Vater und ich haben lediglich soviel bezahlt, wie wir uns leisten konnten, als …«
»Mutter! Ich hab zwei Extrajobs angenommen, damit du Julian bezahlen konntest, nachdem du den Sprengkopf von dieser Rakete angekratzt hattest!«
»Aber das hättest du nicht tun müssen! Es hätte uns solchen Spaß gemacht, mit den Weillars zusammen …«
»Oh, großartig! Bankraub für den Frieden!«
Sie hob den Fuß aus dem Spülstein, ließ ihn auf den Boden fallen und rieb sich die Hüfte. »Das erinnert mich daran, daß ich ihnen vorm Besuchstag ein Bananenbrot backen muß.« Auf gerichtet wirkte sie schlanker als die meisten Frauen ihres Alters, obwohl sie unübersehbar birnenförmig war und die Schwerkraft ihre Proportionen verzogen hatte. Sie pustete sich gelbgraue Haarsträhnen aus dem Gesicht.
»Wie auch immer, Julian könnte es sich sicher ohne weiteres leisten, mir ein auskömmliches Gehalt zu zahlen! Unsere ›Arbeitsessen‹ müssen ihn jedesmal fünfhundert Eier kosten.«
Das war genau der Grund, warum mich ein Hauch von Irritation anwehte, als ich Julian dabei beobachtete, wie er den Rand seiner Dessertschale mit einer Girlande aus Orangenschale umrankte.
Kein zufälliger Beobachter wäre auf die Idee gekommen, daß wir Demokraten sind, geschweige denn bekennende Sozialisten.
Andererseits hatte ich gerade einen Monat in Lawton, Oklahoma, verbracht, und ich war glücklich, wieder in der Zivilisation zu sein, falls man San Francisco zivilisiert nennen kann. Nach einer sechsundzwanzigtägigen Auseinandersetzung mit jemandem, dessen Begriff von Politik noch aus den finsteren Zeiten des Frühkapitalismus herrührte, war natürlich die Gesellschaft von mehr oder weniger kompromißlerischen Vielleicht-Ex-Linken sehr angenehm. Und wenn auch mein Mittagessen unangemessen kostspielig war, schließlich bezahlte ich die Rechnung nicht, jedenfalls nicht direkt – und die Canneloni waren ausgezeichnet. (Oklahomas Vorstellung von fremdländischem Essen bestand aus Strohhut-Pizza.)
Also aß ich still meine Canneloni, als Julian mir Ratschläge für einen Geschworenenprozeß erteilte, und unterließ es, ihn darauf hinzuweisen, daß er sich mit Sorbet bekleckert hatte. Julian bevorzugte vor Gericht die große politische Geste gegenüber der juristischen Kleinarbeit, was völlig in Ordnung ist, wenn dein Klient ein Fan von Guerillatheater und Gefängnisfraß ist. Der Kellner kam mit Kaffee, erkannte Clement Kerrey als Anwalt seiner Gewerkschaft und verfiel in ein bitteres Klagelied über seinen Boß.
Clement fuhr mit einer Leinenserviette über seinen ordentlichen grauen Bart. »Ihre Gewerkschaft hat ein Beschwerdeverfahren«, beschied er kühl. Er vertrat Gewerkschaften, keine Angestellten.
Das Gesicht des Kellners rötete sich, er murmelte ein paar unfreundliche Worte über seine Gewerkschaft und dräute düster damit, daß die Kellner über Streik nachdachten.
Clement Kerrey, ein hagerer und reservierter Mann mit glitzernden schwarzen Augen, war definitiv alarmiert – Gott bewahre ihn vor Streikposten an seinem Lieblingsrestaurant.
Julian schnitt ihm vorsorglich das Wort ab: »Die Rechnung, bitte.«
Der Kellner interpretierte das korrekterweise als Verabschiedung und stolzierte davon; meine ausgestreckte Kaffeetasse blieb in der Luft hängen.
Brian Lieberman lehnte sich nach vom, spähte über die Schulter und sagte dann in vertraulichem Ton: »Das erinnert mich daran, daß wir eine Entscheidung über Mae Siegel fällen sollten.«
Brian war die Quintessenz eines männlichen San Franziskaners (obwohl er Wert darauf legte, heterosexuell zu sein). Er sah immer frisch rasiert und massiert aus, und sein grübchenverziertes Gesicht leuchtete goldfarben wie eine Aprikose aus dem Napa Valley. Er kannte Geschichten über großartige Restaurants, bevor sie – welch ein Horror – ›entdeckt‹ worden waren. Er konnte die wirklichen Gründe aufzählen, warum das Symphonieorchester seinen Dirigenten loswerden wollte, und er wußte, wo man den billigsten BMW der Halbinsel kaufen konnte.
Clement Kerrey schüttelte traurig den Kopf. »Wir müssen Mae gehen lassen.«
»Was?« Ich verschluckte mich an meinem Kaffeesatz. »Redet ihr über Mae Siegel?«
Mae war eine der beiden Sekretärinnen der Firma. Ich ›teilte‹ sie mit Felix Flish. Flish, der Computer-Freak der Firma und de facto Büromanager, drückte ihr ununterbrochen neue Software auf, so daß sie selten für etwas anderes Zeit hatte, als ihren Terminal zu verfluchen. Also landete der Großteil meiner Arbeit auf dem Tisch der anderen Sekretärin, Maria.
Felix, ein sehr hochgewachsener Mann mit einem langen Pferdegesicht und einer großen sattellosen Nase verfiel in einen gelackten britischen Akzent, als er sagte: »Wir können nicht zulassen, daß sich die bezahlten Aushilfskräfte liederlich benehmen.«
Clement versteifte sich und verlagerte sein Gewicht, um dem Kellner zu ermöglichen, Julian die Rechnung zur Unterschrift zu reichen. »Wirklich nicht. Ihr wißt, wir alle mögen Mae. Es ist eine Frage von …«
Julian beendete die Diskussion brüsk: »Ich meine, wir sollten diese Angelegenheit bis zur Teilhabersitzung vertagen.« Er grübelte über der Rechnung, kalkulierte ein überzogenes Trinkgeld und unterschrieb.
Felix lümmelte lässig zwischen Brian und Julian und lächelte mir gerade ins Gesicht. Ich war die einzige von fünf Anwälten in der Firma, die keine Teilhaberin war.
Offensichtlich nahm Julian an, daß ich an unserem Arbeitsplatz zur Schar der Liederlichen zählte.
Die Möglichkeit herauszufinden, was er wirklich dachte, bekam ich nie mehr. Julian fischte die Garnitur aus seiner halbaufgegessenen Mousse, das machte er immer so. Die Garnitur sah aus wie kandierte Birne oder Apfel, in eine Rosette geschnitten. Ich blickte gerade zu ihm rüber, als er sie in den Mund steckte. Er verzog das Gesicht, als sei sie sehr bitter, aber er war zu wohlerzogen, sie wieder auszuspucken.
Abends lag der Große Alte Mann der linken Anwaltschaft mit einer Schierlingsvergiftung im Krankenhaus. Das Restaurant schwor, seine Desserts nicht mit giftigen Wurzeln dekoriert zu haben. Die Polizei klingelte mit einem Durchsuchungsbefehl an meiner Wohnungstür, und die Reporter glucksten vor Vergnügen, als sie herausfanden, daß ich vor zwei Jahren schon einmal Hauptverdächtige in der sogenannten ›Mordserie an der Juristischen Fakultät‹ gewesen war.
Kapitel 2
»Ist es nicht ein wenig heikel für Sie, hier auf der Beerdigung zu sein?«
»Reine Routineangelegenheit«, beschied mir Lieutenant Don Surgelato von der Mordkommission. »Ich verhöre niemanden, Miss Jansson, ich observiere nur.«
Ich warf einen unauffälligen Blick auf meine oberen Blusenknöpfe, weil sich sein Observationsdrang vor allem dorthin zu richten schien. »Sie verhören mich!«
Don Surgelato war früher mal ein guter Footballspieler und hatte sich aus dieser Zeit eine Schwäche für den ›Kann-vor-Kraft-nicht-gehen-Look‹ erhalten: viel zu enger Anzug, offener Hemdkragen und lausig gebundene Krawatte. Um das Bild vollständig zu machen: Sein sturer Ausdruck war ihm angeboren, tief hängende Augenbrauen durchkreuzten sein Gesicht, das sich jetzt für mich zu einem breiten Großer-Junge-Lächeln erhellte. »Kein Verhör. Abgesehen davon sind wir ja alte Freunde.«
Alte Freunde. Sechs Monate lang hatte mich Surgelato ununterbrochen über Morde an Kollegen, die mit mir zusammen eine juristische Fachzeitschrift herausgegeben hatten, verhört. Das war zwei Jahre her – und ich hatte ihn seitdem nicht vermißt.
»Oh Jessas, tut mir das leid, Lieutenant, ich hab Ihren Geburtstag ganz vergessen.« Ich trat zur Seite, um eine Gruppe Lastwagenfahrer mit Elvis Presley-Frisuren in die Kapelle zu lassen.
Wir standen an einer der zugigsten Straßenecken von San Francisco, der Verkehrslärm brüllte vor der holzgeschindelten Kapelle eines Beerdigungsunternehmens, das noch vor kurzem ein ukrainisches Lokal gewesen war und noch schwach nach Piroggen roch. Der Stätte ging jede Eleganz ab, aber es war ein guter Gewerkschaftsladen, und Julian Warneke hätte bei seiner Beerdigung mit Sicherheit keine Streikposten gewollt.
»Sie fahren in der nächsten Woche nach L.A. runter?«
»Ja.« Der Prozeß über die Morde an der juristischen Fakultät war schließlich doch noch angesetzt und der Verhandlungsort nach Los Angeles verlegt worden. Unglücklicherweise kannte ich den Mörder sehr gut; jedenfalls gut genug, um als Hauptbelastungszeugin des Staatsanwalts zu fungieren.
»Das wird Staub aufwirbeln.« Surgelato blinzelte gegen den Wind und beobachtete, wie ein jüngerer Mann mit einem an den Schultern dramatisch ausgestopften Anzug einer schwarzen Limousine entstieg.
»Was meinen Sie damit?«
»In dem Fall haben wir nie ein Geständnis erreicht. Und Sie waren die Hauptverdächtige. Jetzt sind Sie ebenfalls verdächtig.«
»Aber das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.«
»Die Anwältin der Gegenseite wird sagen, daß die Verbindung hauptsächlich aus Ihrer Person besteht. Und so ungern ich das erwähne, Di Palma ist ein echtes As als Verteidigerin.«
Die Verteidigerin war in der Tat ein As. Und der Fakt, daß sie für ihren Klienten auf »Nicht schuldig« plädierte, ließ nichts Gutes ahnen.
»Vielleicht ist Julian gar nicht … Ich meine, vielleicht ist dem Restaurant ein schwerwiegendes Versehen unterlaufen.«
»Was wissen Sie über Schierling, Miss Janson?«
»Sokrates trank welchen.«
»Der war von einem Baum, einer Eibe. Das hier war ein Unkraut. Sieht aus wie eine große Karottenpflanze. Ein paar Gramm von der Wurzel sind tödlich – nach drei, vier Stunden. Die Mundschleimhäute und die Zunge schwellen an. Es geht Ihnen schlecht, aber Sie verspüren keinen Brechreiz.« Er neigte den Kopf und beobachtete mich. »Aber Sie haben ja in Stanford Botanik belegt. Ihnen brauche ich das nicht zu erklären.«
»Wir haben in Botanik nichts gemacht, außer Blütenblätter zu zählen.«
»Entscheidend ist, daß man Schierling finden muß. Auf Brachland in der Nähe von Wäldern oder Sümpfen. Man kann das Zeug nicht einfach im Supermarkt kaufen.«
Ich hörte mit einem Ohr, wie Brian Lieberman in der Kapelle mit einem Anwalt vom Nationalen Amt für Arbeitsbeziehungen über Kraftradfahren diskutierte. Der Mann mit den ausgestopften Schultern schob sich in unsere Richtung. Ich drehte ihm den Rücken zu.
»Ich habe gehört, wegen Ihrer Zulassung gab es ein wenig Ärger«, warf der Lieutenant hin.
»Die Anwaltskammer brauchte etwas Zeit, mich zu überprüfen, wenn Sie das meinen.«
»Ach so ja, verurteilt wegen …«
»Widerstands gegen die Staatsgewalt.« Ich lachte. »Those were the days …«
»Warneke hat Sie verteidigt, war das nicht so? Ich glaube, ich erinnere mich, als ich den Haftbefehl gelesen habe, er hätte Sie wegen eines geringeren Vergehens …«
»Willa!« Der ausgestopfte Schultermann legte eine weiche weiße Hand auf meinen Arm. »Lange her. Großartiges Kostüm.« Er blieb hartnäckig an meiner Seite, auch als ich nicht antwortete. »Erkennst du mich nicht?«
Falls nicht, hätte ich ihm sicher nicht den Rücken zugekehrt. Aaron Bancroft, der uns einst zu Tausenden im Marsch auf Washington geführt hatte, überreichte mir jetzt seine Geschäftskarte: Consultant, Die Elliot-Wellentheorie der Aktienbewegungen. Ich hatte plötzlich ein Gefühl, als ob ich kotzen müßte.
Aarons Sommersprossen und sein Junge-von-nebenan-Gesicht hatten früher immer einen ironischen Gegensatz zu seinen wilden Haaren und radikalen Ansichten gebildet. Mit seinem modischen Anzug und seiner Schildpattbrille sah er jetzt allerdings wie ein erwachsener Howdy Doody aus.
Glücklicherweise machte er einige andere alte Bekanntschaften aus und schlüpfte davon, um ihnen Geschäftskarten zu überreichen.
»Auf einer Beerdigung Geschäftsbeziehungen anleiern!«
»Wollen Sie meine Meinung hören?« Ich wollte nicht, aber Surgelato würde sie mir ohnehin mitteilen. »Er ist auf diese Weise für die Gesellschaft wesentlich nützlicher, als wenn er Molotowcocktails in Banken wirft.«
»Für seine Anklage hat Julian einen Freispruch erwirkt.«
Der Lieutenant gab sich naiv-mokant. »Dann war er natürlich unschuldig!«
Felix Flish rannte die Stufen der Trauerkapelle hoch und blieb stehen, als er unserer ansichtig wurde. Er streckte Surgelato die Hand entgegen. »Sergeant!«
Surgelatos Augen verloren sich im Schatten seiner mächtigen Augenbrauen, so daß ich seinen Gesichtsausdruck nicht entziffern konnte. »Ich freue mich, daß Sie sich an unser Gespräch von neulich abend erinnern, Mr. Flish, aber habe ich damals nicht erwähnt, daß ich Lieutenant bin?«
Der Wind zauste Felix’ Haar zu einem Strahlenkranz. »›Sergeant‹ ist bei mir wahrscheinlich ein Programmfehler, der immer auftritt, wenn ich Polizist sagen will.«
»Ein Programm …? Ah, ich habe verstanden – ein Computermann.« Wenn man vom Tonfall des Lieutenants ausging, hatte er für Computermänner keine allzugroße Verwendung.
Felix bemerkte mich, machte sich aber nicht die Mühe, mich zu grüßen, was ihm ähnlich sah. Er spähte in das Innere der Kapelle und zauberte ein seltsam nostalgisches Lächeln auf sein Gesicht. Bei den ersten Tönen der Orgelmusik folgte ich ihm nach drinnen.
Julians Sarg war mit Paradiesvogelorchideen in japanischem Arrangement dekoriert. Davor kniete eine Gruppe schluchzender Frauen. Eine davon war Bess Warneke, Julians erste Frau. Eine weitere Mae Siegel, seine Sekretärin, die Julian ohne das mindeste Zögern gefeuert hätte. Die dritte Frau war meine Mutter. In ihre Richtung watschelte Silvio Bernstein, unser Kongreßabgeordneter.
Ich traute meinen Augen nicht.
Ich drängelte mich durch die Menge, fing Silvio ab und zog ihn in eine dunkle Ecke hinter der Orgel. Ein Mann in einem sauberen, sorgfältig gebügelten Arbeitshemd spielte: »Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel.« (Was eine grobe Lüge ist.)
Ich mußte meine Lippen nah an Silvios fleischiges Ohr bringen, damit er mich verstehen konnte – aber niemand sonst. »Was tust du denn hier?«
Silvio, ein stämmiger, immer rotgesichtiger Mann, den nur noch ein paar wenige Haarsträhnen von der völligen Kahlheit trennten, intonierte: »Julian Warneke war ein der Sache leidenschaftlich ergebener, überaus verantwortlicher …«
»Ich bitte dich. Du solltest eigentlich auf einer Vergnügungsreise auf Staatskosten sein.«
Silvio schüttelte den Kopf. »Hat dir dein Vater nicht Bescheid gesagt? Wir haben es auf September verschoben.«
»Oh, mein Gott!« Ich spähte ängstlich zu meiner Mutter hinüber. Sie und Bess heulten sich die Seele aus dem Leib, knietief in feuchten Kleenextüchern versunken. »Daddy hat gepackt und ist abgereist – gesagt hat er, daß er mit dir los ist. Mutter glaubt …«
Silvios Augen weiteten sich. »Ich wäre dort?« Dann runzelte er die Stirn. »Das klingt aber gar nicht nach Willy!«
Wir sahen uns ein paar Augenblicke lang an, als würde uns das helfen zu verstehen, warum mein Vater uns angelogen und behauptet hatte, daß er für zwei Wochen nach Nicaragua gehen würde.
Kapitel 3
Meine Eltern waren sich auf einem Anti-Atomtod-Treffen begegnet und hatten mich kurz darauf angesetzt; das war möglicherweise das letzte, was sie jemals in Gang gebracht haben, ohne daß eine ausführliche moralische Debatte vorausgegangen ist. Sie kamen überein, daß eine Heirat zu bourgeois wäre; also konnte mein Vater keinen Nutzen aus der Härtefallregelung ziehen, die ihm die Einberufung zum Koreakrieg erspart hätte. Bestrickt von Mahatma Ghandis Philosophie des passiven Widerstands ließ er sich nach Übersee lotsen, aber dort angekommen, verweigerte er jeden Umgang mit der Waffe. Also verbrachte er zwei Jahre im Militärstraflager.
Inzwischen schockierte meine Mutter ihre wohlanständige Familie mit einer Flucht nach Mexiko, um das Kind ihrer Liebe auf die Welt zu bringen. Wahrscheinlich hoffte sie damit, mich zweisprachig zu machen.
Nach einer Weile wurde mein Vater unehrenhaft aus der Armee entlassen. Seine Eltern, Bauern aus Minnesota, waren gestorben und hatten ihm einen brandneuen blauweißen Bel Air hinterlassen. Ein Kinderfoto zeigt mich auf der Motorhaube sitzend wie eine verstrubbelte Kühlerfigur. Im Hintergrund sieht man die Badlands von Utah. Meine Eltern waren on the road.
Als sie wie so viele aus der Beat Generation für die Rumzieherei zu alt geworden waren, ließen sie sich in San Francisco nieder, in einem Viertel, das später der Haight Ashbury District genannt werden sollte. Sie meldeten mich in einer »Schule« an, die genaugenommen die Etagenwohnung einer dicklichen »Kerzen-Künstlerin« war, die nach Weihrauch roch und nur Zen-Sprüche von sich gab (was mir den lebenslänglichen Verdacht eintrug, daß östliche Philosophie die Menschen zu Dummköpfen macht).
Meine Eltern arbeiteten mit geistig zurückgebliebenen Erwachsenen, was ihnen, so nehme ich an, geholfen hat, die endlosen politischen Versammlungen durchzustehen, an denen sie teilnahmen.
Als ich zum Teenager heranreifte, verwandelte sich unser Viertel in ein interkulturelles Mekka. Einiges davon gefiel mir sehr – besonders die Drogen und die freie Liebe. Dann verwandelten sich die Leute in Blumenkinder, und die ganze Sache wurde ein bißchen dümmlich, aber das ist eine andere Geschichte.
Die Eltern meiner Mutter besuchten uns 1968, ein Versuch, sich wieder mit ihr zu versöhnen. Sie kamen zu der Auffassung, daß meine Mutter eine schlappe Null geheiratet und eine drogenabhängige Hippihure großgezogen hatte. Aber sie waren, untypisch für ihre Generation, Vietnamkriegsgegner, und alles zusammengenommen, fanden wir sie eigentlich eher putzig. Meine Eltern gingen sogar soweit – sie bezeichneten es als surreale Geste – zu heiraten, nur um das miesepetrige Paar zu erheitern. Ich habe den größten Teil der Zeremonie versäumt; ich ging raus, als der barfüßige, per Post georderte Priester begann, Kahlil Gibrans Hochzeitsknittelverse zu rezitieren. (»Hör mal, Baby«, wies mich Mutter hinterher in der Tassajara Bakery zurecht, »er hat sein ganzes Herz in diese Verse gelegt.«)
Meine Großeltern zeigten sich meiner Mutter gegenüber mit einem großen Geldgeschenk erkenntlich, von dem die das meiste einer örtlichen Suppenküche spendete. Meine Eltern waren dann bald darauf wieder pleite, aber, wie mein Vater anmerkte, konnten wir jederzeit auf eine warme Mahlzeit bei Saint Anthony’s rechnen.
Als die Linke sich langsam totlief und uns nur noch Jimmy Carter blieb, machten meine Eltern als seine einsamen Unterstützer die Menschenrechtsfrage zu ihrer Sache. Das führte zu einem Einsatz beim Peace Corps und langen Jahren des Rumzigeunerns in Mittelamerika, gerade als es eine Masse blutiger Aufstände in dieser Region setzte. Ich hätte genausogut Söldner als Eltern haben können; jedesmal, wenn ich in der Zeitung über ein Blutbad südlich unserer Grenzen las, konnte ich sicher sein, daß meine Eltern mittendrin steckten.
Zu dieser Zeit waren die einzigen anderen Amerikaner an solchen Orten katholische Missionare, was bald dazu führte, daß meine Mutter konvertierte. Außer einigen anderen Dingen bedeutete das eine zweite, katholische Hochzeit (wenigstens kein Kahlil Gibran) und ein plötzliches Umsichgreifen von Ikonen zwischen den Nie-wie-der-Vietnam-Postern in ihrem Wohnzimmer. Meine Mutter gestand mir gleichfalls, daß sie mit jedweder Verhütung aufgehört habe, aber da sie schon mitten in der Menopause war, kann diese Aktion als weitgehend symbolisch bezeichnet werden. (»Aber selbstverständlich vertrete ich weiterhin das Recht auf freie Abtreibung.«)
Mein Vater, ein kleiner schmaler Mann mit zurückweichendem Haaransatz, schönen hohen Wangenknochen und Grübchen (die ich geerbt habe), sieht für sein Alter immer noch sehr gut aus. Aber meiner eigenen voreingenommenen Meinung nach ist er meiner Mutter und ihren gemeinsamen tiefempfundenen sozialen Anliegen viel zu verpflichtet, um in seinem fortgeschrittenen Alter noch den Schwerenöter zu mimen.
Also glaubten wir ihm, als er uns erzählte, daß sein Sandkastenfreund und frischgebackener Kongreßabgeordneter Silvio Bernstein ihn zu einer Untersuchungskommissionsreise nach Nicaragua mitnehmen wollte. Meine Mutter hatte wehmütig zugestanden, daß sie für zwei Wochen in der Lage sei, ihre eigene Kocherei zu ertragen. Aber abgesehen von ein paar Tränen und einer ernsten Warnung, sich Silvios politischem Einfluß nicht zu ergeben (schließlich konnte sie ihm nur schwer verzeihen, daß er das Gesetz zur Beibehaltung der Todesstrafe unterstützt hatte), schien sie nicht allzu ängstlich, als mein Vater aufbrach.
Und obwohl er den üblichen Aufstand machte, uns daran zu hindern, ihn zum Flughafen zu bringen, hatte er mit Sicherheit weder nervös noch schuldbeladen gewirkt.
Also, wo zum Teufel, trieb er sich herum?
Kapitel 4
Nach der Beerdigung fuhren wir im Korso zu Brian Liebermans Weinberg: BMWs folgten uralten, psychedelisch dekorierten Kleinbussen und Teamster-Zugmaschinen. Ich fuhr mit Felix Flish in seinem schwarzen Saab. Er machte keine Anstalten, sich mit mir zu unterhalten. Statt dessen legte er eine Rolling Stones-Kassette ein und schlug mit dem großen Zeh den Takt dazu. Ich brauchte eine Viertelstunde, um herauszufinden, daß das Klopfen aus seinem baguettegroßen Schuh kam, und eine weitere Viertelstunde, mich selbst dazu zu überreden, ihm nicht auf den Fuß zu trampeln.
Als die Kassette alle war, sprang ich in die Lücke, in der Hoffnung, die B-Seite zu verhindern. »Warum wollt ihr Jungs eigentlich Mae feuern?«
»Häng bloß mir diese Scheiße nicht an. Ich will sie nicht feuern!«
»Aber, warum will denn Clement …?«
»Mae schläft mit Jim Zissner.«
Jimmy Zissner bewarb sich für das höchste Amt bei den Teamsters, Ortsgruppe Local 16: den Schatzmeister. Die Local 16, Clements größter Klient, war für die Verbissenheit ihrer Wahlkämpfe bekannt. Dieses Jahr war besonders wild, weil Zissners »Teamsters für eine Demokratische Gewerkschaft« den derzeitigen Schatzmeister, Semi Sawyer, mit allem Denkbaren außer vielleicht des Vampirismus beschuldigten. Clement hielt nicht allzu viel von den TDG; ich hörte ihn mal höhnisch bemerken, »wenn sie Demokratie wollen, dann sollen sie doch jeder einzeln verhandeln«.
»Du weißt doch genau, wie beschissen paranoid dieser Sawyer ist«, fuhr Felix fort. »Er sagt, Zissner hat einen Spion im Büro.«
Obwohl unser Büro demonstrativ die Interessen aller Mitglieder der Local 16 repräsentierte, wurde der endgültige und unveränderliche Wille der Local 16 durch die Person ihres Schatzmeisters ausgedrückt. Semi Saywer entschied allein, auf Grund welcher Beschwerden wir vor Gericht gingen und auf Grund welcher nicht. Viele seiner anderen Entscheidungen, zu streiken, Streikbrecherunfälle taktisch gutzuheißen, sich mit den Streikposten anderer Gewerkschaften zum Beispiel zu solidarisieren, zogen ebenfalls rechtliche Komplikationen nach sich. Aus diesem Grund hatte Sawyer unserer Firma ein jährliches Fixum ausgesetzt. Im Gegenzug erwartete er, daß wir alle Konsultationen mit ihm vertraulich behandelten, sogar, möglicherweise auch besonders, seinen Teamster-Kollegen gegenüber.
»Mae würde keine vertraulichen Informationen weitergeben!«
»Versuch mal, das Semi zu erklären, das ist, als würdest du dich mit dem Krakatau unterhalten. Und Clement wirft mit Phrasen wie ›standeswidriges Verhalten‹ und ›Interessenkonflikt‹ um sich.«
»Es wäre besser, wenn Clement Mae verteidigen würde!«
Felix grinste tückisch.
»Felix, das ist doch der reine Feudalismus! Clement hat überhaupt kein Recht, den Sekretärinnen zu erzählen, mit wem sie zu schlafen haben und mit wem nicht! Wenn Semi nicht beweisen kann, daß …«
»Möchtest du Semi die Regeln der Beweisführung erklären? Oder willst du Mr. Arbeitsrecht persönlich erklären, wen er feuern darf?«
Felix griff zu der Stones-Kassette, drückte sie ins Kassettendeck zurück, und machte damit deutlich, daß seine Frage rhetorisch bleiben würde. Zwischen der Musik und seinen taktstampfenden Zehen fühlte ich mich wie im Faß zu Brians Weinberg gerollt.
Der Weinberg war ein Stück kultivierter Hügel mit einem gedrungenen Gebäude am Fuße und einem ausladenden viktorianischen Farmhaus auf der Spitze. Das Haus, welches Brian ›Timely Manor‹ nannte, hatte an drei Seiten eine überdachte Veranda. Dort standen einige mauvefarben gedeckte Tische. Junge matadormäßig ausstaffierte Kellner hoben von dort Tabletts mit gefüllten Pilzen und Crudites runter und verfütterten sie an die Leute.
Hügelaufwärts verpufften dickbäuchige Teamster Wolken von Zigarrenrauch und reichten eine Literflasche Jack Daniels herum, die sie auf leere Weingläser verteilten. Ich konnte hören, wie sie die Anklage gegen den letzten Präsidenten von Teamsters International diskutierten. Worte wie »alles Intrigen« und »Mord an den Gewerkschaften« wurden mehrfach wütend wiederholt. Plötzlich kam ihr Gespräch zum Erliegen. Der Teamster-Dissident Zissner hatte sich zu ihnen gesellt.
Mitten in dieses Pulverfaß hinein walzte einer der jungen Matadore und murmelte: »Französische Pflaumen in weiße Schokolade gestippt?«