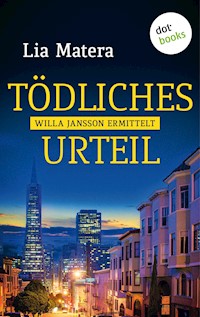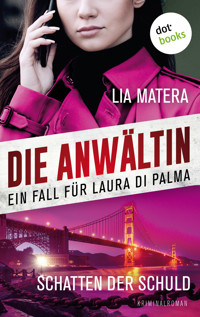4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Laura Di Palma
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die tödlichen Schatten der Vergangenheit: Der fesselnde Kriminalroman »Die Anwältin – Glanz der Lüge« von Lia Matera jetzt als eBook bei dotbooks. Laura Di Palma ist die gefeiertste Strafverteidigerin von San Francisco – nur widerstrebend kehrt sie der Stadt den Rücken, um in ihre Provinzheimat in den kalifornischen Redwood-Wäldern zu reisen, doch der rätselhafte Tod eines alten Freundes lässt ihr keine Ruhe. Niemand in Hillsdale scheint Nachforschungen anstellen zu wollen – aber Laura hat es schon immer verstanden, unbequeme Fragen zu stellen und düstere Wahrheiten so ans Tageslicht zu bringen. Allerdings ahnt die Anwältin nicht, wie tief die Wurzeln des Verbrechens in dieser Stadt wirklich reichen – zumal eine der Spuren bald zu ihrem zwielichtigen Ex-Mann führt … Die mehrfach preisgekrönte Autorin jetzt bei dotbooks: »Laura Di Palma ist einer der unwiderstehlichsten Charaktere der Krimiliteratur.« Baltimore Sun Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Anwältin – Glanz der Lüge« von Lia Matera ist der Auftakt ihrer fesselnden Krimi-Reihe um eine starke Frau zwischen zwei Welten: ihrer Heimat in den kalifornischen Redwood-Wäldern und den schillernden Anwaltskanzleien San Franciscos. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Ähnliche
Über dieses Buch:
Laura Di Palma ist die gefeiertste Strafverteidigerin von San Francisco – nur widerstrebend kehrt sie der Stadt den Rücken, um in ihre Provinzheimat in den kalifornischen Redwood-Wäldern zu reisen, doch der rätselhafte Tod eines alten Freundes lässt ihr keine Ruhe. Niemand in Hillsdale scheint Nachforschungen anstellen zu wollen – aber Laura hat es schon immer verstanden, unbequeme Fragen zu stellen und düstere Wahrheiten so ans Tageslicht zu bringen. Allerdings ahnt die Anwältin nicht, wie tief die Wurzeln des Verbrechens in dieser Stadt wirklich reichen – zumal eine der Spuren bald zu ihrem zwielichtigen Ex-Mann führt …
Die mehrfach preisgekrönte Autorin jetzt bei dotbooks: »Laura Di Palma ist einer der unwiderstehlichsten Charaktere der Krimiliteratur.« Baltimore Sun
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
Sowie ihre Reihe um Willa Jansson mit den Kriminalromanen:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2021
Dieses Buch erschien bereits 1991 unter dem Titel »Am Rande des Gesetzes« bei Heyne und1996 unter dem Titel »Lauras teuerster Fall« bei Fischer.
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1988 unter dem Originaltitel »The Smart Money« bei Bantam Books, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1988 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Senyuk Mykola / curtis / HolyCrazyLazy
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-785-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Anwältin 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Die Anwältin Glanz der Lüge
Ein Fall für Laura Di Palma
Aus dem Amerikanischen von Sonja Winner
dotbooks.
Kapitel 1
Mein Cousin Hal hatte gerade einen abbruchreifen Bungalow in der Nähe des Hafens bezogen. Die anderen Bewohner hatten die Siedlung alle verlassen, als sich in den Fundamenten Risse zeigten und die Dünen sich wieder in den Straßen breit machten. So waren Hals Petroleumlampen die einzige Beleuchtung der Privatstraße, über die der Wind fegte. Es gab nicht den mindesten Komfort, keine Heizung, kein Wasser und keine Gesellschaft – außer den Sandflöhen, die überall herumkrabbelten, und anderem hungrigem Ungeziefer. Aber Hal schien es nichts auszumachen, seine Vorräte in Einmachgläsern zu verschließen, an denen die Mäuse und Mistkäfer verzweifelt kratzten – wie im Märchen das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern an den Fensterscheiben.
Ich stand vor dem Eingang zu seiner Bruchbude. Die Funzeln warfen schwaches Licht auf die mit Brettern vernagelten Fenster, eine Veranda, die der Sand fast erstickte, und die rissigen, feuchten Außenwände. Hinter dem Haus, auf der anderen Seite der Bucht, sah man das stillgelegte Atomkraftwerk, angestrahlt, wie ein Dinosaurier aus Neon. Mein Heimatort.
»Sieh da, die Frau Staranwältin!« Mein Cousin sah mich mit unverhohlenem Mißmut an. »Macht in der düsteren Provinz ein Büro auf, nur um es ihrem Ex-Gatten zu zeigen.«
»Du hast’s erfaßt.« Der Wind peitschte mir den Sand um die Füße, und mein Nacken war steif vor Kälte. »Ich erfriere, Hal.«
Er winkte mich herein und führte mich über einen zugigen Flur. Sein Pullover war zu kurz, der Hosenboden seiner Cordjeans abgewetzt.
Henry Di Palma, Junior – früher hatte er gestärkte Hemden und Hosen mit Bügelfalten bevorzugt. Dutzende davon hingen noch in den mit Zedernholz getäfelten Wandschränken im Haus seines Vaters, des Bürgermeisters.
In Hals Wohnzimmer flackerten über einem zerschlissenen Sessel drei Petroleumlampen, und das Kaminfeuer kämpfte vergeblich gegen den kalten Luftstrom, der durch den Schornstein herunterdrückte. Hal mußte einfach nur dagesessen haben, ohne irgendwas zu tun. Es lagen keine Bücher oder Zeitungen um den Stuhl herum. Nur ein Marmeladenglas stand da, mit einem Rest Rotwein drin.
Ich fand einen Holzstuhl und wischte ihn ab; als ich den Staub auf meiner Handfläche sah, rümpfte ich die Nase.
»Muß die Putzfrau übersehen haben«, kommentierte Hal.
Ich setzte mich und musterte ihn: finstere Brauen, tiefe Furchen auf den Wangen, bis zum Kinngrübchen hinunter; in den Augen ein ständiges, unruhiges Flackern: graumeliertes Haar, dem eine ungeduldige Hand, vermutlich die eigene, einen stümperhaften Schnitt verpaßt hatte. »Was man nicht alles tut, um sich die Familie vom Leib zu halten, wie?«
»Immerhin mache ich keine Umwege, nur um jemandem hinterrücks ein Bein zu stellen.«
»Dein Mitleid für meinen Ex-Mann kannst du dir sparen. Der hat’s nicht anders verdient.« Gary Gleason, mein heißer Schwarm aus der Oberschule; er hatte den Posten des Pflichtverteidigers in der Stadt. Und den wollte ich ihm abjagen, nur zu meinem persönlichen Vergnügen. »Ich mache hier nur ein Büro auf. Nicht gesagt, daß die Stadt meine Bewerbung um den Posten auch annimmt.«
»Du bist eine Berühmtheit!«
»Da hast du recht.«
Ein Jahr zuvor hatte ich einen Mann namens Wallace Bean verteidigt. Er hatte zwei republikanische Senatoren erschossen, als sie aus einem Privatjet stiegen. Es war mir gelungen, eine Gruppe von Geschworenen zusammenzustellen, wie sie in einer Million Fällen nur einmal vorkommt, und die einem Expertengutachten genug Respekt entgegenbrachte, um Bean wegen Unzurechnungsfähigkeit freizusprechen. Die ganze Nation war in Aufruhr – besonders die konservativen Anhänger der Senatoren und ihrer ›Bomben-für-den-Sieg‹-Propaganda zum Vietnamkrieg. Aber für mich war das der Startschuß zu meiner Karriere. Time, Newsweek, sämtliche überregionalen Zeitschriften brachten ausführliche Artikel über den Fall – und über mich.
»Aber ich bin nicht unbedingt beliebt, Hal.«
Mein Heimatstädtchen bestand nur aus konservativen Rednecks – Waldarbeiter, Fischer, Arbeiter aus den Konservenfabriken und Molkereien. Diese Leute hatten zweifellos nichts als Mißbilligung übrig für das, was der Präsident einen ›Irrweg der Justiz‹ genannt hatte. Andererseits war ich ein Star in diesem Städtchen, in dem nichts Aufregendes mehr passiert war, seit vor Jahren einmal Robert Goulet für eine Nacht im Hillsdale Inn abgestiegen war.
Ich lächelte meinen Cousin an. »Alles in allem würde ich sagen, was das Geldverdienen betrifft, habe ich einen echten Volltreffer gelandet.«
Hal strich sich mit seinen langen, schwieligen Fingern über das – erstaunlich glattrasierte – Kinn. »Es ist komisch, aber mir geht es mit dem Geld wie mit den Mädchen: es fliegt mir einfach zu.«
Ich ließ meinen Blick durchs Zimmer schweifen. Überall auf dem Boden Staubflusen, Holzkisten, die als Tische dienten, im Feuer glühende Teile von irgendwelchen Möbelstücken. »Merkt man gar nicht, wenn man sich hier so umsieht.«
»Keine Gewissensbisse wegen Bean? Nur ein Verrückter mehr, der frei herumläuft?«
»Das war eine Prüfungskommission von Medizinern, die meinen Mandanten für gesund erklärt hat, nicht ich.«
»Aber du hast ihn vertreten...«
»Bei der medizinischen Anhörung? Natürlich hab’ ich ihn da vertreten. Das ist mein Job.« Der Generalstaatsanwalt hatte mir vorgehalten: »Wie kann ein Mensch im Mai verrückt sein, und im April schon wieder gesund?« Worauf einer der Psychiater ihm trocken geantwortet hatte: »Wie kann der Gouverneur den Etat für die Nervenkliniken beschneiden und weiterhin davon ausgehen, daß wir jahrelange stationäre Behandlung im Angebot haben?« »Es war nicht meine Entscheidung, Bean wieder auf die Straße zu lassen.«
»Ach, die Lorbeeren nimmst du an, aber die Verantwortung lehnst du ab?«
»Wenn du so willst.« Ein kalter Luftzug wehte mir um die Beine, ich zog den Rocksaum über die Knie. »Warum dieses Einsiedlerleben, Hal?«
Er lächelte. Sein Gesicht erschien – bis auf die Augen – mit einem Mal beinahe freundlich. »Haben sie dir das zu Hause nicht erzählt?«
»Der Krieg ist doch für dich nur eine gute Entschuldigung, um als undankbarer Taugenichts herumzugammeln und dich selbst kaputtzumachen.«
»Bleib ruhig bei deinem ›ich hab’s dir ja gleich gesagt‹, wenn’s dir Spaß macht.« Hal senkte die Augenlider, sein Lächeln verzog sich zu einem Grinsen.
Ich hatte mich lautstark darüber entrüstet, daß Hal sich der Einberufung nicht widersetzt hatte – und ich hatte tatsächlich etwas wie Genugtuung empfunden, als ich hörte, er sei nur noch launisch und gereizt seit seiner Rückkehr aus Vietnam. Ich hatte ihn ganze zwei Mal gesehen seitdem. 1981 lief er mir im Golden Gate Park über den Weg. Er sah ausgezehrt und heruntergekommen aus und erzählte, daß er seit sechs Jahren nicht mehr zu Hause gewesen sei. Im Winter 1983 stand er eines Tages vor meiner Tür, mit einer ölverschmierten Zange in der Hand. Er blieb ein paar Tage, nur so lange, bis sein stotternder alter Bus repariert war. Da wirkte er viel entspannter, beinahe ausgelassen, mit seinem trockenen, etwas unbeholfenen Humor. Aber was er die ganze Zeit über getrieben, wo er gewesen war, das wollte er nicht erzählen. Zu Hause ließ ich von Hals Besuch nichts verlauten, ich hätte ja schlecht behaupten können, daß er mir wohlauf oder gar glücklich vorgekommen wäre. Soviel ich wußte, hatte Hal sich auch in den zwei Jahren seit damals nicht bei seiner Familie gemeldet. Und eines Tages letzte Woche war er einfach in dieser verlassenen Siedlung aufgetaucht.
»Weißt du, wie lange der Krieg schon vorbei ist, Hal? Seit über zehn Jahren!« Für mich genug Zeit, um mich scheiden zu lassen, in die Großstadt zu ziehen, College und Jurastudium abzuschließen, eine Anstellung bei einem Oberlandesgericht zu bekommen, ein Jahr beim Bundesgericht, Abteilung Strafrecht, zu arbeiten und schließlich bei einer der besten Anwaltskanzleien von San Francisco, bei White, Sayres & Speck unterzukommen. »Worum geht’s dir eigentlich? Was soll diese ganze dick aufgetragene Seifenopern-Tragödie?«
»Bitte. Verschone mich mit deinem Moralgewäsch!«
»Wenn du mich mit deinem verschonst...«
Hal verschränkte die Hände hinter dem Kopf und musterte mich. Ich lehnte mich zurück und ließ ihn schauen. Meine helle Haut hatte sich gut gehalten – mit dreiunddreißig immer noch keine Falten – und die meisten Männer fanden meine dunklen Augen und meine vollen Lippen so faszinierend, daß ihnen die etwas zu große Nase gar nicht auffiel. Ich trug ein Kostüm, dessen Gürtel meine schmale Taille sehen ließ, und das wahrscheinlich mehr gekostet hatte als Hals sämtliche Habseligkeiten zusammen. Mit meinen feinen Schuhen ließe sich problemlos die Monatsmiete für ein komplettes Einfamilienhaus in diesem Provinznest decken. Und meine Haare, ehemals eine wilde Lockenmähne, hatte ich zu einem verflucht teuren, aalglatten Bubikopf mit Seitenscheitel trimmen lassen. Wenn ich nicht wie eine kompetente, äußerst erfolgreiche Anwältin aussah – an mir lag es nicht.
»Mir hast du als Mogli besser gefallen«, war das Urteil meines Cousins.
»Du bist nicht mehr auf der Höhe der Zeit, Hal. Die Mode im Dschungel hat sich geändert.«
»Nun sag schon, warum bist du hierher zurückgekommen? Regen hast du doch immer gehaßt.«
»Wie du schon sagtest, um es meinem Ex-Mann zu zeigen.«
Er schüttelte den Kopf. »Und dann? Angenommen du kriegst deinen verdammten Posten als Pflichtverteidiger, Gleason strampelt ein bißchen und dann fängt er sich wieder. Der hat’s noch immer geschafft.«
»Darauf würde ich mich nicht verlassen.« Ich hatte einen gehässigen Ton erwischt, der mich überraschte. Schließlich hatte ich jede Menge Übung darin, meiner Stimme irgendwelchen Ärger nicht anmerken zu lassen (»Bei allem Respekt, Euer Ehren...«). Ich wechselte das Thema. »Kommst du zu meiner Einstandsparty im Büro?«
»Sind meine Eltern auch da?«
»Was glaubst du denn?« Kein Wort hatte ich all die Jahre von ihnen gehört, seit sie mich ›verloren‹ glaubten, weil ich nach San Francisco gegangen war, aber bei der Examensfeier, da hatten sie mit ihren Kameras in der ersten Reihe gesessen.
»Ich glaube, ich habe schon eine Verabredung.« Seine Wangenfurchen sahen im Schein des Kaminfeuers noch tiefer aus.
»Und ich glaube, dein ewiger Krieg ist als Ausrede ziemlich ausgeleiert.«
»Weißt du vielleicht eine bessere für mich?«
Ich wies mit der Hand in den verwahrlosten Raum. »Im Grunde ein Jammer, daß sich die Planungskommission von deinem Vater damals diese idiotische Siedlung aufschwatzen ließ.«
Er setzte sich mit einem Ruck auf. »Du solltest meinem Vater dankbar sein. Um diese kleine Höhle hier bauen zu können, mußte unser Herr Bürgermeister nämlich deinen Ex-Mann ins Krankenhaus bringen.«
»So hat jedes Unglück eben auch sein Gutes, Hal.«
Hal legte die Ellbogen auf die Knie. »Was hat Gleason dir eigentlich angetan?«
»Darum geht’s nicht. Er wird etwas tun, und zwar für mich.« In meiner Stimme lag immer noch eine Spur Bosheit, aber nur eine Spur. »Wenn er erst eingesehen hat, daß er mich anders nicht wieder aus der Stadt kriegt.«
Das flackernde Feuer ließ die Schatten tanzen, über die kahlen Wände und die Decke, von der lauter Spinnweben hingen. Hals Stimme war ungewöhnlich ruhig. »Kommt Gleason auch zu deiner Einstandsparty?«
»Das nehme ich doch an. Er wird ja nicht unhöflich sein wollen.«
»Du hast ihn also eingeladen?«
»Aber natürlich, Hal! Ich freue mich auf keinen so sehr wie auf ihn.«
Kapitel 2
Ich hängte meine Jacke an der Dielengarderobe auf und kämpfte gegen das Gefühl an, lebendig begraben zu sein. Dieses Gefühl überfiel mich jedesmal, wenn ich die vergoldeten Rokokospiegel und die Satinsofas mit Blumenmuster sah, die zum festen Inventar der Villa gehörten, in der mein Vater mit Hals Eltern wohnte. Mein Vater war seit dreißig Jahren Witwer, aber er und ich hatten die ganze Zeit, zusammen mit einer Haushälterin, in dem Haus gewohnt, das meine Mutter einst für uns ausgewählt hatte. Erst als ich heiratete, verkaufte mein Vater den Backstein-Bungalow und zog zu ›Onkel‹ Henry, der ein Cousin zweiten Grades von ihm war.
Ich fand Papa in seinem Arbeitszimmer. Er hatte die Beine hochgelegt – die Füße ruhten samt den blanken schwarzen Schuhen auf seinen Geschäftsbüchern – und schaute zum Fenster hinaus, während er eine kleine Zigarre rauchte. Seine schwarzen Haare waren glatt zurückgekämmt, auf seinem runden, lustigen Gesicht lag ein seriöser Ausdruck. Er war ein kleiner, aber energischer Mann mit feisten Wangen, einer großen, knolligen Nase und wachen Augen mit kurzen, borstigen Wimpern.
»Ich war bei Hal«, sagte ich.
Er nahm die Füße auf den Boden herunter. »›Hal‹! Der Name meines Cousins ist für seinen Sohn wohl nicht gut genug?«
»Also gut, bei Henry.« Ich hatte wenig Lust, schon wieder den Kampf um den Namen für Hal zu fechten. Als mein Cousin sechzehn wurde, bestand er darauf, daß seine Zeitgenossen ihn fortan ›Hal‹ nannten. (Jahre später erst las ich Heinrich IV, Teil 1 und kapierte den Witz.) Gleichzeitig weigerte er sich strikt, sein Geburtstagsgeschenk anzurühren – einen nagelneuen Fiat Spider, für den ich damals gestorben wäre.
Papa schüttelte den Kopf und brummte: »In einem Palast könnte er leben – und haust statt dessen in einem Rattenloch!«
Eine leichte Übertreibung. Das ›Haus des Bürgermeisters‹ (das man leicht für sein eigenes halten konnte, nachdem mein Onkel seit siebenundzwanzig Jahren Bürgermeister war) war das Imitat eines Schweizer Zehn-Zimmer-Chalets, das sich grotesk von den Bungalows und viktorianischen Häusern in der Stadt abhob. Aber ein Palast war das ganz sicher nicht, auch wenn es auf Kosten des Steuerzahlers völlig übertrieben ausgestattet war.
»Ich glaube, daß Tante Diana für seinen, hm, sagen wir, rauhen Charme, nicht sehr empfänglich ist.« Die Untertreibung des Jahres. Hals Mutter hatte nichts als Geringschätzung übrig für jeden, der weniger oberflächlich, weniger wohlhabend und weniger falsch war als sie selbst. Die Spießbürger der Stadt schätzten sie dafür, für ihre ungenierte Raffgier und die Protzigkeit, mit der sie ihren Reichtum zur Schau stellte. Aber das waren natürlich nicht gerade die Eigenschaften, die man sich von einer Mutter wünschte, vor allem nicht, wenn man so ein misanthropisch veranlagter Habenichts wie Hal war.
»Hal ist – Henry ist doch sowieso zu alt, um noch zu Hause zu wohnen.«
Papa drückte seine Zigarre aus und schnippte sich Asche von der Weste. »Zu alt, um wie ein Zigeuner zu leben, wolltest du wohl sagen.«
»Ich hab’ mir ein Haus gemietet heute.«
Papas Nasenflügel zitterten, aber er sagte nichts; ein Punktsieg für mich, daß er es für sinnlos hielt, Einwände zu machen. Wir wußten alle beide, daß Tante Diana mutmaßen würde, ich lebte allein, um ungestört Männerbesuche zu empfangen – eine Vorstellung, die für meinen Vater auch dann noch unerträglich bliebe, wenn ich hundert Jahre alt wäre. Er hatte es noch immer nicht verdaut, daß ich mich hatte scheiden lassen. Männer, so hatte er damals ständig gesagt – immer wieder, solange bis ich die Flucht aus der Stadt ergriff – Männer bleiben immer Kinder und eine Frau muß Verständnis haben, so ist nunmal die Welt.
»Ein viktorianisches Haus in der Clarke Street«, fuhr ich fort.
Papa zuckte zusammen; ich achtete darauf, mein Lächeln im Zaum zu halten. Die drei viktorianischen Blocks in der Clarke Street waren das Teuerste, was es in der Stadt gab. Man hatte sie von oben bis unten im Landhausstil restauriert, mit Bleiglasfenstern und Eichenholzfußböden. Sie lagen im selben Teil der Stadt, in dem mein Ex-Mann eine Haushaltsgemeinschaft mit seiner Freundin Kirsten Strindberg unterhielt. Um genau zu sein, lag mein neues Zuhause, ein zugiger Sechs-Zimmer-Bau, direkt gegenüber dem Haus meines Ex-Manns.
Tante Diana trat herein. Sie war eine hochgewachsene Frau mit hohen, geschwungenen Brauen und einer langen, schmalen Nase, aber einem winzigen Kinn und einem zu kurzen, plumpen Hals. Sie grüßte mich mit kalter Herzlichkeit. Heute morgen hatte sie mir den Vorschlag gemacht, daß bei meiner Einweihungsparty sie und mein Onkel als Gastgeber auftreten könnten. (»Es macht sich nicht gut, wenn sich eine junge Dame selbst einführt.«) Meine Ablehnung war natürlich ziemlich brüsk ausgefallen, also hatte Tante Diana beschlossen, mich zu strafen, indem sie sich plötzlich an eine ›andere Verpflichtung‹ erinnerte.
»Soll ich ein Gedeck für dich auflegen lassen zum Abendessen?« fragte meine Tante.
»Ich habe um sieben eine Verabredung«, log ich. »Tut mir leid.«
»Du bist doch nicht auf Diät?« Sie zog die Nase hoch und musterte meine schlanke Figur. »Man sagt, mit dreißig muß eine Frau sich entschieden haben, entweder für ihr Gesicht, oder für ihre Figur.«
Zwei gleichermaßen trostlose Alternativen, was meine Tante betraf.
Ich verbrachte den größten Teil des Abends damit, durch die Gegend zu fahren. Elf Jahre lang hatte ich mit Hillsdale immer nur das Gefühl verbunden, in der Falle zu sitzen und langsam vor die Hunde zu gehen, von meiner Familie erdrosselt zu werden und – das war das Schlimmste – von meinem Ehemann blamiert. Jetzt fuhr ich durch diese Straßen und hatte allenfalls das Gefühl, daß der Ort mir irgendwie bekannt vorkam, nichts weiter. Es war einfach nur eine beliebige Küstenstadt am Pazifik, im Nordwesten der Staaten, eingehüllt in grauen Nieselregen, mit großen quadratischen Häusern auf quadratischen Grundstücken, breiten Straßen mit hohen Bordsteinen, tiefen Abflußrinnen, einer Menge schlammiger Straßengräben und Gullis, und einem fischigen Geruch überall, der vom sanierten Hafenviertel herüberkam. Hier und da ragte am Rande des Gehwegs noch ein Eisenpfosten hervor, an dem früher die Boote festgebunden wurden. Die billigen Pensionen in der Hafengegend hatte man mit einem frischen Anstrich und historischen Gedenktafeln herausgeputzt. Nach dem hektischen Trubel San Franciscos wirkten diese behäbigen alten Häuser richtig ehrwürdig auf mich, mit ihrem herabhängenden Rhododendron und den riesigen Rosensträuchern. Der meterhohe Zehrwurz im Graben hinter meinem alten Haus fiel mir plötzlich ein, an den ich seit Jahren nicht mehr gedacht hatte.
Ich parkte den Wagen vor meinem frisch gemieteten Haus, drehte drinnen erst mal die Heizung kräftig auf und schaute hinaus, auf die andere Seite der Straße. Mein Ex-Mann hatte ein zweistöckiges viktorianisches Haus mit gewölbtem Dach, das einen recht gepflegten Eindruck machte. Die Fassade war beige, mit rostroten und marineblauen Einfassungen. Davor stand ein grüner Peugeot, kuschelig zwischen die Rabatten gebettet. Überall blühte roter und violetter Rhododendron, der Rasen war mit Sorgfalt geschnitten, die Veranda hing voller Fuchsien.
Ich dachte darüber nach, wo Lennart Strindbergs Grab sein mochte und ob es wohl ebenso manikürt wäre wie der Garten meines Ex-Mannes. Aber vermutlich zog Kirsten es vor, die Lebenden zu verwöhnen.
Die Lebenden. Ich hielt meinen Plan für klug; es war der beste, der mir unter den gegebenen Umständen hatte einfallen können. Trotzdem war er nur eine halbe Sache. Keine echte Bombe; kein Messerstich direkt ins Herz.
Ich mußte an Kirstens widerliche Angewohnheit denken, Lennart herumzukommandieren; an die Art, wie sie ihr kleines, rundes Puppengesicht wehleidig verzog und sagte : »Len, würdest du uns ein wenig Kaffee nachschenken?« oder: »Len, könntest du zum Einkaufen fahren?«
Lennart Strindberg, einsneunzig groß, blondes, seidiges Haar, weiße, durchscheinende Haut, hohe Wangenknochen, eine feingeschnittene Nase, schmale lange Hände, graue Augen, die immer in der Ferne waren, und ein leicht melancholischer Zug um den breiten Mund: Lennart Strindberg war, daran gab es für mich keinen Zweifel, der schönste Mann der Welt.
Und er ließ es sich gefallen, von Kirsten zum Handlanger gemacht zu werden, und das auch noch mit der größten Gelassenheit. Nicht ein einziges Mal hatte ich gesehen, daß Lennart auch nur eine Sekunde lang zögerte. Das Wort ›Nein‹ gehörte einfach nicht zu seinem Wortschatz.
Mich zog Kirsten immer auf, in Garys Gegenwart. »Du verdirbst Gary!« rief sie affektiert, wenn sie erfuhr, daß ich irgendeine Kleinigkeit für ihn getan hatte. Dann kniff sie die Augen zusammen und fügte hinzu: »Bei mir hätte er innerhalb kürzester Zeit den richtigen Drill!«, worauf Gary sein ›Ach, tatsächlich?‹-Grinsen aufsetzte.
Das letzte Mal, als ich ihn sah, erzählte Lennart Strindberg mir, daß Kirsten es haßte, wenn man nach ihrer Pfeife tanzte, weil es ihr ein unweibliches Gefühl gab.
»Warum tust du es dann?«
Lennart hatte die Achseln gezuckt. »Gute Manieren sind da am nötigsten, wo sie keine Wertschätzung finden.«
Lennart Strindberg. All die Jahre hatte ich an ihn gedacht wie an einen lebenden, atmenden Menschen. All die Jahre hatte ich mich gefragt, ob wir uns wohl jemals wiedersehen würden, ob er je seine Meinung über mich ändern würde – ›klüger würde‹.
Und all diese Jahre war Lennart Strindberg tot gewesen. So lange tot, daß Kirsten und Gary wahrscheinlich nur noch selten an ihn dachten – und wenn, dann ohne großes Schuldgefühl und ohne die geringsten Gewissensbisse.
Aber das würde sich ändern. Dafür wollte ich schon sorgen.
Kapitel 3
Die Einweihungsparty lief gut.
Ich hatte jede Menge teuren Champagner eingekauft, und ich tat mein Bestes, um die Richter und Justizbeamten für mich einzunehmen – denn von ihren inoffiziellen Empfehlungen hing bei der Auswahl des Pflichtverteidigers einiges ab.
Ich ließ mich von Onkel Henry herumführen und lauter Leuten vorstellen, die ich bereits kannte. Onkel Henry ähnelte äußerlich sehr meinem Vater, genauso klein und beleibt, die gleiche gute Farbe und straffe Haut im Gesicht, das glatte schwarze Haar. Aber Onkel Henry hatte eine Art von aufgesetzter Offenheit oder Verbindlichkeit an sich, die mein Vater nie hätte vortäuschen können – was er allerdings auch nie nötig gehabt hätte.
Onkel Henry war in bester Laune an diesem Nachmittag, klopfte jedem auf die Schulter und erzählte Witze, bei denen Tante Dianas Lippen vor Mißbilligung schmal geworden wären.
Ich stand beim Kongreßabgeordneten unseres Kreises, einem aufgeblasenen Kahlkopf mit einer roten Nase, die an eine matschige Erdbeere erinnerte. Ich erläuterte – zum tausendsten Mal – das ›TV-Syndrom‹, ein Ausdruck, den ich im Prozeß gegen Wallace Bean geprägt hatte. Bean war süchtig nach der Sorte von Fernsehkost, die Gewalt und Intrigen verherrlichte und zeigte, wie ein einzelner mutiger Mann sich über das Gesetz hinwegsetzte, gegen die Gesellschaft kämpfte und den Lauf der Welt veränderte. Als Bean mit seiner Fünfundvierziger vor die Flugzeugtreppe trat, sah er sich als Retter des Liberalismus, als Rächer der gefallenen Soldaten, als der Mann, der Amerikas Seele reinwaschen würde von der Schuld eines ungerechten Krieges.
Die Geschworenen hatten Beans Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit gar nicht mit dem TV-Syndrom begründet. Es hatte sich lediglich um ein Rückzugsargument gehandelt: selbst wenn Bean gesund war, so hatte ich behauptet, war er zu verwirrt von der Fernsehbotschaft Gewalt-für-einen-guten-Zweck, um zu erkennen, daß seine Handlungsweise gesellschaftsfeindlich oder falsch war.
Bedauerlicherweise war die Presse – und mit ihr sogar viele Anwälte, die es hätten besser wissen sollen – der Meinung, Bean sei freigesprochen worden, weil er zuviel ferngesehen hätte. Das TV-Syndrom wurde über Nacht zu einem Schlagwort für das Untergraben der Gesetze durch gerissene Anwälte. In dem Jahr seit dem Prozeß war ich in einem Dutzend Talkshows aufgetreten und hatte an die hundert Interviews für Zeitungen und Magazine gegeben, um dem Mißverständnis abzuhelfen. Aber die Leute schienen in ihrem Glauben an die Pervertiertheit des Rechtssystems unerschütterlich zu sein.
Mittlerweile hatte ich es satt, die Dinge klarzustellen. Zu dem fetten Kongreßabgeordneten sagte ich daher nur: »Sir, Bean gehörte zu der ersten Generation, deren Vorstellung von Realität auf dem basierte, was sie im Fernsehen sah. Das ist ziemlich erschreckend, wenn man es bedenkt.«
Ich hatte die Entgegnung des Kongreßabgeordneten so oft gehört – wir alle sehen fern, aber wir bringen keine Senatoren um – daß ich mein Gehirn auf Warten schaltete und mich diskret im Raum umsah, auf der Suche nach einer Entschuldigung, mit der ich mich empfehlen könnte.
Da sah ich Gary Gleason in der Nähe der Tür.
Er trug einen Anzug aus Haifischleder, der aussah, als käme er direkt aus einem Paket, mit einem Poststempel von Tokyo. Der Kerl hatte sich verflucht schlank gehalten; er war nicht sehr gealtert. Aber ich hatte ihn nicht so klein in Erinnerung, vor allem nicht so kurzbeinig. Seine Haare waren dünner geworden, aus dem braunen Krauskopf war eine Lockenfrisur geworden, die mehr von seiner Stirn sehen ließ als in seiner Jugend. Und sein Gesicht – nun, es war dem Gesicht, in das ich mich einst verliebt hatte, ähnlich genug, um ein klein wenig von dem alten Gefühl in mir zu wecken. Ein klein wenig, nicht mehr.
Er sah noch immer so finster und nachdenklich drein, hatte immer noch die verschatteten, dunklen Haselnußaugen und seine gerade, kurze, ebenmäßige Nase. Auch den dicken Schnurrbart über der breiten Oberlippe hatte er noch, nur die buschigen Koteletten hatte er sich abrasiert.
Trotzdem wirkte er älter. Seine Wangen waren nicht mehr ganz so voll, um die Augen hatte er Lachfältchen und auf der Stirn Furchen vom Stirnrunzeln. Und er verbreitete eine Aura von Wachsamkeit, die ganz anders war als die überhebliche Arroganz in seiner Jugend – vielleicht aber auch nur eine natürliche Reaktion unter den gegebenen Umständen.
Mein Ex-Mann, der nichts von meinem forschenden Blick bemerkte, sah sich in meinem gut ausgestatteten Büro um und schüttelte leicht den Kopf.
Ich entschuldigte mich und schlenderte zu ihm hinüber. Im Augenwinkel sah ich Papa, wie er mich beobachtete, sah, wie er stumm und steif wurde, die Hand blieb in der Luft stehen, das Feuerzeug mit offener Flamme wie eine Fackel. Gary merkte, daß ich mich ihm näherte, musterte mich und vergaß dabei zu lächeln.
»Es ist einfach zu lange her«, log ich. Ich schüttelte die einst so vertraute Hand und dachte: Du mieser Kerl, warte nur! »Wie geht deine Kanzlei?«
Er ließ meine Hand schnell los. »Gut – großartig. Ja, wirklich großartig. Hier gibt es genügend Arbeit, die Stadt könnte noch gut ein paar mehr Anwälte gebrauchen.« Dabei streifte er mit dem Blick die vier Räume, aus denen mein Büro bestand.
»Ich arbeite allein«, sagte ich zu ihm. »Ich werde hier drin sitzen.« Ich zeigte in den Raum, von dem aus man auf das Gerichtsgebäude sehen konnte. »In dem Zimmer ganz hinten werde ich meinen Detektiv unterbringen, und in dem neben mir das EDV-System. Und hier vorne natürlich den Empfang.«
Er schaute zum nächstgelegenen Fenster hinaus, um seine Überraschung zu verbergen; ich erinnerte mich an diesen Spleen. Das Fenster ging zur Hauptstraße im Zentrum hinaus, die gleichzeitig ein Teil des Highway 101 war. Ein zwanzig Meter langer Holztransporter ratterte vorbei, mit einer Ladung von Redwood-Stämmen auf dem Anhänger, und verfinsterte einen Moment lang die Aussicht auf Woolworth.
»Dein eigener Detektiv, ja?«
Ich nickte. »Ich finde es besser, einen eigenen zu haben; es ist so viel bequemer. Und ich bin ziemlich high-tech geworden in letzter Zeit. Wie steht’s bei dir? Bist du schon ins Computerzeitalter eingestiegen?«
Er schüttelte den Kopf. »Wir arbeiten immer noch mit Schreibmaschinen. Übrigens wirst du hier möglicherweise Schwierigkeiten haben, eine geeignete Sekretärin zu finden, wenn dein System sehr anspruchsvoll ist.«
»Ich habe für die erste Zeit eine der Anwaltsgehilfinnen von White, Sayres & Speck, solange bis sie die neuen Räume bezogen haben. Die ist ein echtes Computer-As.« Ich lächelte. »Ich glaube, sie ist auf mein Angebot ganz allein wegen Sandy eingestiegen – mein Detektiv; er hat nämlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit Gary Cooper.«
Eine kleine Steifheit in seiner Kinnpartie verriet mir, daß Gary sich ärgerte. »Großartig.«
»Wie geht es Kirsten?« Ich haßte es, ihren Namen auszusprechen.
Er erwiderte meinen Blick. »Gut.«
»Kinder?«
Kinder wären eine Komplikation gewesen, die ich in meinem Plan nicht berücksichtigt hatte. Ich atmete innerlich auf, als Gary sagte: »Nein. Noch nicht.«
Der richtige Augenblick für den Eröffnungsschlag: »Ich habe neulich erfahren, daß das Bürogebäude von White, Sayres & Speck Kirsten gehört.«
Gary sah erstaunt aus. Vom Hals stieg eine leichte Röte auf. Er sagte nichts.
»Sie ist sogar der Grund, warum das Büro umzieht. Der Vertrag ist ausgelaufen, und die Miete ging beinahe um tausend Prozent hoch.«
Gary runzelte die Stirn. »Ich glaube, die einzigen Büros, die in San Francisco noch billige Mieten haben, sind die mit fünfzehn oder zwanzig Jahre alten Verträgen.«
»Im Gegensatz zu hier«, stimmte ich ihm zu. »Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, wie niedrig die Miete für die Räume hier ist.« Ich wartete, bis Gary sich wieder gefangen hatte. »Aber vielleicht kannst du ja jetzt, wo Kirsten eine angemessene Marktmiete für ihre Immobilien in San Francisco bekommt, in ein paar Computer investieren.«
Gary kniff die Augen zusammen und überlegte, was er antworten sollte.
Ich fügte beiläufig hinzu: »Übrigens, weißt du, daß wir Nachbarn sind?«
»Nachbarn?« Er schaute entsetzt.
»Mein Vater sagt, du wohnst in der Clarke Street. Ich hab’ gerade ein Haus da gemietet. Nummer einhundertsiebenundfünfzig.«
»Nein, tatsächlich...?« Einen Augenblick lang sah es aus, als würde Gary die Fassung verlieren. Aber er fing sich wieder, vergrub die Fäuste in den Taschen und beobachtete mich. »Dann wohnst du direkt gegenüber von mir.«
»Sag mal, siehst du Lennart Strindberg noch manchmal?« Ich bemerkte, wie die Röte sich auf einen Schlag in Blässe verwandelte. »Das müssen, warte mal, etwa elf Jahre her sein, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich dachte, ich ruf’ ihn mal an, wenn er noch in der...«
»Er ist gestorben.« Garys Tonfall war zögerlich. Er nahm mir nicht ab, daß ich nichts davon wußte.
Es war mir egal, was er glaubte. »Lennart Strindberg gestorben?«
»Vor ein paar Jahren.« Vor elf Jahren. »Ich hätte dich benachrichtigt – aber ich dachte, du wüßtest.« Er ließ mich nicht aus den Augen, ich hatte ihn verunsichert.
»Und wer, dachtest du, hätte es mir sagen sollen?« Ich ließ ihn etwas von der Wut spüren, die ich in mir hatte.
Gary wandte den Blick ab. »Ich dachte, dein Vater – tut mir leid.«
»Ach ja?«
Unsere Blicke trafen sich wieder; ich hatte ihn ziemlich überrascht.
»Tut mir wirklich leid«, murmelte er.
»Dann solltest du nachher auf einen Sprung bei mir zu Hause vorbeikommen und mir erzählen, was passiert ist.«
Er runzelte die Stirn und zögerte.
»Hier ist nicht der Ort, um darüber zu sprechen«, sagte ich.
Er furchte die Stirn. »Also gut.«
»Sieben Uhr?«
Er nickte.
Ich drehte mich rasch um und begrüßte einen neuen Gast, bevor Gary mein Lächeln auffallen konnte. Aber Papa, der sein Feuerzeug wieder verschlossen hatte, war es nicht entgangen.
Was er sich dabei dachte, weiß ich nicht.
Kapitel 4
Der Empfang löste sich gegen fünf Uhr auf. Ich hatte einen kleinen Schwips von dem Champagner und war zu aufgedreht, um mit Papa und meinem Onkel nach Hause aufzubrechen.
Ich schnappte mir zwei Flaschen Champagner und raste zu Hal hinaus. Ich hatte plötzlich den Einfall, ihn betrunken zu machen und dann zum Lachen zu bringen.
Mir gelang weder das eine noch das andere. Mein Cousin wollte mich gar nicht erst hereinbitten in seine morschen Gemächer. Statt dessen nahm er mir die Flaschen ab und marschierte los, offensichtlich in der Annahme, ich würde schon mitkommen. Ich folgte ihm, ging auf dem Gehsteig, dessen Belag aufgeworfen war, kämpfte mich durch den Müll aus sandigen Teppichstücken, Glasbruch, verzogenem Holz von den Fensterstöcken, Dünengras und Bierdosen. Links und rechts von uns ragten zweistöckige Häuser aus dem ganzen Schrott. Die Türen und Fenster waren mit Brettern vernagelt, überall hingen warnende Anschläge der Baupolizei, die sich langsam ablösten und im salzigen Wind flatterten. Hier und dort hatten Neugierige eine Tür aufgebrochen, und man konnte ins Innere sehen, auf kahle Fußböden, Bruchstücke von zurückgelassenen Möbelstücken und geplünderte Einbauküchen, aus denen die Geräte geklaut waren. Die Wände waren voller Graffiti, die meisten verhöhnten das Motto der Stadtplaner, »Luxus, den Sie sich leisten können.«
Am Ende der Straße überquerten wir die Sandfläche, die die sinkende Siedlung von der Bucht trennte. Wir mußten uns gegen den eiskalten Wind stemmen. Hal führte mich zu einer riesigen Mole aus großen Felsbrokken, die wie ein gekrümmter Finger ins Meer hinausragte.
Ich schlug den Kragen meiner Jacke hoch. Immer war es elend kalt da draußen auf der Mole, eine schmerzende Kälte, und an diesem Abend war es nicht anders. Die Wellen schlugen auf die kantigen Granitbrocken, der Wind heulte und die Gischt spritzte hoch.
»Keine Angst um die edlen Klamotten?« fragte Hal und grinste hämisch.
»Keine Sorge. Davon hab’ ich noch mehr«, beruhigte ich ihn.
Er ließ beide Korken gleichzeitig knallen und reichte mir eine der Flaschen herüber, während er bei der anderen den Schaum abschlürfte. »Teurer Geschmack bei Genußwaren.«
»Bei allem.«
»Allen Waren.« Er setzte sich auf einen schmalen Felsbrocken an meiner Seite. »Die sind für dich das wichtigste, was?«
»Waren – Unsinn. Verpackung, Erscheinung, darauf kommt es doch nur an. Das sind meine Arbeitsmittel, Hal. Meine Kleidung, mein Auto, meine ganzen Sachen sagen den Männern um mich herum – und bei einigen von ihnen ist das der einzige Weg, um sie überhaupt zum Zuhören zu bringen, das kannst du mir wirklich glauben –, daß ich Grips habe, daß ich Erfolg habe, daß ich Macht habe.«
»Quatsch. Es sagt ihnen, daß du Geld hast.«
»Trink von dem Champagner. Dann wirst du froh sein, daß ich Geld habe.«
Hal trank. Fast ein Drittel der Flasche. Ein routinierter Trinker, wie es schien.