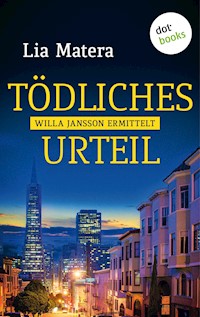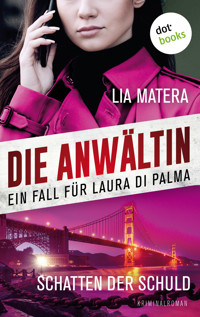Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Willa Jansson
- Sprache: Deutsch
Zwischen Glanz und Schatten: Der fesselnde Justizkrimi »Strafendes Schweigen« von Lia Matera jetzt als eBook bei dotbooks. Erfolg oder Gerechtigkeit? Immer mehr zweifelt die junge Anwältin Willa Jansson daran, dass ihre Arbeit für eine Wall-Street-Firma, bei der sie tagein tagaus von machtgierigen Männern in Tausend-Dollar-Anzügen umgeben ist, die richtige Wahl war. Da kommt Willa ein Angebot aus einer Kanzlei in ihrer Heimat gerade recht. Doch kaum ist sie zurück in San Francisco, wird ihr wieder klar, warum sie aus dieser Stadt geflohen ist: Ihre Familie ist ihr fremd geworden, ihr zwielichtiger Exfreund zieht sie in eine unkoschere Sache hinein und in der Kanzlei ist sie nicht so willkommen, wie sie erst dachte. Um sich abzulenken, stürzt sich Willa in einen neuen hochkarätigen Fall, doch dieser scheint schon bald als einzige Belohnung den Tod zu bieten … »Matera sollte niemand verpassen – eine der besten zeitgenössischen Krimiautorinnen.« Booklist Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Strafendes Schweigen« von Lia Matera ist Band 4 ihrer Reihe um die toughe Anwältin Willa Jansson und den besonderen Flair San Franciscos in den 70er und 80er Jahren. Jeder Band kann unabhängig gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Erfolg oder Gerechtigkeit? Immer mehr zweifelt die junge Anwältin Willa Jansson daran, dass ihre Arbeit für eine Wall-Street-Firma, bei der sie tagein tagaus von machtgierigen Männern in Tausend-Dollar-Anzügen umgeben ist, die richtige Wahl war. Da kommt Willa ein Angebot aus einer Kanzlei in ihrer Heimat gerade recht. Doch kaum ist sie zurück in San Francisco, wird ihr wieder klar, warum sie aus dieser Stadt geflohen ist: Ihre Familie ist ihr fremd geworden, ihr zwielichtiger Exfreund zieht sie in eine unkoschere Sache hinein und in der Kanzlei ist sie nicht so willkommen, wie sie erst dachte. Um sich abzulenken, stürzt sich Willa in einen neuen hochkarätigen Fall, doch dieser scheint schon bald als einzige Belohnung den Tod zu bieten …
»Matera sollte niemand verpassen – eine der besten zeitgenössischen Krimiautorinnen.« Booklist
Über die Autorin:
Lia Matera ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, die für ihre Krimireihen um die toughen Anwältinnen Laura Di Palma und Willa Jansson u. a. für den »Edgar Allan Poe«-Award nominiert und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. Als Absolventin der juristischen Fakultät von San Francisco flossen viele ihrer Erfahrungen aus der Welt der Anwälte und Justizskandale in ihre Kriminalromane ein.
Bei dotbooks veröffentlichte Lia Matera ihre Reihe um Laura Di Palma mit den Kriminalromanen:
»Die Anwältin: Glanz der Lüge – Der erste Fall«
»Die Anwältin: Zeichen des Verrats – Der zweite Fall«
»Die Anwältin: Flüstern der Rache – Der dritte Fall«
»Die Anwältin: Schatten der Schuld – Der vierte Fall«
»Die Anwältin: Echo der Strafe – Der fünfte Fall«
Sowie ihre Reihe um Willa Jansson mit den Kriminalromanen:
»Tödliches Urteil – Der erste Fall«
»Kalte Strafe – Der zweite Fall«
»Perfektes Verbrechen – Der dritte Fall«
»Strafendes Schweigen – Der vierte Fall«
»Zornige Anklage – Der fünfte Fall«
»Geheime Zeugen – Der sechste Fall«
»Stiller Verrat – Der siebte Fall«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »Prior Convictions« bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Altlasten« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1991 by Lia Matera
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Svetlana SF
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-190-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Strafendes Schweigen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lia Matera
Strafendes Schweigen
Der vierte Fall für Willa Jansson
Aus dem Amerikanischen von Sonja und Edith Winner
dotbooks.
Prolog
Tom, Tom, Tom. Immer im Kreis. Tom, Tom, Tom, all die Jahre. Tom, mit seiner verrückten Schwester und seiner dicken, kleinen Mutter mit dem südländischen Teint. Tom, dieser Körper – der am besten aussah, wenn er naß war; sein Bizeps, seine Stimme. Ein Tier aus Haaren und Muskeln. Bestia nannte seine Mutter ihn. Eingezwängt in seine Kleider, die Nähte kurz vorm Platzen.
Ich sehe ihn vor mir, auf den Anti-Kriegs-Demonstrationen, die breite Brust, hinter der die heftigste Leidenschaft wallte. Tomasino Rugieri, was mögen die vielen Jahre Gefängnis aus dir gemacht haben?
Wer weiß, vielleicht ist das, was man über Gefängnisse hört, alles übertrieben, eine Übertreibung, um uns alle in Schach zu halten. Ich habe es mich oft gefragt und immer gehofft, daß es so ist. Damals jedenfalls haben wir uns davon nicht beeindrucken lassen.
»Früher oder später werden sie uns sowieso alle einlochen«, schrie er von der Tribüne herunter, und die Menge tobte schon, bevor er seinen Satz zu Ende gebracht hatte: »Also warum nicht gleich am 17. April« oder am 18. Dezember oder wann immer die nächste Demonstration angesetzt war.
Ich wollte auch keine Angst vor dem Gefängnis haben, aber ich hatte welche. Genauso, wie ich Angst vor den Nationalgardisten hatte, die die Demonstrationen der Bostoner Colleges umringten, und Angst vor den bewaffneten Spezialeinheiten der Polizei, die aus ganzen Konvois von Lastwagen strömten. Ich blieb deswegen zwar nicht zu Hause, aber ich achtete immer darauf, mich in den hinteren Reihen zu halten. Irgendwo, wo ich mich schnell aus dem Staub machen und in den Schutz der Anonymität flüchten konnte. Hätte Nixon nicht die unschuldigen Kinder vietnamesischer Bauern verbrannt, wäre ich mit Sicherheit daheim geblieben. Aber so lief ich mit, immer furchtsam, immer auf dem Sprung – die anderen konzentrierten sich auf die Redner, auf die Sprechchöre. Ich bewunderte die Wut auf ihren Gesichtern.
Dabei wurde am Ende doch so gut wie niemand von uns eingesperrt. Bis auf ein paar Kriegsdienstverweigerer, diese Unglücksraben mit den niedrigen Losnummern. Die nicht mit der richtigen Mischung aus Bibelzitaten und Gandhi aufwarten konnten, um die von der Einberufungsstelle zu überzeugen, die keine pazifistischen Begründungen aus dem Ärmel schütteln konnten.
Tom weigerte sich, so eine Begründung zu schreiben. »Das hier, Christine, ist der einzige Aufsatz, den die Einberufungsstelle von mir kriegt«, drohte er und zeigte mir den Ziegelstein, den er in seiner Pranke hielt.
Seine Mutter wurde wütend, wenn sie ihn so reden hörte. Einmal griff sie in seine dicken, schwarzen Haare und zog so fest an seinen Locken, daß er sie am Handgelenk packte und festhielt. »Bestia« – Tier, sie ließ einen Schrei los, den ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Dann ballte sie die andere Hand zur Faust, hämmerte ihm auf Brust und Kopf und brüllte: »Umbringen willst du mich, bestia.«
»Ich schreibe keine Aufsätze für Faschisten«, schrie er zurück. Er hielt auch noch ihre andere Hand fest, so daß sie sich nicht mehr bewegen konnte, und sah sie bitterböse an, bis sie sich mit einem Ruck befreite – um ihm schon im nächsten Augenblick schluchzend um den Hals zu fallen.
Seine Schwester Irene stürzte zur Küchentür herein, die dichten schwarzen Brauen vor Zorn zusammengezogen, die Zähne entblößt. »Laß sie zufrieden«, schrie sie, »du bist ein Tier!«
Und mir schlug das Herz bis zum Hals beim Anblick dieses animalischen Körpers unter dem gespannten Hemd. Tom – diese dichtbehaarte, starke, breite Brust unter meinen gierigen Händen!
Die Leute aus seinem Kollektiv mochten mich nicht. Sie warfen Tom vor, daß er in seinem Engagement meinetwegen nachlasse. Er hätte, so sagten sie, eine Mauer um uns beide errichtet, und die Arbeit, die getan werden müsse, darüber vergessen. Tom reagierte wütend und bestand darauf, daß er ein Recht auf eine persönliche Beziehung habe. Das hätte er vielleicht, bekam er daraufhin von ihnen zu hören, wenn es sich um eine gleichberechtigte Partnerschaft handeln würde mit einem »bewußten und befreiten Individuum, das für unsere Sache kämpft«.
Als sie das sagten, sprang Tom von seinem Stuhl auf. »Mein Privatleben geht niemanden etwas an. Es hat nichts mit Politik, nichts mit Strategie zu tun, und es steht hier überhaupt nicht zur Diskussion.« Es folgte längeres Schweigen, dann zog eine Frau eine Zeitschrift hervor: eine Ausgabe des ›Prairie Fire‹ vom Weather Underground. Tom schlug sie ihr aus der Hand. Die Ausgabe enthielt einen Artikel, in dem die Monogamie verteufelt wurde, weil sie die Bildung kollektiver Strukturen verhindere.
Jemand anders sagte: »Da seht ihr es, er hat Chris bereits auf ein Podest gestellt.«
Ich packte meine Sachen und ging. Tom folgte mir. In jener Nacht holte Tom meine Sachen aus dem Studentenwohnheim, und ich zog zu ihm in seine Wohnung. Gut möglich, daß dies auch die Nacht war, in der ich schwanger wurde; meine Pillen steckten irgendwo in einem Umzugskarton.
Ich hätte Tom ohnehin geheiratet. Seiner Mutter Santina brach es das Herz, daß wir ohne Trauschein zusammenlebten. Und aus irgendeinem Grund bedeutete mir ihr Herz etwas, eine zarte Blüte auf einem stacheligen, alten Kaktus. Bedeutete mir mehr als die Gefühle meiner eigenen Mutter. Meine Eltern, das wußte ich, würden damit drohen, mich zu enterben – das schwache Waffenarsenal der Vorstadt. Aber für mich war meine Mutter nur eine kalte, gepuderte Wange, Vaters schlankes Gesellschaftspüppchen. Santina dagegen war etwas Besonderes, so lebensprühend und ungebändigt, eben unverkennbar, unentschuldbar südländisch. Die ungestüme Umarmung, als ich ihr sagte, ich würde Tom heiraten, und die Art, wie sie sagte: »Ich habe gewußt, du bist nicht eine wie diese billigen puttane« – das ließ meine kleinen Reserven an Selbstwertgefühl anwachsen.
Meine Freunde waren entsetzt, als sie von meiner Heirat erfuhren. »Warum?« war die allgemeine Reaktion. Auch Leute ohne ideologische Vorbehalte gegen die Monogamie hielten die Ehe für eine einschränkende und unbequeme Einrichtung.
Aber ich konnte sehen, daß es für Tom einen Unterschied machte, verheiratet zu sein. Mir war nicht ganz klar, was für einen Unterschied und weshalb, aber bereits an unserem Hochzeitstag lag in seinen Augen Stolz, oder so etwas. Genau wie bei Santina, die abwechselnd an meiner Schulter schluchzte, so daß ihr festes Haar mich am Kinn kratzte, und mir mit Sambuca zuprostete, die Wangen gerötet und mit einem Zahnlückenlächeln.
Von diesem Tag an gab mir Santina gute Ratschläge. Sie hatte sich bereits ein Dutzend Wege ausgedacht, wie Tom zu retten war, aber glaubte, daß ich als seine Frau mehr Anrecht darauf hatte, ihm meinen Willen aufzuzwingen. »Du sagen, er soll gehen nach Kanada, auf dich er hört«, war einer ihrer Lieblingsvorschläge. »Luigi, die Sohn von Lebensmittel, ist gegangen Kanada, und sie haben nicht eingezogen.«
Vier ihrer Brüder waren im Zweiten Weltkrieg gefallen. Einer war in Griechenland umgekommen, einer in deutscher Kriegsgefangenschaft, der dritte, ein Partisan, war von den Amerikanern erschossen worden »wie eine Bandit«, und der jüngste, zu jung für den Militärdienst, war vor ihren Augen in Stücke gerissen worden, auf einer Piazza, während seine Schwestern auf dem Balkon ihrer Stadtwohnung standen.
»Nie vergesse ich«, erzählte Santina mir mehr als einmal. »Ich schaue hinauf, ich sehe diese amerikanische Flugzeug. Nächste Moment, Francuccio und ganze Piazza Giulia ist eine große Knall und Feuer und Staub. Oh, diese Staub.« Dabei legte sie sich die Hand an die Wange und bedeckte das halbe Gesicht mit ihren dicken, kurzen, unberingten Fingern. »Nächste Tag, wir hören von eine compare, daß die maledetti Deutsche haben geschnappt meine Bruder Gigetto.«
Jeden Morgen ging sie zur Messe, und jeden Morgen fragte sie Gott, warum ihr ältester Bruder Partisan werden mußte, warum er den Faschisten einen Grund geben mußte, das Haus der Familie in ihrem Heimatdorf niederzubrennen. »Wenn wir nicht gehen müssen von Terra Spaccata nach la città, Francuccio, er wäre hier, bei mir, in Amerika, vielleicht wäre reiche Mann.« Und sie beendete ihre Geschichte, wie sie alle ihre Geschichten beendete: indem sie sich die Tränen aus dem Gesicht wischte und den Kochlöffel in den großen Topf mit Spaghettisauce senkte, die allezeit auf dem Herd blubberte.
Als Tom die Losnummer sechzehn bekam, flehte ich ihn an, einen Anwalt aufzusuchen. »Ich habe nichts verbrochen, und ich brauche verdammt noch mal keinen, der mich verteidigt, schon gar nicht so einen billigen Paragraphen-Heini.« Und seine schwarzen Augen blitzten mich drohend an: Ende der Diskussion.
Ich ging in die Selbsterfahrungsgruppe, die ich mit Freundinnen gegründet hatte, aber mir kamen ihre Probleme, verglichen mit Toms, banal vor. Ihre Konflikte mit überkommenen Geschlechterrollen, was war das schon, gemessen an Toms Schwierigkeiten? Sie konnten dafür nicht ins Gefängnis kommen – so dachte ich jedenfalls, bis ich selber Kinder hatte. Die Frauen sahen auf mich herab, weil ich so viel über Tom sprach.
Ich wartete darauf, daß der Staat gegen meinen Mann Anklage erhob.
Und während ich wartete, traf ich einen Mann. In einem Seminar über italienische Literatur, das ich Santina zuliebe belegt hatte, obwohl sie nicht das geringste Interesse an meinen Studien zeigte und selbst nicht lesen konnte.
Sein Name war Edward Hershey. Er war groß, schlank, langbeinig, mit grünen Augen und einem ernsten Gesicht. Er war sehr männlich, aber weicher als Tom, vielleicht sogar netter, aber vor allem war er sanfter. Erst war er ein guter Freund, dann wurde er mein Liebhaber. Ich glaube, ich liebte Tom wegen seines Körpers, unserer Körper, wegen dieser animalischen Verbindung, die zwischen uns bestand. Ich liebte sein Feuer, das Fremde in ihm, wie verschieden er von mir doch war. Aber ich verstand Edward; er war genau wie ich, Mayonnaise auf Weißbrot, ohne daß es einem schmeckt. Es war so leicht, sich mit ihm zu unterhalten, wir hatten den gleichen Hintergrund, die gleiche Herkunft und gefühlsmäßig die gleiche Wellenlänge. Für ein paar außergewöhnliche Wochen schlief ich mit beiden.
Zwanzig Jahre ist das her. Danach war ich sehr lange Zeit ohne Mann.
Als Tom das über Edward und mich herausfand, wurde er zum Berserker und brach mir den Arm. Ich nehme an, er hatte seit geraumer Zeit etwas geahnt. Manchmal bestand er darauf, daß ich zu Hause blieb. Er drängte mich mit seinem mächtigen Körper gegen die Wand. »Wir sind jeden verfluchten Abend auf irgendeiner Veranstaltung. Solange wir zu Hause sind, laß uns auch wie Verheiratete zusammensein.«
An dem Abend, an dem er es herausbekam, war ich zu weit gegangen. Als ich Edward unter einer Straßenlaterne küßte, hörte ich mich selbst sagen: Ich liebe dich. Es machte mir Angst, und ich glaube, Edward machte es auch Angst; er erwiderte meine Liebeserklärung nicht.
Vielleicht hatte jemand uns gesehen, als wir über den Campus gingen. Vielleicht hatte Tom uns gesehen. Er war nicht in seinem Kollektiv an diesem Abend, wo ich ihn vermutete. Er war vor mir zu Hause. Noch bevor ich die letzte Treppe zu unserer »Hütte«, wie wir sie nannten, erreicht hatte, öffnete er die Tür.
Ich fühlte eine Beklemmung. Mir wurde schwindlig, ich bekam weiche Knie und zitterte – pure Vorahnung. Ich versuchte in der engen, kleinen Wohnung etwas zu finden, an dem ich mich festhalten konnte, um nicht so zu zittern.
Tom packte mich am Handgelenk, verdrehte mir den Arm, bis ich den Knochen knacken hörte.
Großer Gott, es tat weh! Die Angst lähmte mich, ich stand da wie versteinert, wie in einem Alptraum. Ich sah Tom an. Ich hob schützend meinen freien Arm hoch, der Haß in seinen Augen überwältigte mich, während er mit tränenüberströmtem, verzerrtem Gesicht auf mich einschlug, wie eine Sprungfeder schnellte sein kräftiger Arm vor und zurück. Ich stand derart unter Schock, daß ich nicht schreien konnte, nicht ein Laut kam aus meiner Kehle.
Tom sagte etwas auf italienisch. Italienisch!
Santina hatte mir die Geschichte von einer Schneiderin aus ihrem Dorf erzählt. Ihr Mann war nach Deutschland gegangen, um dort zu arbeiten, wie so viele andere Arbeitslose aus dem Süden Italiens. Die Schneiderin galt im Dorf als eine hübsche junge Frau, und nach etlichen einsamen Jahren nahm sie sich einen Liebhaber. Einer der Dorfbewohner kam nach Deutschland und erzählte es ihrem Mann. Dieser setzte sich in den nächsten Zug, schlich bei Nacht in das Dorf zurück und entstellte das Gesicht seiner Frau mit einer Rasierklinge – während das ganze Dorf ihre Schreie und Hilferufe hörte. Dann riß er ihr die Kleider vom Leib und jagte sie von Haus zu Haus und denunzierte sie als Ehebrecherin.
»Und dann paar Tage seine Mamma hat gerufen alle in ihr Haus, ›kommt schauen, die puttana‹, und sie, poverella, hat geweint auf die Bett, nuda, und ganze Gesicht und ganze Brust ...« Santina deutete mit den Händen die Schnittwunden an. Der Mann suchte noch tagelang nach dem Liebhaber, um ihn zu töten, aber der war auf ein Schiff nach Amerika gegangen. Der Ehemann ging nach Deutschland zurück und schickte seiner Frau nie wieder einen Penny. »Sie ist weggegangen und ist geworden eine prostituta in Roma«, schloß Santina mit betrübter Miene, »für die porchi Americani.« Die Familienehre, erklärte sie. Der Mann hatte keine andere Wahl.
Ich hatte Tom immer für einen Amerikaner mit einer italienischen Mutter gehalten. Ich hatte mich geirrt.
Tom sprach danach kein Wort mehr mit mir. Ich hörte, daß er von unseren Freundinnen bei Versammlungen beschimpft und zur Rechenschaft gezogen wurde. Er ging dann nicht mehr hin. Als ich wieder in der Lage war, nach ihm zu suchen, war er wie vom Erdboden verschluckt. Ich sehnte mich nach ihm, gab mein ganzes Geld für Detektive, Zeitungsanzeigen aus. Inzwischen war ich im vierten Monat schwanger, rundlicher, aber man sah noch nichts.
Seine Mutter schlug mir die Tür vor der Nase zu. »Puttana«, Hure, war alles, was sie sagte, »nichts Scheidung«. Sie ließ mich stehen, heulend, den Arm noch immer in Gips, und ich fragte mich, wie sie nach all den Geschichten über Pasta und all dem Bangen um Toms Zukunft denken konnte, ich wolle mich scheiden lassen.
Da kam Toms Schwester aus der Tür gestürzt. Ihr derbes Gesicht war rot. Sie sah wütend aus, wie immer. Ich glaubte, sie wolle mich anspucken, und wich zurück. Aber statt dessen schloß sie mich in die Arme und sagte die scheußlichsten Dinge über Tom, wie ich sie noch nie von einem Menschen über einen anderen gehört hatte. Ich befreite mich. Ihre Umarmung tat mir weh. Sie geiferte und höhnte. Mir wurde übel. Sie sagte mir, daß Tom sich Highway 61 angeschlossen hatte, einer radikalen Gruppierung, die ab und zu jemanden aus dem Bostoner Hauptquartier zu unseren Demos schickte, um uns zu Bombenattentaten auf irgendwelche Fabriken anzustiften. Als mir das Geld ausging, zog ich zu meinen Eltern, die einen Blick auf meinen Arm warfen und dachten, ich hätte mir den Bruch selbst beigebracht. Ihr einziger Kommentar war: »Das ist keiner von uns.« Einer von uns hätte so etwas nie getan. Während sie vor dem Fernseher saßen und sich Bilder der brennenden vietnamesischen Dörfer anschauten, erklärten sie mir, die mediterranen Völker seien von Natur aus gewalttätig. Als sie milder gestimmt waren, schlug meine Mutter vor, ihr Bruder, der kalifornische Anwalt, könne Tom vielleicht helfen, seine Anklage wegen Wehrdienstverweigerung abzuweisen – wenn Tom in die Scheidung einwillige.
Ich hielt den Mund, sie schienen mir nicht wert, mit ihnen zu streiten. Außerdem hatte ich nicht die Energie dazu. Ich tat, was ich immer getan hatte, ich lebte neben ihnen her. Vielleicht ist das mein Grundmuster; später mit meinem zweiten Ehemann verhielt ich mich genauso. Tom war der einzige, mit dem ich immer gestritten und gekämpft habe.
Ich nahm Kontakt zu Highway 61 auf. Sie nannten sich nach einem Bob-Dylan-Song, in dem Gott Abraham befiehlt, seinen Sohn zu töten, und zwar auf dem Highway 61. Ich sagte nicht, daß ich auf der Suche nach Tom war, und gab den Mädchennamen meiner Mutter an, damit er keinen Verdacht schöpfen konnte, wenn er von meinem Anruf hören sollte. Es dauerte zwei Monate, bis sie mir soweit trauten, daß sie mich jemand Wichtigen treffen ließen. Ich half ihnen, wo ich konnte, in der Hoffnung, Tom zu sehen, kochte Kaffee, baute Sprengsätze; ich versuchte, daran zu glauben. – Das Zusammenleben mit meinen Eltern machte den Klassenhaß leicht.
Dann beging ich den größten Fehler meines Lebens.
Ich erzählte einem der Highway-Leute, daß meine Eltern eine Europareise planten und ich den ganzen Sommer lang ihr schönes großes Haus für mich allein hätte.
Wenn ich am Unabhängigkeitstag, am 4. Juli, nicht schon so starke Wehen gehabt hätte, daß eine Hausgeburt nicht mehr in Frage kam, dann wäre ich eine Gefangene in dem Haus geworden. Und der andere Gefangene in dem Haus, ein unschuldiges Baby (nicht meins), wäre wahrscheinlich ermordet worden. Und mein Mann Tom wäre womöglich nie ins Gefängnis gekommen.
Kapitel 1
Da schwamm es davon, mein schönes Gras. Ich stand am Santa Monica Pier und sah zu, wie die Brösel wegtrieben. Im letzten Augenblick kamen sie in einen Strudel, machten kehrt und schwammen zu mir zurück. Als ob das Zeug sagen wollte: Willa, nein, ich bin dein letztes Körnchen Nonkonformismus. Um ein Haar wäre ich in die graue Brühe gesprungen, um die aufgeweichten Überbleibsel meines letzten verbliebenen Lasters wieder herauszufischen. Meines letzten verbliebenen Lasters – großer Gott, war ich langweilig geworden!
Aber ich hielt mich zurück, indem ich mir sagte, denk an all die Tage, an denen du dich schon morgens beim Aufwachen gefühlt hast wie ein mieser Westernsong. Sämtliche Tage des vergangenen Jahres. Und etliche Tage in etlichen Jahren davor. Genaugenommen kiffte ich seit meinem dreizehnten Lebensjahr, seit ein süßer Junge mit einem Ohrring mir einen Joint in die Hand gedrückt hatte. In der Haight Street, gleich um die Ecke von dem Haus, in dem wir wohnten. Mir war gerade noch genug Grips geblieben, um mir darüber klar zu sein (wenn nicht sogar genau zu kapieren, was das hieß), daß das nunmehr fünfundzwanzig Jahre zurücklag. Erstaunlicherweise hatte ich einiges erreicht – trotz der Kifferei und trotz des Hanges zum Nomadisieren, den mein bewegtes politisches Leben mit sich brachte. Ich hatte – wenn auch mit rund zehn Jahren Verspätung gegenüber den meisten meiner Altersgenossen – die Stanford University und die Malhousie Law School hinter mich gebracht sowie zwei reguläre Jobs in Anwaltsbüros; beim ersten hatte die politische Farbe gestimmt, beim zweiten das Gehalt. Vielleicht hatte das Gras mir geholfen, diese ganze Scheiße überhaupt zu ertragen. Aber was mir nicht gefiel, das war, daß ich es inzwischen jeden Tag brauchte.
Jedenfalls sagte ich mir, daß jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war, um damit aufzuhören. Ich befand mich nämlich auf dem besten Weg in eine (wenn auch reichlich frühe) Midlife-crisis. Den besten Job, den ich je hatte – nun ja, den bestbezahlten – soeben aufgegeben; mein Liebesleben lag irgendwo hingestreckt mit einem Pfahl im Herzen; und meine Laune war jenseits von Gut und Böse. Was sprach dagegen, meinen grauen Zellen eine Regenerationspause zu gönnen?
Hinter mir auf dem Landungssteg klappte ein persisches Ehepaar geräuschvoll einen fahrbaren, aus Schrotteilen zusammengesetzten Hot-dog-Stand auf. Ein paar Frühaufsteher streiften sich Knieschoner über und schlüpften in ihre Rollschuhe. Ein von Eimern umgebener Vietnamese spießte Köder auf Angelhaken. Ich schüttelte die letzten Marihuana-Krümel aus dem Plastiktütchen und sah zu, wie sie durch einen gelblichen Schleier zu Boden schwebten. Dann warf ich, nicht ganz so ungeniert, auch das Tütchen ins Wasser. Für Umweltverschmutzung konnte man in Santa Monica unter Umständen länger ins Kittchen wandern als für Drogenbesitz.
Ich ging den Steg entlang zurück und rieb mir den letzten Rest des grünen Staubs von den Fingern. Santa Monica, dieses Miami der ehemaligen politischen Aktivisten – sehr passend, mein Gras ausgerechnet hier den Fluten zu übergeben. Jetzt war ich also angepaßt, langweilig, und endgültig herausgewachsen aus meiner überholten Jugenduniform: gebleichte Jeans, Mokassins und Batik-T-Shirt. (Von der Langhaartracht mit Mittelscheitel hatte ich mich schon vor einem Weilchen verabschiedet, zugunsten einer echten Frisur – schulterlang mit Seitenscheitel –, der einzigen, mit der eine einszweiundfünfzig große Blondine, die Make-up und hohe Absätze verabscheut, noch einigermaßen erwachsen aussieht.)
Mißmutig und einsam einen dicken Joint zu rauchen, das war meine Alternative zu Sushi-Bars und Fitneß-Studios gewesen, in denen sich die Anwälte herumtrieben, von deren Gesellschaft ich schon in den Arbeitsstunden genug hatte. Gras war meine kleine Privatparty, das letzte flackernde Lämpchen an einer alten Lichtorgel. Und ohne Gras wäre ich vielleicht eine Marilyn Quayle geworden. (Wobei die Kleiderordnung meiner Jugend mich wenigstens nicht zwang, Hüte zu tragen, die einem Hundenapf täuschend ähnlich sahen.)
Ich warf einen letzten unfreundlichen Blick auf die Motels und Flachdach-Restaurants des Santa Monica Boulevard. Dann stieg ich in mein Auto, einen vollgepackten Kombi, in dem sich meine sämtlichen Habseligkeiten befanden, hauptsächlich Kleider, sorgsam verstaut in Hängekoffern. Das eine Jahr in dem Anwaltsbüro mit den höchsten Gehaltsschecks von Los Angeles hatte Wunder in meiner Garderobe bewirkt. Ein paar Monate mehr, und ich wäre die bestangezogenste Anwältin der Betty-Ford-Klinik geworden.
Ich ließ den Motor an. Ich schlotterte, weniger vor Kälte als vor Nervosität. Die längste Zeit meines Lebens hatte ich in San Francisco zugebracht, wo man mit Bus, Straßen- und U-Bahn überall hinkommt. Ich hatte nie einen Grund gesehen, einen Führerschein zu machen. Erst als ich in Los Angeles mit meinen Fahrten ein ganzes Taxiunternehmen allein über Wasser halten konnte, sagte ich mir, daß ich vielleicht doch noch nicht zu eingerostet wäre, um Autofahren zu lernen. Heute hatte ich bis zum Einbruch der Dunkelheit noch einige hundert Meilen vor mir.
Endlich brach ich die Zelte ab. 346 Kreidestriche hatte ich an die Wand gemalt, in meinem Apartment in Westwood (selbstverständlich mit Stuck, Teppichboden und jener zeitlos häßlichen Einrichtung, die ebenso sauber wie langweilig ist, so wie ich es allmählich wurde). Ich hatte meine Zeit abgesessen und durfte auf Bewährung in die Freiheit.
Daß ich aus Los Angeles wegging, war die gute Nachricht. Die schlechten würden Bände füllen.
Ja, ich hatte meine Zeit abgesessen und meine berufliche Karriere rehabilitiert. Meine Strafe hatte darin bestanden, ein Jahr lang in irgendwelche Kreditverträge zu starren und mit widerlichen, machtgierigen Männern mit roten Krawatten zu verhandeln, aber ich hatte es hinter mich gebracht. Jetzt war ich markttauglich – eine Anwältin mit vierjähriger Prozeßerfahrung, spezialisiert auf Familien- und Wirtschaftsrecht; das reichte aus, um einer Kanzlei von Nutzen zu sein, und war zu wenig, um von Kollegen als unliebsame Konkurrentin um eine Partnerschaft beargwöhnt zu werden. Ich würde keine großen Schwierigkeiten haben, wieder in einer Kanzlei unterzukommen.
Leider haßte ich meinen Beruf.
Im Grunde wollte ich – ich geb’s ja zu – nur wieder zurück in mein geliebtes San Francisco. Ich hatte es so vermißt, hatte mich grün und blau geärgert, als das Erdbeben losging und ich nicht da war, um an der allgemeinen Panik teilzuhaben und jedem im Weg zu stehen. Eigentlich hätte ich mich freuen sollen, es nun endlich wiederzusehen. Aber da war noch die Sache mit meinen Eltern, diesen Betroffenheitsfanatikern (mein frühester Kindheitstraum war nicht, meinen Namen auf einer Plakatwand am Broadway zu sehen, sondern die Parole »Freiheit für Willa Jansson« auf einem hektographierten Flugblatt). Als allzeit engagierte Polit-Aktivisten hatten sie es mir krummgenommen, daß ich diesen gelinde gesagt »sozial unnützen« Job in Los Angeles angenommen hatte. Und ich hatte ihnen krummgenommen, daß sie mir das krummnahmen.
Und da war die Sache mit diesem dummen Gefühl, gegen das ich anzukämpfen hatte. Man hätte es wohl »Liebe« nennen können, wenn der Kerl, um den es sich handelte, mir je eine Chance gegeben hätte, es ihm gegenüber so zu nennen. Aber Don Surgelato hatte das ganze Jahr, das ich in L. A. darbte, nichts von sich hören lassen.
Als ich kurz davor war, deswegen zu verzweifeln, wandte ich mich an einen brillanten jungen Therapeuten. Er sollte mir bei meinen Problemen helfen. Als erstes half er mir dabei, mich komplett lächerlich zu machen, indem ich mich auch in ihn gleich verknallte.
Ich war also auf dem Weg nach San Francisco, aber ich wollte nicht wirklich hin. Ich war markttauglich, aber wollte keinen Job in meinem Metier. Und ich wurde langsam, aber sicher eine Marilyn Quayle.
Mein Therapeut (dem ich meine pubertäre Gefühlsaufwallung verschwiegen hatte) war der Meinung, ich sollte wenigstens so lange in L. A. – und im Büro von Wailes, Roth, Fotheringham & Beck – bleiben, bis ich meine übrigen Probleme im Griff hätte.
Aber ich entschied mich anders. Als ich aus heiterem Himmel ein Job-Angebot bekam, griff ich sofort zu. Montag in einer Woche sollte ich im Büro von Michael J. Shanna, Bundesrichter des Bezirks Kalifornien-Nord, eine Stelle als Schriftführerin antreten.
Schriftführerstellen werden normalerweise gern mit frischgebackenen republikanischen Jura-Absolventen besetzt. Ich hatte mich für den Posten eigentlich nur deshalb beworben – und ihn mir mit ein paar gewandten Phrasen beim Vorstellungsgespräch auch geangelt –, weil ein alter Freund und früherer Arbeitgeber mich dazu überredet hatte. Der zweite Grund, der für den Job sprach, war, daß er auf ein Jahr befristet war. Jede Kanzlei, bei der ich mich beworben hätte, hätte von mir erwartet, daß ich einen Vertrag auf unbefristete Zeit unterschrieb, und das konnte ich nicht. Mir war schon mulmig genug bei dem Gedanken, ein ganzes Jahr lang die Disziplin für ein läppisches Schriftführerdasein aufbringen zu müssen. Aber ein Jahr war wenigstens ein überschaubarer Zeitraum, die Stelle machte sich im Lebenslauf nicht allzu schlecht, und sie war die beste Gelegenheit, L. A. auf Wiedersehen zu sagen. Ich packte die Gelegenheit beim Schopf.
Mein Therapeut schien sich Sorgen zu machen, auf seine betont unaufdringliche Art. Ich sah ihn vor mir, wie er in seinem Rattansessel saß, in seinem makellosen Manhattan-Look – Laserstrahl-Blick, zerzauste Haare, grauer Zweireiher, Nickelbrille. (Ich ging davon aus, daß sich alle seine weiblichen Patienten in ihn verliebten; ich hielt es für ein Klischee der modernen Neurose.) Sein Vorschlag hatte gelautet, ich sollte mich »von dem Gedanken lösen«, jetzt im Moment wichtige Entscheidungen für meine Karriere oder mein Leben treffen zu müssen. Ich sollte mich »noch eine Weile treiben lassen« – und ich sollte mich auch davor hüten, richtige Entscheidungen aus falschen Gründen zu treffen.
Vielleicht hatte er nicht mal so unrecht; vielleicht hätte ich tatsächlich besser in L. A. bleiben sollen. Bei allen Fehlern, die man dieser Stadt nachsagen konnte – dort gab es wenigstens jemanden, der bereit war (für 85 Dollar die Stunde), sich meine Probleme anzuhören, ohne sie mit denen von Müttern in der dritten Welt zu vergleichen.
Aber es sieht ganz so aus, als ob ich den Ratschlägen von Leuten, die es gut mit mir meinen, grundsätzlich nicht folgen kann. Ich folge statt dessen meinen eigenen.
So fuhr ich die Küstenstraße nordwärts, blind für die wogende Brandung, die emporschnellenden Pelikane, die mit Eiskraut bedeckten Klippen. Das ist der Eintrittspreis für die Midlife-crisis: Man wird blind für alles, was nicht mit einem ins Bett steigt.
Kapitel 2
Es war schon spät, deshalb fuhr ich direkt zu der Wohnung meiner Eltern. Mein Vater hatte mich morgens noch angerufen, um mich zum Abendessen einzuladen. Er wollte ein neues Rezept ausprobieren, »Buddhas Festtagsschmaus«. Schön, hatte ich zu ihm gesagt, ich bringe Ketchup mit.
Als ich aus dem Wagen stieg, fühlte sich mein Körper wie eine fest geballte Faust an. Neun Stunden lang hatte ich mir den Rücken verspannt. Ich schaffe es nicht, mich beim Autofahren zurückzulehnen. Irgend etwas zwingt mich, mit aller Kraft das Lenkrad festzuhalten, als ob der Wagen von der Straße abheben könnte, wenn ich den Griff lockere.
Meine Eltern wohnen in einem Häuserblock, der aussieht wie eine Retrospektive der architektonischen Trends der letzten paar Jahrzehnte – Kuppeln und Türmchen Seite an Seite neben glattem, schmucklosem Putz. Das bunte Durcheinander wirkte im Mondlicht wie die Silhouette einer Märchenstadt. Ich blieb einen Moment lang stehen, sog das Bild in mich ein und freute mich, wieder daheim zu sein.
Die Abendluft war kühl und frisch, wohltuend anders als der ewige drückende Dunst in L. A. Aus der Wohnung meiner Eltern stieg mir ein Geruch von schwarzen Bohnen und Knoblauch in die Nase. Mein Vater ist ein Anhänger des Glaubens, daß sich der Geschmack von Tofu mit Gewürzen verfeinern läßt; vielleicht ließe er sich, wenn Tofu überhaupt einen Geschmack hätte.
»Willa Jansson.«
O nein. Ich wollte die Stimme nicht wiedererkennen. Es konnte nicht wahr sein. So hinterhältig und gemein konnte das Schicksal nicht sein. (In der Tat spielte das Schicksal hier überhaupt keine Rolle.)
Aber da stand er, zehn Meter von der Veranda meiner Eltern entfernt, und streckte mir die Arme entgegen. Edward Hershey, in Lederjacke und Baseballstiefeln, einhundertachtzig Zentimeter höchst unangenehmer Erinnerungen.
»Was machst du denn hier?« fragte er, ganz erstaunt.
»Meine Eltern.« Ich wies auf das schmale viktorianische Häuschen mit der abgeblätterten Fassade. »Und was suchst du hier?«
»Jemanden besuchen.« Er stand da und rührte sich nicht: Porträt eines Mannes unter einer Straßenlampe. Die goldverzierten Simse hinter seinem Rücken gaben im Mondschein einen prachtvollen Bilderrahmen ab. »Du bist wieder im Lande?«
Woher wußte er, daß ich fort gewesen war?
»Ich fange nächsten Montag bei Richter Shanna an, als Schriftführerin. Im Bundesgericht.«
Edward ließ sich ein paar Sekunden Zeit, bis er wieder sprach. Damit ich mir in Ruhe seinen guten Haarschnitt, seinen hübschen Lockenkopf, seine breiten Schultern ansehen konnte? »Willa, ist es dir schon mal passiert, daß du dir etwas gewünscht hast, und prompt geht dein Wunsch im gleichen Moment in Erfüllung?«
»Hast du dir gewünscht, mir auf einer dunklen Straße über den Weg zu laufen?« Ich mußte an all die Jahre denken, in denen ich mir regelmäßig gewünscht hatte, seinen Reißverschluß für Zielübungen vor mir zu haben.
»Ich hab mir gewünscht, einen Anwalt zu kennen, der mir einen Gefallen schuldet.«
»Der dir einen Gefallen schuldet?« Den »verdammten Mistkerl« brauchte ich nicht hinzuzufügen, er lag bereits in meinem Tonfall.