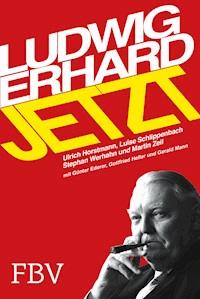9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Schriftstellern, die das Schreiben aufgegeben haben Schriftsteller wollen immer schreiben, denkt man. Doch es gibt Ausnahmen: Dichter, die das Schreiben aufgegeben haben. Warum? Und wie kommen sie damit zurecht? Hölderlin z.B. verlor den Verstand, Philip Larkin verglich die Leere im Schädel mit der Glatze darauf und ging zur Tagesordnung über. Ulrich Horstmann hat sich die Strategien der beherzten Entdramatisierung und der gewitzten Katastrophenbewältigung angesehen und schildert pointiert, wie Autoren von Swinburne, Rimbaud, Walser, Beckett, Koeppen bis zu Hildesheimer ausprobierten, ob und wie sich ganz im Stillen leben lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Ulrich Horstmann
Die Aufgabe der Literatur
Wie Schriftsteller lernten, das Verstummen zu überleben
Sachbuch
Fischer e-books
1Einleitung und Vorspiel des Gioacchino Rossini
Daß Literatur neben ihrer Unterhaltungsfunktion immer auch zu belehren habe und Instruktion und Kurzweil hier also in demselben rhetorischen Prachtgeschirr gingen, war schon die Überzeugung der Antike. Horaz hat sie auf die klassische Formel »aut prodesse volunt aut delectare poetae« gebracht. Aber obwohl es wohl kaum einen langlebigeren und folgenreicheren Satz in der Geschichte der Literaturtheorie gegeben hat, sagt er nur die halbe Wahrheit. Denn die Literaten haben – um aus dem Lateinischen ins Neudeutsche zu wechseln – als phantasiereiche Stifter und Ausgestalter unterhaltsamer Lernfelder selbst unentwegt neue Lektionen lernen müssen. So zum Beispiel die, daß sich auch das angeblich zeitlose Arsenal des Klassischen verbraucht und erschöpft, ja, das Medium selbst, die ›weltweite‹ lingua franca, unter der Feder wie wieder und wieder verdünnte Tinte verblaßt. Das vulgäre Idiom des jeweils Volkstümlichen poetisiert sich, und wer als Autor den Anschluss an das aufblühende Italienische, Französische, Englische und Deutsche verpaßt, verzichtet in der Neuzeit auf Breitenwirkung und verurteilt sich zu einer scholastisch-akademischen Nischenexistenz. Auch neue Klein- und Großformen wie das Sonett und der Roman, der das Erbe des abgewirtschafteten Epos antritt, wollen eingeübt sein und konterkarieren die Trägheitskräfte der Tradition. Und eines Tages wird selbst die Rückkopplung zum Unstrittigen gekappt, die es noch einem Alexander Pope erlaubt hatte, Literatur als die architektonische Um- und Neugestaltung von Gemeinplätzen zu begreifen. Sein »What oft was thought, but never so well expressed« aus dem Essay on Criticism von 1711 war schon vor dem Jahrhundertende nicht mehr konsensfähig, denn das Originalgenie lebt vom Traditionsbruch, und nicht nur im revolutionären Paris und nicht nur im handgreiflichen Sinn flogen die Pflastersteine.
Es beginnen, wenn man so will, die zwei Jahrhunderte der Zumutung, in denen ein ehedem hofierter und zurückgelehnter Leser sich anstrengen und mobilisieren muß, um den romantischen, modernen und postmodernen Avantgarden auf den Fersen zu bleiben. Wo er ein Buch aufschlägt, experimentiert er mit, und es wird mit ihm experimentiert, so daß es durchaus tröstlich erscheinen will, wenn auch die Verursacher ständiger Reorientierung von den Geistern, die sie riefen, eingeholt und heimgesucht werden. Den Schriftstellern ihrerseits wird nämlich in diesem Zeitraum, so jedenfalls die These des vorliegenden Buches, über den ständig wachsenden Innovationsdruck hinaus ein Lernprozeß von nie dagewesener Rigorosität und Schmerzhaftigkeit zugemutet, weil sich die Aufgabe der Literatur um die Aufgabe der Literatur erweitert.
Hinter diesem Wortspiel verbirgt sich damit etwas erbarmungslos Spielverderberisches wie die Medusa hinter einer venezianischen Karnevalsmaske. Es geht nämlich nicht mehr um das unfreiwillige Ende einer Schriftstellerkarriere, es geht um seine Steigerungsform, den kreativen GAU als größten anzunehmenden Unfall der Künstlerexistenz. Was ist gemeint? Nichts anderes als der einschneidende Unterschied zwischen dem Am-Schreiben-gehindert-Werden und dem Sich-das-Schreiben-Verbieten. Exogen bedingte Produktionseinstellungen sind die Regel, schließlich ist auch ein ›unsterblicher‹ Autor nicht gegen Alter und Krankheit gefeit, und eines Tages erlischt selbst die überbordendste Phantasie, im Extremfall synchron mit dem Lebensfunken. Das ist Biologie und – mit Ausnahme des Betroffenen – für alle anderen als natürliches Faktum hinnehmbar. Tragisch wird die Terminierung unter Umgehung der Naturgesetze, d. h. dann, wenn sich kollektive Besserwisserei einmischt und Inquisition oder politische Zensur auf den Plan treten, um einen mißliebigen Autor mundtot zu machen. Aber auch diese Interventionen sind so alt wie das Schreiben selbst, und trotz des totalitären Accelerando der Bespitzelungen, Gehirnwäschen, Berufsverbote und literarischen Existenzvernichtungen im 20. Jahrhundert hat die Zielgruppe – angefangen beim Schreiben unter Pseudonym oder für die Schublade – über ganze Epochen hinweg Adaptions-, Vermeidungs- und Subversionsstrategien ausbilden können, die das Schlimmste verhütet und die Kontinuität künstlerischen Schaffens gesichert haben.
Eben dieser Erfahrungsschatz und die Möglichkeit des Rückgriffs auf und in die Trickkiste der Vorgänger fehlt nun beim Auftauchen des neuen ›worst case scenario‹, bei dem die Schreibblockade endogene Ursachen hat und, salopp formuliert, auf eine ›innere Stimme‹ zurückzuführen ist, die die Fortsetzung des Schaffensprozesses kategorisch untersagt. Dabei soll der Einfluß externer Faktoren keineswegs in Abrede gestellt werden; entscheidend aber ist, daß die literarische Exkommunikation und Demissionierung letztlich selbstund eben nicht fremdbestimmt erfolgt. Solches Verstummen ohne zureichenden objektiven Grund, will sagen, körperliche Gebrechen oder den Zwang der äußeren Umstände, ist kulturgeschichtlich neu und wird von George Steiner in seinem Aufsatz »Silence and the Poet« (1966) auf den Beginn des 19. Jahrhunderts datiert, wobei die Frequenz der Fälle, wie die folgende Abhandlung zeigt, allmählich, aber stetig zunimmt. Steiner notiert:
This election of silence by the most articulate is, I believe, historically recent. The strategic myth of the philosopher who chooses silence because of the ineffable purity of his vision or because of the unreadiness of his audience has antique precedent. It contributes to the motif of Empedocles on Aetna or to the gnomic aloofness of Heraclitus. But the poet’s choice of silence, the writer relinquishing his articulate enactment of identity in mid-course, is something new. It occurs […] in two of the principal masters, shapers, heraldic presences if you will, of the modern spirit: in Hölderlin and Rimbaud. [1]
In seiner Debütphase ist das intrinsische Schreibverbot schlechterdings nicht handhabbar, weder auf seiten der Opfer, die ja zugleich Täter sind, noch auf der ihrer späteren Interpreten, die immer wieder versuchen, das so noch nicht dagewesene Nein in seine Vorgängerformen, d. h. objektivierbare Auslöser rückzuübersetzen, und einen Hölderlin, sein englisches Analogon John Clare und selbst noch einen Robert Walser pathologisieren und krank schreiben, was das Zeug hält. Aber nur der Anschein gibt ihnen recht, denn die drei Autoren haben sich nicht deshalb als Teilnehmer des jeweils zeitgenössischen literarischen Diskurses disqualifiziert, weil sie verrückt geworden sind. Vielmehr kommt zuerst das Versagen der Stimme, das – von der Präzisierung hängt alles ab – jetzt ein frei gewähltes und doch irreversibles Sich-die-Stimme-Versagen geworden ist. Darauf folgt ein sich bis ins Selbstzerstörerische aufschaukelnder Ausbruch von Autoaggression, denn wie soll sich ein Ich erklären, daß es sich selbst aus dem Kernbezirk seiner Identität ausgesperrt hat und seiner Einbildungskraft ein für allemal den Riegel vorschiebt? Und erst dieses Sekundärphänomen, die Abstoßung des Neinsagers durch die Relikte einer ehedem schöpferischen Persönlichkeit, ruft die einschlägigen gesellschaftlichen Institutionen – auf gut deutsch Irrenhäuser – auf den Plan, die in den drei genannten Fällen die Notfallversorgung und den Schutz des mit sich Zerfallenen vor den Schockwellen der Desintegration übernehmen müssen.
Haben wir es also bei denen, die ›von sich aus‹ und ›von selbst‹ aufhören zu schreiben, mit einer Serie, einer sich zur Gegenwart hin verdichtenden Reihe von immer gleichen lebensbedrohlichen Implosionen zu tun? Glücklicherweise nicht, wie schon ein Blick auf Wolfgang Hildesheimer und Philip Larkin, die beiden jüngsten von uns behandelten ›Fälle‹, beweist. Der Kontrast zu der initialen Dreierkonstellation Hölderlin–Clare–Walser könnte nämlich ausgeprägter nicht sein. Während der Verzicht ihre Vorgänger mit einer tragischen Aura umhüllt und das ›Herzzerreißende‹ ihrer Biographien von der existentiellen Überforderung Zeugnis ablegt, reagieren Hildesheimer und Larkin auf fast ostentative Weise undramatisch. Sie avisieren und kommentieren die kreative Geschäftsaufgabe zwar noch, gehen danach aber, sei es als collagierender Privatier, sei es als Bibliothekar, zur Tagesordnung über. In zwei Jahrhunderten, in sechs oder sieben Generationen, ist also etwas Bemerkenswertes geschehen: Autoren haben Mittel und Wege gefunden, um mit dem Verstummen, das anfangs noch mit vernichtender Gewalt und womöglich auf dem Höhepunkt der Leistungskurve über den Betroffenen hereinbricht, zu Rande zu kommen. Sie haben – wie im Fall der Zensur und anderer Formen organisierten Wortentzugs auch – Routinen ausgebildet, ein ganzes Spektrum möglicher Reaktionen durchgespielt, das alle Monotoniebefürchtungen zerstreut und die, fast möchte man sagen Buntheit der folgenden Kapitel gewährleistet. Kurzum, die Leidtragenden einer bis zur Selbstaufgabe freien Schriftstellerei haben das ihnen zugemutete Lernpensum mit nicht geringerem Erfolg bewältigt als die Leser das ihre.
Es gibt also Anlaß und gute Gründe, um die individuelle Katastrophengeschichte vom Wegbrechen der eigenen künstlerischen Mission gleichzeitig als Etappe einer kollektiven Problembewältigungs- und Erfolgsgeschichte nachzuzeichnen. Stichworte wären in diesem Zusammenhang Entpathetisierung, Selbstdämpfung der tragischen Potentiale und die Tendenz, den literarischen Kontrollverlust durch andere Formen der (Selbst-)Inszenierung wettzumachen. Aber womöglich sind solche abstrakten und resultativen Formulierungen im Kontext einer Einleitung eher Stolpersteine als ›stepping stones‹. Versuchen wir also statt dessen, dem legitimen Wunsch nach Orientierung und Vorabinformation mit einem Als-ob-Argument nachzukommen, das so gewiß nicht wissenschaftsfähig ist, aber den Entwicklungstrend über eine zweckdienliche Fiktion vor Augen führt. Die braucht man sich außerdem nicht einmal selbst zurechtzuzimmern, denn das Publikum – in diesem Fall allerdings nicht das der Literatur, sondern der Musik – hat vorgearbeitet, und das Resultat, die von ihm umkomponierte Wirklichkeit, ist als höhere Form der Folklore fast jedem geläufig.
Hier allerdings zunächst die ungeschönten Fakten, wie sie sich etwa Denise P. Gallos Gioacchino Rossini. A Guide to Research entnehmen lassen. Rossini (1792–1868), Mode- und Kultkomponist, stellte 1829 nach der Uraufführung des Guillaume Tell die Opernproduktion ein. Der Siebenunddreißigjährige, eben vom französischen König zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt, bezeichnet sich fortan in Briefen nur noch als »ex-compositore« und »viertklassiger Pianist«. [2]Obwohl er ab 1857 wieder an Klavierwerken, den Péchés de vieillesse, arbeitete und auch eine Petite messe solennelle vollendete, wertete er diese Musikstücke durch ihre Titel – die »Sünden des Alters« enthalten u.a. die Kompositionen »Quatre mendiants« (Studentenfutter), eine »Etude asthmatique«, die »Fehlgeburt einer Polka« und den »Rizinuswalzer« [3]– oder Kommentare wie »Lieber Gott, da ist sie, die arme kleine Messe. Ist es wirklich geistliche Musik?« [4]konsequent ab. Wer Erklärungen für das abrupte Ende einer überaus erfolgreichen Karriere erbat, der bekam in der Regel ebenso höfliche wie austauschbare und seichte Einlassungen zu lesen, z.B.: »Wer früh beginnt, muß auch […] früh enden« [5]oder:
Ich hatte keine Kinder. [Und] nachdem ich mich fünfzehn Jahre lang abgeplagt und während dieser … Periode vierzig Opern geschrieben habe, empfand ich das Bedürfnis nach Ruhe und zog mich nach Bologna zurück, um da still zu leben … così finita la comedia. [6]
Die erholsame Zurückgezogenheit entpuppt sich allerdings bis weit in die 1850er Jahre hinein als ein nicht enden wollendes Krankenlager samt rastloser Suche nach Linderung, wenn schon nicht Genesung. Rossini leidet gleichzeitig oder in Folge an chronischer Gonorrhöe, Urethritis, Magen-, Darm- und Blasenproblemen, Hämorrhoiden und dem Symptomkomplex einer manisch-depressiven Persönlichkeit.
Inzwischen dürften auch die Rossini-Forscher angesichts der ständig anschwellenden Krankenakte ins Ächzen und Stöhnen geraten, und da ist es heilsam, dem Maestro selbst ein Ohr zu leihen. »Ich habe alle Frauenleiden«, erklärt er seinem Begleiter einmal während eines Spaziergangs. »Alles, was mir fehlt, ist die Gebärmutter.« [7]Ein Satz, schon sind die Ausdünstungen der Matratzengruft zerstoben, und der legendäre Rossini, Lebemann, Frauenheld und Meisterkoch, tritt wieder vor uns hin, ein Liebling der Götter, der bereits in jungen Jahren und lange vor seiner ›Dekomposition‹ auf Mißerfolge und Rückschläge mit den passenden kulinarischen Gegengiften zu reagieren wußte. So etwa, nachdem 1812 in Bologna sein biblisches Oratorium Ciro di Babilonia durchgefallen war. Nach dem Debakel bestellte er, wie er selbst berichtet,
bei einem Zuckerbäcker ein Schiff von Marzipan […], dessen Wimpel den Namen »Ciro« trug; der Mastbaum war zerbrochen, das Segel durchlöchert, und es lag auf der Seite, in einem Meer süßen Rahms schwimmend. Die lustige Gesellschaft verzehrte lachend mein gescheitertes Fahrzeug. [8]
Solche Episoden erklären die ›Anschlußfähigkeit‹ des mythischen an den faktischen Rossini, der auch als Invalide keinerlei Interesse daran entwickelte, seinen glanzvollen Doppelgänger auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Das hat erst eine auf das Allzumenschliche versessene Sekundärliteratur in Angriff genommen, allerdings mit bemerkenswert geringem Erfolg. Liest man die neueren Monographien, stößt man immer wieder auf energische Richtigstellungen und ›disclaimer‹ wie die folgende:
[Bei Rossini] konnte weder von Schwelgerei noch von exquisiter Kochkunst die Rede sein. Das erstere ließ sein defekter Verdauungsapparat nicht zu, und letzteres erschöpfte sich im Aufwärmen von Wasser für die Pasta und dem Zerhacken von Trüffeln zum Zweck der Verfeinerung von Gänseleber und Teigwaren; vorzugsweise aber stippte er Brotstücke in eine große Tasse Milchkaffee. Rezepte von Rossini gibt es nicht – mit Ausnahme einer Salatkreation. […] Man mag [sie] versuchen und dabei zum Feinschmecker werden, aber daß Rossini zu einer »Säule der Eßkultur« in Frankreich geworden ist, wie es eine Kulturgeschichte der Gastronomie aus dem Jahr 1894 behauptet, entspricht nur der Verlängerung einer posthumen Anekdotenreihe, die dem Bild eines feisten, gemütlich zurückgelehnten Bonvivants, dem das Komponieren zu anstrengend geworden war, eine epikureische Lebenshaltung zuordnete. [9]
Aber ebendieser exorzierte Epikureer ist in den Köpfen der Nachwelt nicht mehr totzukriegen: Rossini als Inbegriff und Inkarnation einer beneidenswerten ›Leichtlebigkeit‹, als der Begnadete, dem die Musik schneller zufliegt, als er sie komponieren kann, und der sich, als sie verhallt, ebenso unangefochten und ohne ein Fünkchen des Bedauerns bei Gott dafür bedankt, daß er rechtzeitig aufhören konnte. [10]Nun gut, ein Augenblick der »geistigen Ohnmacht«, der »Mattigkeit und Wasserscheu«, [11]aber dann ist das Notenpult beiseite geräumt, tut sich die Küchentür auf wie der Eingang zu einem anderen Konzertsaal, lockt das Adagio wohltemperierter Glut unter der Herdplatte im Einklang mit der »Produktivkraft [raffiniert bestückter] Delikatessengeschäfte«. [12]
Noch ist die Literatur, so könnte man sagen, traumatisiert von der ungeahnten Möglichkeit, daß ein Autor das Schreiben einstellen kann, ja einstellen muß, ohne daß zwingende äußere Gründe dafür vorliegen, da liefert die Schwesternkunst der Musik schon den Leitmythos, der dem seiner gewissenhaften Selbstentmündigung Ausgelieferten einen Ausweg aus der medusischen Paralyse zeigt. Verhaltet euch so, wird hier empfohlen, als ob auch ihr dieser Rossini sein oder werden könntet. Hier ist die Partitur, macht euch ans Nachspielen. Und wenn es diesen Künstler, dessen Lebensmelodie selbst durch ein nie mehr aufgehobenes musikalisches Pausenzeichen nicht dissonant wurde, nur qua Fiktion gegeben hat, dann werdet ihr als Virtuosen der Fiktionalität doch wohl das Richtige mit diesem Schemen anzufangen wissen.
2Triumvirat der Entmündigten: Hölderlin – Clare – Walser
Noch aber sind diese verlockenden Sirenenklänge Zukunftsmusik. Wir schreiben das Jahr 1802. Ein verspielter Gioacchino Rossini wird zehn, der bejahrte und unausgesetzt produktive Joseph Haydn steht im Zenit des Ruhms. Bei der Aufführung am Wiener Hof singt die Kaiserin die Sopran-Soli seines eben fertiggestellten Oratoriums Die Jahreszeiten. Aber einen halben Kontinent entfernt ereignet sich ganz im Stillen etwas kulturgeschichtlich nicht minder Folgenreiches. Ein als überspannt geltender junger Mann trifft Ende Januar in Bordeaux ein, um eine Hofmeisterstelle bei dem Hamburgischen Konsul und Weinhändler Meyer anzutreten. Schon im Mai macht er sich Hals über Kopf auf den Rückweg – ein Verstörter, der noch vier Jahrzehnte zu leben hat und doch jener Winterwelt seiner Anreise, den »überschneiten Höhen […] in eiskalter Nacht«, [13]nie mehr entkommen wird. »Weh mir«, heißt es mit frostiger Klarsicht in der im Anschluß entstandenen »Hälfte des Lebens«, »weh mir, wo nehm’ ich, wenn / Es Winter ist, die Blumen, und wo / Den Sonnenschein, / Und Schatten der Erde? / Die Mauern stehn / Sprachlos und kalt, im Winde / Klirren die Fahnen.«
Von solchen ›Nachtgesängen‹ schreibt Friedrich Hölderlin (1770–1843) nicht mehr viele, dafür werden die fragmentierten, die zerfetzten Umnachtungsgesänge mehr und mehr, und dann konturiert auch das Mauerwerk aus, von dem er gesprochen hatte. 1806 umschließt es eine Heilanstalt, das sogenannte Autenriethsche Clinicum, Vorläufer der Tübinger Universitätskliniken, in das Hölderlin zwangseingewiesen wird und wo man ihn sieben Monate lang therapiert und malträtiert. [14]Danach runden sich die Gemäuer zu den Wänden eines Turms, in dem der Schreinermeister Ernst Zimmer dem ›hoffnungslosen Fall‹, dem der behandelnde Arzt höchstens noch drei Jahre gibt, [15]eine Kammer mit Blick auf das Neckartal und die Flußauen überlassen hat. Dank der Biographie des jungen und schon 1830 verstorbenen Hölderlin-Verehrers Wilhelm Friedrich Waiblinger können wir den inzwischen längst musealisierten Raum immer noch als Zeitgenossen, als Augen- und Ohrenzeugen betreten. Klopfen wir also an.
Ein heftiges lautes: Herein! wird gehört. Man öffnet die Tür, und eine hagere Gestalt steht in der Mitte des Zimmers, welche sich aufs Tiefste verneigt, nicht aufhören will, Complimente zu machen, und dabei Manieren zeigt, die voll Grazie wären, wenn sie nicht etwas Krampfhaftes an sich hätten. Man bewundert das Profil, […] gewahrt mit Bedauren und Trauer die convulsivische Bewegung, die durch das ganze Gesicht sich zuweilen vorbereitet, die ihm die Schultern in die Höhe treibt, und besonders die Hände und Finger zucken macht. Er trägt ein einfaches Wams, in dessen Seitentaschen er gerne die Hände steckt. Man sagt einige einleitende Worte, die mit den verbindlichsten Verbeugungen und einem Schwall von Worten empfangen werden, die ohne allen Sinn sind. [Dann wird Hölderlin artikulierter.] Der Fremde sieht sich Eure Majestät, Eure Heiligkeit, gnädiger Herr Pater betitelt. [16]
Kopfstehende Welt, denn wir sind drauf und dran, unser menschenscheues Gegenüber von der abgöttischen Verehrung in Kenntnis zu setzen, die ihm seit seiner Wiederentdeckung durch Trakl, Rilke und Stefan George entgegengebracht wird. Aber zu spät. »Wie Euer Heiligkeit befehlen: Soll ich über den Menschen, Sommer, Zeitgeist?«, haspelt er herunter. [17]Kaum haben wir begriffen, daß er uns zur Wahl eines Themas auffordert und das Wort ›Sommer‹ wiederholt, rastet das Ritual auch schon ein. Er sieht ein paar Herzschläge lang aus dem Fenster auf die Schneereste in der Flußlandschaft, dann macht er sich wie ein Schnellzeichner an die Herstellung eines Poems. »Sommer« steht jetzt oben auf einem sauberen Bogen Papier, die Buchstaben treiben aus wie Blätter in einer Zeitraffersequenz, und am Zeilenende ploppen die Reimknospen auf: Gefilde – Milde, ausgebreitet – gleitet, Tale – Strahle: »[…] Und Wolken ziehn in Reih’ in hohen Bäumen, / Es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu säumen.« Fertig. Und jetzt noch die Signatur – »Mit Untertänigkeit Scardanelli« – nebst Datierung: »d. 9ten März 1940«.
So bekommen es die Besucher schriftlich: Friedrich Hölderlin ist nicht mehr er selbst, und er gehört seiner Zeit, dem inzwischen heraufziehenden Biedermeier, nicht mehr an. Aber das Herausfallen und die damit einhergehenden Ausfallerscheinungen, die den je nach medizinischem Erkenntnisstand gestellten und revidierten Diagnosen von »Manie« und »katatonischem Stupor« über »dementia praecox« bis zu »zyklothymer Schizophrenie« als empirisches Fundament dienen, sind nicht alles. Wer genauer hinsieht, entdeckt, daß Hölderlin bei seinen ›Auftritten‹ mehr leistet, als ein Demonstrationsobjekt für geistigen Verfall abzugeben. Er karikiert nämlich die Rolle des ›Dichterfürsten‹ bis in die Körpersprache hinein. Dessen durchgeistigtes Antlitz verwandelt sich in einen Tumult konvulsivisch entgleisender Gesichtszüge, die Hände, in denen auf Abbildungen die Feder ruht, führen ihren eigenen Veitstanz auf, und die ganze hehre poetische Geschäftigkeit wird mit wiederholtem Schulterzucken kommentiert. Daß diese Parodie mit Friedrich Schiller aber nicht nur auf Hölderlins zeitweilige Vaterfigur oder auf einen Johann Wolfgang von Goethe abzielte, der den um Protektion bemühten Siebenundzwanzigjährigen einmal nicht ohne paternalistischen Unterton als »wirklich liebenswürdig und mit Bescheidenheit, ja mit Ängstlichkeit offen« [18]charakterisiert hatte, sondern in erster Linie den Parodisten, d. h. Hölderlin selbst, aufs Korn nahm, wird noch eingehender zu erläutern sein. Wichtig ist an dieser Stelle der Befund einer zumindest partiellen Regeneration. Überzeichnung und Karikatur setzen ein nicht geringes Maß an Selbstkontrolle und Selbstdisziplin voraus, und das war dem aus Frankreich zurückgekehrten Hofmeister und Magister, der tobend im Haus seiner Mutter anlangte und sie und die entsetzten Mitbewohner auf die Straße trieb, doch offensichtlich verlorengegangen.
Allerdings nicht durchgängig. Zwischen 1802 und 1806, dem Zeitpunkt der Hospitalisierung, gab es mehrere sich aufschaukelnde Krankheitsschübe, zwischen denen Hölderlin auf dem alten Niveau und darüber hinaus literarisch arbeitsfähig war und seine zweibändige Übersetzung der Tragödien des Sophokles für den Druck vorbereiten konnte. Insbesondere in den Verschlimmerungsphasen aber war die tiefgreifende Destabilisierung, gerade auch für die Freunde aus der gemeinsamen Zeit am Tübinger Stift, nicht zu übersehen. Anläßlich des Besuchs von Hölderlin bei Schelling und dessen Frau im Kloster Murrhardt im Sommer 1803 schreibt dieser an Hegel, damals noch Privatdozent in Jena:
Der traurigste Anblick, den ich während meines hiesigen Aufenthalts gehabt habe, war der von Hölderlin. […] Seit [seiner] fatalen Reise ist er am Geist ganz zerrüttet, und obgleich noch einiger Arbeiten, z.B. des Übersetzens aus dem Griechischen bis zu einem gewissen Punkte fähig, doch übrigens in einer vollkommenen Geistesabwesenheit. […] Er vernachlässigt sein Äußeres bis zum Ekelhaften und hat, da seine Reden weniger auf Verrückung hindeuten, ganz die äußeren Manieren solcher, die in diesem Zustande sind, angenommen. – Hier zu Lande ist keine Hoffnung ihn herzustellen. [19]
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der später gern als »Proteus der Philosophie« bezeichnete Idealist hier selbst etwas geistesabwesend und zerfahren argumentiert, denn von Zerrüttung ist dem Wortlaut des Briefes nach wenig zu bemerken, solange man Hölderlin zuhört; erst wenn man ihn ansieht, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Aber wie dem auch sei, und gleich, ob die Symptomatik, das Verkommen, Verlottern und Verludern, zuerst in den Äußerungen oder im Äußeren auftritt, seine Umwelt grenzt ihn immer mehr aus. Schellings vorsichtiger Appell an die Hilfsbereitschaft des zukünftigen Weltgeist-Phänomenologen bleibt folgenlos, und er beruhigt sich damit, seinen guten Willen unter Beweis gestellt zu haben. Andere, wie der Diplomat und Schriftsteller Isaak von Sinclair, sind da zupackender. Erst holt Sinclair Hölderlin zu sich nach Stuttgart, dann verschafft er dem auch finanziell den Boden unter den Füßen Verlierenden eine halbe Sinekure als Hofbibliothekar in Homburg, für deren Vergütung Sinclair insgeheim selbst aufkommt. Allerdings sorgt er ungewollt auch für zusätzliche seelische Belastungen, weil Hölderlin durch die revolutionäre Gesinnung seines Wohltäters, die er im übrigen weitgehend teilt, 1805 in den Hochverratsprozeß gegen Sinclair, Baz, Seckendorf und andere hineingezogen wird. Vor der Verhaftung und Einkerkerung rettet ihn nicht zuletzt ein Gefälligkeitsgutachten eines Freundes der Familie. Dr.Müller streicht darin rhetorisch geschickt seine anfängliche Skepsis gegenüber den über Hölderlin umlaufenden Gerüchten heraus, muß sich dann aber eines Besseren belehren lassen:
Seiner alten hypochondrie eingedenk fande ich die Saage nicht sehr auffallend, wollte mich aber doch von der Wirklichkeit derselben überzeugen und suchte ihn zu sprechen. Wie erschrake ich aber als ich den armen Menschen so zerrüttet fande, kein vernünftiges Wort war mit ihm zu sprechen, und er ohnausgesetzt in der heftigsten Bewegung. Meine Besuche wiederholte ich einigemal, fande den Kranken aber jedes Mal schlimmer, und seine Reden unverständlicher. Und nun ist er, so weit daß sein Wahnsinn in Raserey übergegangen ist, und daß man sein Reden, das halb deutsch, halb griechisch und halb Lateinisch zu lauten scheinet, schlechterdings nicht mehr versteht. [20]
Mit dieser medizinischen Beurteilung wird, wie man sich klarmachen muß, eine Kerkertür im letzten Moment zugestoßen und zugleich eine zweite, die des Tübinger Clinicums des Dr.von Autenrieth, entriegelt. Es spricht immerhin für die diagnostischen Fähigkeiten des Dr.Müller, daß es schon ein Jahr später nur noch diesen einen Weg zu geben scheint. Auch Sinclair, inzwischen wieder auf freiem Fuß, weiß sich keinen Rat mehr und stellt die Weichen, indem er Hölderlins Mutter auffordert, ihren Sohn aus Homburg abholen zu lassen. Am 11.September wird das Vorhaben unter Einsatz körperlicher Gewalt in die Tat umgesetzt. Damit ist der spätere Vorführer zweideutiger literarischer Performances erst einmal selbst ›veranstaltet‹.
Es scheint müßig, weiter über äußere Auslöser von Hölderlins mentaler Destabilisierung zu spekulieren. Vom Hitzschlag auf einer französischen Landstraße über ihm wider die Natur gehende Ausschweifungen in Bordeaux bis zu einem undokumentierten Besuch am Sterbebett der unerreichbar gewordenen Geliebten Susette Gontard in Frankfurt oder der Zerreißprobe zwischen der Loyalität gegenüber dem angeklagten Sinclair und der Angst vor dem lebendig Begrabenwerden als politischer Häftling reichen die Vorschläge. Wer recht hat, ist bis heute offen – womöglich keiner der kontrovers Diskutierenden. Jedenfalls kann man mit der Unentscheidbarkeit der skizzierten Explikationen leben, solange über das explicandum Einigkeit herrscht: Der psychisch keineswegs gefestigte Hölderlin, der bereits in der Jugend depressive Züge ausbildet – im Vokabular der Epoche ist die Rede von Melancholie – und der Rudolf Magenau schon 1795 als »ein lebender Toter« [21]vorkommen wollte, gerät zu Beginn des 19. Jahrhunderts in zunehmend unerträgliche Lebensumstände, in denen die Problemlösungsstrategien der Normalität keine oder kaum noch Wirkung zeitigen. Die ›kollateralen‹ Schicksalsschläge und Ausweglosigkeiten sind – insbesondere in ihrer Erlebnisdimension und subjektiven Verarbeitung – nur umrißhaft und unscharf rekonstruierbar; die These, daß sie für sein literarisches Verstummen verantwortlich zeichnen, ist deshalb ein seit anderthalb Jahrhunderten süchtig machendes, aber leerlaufendes Glasperlenspiel.
Zeit für eine neue Sichtweise, die die existentielle Krise nicht über externe ›Zünder‹ von außen nach innen transportiert, sondern genau umgekehrt im Persönlichkeitskern Hölderlins ansetzt. Paradoxerweise liegen nämlich genau hier und nur hier die Fakten in der wünschenswerten Vollständigkeit offen. Die literarischen Manuskripte und Arbeitsblätter dokumentieren unmißverständlich, wie Hölderlin vom sorgfältig inszenierten rauschhaften, oratorischen und hymnischen Schreiben immer tiefer in das semantische Rauschen und damit die eigene Exkommunikation geriet. Schon richtig, es gab in dieser Zeit noch Fanale wie »Friedensfeier«, »Patmos«, »Andenken« und die oben zitierte »Hälfte des Lebens«; aber »Kolomb«, ein Hohelied auf den Neue-Welt-Entdecker Kolumbus, erscheint wie ein teilweise vom Salzwasser zerfressenes Logbuch und »Das Nächste Beste« hat in seiner Bruchstückhaftigkeit und seinem Zerschlagensein die professionelle Beschlagenheit eines Germanisten dazu gebracht, auf gut fünfhundertundfünfzig Seiten zu retten, was nicht zu retten ist. [22]Und zwar schon deshalb nicht, weil das fragmentarisch intendierte ›große Ganze‹ oder die zersprengte Totalität in und von Hölderlins Kopf nicht mehr faßbar war. Dieser poetische Kompetenzentzug, der Verlust einer in der deutschen Literatur vielleicht noch nie dagewesenen imaginatorischen Reichweite ist das Primärphänomen und die Primärkatastrophe. Und selbst wenn die weiteren Schicksalsschläge nicht eingetreten wären, die die Situation Hölderlins gewiß nicht erträglicher gemacht haben, wäre sein Leben durch die Implosion seiner Gaben und Kompetenzen in existenzgefährdender Weise aus den Fugen geraten.
Noch einmal und als pars pro toto -Widerrede: Es ist nicht der Verlust Susette-›Diotimas‹, also der geliebten, aber verheirateten Frau, der Hölderlin um die geistige Gesundheit bringt und als Dichter mundtot macht. Die vom Ehemann erzwungene Trennung hat ihn, wie die wohl 1800/01 entstandene Elegie »Menons Klagen um Diotima« beweist, nicht aus der Lebensbahn geworfen. Der Sprecher leistet ›Trauerarbeit‹, die Wunden schließen sich, und der durch die bestandene Prüfung in seiner künstlerischen Mission Bestärkte – »wer so / Liebte, gehet, er muß, gehet zu Göttern die Bahn« – findet Trost:
Und wie, wenn ich mit ihr, auf sonniger Höhe mit ihr stand, Spricht belebend ein Gott innen vom Tempel mich an. Leben will ich denn auch! schon grünt’s! wie von heiliger Leier Ruft es von silbernen Bergen Apollons voran! Komm! es war wie ein Traum! Die blutenden Fittiche sind ja Schon genesen, verjüngt leben die Hoffnungen all.
Erst als sich die andere – überirdische – Diotima, die Muse, entzieht, ist kein Wiederaufstieg, kein Sich-Aufschwingen, keine (Selbst-)Heilung mehr möglich und die Katastrophe da. Das unvollendete Rollengedicht »Wenn aus der Ferne … «, wahrscheinlich 1808, also im Turm, entstanden, rekapituliert den Abschied. Hölderlin spricht nicht mehr, aber er kann die schon namenlos gewordene Verkörperung der Poesie noch »aus der Ferne, da wir geschieden sind«, zu sich reden lassen. »In meinen Armen«, erinnert seine Muse sich, erinnert sie ihn, läßt sich der angeblich geisteskranke Hölderlin durch sie in Erinnerung rufen, »lebte der Jüngling auf«. Aber diesmal ist die Vitalität nicht reaktivierbar, die kreative Potenz auf immer dahin. »Es waren schöne Tage. Aber / Traurige Dämmerung folgte nachher.« Wie soll sich ein Demissionierter, Abgeschriebener, ein von seiner Inspiration im Stich gelassenes Überbleibsel in dieser Hoffnungslosigkeit, dem erbärmlichen Mangel an Strahlkraft am Leben halten? Die Muse Diotima, die immer wieder mit der inzwischen ja verstorbenen irdischen Doppelgängerin verschmilzt und Hölderlin vielleicht deshalb weiterhin wehmütig als »Geliebter« anspricht, antwortet gleichwohl ohne jede Beschönigung und ohne den Anflug eines guten Rats, bevor sie – und das Gedicht – mitten im Satz abbricht: »das / Weißt aber du nicht«.
Ohnmächtig, hilflos, von allen guten Geistern verlassen steht er da, der vorher nur allzu genau zu wissen glaubte, wozu er auf der Welt war. Hölderlins Zeitgenosse Percy Bysshe Shelley hat die Dichter in seiner Defence of Poetry als »unacknowledged legislators of the world« bezeichnet und den Potentaten der Einbildungskraft damit immerhin noch ins Poesiealbum geschrieben, daß ihre Dekrete nicht sonderlich ernst genommen werden. Dem Sänger und Sager Hölderlin, der mit den griechischen Versformen und Rhythmen, die er so virtuos eindeutschte wie kein zweiter, auch die alten Götter, ihre elementare Macht und den Einklang des Menschenlebens zurückbringen wollte, schienen solche Zwischenreden und Einmischungen eines skeptischen Realitätssinns eher kontraproduktiv. Er wollte die Wiederkehr der angeblich durchpoetisierten Welt der Antike, und er setzte ganz auf die Hebelwirkung der Vision, um den revolutionären Umsturz zu bewältigen. Deshalb das extreme Übergewicht oratorischer Gattungen wie Ode, Elegie und Hymne in seinem Werk, deshalb der Befund, daß »Sprechakte des Anrufs, des Aufrufs, der Anrede, Frage, Antwort, der Aufforderung und Bitte, des Danks, des Lobs, Feierns und des Tadels […] die Diktion seiner Gedichte [charakterisieren]«. [23]Denn Hölderlin ist, wie Gerhard Kurz’ germanistischer Kollege Jochen Schmidt ergänzt, ein Geisteskind der im 18. Jahrhundert im Rückgriff auf Longin formulierten Ästhetik des Erhabenen, [24]die gleichsam auf den sie umsetzenden Künstler abfärbt und ihn heraushebt und erhöht.
Solche (Auto-)Privilegierung und Auratisierung zeigt sich in Hölderlins Gedichten beinahe ständig, und eine Handvoll repräsentativer Zitate mögen den hohen Ton und überhöhten Leistungsanspruch an die Gattung und die hier Praktizierenden verdeutlichen. »Was bleibet aber«, heißt es in »Andenken«, »stiften die Dichter.« Diese Formulierung ist fraglos wegen ihrer Kürze, womöglich aber auch wegen der – im Verzicht auf sofortige Wirkung und ›Durchschlagskraft‹ fälschlich unterstellten – Bescheidenheit in den Zitatenschatz eingegangen. Aber wo sich die Poeten, »die Zungen des Volkes«, kleinmachen, da behindern sie ihre Artikulationsfähigkeit, kann man Weckrufe doch unmöglich lispeln. Deshalb ist Hölderlin ›Lautsprecher‹ wie in »Wie wenn am Feiertage«:
Doch uns gebühret es, unter Gottes Gewittern,
Ihr Dichter! mit entblößtem Haupte zu stehen,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand
Zu fassen, und dem Volke ins Lied
Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen.
Dichter sind mit anderen Worten ›blitzgescheit‹ und trotzdem vor Selbstverliebtheit und Egozentrik gefeit, weil sie ihre unvergleichlichen Gaben bedingungslos dem Dienst an der guten, nein, an der besten Sache weihen: »Beruf ist mirs, / Zu rühmen Höhers, darum gab die / Sprache der Gott und den Dank ins Herz mir« (»Der Prinzessin Auguste«). Zweifel werden also letztlich gotteslästerlich, weshalb sich Hölderlin noch 1804 in »Blödigkeit« – der Begriff meint damals noch schlicht Schüchternheit oder Zaghaftigkeit – mit den Zeilen zur Ordnung ruft:
Geht auf Wahrem dein Fuß nicht, wie auf Teppichen?
Drum, mein Genius! tritt nur
Bar in’s Leben, und sorge nicht!
Da steckte er schon mit beiden Füßen im Morast und seine Zeit als Hyperion – auf Deutsch der Darüberhingehende – war vorbei.
Hatte er sie wirklich für unbegrenzt, für von ewiger Dauer gehalten? Dann wäre der Enthusiasmierte geisteskrank und realitätsuntüchtig gewesen, lange bevor er dazu erklärt wurde. Es gab ihn also sehr wohl und von Anfang an, den anderen, den mit seinem überhöhten und zunehmend überanstrengten Selbstbild dissidenten Hölderlin, den Dichter des Selbstzweifels, der Angst, ja fast schon der Untergangsgewißheit, und auch dieses Alter ego redet offen oder zwischen den Zeilen zu uns. Schon der Achtzehnjährige, der in der alkäischen Ode »Mein Vorsatz« seinen Lebensentwurf ausbreitet, geht interessanterweise vom Scheitern aus – »Ich erreich’ ihn nie den / Weltumeilenden Flug der Großen« – und schließt mit der Selbstherausforderung durch ein pathetisches Trotzdem. Zehn Jahre später wird in »An die Parzen« mit den Schicksalsgöttinnen immer noch verhandelt, und zwar fast in Form eines Teufelspakts – ein Intervall des Glücks und Gelingens gegen den Rest des Lebens und das Seelenheil:
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, von süßem
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil’ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,
Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.
Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, dieser mehr als risikofreudige ›Vorschlag zur Güte‹ sei bei den metaphysischen Entscheidungsträgerinnen auf offene Ohren gestoßen, der Handel abgeschlossen und der Vertrag, besonders was die letzte Strophe angeht, bis aufs i-Tüpfelchen eingehalten worden. Hatte der andere, der unverstiegene Hölderlin das Zweite Gesicht im Hinblick auf das Schicksal des ›großen Zwillingsbruders‹? Hat er die Schlußzeilen in »Hyperions Schicksalslied« geschmuggelt, in denen der von seinen Göttern Begeisterte abstürzt und abfällt und sich plötzlich in den Kaskaden eines wenig elitären Menschenstroms wiederfindet: »Es fallen / Die leidenden Menschen / Blindlings von einer / Stunde zur andern, / Wie Wasser von Klippe / Zu Klippe geworfen, / Jahr lang ins Ungewisse hinab«? Legte er die nach Bertaux in Hölderlins Werk so unübersehbare Spur von Antizipationen und ›Probeläufen‹ jenes Schweigens, in dem es dann versank? [25]
Schon möglich. Vor allem aber sorgte dieses zähe, gnomische, fast bedürfnislose und unverführbare Andere für ein auf den ersten Blick unspektakuläres, aber im Grunde unerhörtes Ereignis. Der Rhapsode und Hymniker Hölderlin überlebte den Gravitationskollaps seines poetischen Sendungsbewußtseins und seiner Mission ebenso wie all die Sekundärkatastrophen, die den psychischen Aggregatzustand Unglück nach dem Gesetz der Serie über alle Erträglichkeit hinaus zu verschlimmern pflegen. Mehr noch, im Gegensatz etwa zu Nikolaus Lenau und der Bildhauerin Camille Claudel, die beide völlig ausgebrannt und in zunehmend apathischer Demenz im Irrenhaus dahinvegetierten, existierte ein besonders resistenter Ich-Rest, ein Bruchteil der Persönlichkeit weiter bzw. regenerierte sich im Turm. Am besten benutzt man ein Bild, um das Geschehen zu beschreiben. Hölderlin erleidet Schiffbruch, aber er geht nicht unter. Er hält sich als Wrack an der Oberfläche und driftet langsam fort von der Unglücksstelle, in seinem ›Erscheinungsbild‹ Zeugnis ablegend von den Umständen der Katastrophe. Oder mit dem Vergleich Bertaux’: Hölderlin ist durch seine Traumatisierungen – insbesondere die an Folter grenzende ›Behandlung im Clinicum‹ – zum psychischen Krüppel geworden. Aber deshalb war er noch lange nicht geisteskrank oder wahnsinnig: »[Schließlich fällt es] niemandem ein, […] zum Beispiel einen Kriegsbeschädigten, der verstümmelt wurde, einen ›Kranken‹ zu nennen.« [26]
Diese Sicht der Dinge verlangt neben einleuchtenden Vergleichen aber fraglos auch nach überzeugenden Argumenten, und sie stehen in der Tat zu Gebote. Eines haben wir schon angeführt. Der ›residuelle‹ Hölderlin, der Überrest eines von den Zeitgenossen übersehenen und erst Generationen später rehabilitierten Großen der deutschen Literatur, ist in der Lage, sich mimisch und gestisch zu dem Dichter- und Selbstbild zu verhalten, das eine lebensgefährliche Überanstrengung und Überforderung im Gefolge hatte, und zwar parodistisch. Das gleiche gilt auch für die Schwundstufe der literarischen Produktion, die Turm-Gedichte. Auch sie kommentieren sowohl die jetzige Situation wie auch ihr so glänzendes Gegenüber, das Werk des abgestürzten Hyperion. Beispielsweise wird die Selbstentfremdung, der Bruch zwischen dem Götterboten und dem Stubenhocker, zwischen dem ›harmlosen Irren‹ und seiner unmittelbaren Umgebung in Wendungen wie »er lebt den Menschen nicht vergebens« (»Der Mensch«) oder »wo ich umher mich leite« aus »Der Spaziergang« zum Thema. Der eingefallene, eingestürzte, verzwergte Hölderlin ist sich hier äußerlich geworden, er lebt nicht, er lebt sich, und zum Spaziergang tritt er an wie ein ferngesteuertes, roboterhaftes Simulacrum seiner selbst.
Wem das als Demonstration einer – zugegebenermaßen störanfälligen und instabilen – intellektuellen Wachheit und Urteilsfähigkeit nicht ausreicht und wer statt dessen auf die Unordnung, die Frenesien und das ›wirre‹ Kauderwelsch des ›Geisteskranken‹ verweist, dem möchte man ein Quentchen mehr von der Geduld und dem detektivischen Scharfsinn wünschen, mit dem Pierre Bertaux ein von Wilhelm Waiblinger aufgeschnapptes und festgehaltenes ›Unwort‹ dekodiert. »Ich, mein Herr«, erklärt da der angeblich Umnachtete, »bin nicht mehr von demselben Namen, ich heiße nun Killalusimeno. Oui, Eure Majestät.« [27]Zunächst erfolgt die phonetische und orthographische Korrektur. Was Waiblinger gehört hat, war »Kallilusomenos« oder »Kallilysomenos«, also ein Kompositum aus der griechischen Vorsilbe kalli- (auf eine schöne Art) und dem Partizip in der Medialform des Verbs luô ([ab]waschen, baden) beziehungsweise lyô (los-, freilassen). Bertaux fährt fort:
»Ich heiße kallil[y]somenos«: »Ich bin der, der sich selbst schön, in Schönheit erlösen, auflösen, befreien wird.« Ist das unsinnig? [Der Satz] könnte sogar als Lebensmaxime von Hölderlins fünfunddreißig Jahre dauernder Existenz im Tübinger Turm gelten. [Hier versucht der von den Freunden und Zeitgenossen Abgeschriebene], das Problem der eigenen Existenz »für sich selbst«, und zwar auf eine möglichst schöne Art (kalos), zu lösen. Er »befreit« sich von den Verpflichtungen […] und zieht sich unter anderem in die Musik und in den Verkehr mit sich selber und den eigenen Gedanken zurück. [28]
Rettung durch Abkapselung, Rücknahme, Rückbau des gekenterten Flaggschiffs eines poetischen Christopher Kolomb zum Floß der Medusa lautet die Devise. Denn auch in die Balken und Bretter dieses über Jahrzehnte in immer ruhigeres Fahrwasser geratenden Notbehelfs kann man Gedichte ritzen. Ein paar Dutzend davon sind uns überliefert. Hölderlin ist in diesen Produkten der »gespenstisch konventionalisierten Harmonie« [29]nicht wiederzuerkennen. Statt grandioser Seelenlandschaften unter Donner und Blitz, kommenden Göttern und einer – man verzeihe das anachronistische Bild – wie ein Glasfiberstab gebogenen und torsionierten Sprache »durchgehend eigentümlich spannungslose, monotone und doch in ihrer Einfachheit manchmal noch anrührende Verse [in] stereotype[n] Bilder[n]«. [30]Schönfärberei, ängstliche Distanz, Ausklammerung von ›ich‹ und ›du‹ sowie des Referenzfeldes Antike konstatiert die Sekundärliteratur angesichts solcher Sekundärpoesie, in Summe also konsequente Ex-Kommunikation, die auch vor der sprachlichen Abrüstung und Demobilisierung nicht zurückschreckt:
Während früher oft weiträumige Hypotaxe die poetische Sprache bestimmte und die Syntax die Verseinheit, ja immer wieder in kühnem Enjambement sogar die Stropheneinheit überschritt, gibt es nun fast nur noch einfachste Parataxe, in girlandenhaftem Reihungsstil so geordnet, daß Verseinheit und Sinneinheit zusammenfallen. Reduktion und Regression kennzeichnen auch die Einförmigkeit der Naturbilder, die nicht mehr leben, sondern wie in einem Baukastenspiel zu Konfigurationen immer gleicher Grundelemente erstarrt sind. [31]
So werden literaturwissenschaftliche Beschreibungsversuche oft zu einer – immer ausbaufähigen – Mängelliste und Vermißtenanzeige. Die sie wieder und wieder aufgeben, vergessen, daß auch die Turmgedichte, nicht anders als ihre ungleich virtuoseren und elaborierteren Vorgänger, eine Botschaft transportieren, die nur so, will sagen über die ostentative Präsentation der Verluste und des Nicht-mehr-Könnens aussagbar ist. Deshalb ist es verdienstvoll und in mancher Beziehung eine Pionierleistung, wenn sich in dem 2004 erschienenen Sammelband zur späten Hymnik und Tragödientheorie Hölderlins immerhin drei Beiträger eingehender mit den Scardanelli-Gedichten befassen, und zwar unter dem Aspekt der Eigentümlichkeit und des Rechts auf möglichst vorurteilsfreies Gehör. Am weitesten wagt sich dabei Christian Oestersandfort in der revisionistischen Lektüre der Flaschenpost eines Schiffbrüchigen vor.
Sein Aufsatz »Hölderlins Pseudonym Scardanelli als Künstlerkonfiguration einer Dichtung der Bescheidenheit« besticht durch den Nachweis, daß die Turm-Gedichte kein verstümmeltes Echo darstellen, sondern einen nicht minder drastischen Widerruf des alten Selbstverständnisses formulieren als die eingangs dieses Kapitels diskutierte körpersprachliche Karikatur der ›Dichterfürsten‹. Von den spätesten Gedichten schreibt ihr Exeget:
[Sie] treiben auch keinen Kult mehr um den Künstler und die Kunst. Zum Ausdruck kommt in ihnen vielmehr ein abgeklärtes Verhältnis zum künstlerischen Schaffen, eine Einsicht in die Grenzen von Kunst und Künstler. [Sie sind] symbolisiert in den häufig genannten Bergen, der Umrahmtheit der Bilder, die »auf Bilderbuchgröße« verkleinert sind. Hier wird eine skeptische Antwort gegeben auf die Frage: »Wozu Dichter in dürftiger Zeit?« [32]
Es ist mit anderen Worten ein »Vertrauensverlust« [33]gegenüber dem Medium und den eigenen Fähigkeiten konstatierbar, ein Umkippen der ehemaligen habituell verfestigten Überforderung fast