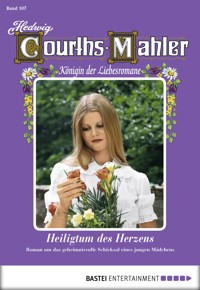Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod ihrer Eltern wächst die kleine Liselotte im Schloss des Barons von Bodenhausen auf. Dort wird das Mädchen herablassend behandelt und als "Bettelprinzess" verspottet. Mit der Zeit stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei der vermeintlichen "Bettelprinzess" um eine Nachkommin der Grafschaft Hochberg-Lindeck handelt. Die mittlerweile zur jungen Frau herangewachsene Liselotte wird damit zur reichen Gräfin. Und dann gibt es ja auch noch die Liebe...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Die Bettelprinzess
Saga
Die Bettelprinzess
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950229
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Es war an einem regnerischen Sommerabend. Wie in Dunst und Nebel gehüllt lag das Thüringer Land. Von den Bäumen herab tropfte es noch nass und schwer.
Am Eingang des hübschen Dörfchens Bodenhausen, an der grossen Fahrstrasse, die vom Bahnhof nach dem Schlosse führte, das den gleichen Namen trug, lag der einzige Gasthof des Oertchens. In schwarzen Lettern prangte stolz an der Fassade: „Gasthof zur Weissen Taube“. Das konnte man selbst jetzt in der Dämmerung noch erkennen. Das Haus bot einen sauberen, freundlichen Anblick mit seinen weiss gestrichenen Wänden und grünen Fensterläden. Es lag inmitten eines grossen Gartens. Die eine Hälfte dieses Gartens war mit Tischen und Bänken versehen und zur Aufnahme von Gästen eingerichtet. Die andere Seite jedoch war mit Obstbäumen und Gemüse bepflanzt und stand dem Verkehr nicht offen.
Die „Weisse Taube“ gehörte der Witwe des früheren Besitzers, Frau Martha Schulz. Das war eine saubere, behende Frau, die ihrem Anwesen resolut vorstand und auf Ordnung und „Reputierlichkeit“ hielt, wie sie selbst zu sagen pflegte. In den letzten Jahren hatte sie sogar zuweilen Sommergäste im Hause, die es sich ein paar Wochen wohl sein liessen in der schönen, waldreichen Gegend. Und ausserdem kamen Sonntags wohl auch aus der zwei Stunden entfernten Stadt einige Ausflügler, die in der „Weissen Taube“ guten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen verzehrten. Bei Frau Martha Schulz war alles gut, frisch und nicht teuer.
Es war einige Zeit, nachdem der letzte Zug die Station Bodenhausen passiert hatte, als sich dem noch unbeleuchteten Gasthof eine schlanke, junge Frau in Trauerkleidern näherte. Sie führte ein etwa fünfjähriges Kind an der Hand. Die Kleine schmiegte sich schlaftrunken an die Mutter.
„Ich bin so müde — so müde, liebe Mami,“ sagte sie schläfrig und gähnte herzhaft. Die schlanke Fraubeugte sich liebevoll herab und küsste die Kleine.
„Nur noch ein wenig Geduld, meine kleine Liselotte, gleich wirst du in einem weichen Bettchen liegen und Schlafen,“ sagte sie mit sanfter, wohllautender Stimme, in der es jedoch wie von unterdrückten Tränen zitterte.
Mutter und Kind betraten nun den noch dunklen Hausflur des Gasthofs. Kein Mensch war zu hören und zu sehen. Um diese Zeit war man in der „Weissen Taube“ nicht gewohnt, Gäste zu empfangen.
Unklar erkannte die junge Frau gleich neben dem Eingang eine Bank. Auf diese liess sie sich erschöpft nieder und nahm zärtlich beruhigend das müde Kind auf den Schoss. Es lehnte sein dunkles Lodenköpfchen, von dem der kleine Strohhut in den Nacken geglitten war, an die Schulter der Mutter und schlief sofort ein.
Die fremde Frau hatte, ehe sie sich setzte, mit ihrem Schirm auf die Bank geklopft, um jemand herbeizurufen. Das hörte Frau Martha Schulz, die eben im Gastzimmer die Lampen anzündete. Die etwa vierzigjährige, rundliche Frau mit dem frischen, gutmütigen Gesicht trug über einem sauberen Waschkleid eine breite, weisse Schürze, über der eine schwarze Ledertasche hing. Behende eilte sie hinaus in den Flur.
„Wer ist da?“ fragte sie, in dem Halbdunkel niemand erkennend.
„Verzeihen Sie, ich wollte nur fragen, ob ich bei Ihnen für einige Wochen ein bescheidenes Zimmer bekommen könnte. Mir wurde gesagt, dass Sie an Sommergäste vermieten,“ sagte die Fremde halblaut, um ihr schlafendes Kind nicht zu stören.
Ein wenig misstrauisch lief die Wirtin tiefer in den Flur hinein und öffnete eine Tür.
„Heinrich, stecke doch die Lampe im Flur an!“ rief sie hinein.
Heinrich, der Hausdiener, ein grosser, starker Bursche mit semmelblondem Haarschopf und frischem Gesicht, tat wie ihm geheissen. Der Schein der Lampe beleuchtete nun ein so liebliches, rührendes Bild, dass selbst der lange Heinrich ein Weilchen wie gebannt hinüber blickte. Auf der Bank sass eine blasse, aber schöne junge Frau, deren dunkelblaue Augen wie im tiefen Leid empor sahen. In ihren Armen hielt sie ein engelschönes, schlafendes Kind.
Dem langen Heinrich wurde so andächtig zumute, wie Sonntags in der Kirche. So etwas Schönes hatte er noch nie gesehen. Und Frau Martha wurde ganz seltsam weich ums Herz. Jede Spur von Misstrauen verflog sofort. Sie fühlte instinktiv, dass sie hier eine Unglückliche vor sich hatte, die wohl Mitleid, aber kein Misstrauen verdiente.
Tief aufatmend strich sie über ihre weisse Schürze.
„Jawohl, meine Dame, ein Zimmer können Sie bekommen. Es ist noch alles frei in diesem Jahre. Gleich lasse ich Ihnen das Giebelstübchen vorrichten, wenn es Ihnen gefällt. Ich habe freilich nur ganz schlichte Stübchen zu vermieten. Das Giebelstübchen hat die hübscheste Aussicht und liegt am ruhigsten Dort hören Sie vom Gasthofsbetrieb gar nichts.“
„Das ist mir lieb. Ich will auch nur ein einfaches Zimmer. Nur sauber und ruhig soll es sein.“
„Dann sehen Sie es sich bitte an, meine Dame. Heinrich, bring eine Lampe.“
Die Fremde erhob sich und Heinrich leuchtete voran.
Die resolute Frau Martha nahm der Fremden das schlafende Kind ab.
„Die Kleine ist zu schwer für Sie. Ich will sie tragen. Was ist das für ein schönes Kindchen, den reine Engel.“
Heinrich nickte, als müsse er das bestätigen.
„Ich hätte das Kind doch vom Bahnhof hierhertragen können,“ sagte er ein bisschen unbeholfen.
Die Fremde sah ihn freundlich an.
„Liselotte ist bis hierher gelaufen, nun war sie müde,“ sagte sie.
„Ach, Sie hätten den kleinen, molligen Plumpsack auch nicht so weit tragen können, meine Dame. Ist ja ein gut Stück Weg. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie kamen, hätte ich freilich den Heinrich nach der Bahn geschickt. Wie fest die Kleine schläft.“
Heinrich sah prüfend von Mutter zu Kind.
„Das ist sicher eine vornehme Dame, trotz der einfachen Kleider. Sie ist noch zehnmal schöner als die Frau Baronin aus dem Schlosse, wenn sie sich auch nicht in Samt und Seide kleidet und einen Federhut trägt,“ dachte er bei sich.
Auch Frau Martha hegte ähnliche Gedanken, und sie fragte sich besorgt, ob der Fremden das schlichte Giebelstübchen nicht zu gering sein würde.
Heinrich öffnete jetzt eine Tür und beleuchtete ein freundliches, sauberes Zimmerchen. An der einen Wand stand ein Bett, ein Waschtisch und ein Kleiderschrank. Auf der gegenüberliegenden Seite befanden sich ein Diwan, eine Kommode, zwei Stühle und ein Kleiderhaken. Am Fenster stand ein Sessel mit einem kleinen runden Tisch und an der Rückwand neben der Tür ein grösserer Tisch und daneben ein Kofferständer.
Ueber dem Waschtisch hing ein Spiegel und über der Kommode ein Bild der Königin Luise. Das war die ganze Einrichtung. Aber über dem Bett lag eine blütenweisse Decke und an dem Fenster hingen ebenso saubere, hübsche Mullgardinen.
„Genügt Ihnen das Zimmer, meine Dame?“ fragte die Wirtin.
„Oh ja, es ist so freundlich und sauber. Wenn es nicht zu teuer ist, möchte ich es wohl mieten,“ antwortete die Fremde mit ihrer sanften, wohllautenden Stimme.
Sie wurden nun schnell handelseinig und die Wirtin legte das schlafende Kind sorgsam und sanft auf den Diwan.
Dann richtete sie selbst schnell das Bett, während Heinrich Wasch- und Trinkwasser herbeiholte. Ein Zimmermädchen gab es nicht in der „Weissen Taube“ und das Hausmädchen war mit der Köchin zusammen beschäftigt, Wäsche zu legen.
Frau Martha hätte es sich aber auch sonst nicht nehmen lassen, für das Behagen der Fremden zu sorgen.
Kaum eine halbe Stunde war vergangen, da lag die kleine Liselotte ausgekleidet und gewaschen in den weichen Kissen.
Die Fremde ging mit hinunter, um in dem noch völlig leeren Gastziminer ein einfaches Abendessen zu verzehren: Heinrich wurde inzwischen nach dem Bahnhof geschickt, um das Gepäck abzuholen.
Die Wirtin bediente die junge Frau selbst und plauderte freundlich mit ihr.
Sie erfuhr nun, dass sie Frau Maria Hochberg hiess und vor kurzem erst ihren Gatten durch den Tod verloren hatte. Maria Hochberg wollte ich einige Wochen in dem stillen friedlichen Dörfchen erholen und versuchen, ihr Leid zu verwinden. Sie stand mit ihrem Kinde ganz allein im Leben und gestand ganz offen, dass sie nur ein sehr kleines Vermögen besass. Sobald sie sich erholt und gekräftigt habe, müsse sie für sich und ihr Kind arbeiten, sagte sie. Ihre bisherige Wohnung habe sie aufgegeben und die Möbel verkauft, um einige tausend Mark in den Händen zu haben. Aber sie habe als Mädchen ihr Brot durch allerlei Malereien auf kunstgewerblichen Gegenständen verdient und wollte dies auch in Zukunft tun. Nur müsse sie erst wieder fähig sein, klar zu denken.
Teilnahmsvoll hatte Frau Martha zugehört. Nun sprach sie der jungen Frau, die so rasch ihr Herz gewonnen hatte, Mut ein.
Maria Hochberg fragte, ob die Wirtin gewillt sei, sie mit ihrem Kinde in volle Pension zu nehmen. Sie verlange nur einfache, kräftige Kost und reichlich frische Milch für ihr Kind.
Frau Martha ging gern darauf ein und berechnete einen mässigen Preis. Darauf bezahlte Frau Maria Hochberg gleich für einen ganzen Monat im voraus. So waren beide Teile zufrieden.
Gleich, nachdem die junge Frau ihr Abendessen verzehrt hatte, ging sie wieder hinauf zu ihrem Kinde.
Noch lange sass sie am offenen Fenster des Giebelstübchens, vor dem ein grosser Apfelbaum seine Zweige streckte.
Der Mond stand jetzt am Himmel und nur leichte Wolken zogen noch darüber hin. Ein tiefer Frieden lag über dem Dörfchen und die tiefe Stille wurde nur zuweilen unterbrochen durch das dumpfe Brüllen einer Kuh oder das Bellen eines Hundes. Sonst hörte die einsame Frau nichts als die Atemzüge ihres Kindes und das Spielen des Windes in den noch nasen Zweigen des Apfelbaums. Träne um Träne rann über ihr blasses, schmerzbewegtes Gesicht.
„Siehst du vom Himmel auf mich und dein Kind herab, mein geliebter Mann? Ach, warum hast du mich allein gelassen? Wie schwer ist das Leben ohne dich. So glücklich war ich an deiner Seite. Aber das Glück war zu gross, ich durfte es nicht behalten. Und nun kann ich es nicht fassen, dass du nie mehr bei mir sein wirst, bei mir und deiner kleinen Liselotte, die du so zärtlich liebtest.“
So hielt die Unglückliche Zwiesprache mit dem geliebten Verstorbenen.
Vom Kirchturm herüber schlug ein dünnes Glöcklein die elfte Stunde. Da erhob sich Maria Hochberg seufzend und begab sich zur Ruhe, nachdem sie am Lager ihres Kindes in die Knie gesunken war und um Kraft gebetet hatte.
Lange lag sie noch wach und lauschte den friedlichen Atemzügen ihres Kindes.
Ihre Augen brannten von den vergossenen Tränen und das Herz war ihr schwer. Endlich erbarmte sich der wohltätige Schlaf und führte sie in ein glückliches Traumland.
Früh am nächsten Morgen war sie schon wieder wach. Sie erhob sich leise, um das Kind nicht zu stören, und kleidete sich an. Dann begann sie behutsam ihre Koffer auszupacken und ihre Sachen in Schrank und Kommode zu ordnen.
Dabei erwachte klein Liselotte.
Erstaunt richtete sie sich vom Lager auf und rieb ich den Schlaf aus den Augen. Dann sah sie sich verwundert im Zimmer um.
„Mami! Ach Mami, wo sind wir denn? Dies ist doch nicht unser Schlafzimmer zu Hause,“ sagte sie mit drolliger Miene und schüttelte die dunklen Locken aus dem schlafgeröteten Gesichtchen.
Maria trat schnell zu ihrem Kinde heran. Sie liess sich neben ihm auf dem Diwan nieder und umschlang es zärtlich mit den Armen.
„Weisst du denn nicht mehr, Liebling, dass wir gestern eine grosse Reise gemacht haben und nun nicht mehr zu Hause sind?“ fragte sie, sich zu einem Lächeln zwingend.
Liselotte schmiegte das rosige Köpfchen an die Mutter und nickte energisch.
„Ja, das weiss ich, wir sind weit mit der Puffbahn gefahren und wollten in den schönen grünen Wald und auf die Wiesen, wo viele bunte Blumen blühn.“
„Ja, Liselotte, und da sind wir nun.“
„Ach hier ist doch kein Wald und keine Wiese.“
„Oh, du brauchst nur nachher zum Fenster hinauszusehen, dann siehst du den Wald und die Wiesen. Wenn du angekleidet bist und mit Mama gefrühstückt hast, dann gehen wir auf die Wiese und in den Wald.“
Liselotte klatschte in die Händchen.
„Oh, wie schön! Dann pflücke ich Blumen und winde dir einen Strauss, wie ihn dir Papi oft gebracht. Werden wir nun endlich hier unsern lieben Papi finden?“
Die arme Mutter schluckte krampfhaft ihre Tränen hinunter.
„Ich habe dir doch gesagt, mein Herzkind, unser Papi macht eine weite, weite Reise.“
„Nun, die haben wir doch auch gemacht, da müsste mein lieber Papi doch hier sein.“
„Nein, mein Kind — er ist viel, viel weiter fort. Wir werden ihn noch lange, lange nicht wiedersehen.“
„Ach Mami, nun bist du wieder so traurig. Wie lange Papi auch ausbleibt. Er hat mir doch gesagt, ehe er abreiste, dass er bald wiederkommen würde.“
„Aber du weisst doch, er wird länger aufgehalten, als er glaubte.“
Liselotte nickte verständig.
„Ja, Mami, ich weiss. Aber du bist auch traurig darüber. Als der Brief kam, der dir meldete, dass Papi noch lange fortbleibt, da bist du vor Schrecken umgefallen und hast so bleich ausgesehen und dich gar nicht gerührt. Und dann hast du gar nichts essen können und hast immerfort geweint und hast gejammert: Mein Herzkind, nun sind wir allein! Ach, Mami, ich wollte Papi käme nun endlich wieder, dass du wieder fröhlich wirst.“
Liselotte ahnte nicht, dass es von der Reise, die ihr Vater angetreten hatte, keine Rückkehr mehr gab. Sie wusste auch nicht, wie ihre kindlichen Worte der Mutter das Herz zerrissen. Der Vater hatte zu ihr gesagt, als er Abschied nahm, um eine notwendige Reise zu unternehmen:
„Ich komme bald wieder, Maus, sei hübsch artig und lieb.“
Nun, sie war artig gewesen und hielt sich an das Versprechen des Vaters. Dass er bald darauf, fern von Weib und Kind, den Tod gefunden, hatte man Liselotte nicht gejsagt. Sie hätte es auch nicht verstanden.
Maria hielt nur mühsam ihre Tränen zurück. Sie sprach schnell von etwas anderem, um das Kind abzulenken.
„Nun komm, Maus, jetzt wollen wir dich schnell waschen und ein Kleidchen anziehen. Hast du nicht Hunger?“
„Ja, sehr. Bekomme ich Milch und Brötchen?“
Gewiss, sobald du fertig bist. So, Schuh und Strümpfchen hast du schon an.“
Liselotte sprang von ihrem Bettchen herab.
Jetzt erblickte sie den Apfelbaum am Fenster. Jubelnd streckte sie die Händchen danach aus.
„Schau, Mami, wie schön, da wächst uns ein Baum in das Zimmer!“
„Ja, Liselotte, ein Apfelbaum.“
„Ein Apfelbaum? Ach, was sind da für winzige Aepfel dran — und so viele, viele!“
„Die werden alle noch grösser wachsen, sollst sehen.“
Liselotte kletterte schnell auf den Sessel am Fenster und sah hinaus in den schönen grossen Obstgarten mit den weiten Rasenplätzen. Gleich hinter dem Garten begann der Wald und auf der anderen Seite sah man die roten Ziegeldächer des Dörfchens liegen.
„Ach Mami, Mami, schau doch — der schöne grosse Garten. Und da ist auch eine grüne Laube! Dürfen wir da hineingehen?“
„Ich will unsere Wirtin fragen. Aber nun komm, dass du fertig wirst. Wir wollen hinaus in die warme Sonne!“
Liselotte liess sich nun willig ankleiden. Die Mutter zog ihr ein schlichtes Leinenkittelchen an und eine Schürze darüber. Dann gingen sie hinunter.
Frau Martha Schulz empfing sie am Fusse der Treppe im Hausflur und aus einer Tür lugte der flachsblonde Kopf Heinrichs.
Die Wirtin erkundigte sich freundlich, wie ihre Gäste geschlafen hatten, und plauderte lebhaft mit der kleinen Liselotte.
Heinrich konnte es sich nicht versagen, herbeizukommen und auch einige Worte an Liselotte zu richten. Dabei staunte er Mutter und Tochter wie ein Wunder an.
Maria Hochberg fragte die Wirtin, ob sie wohl mit ihrem Kinde in den Garten gehen könne.
„Aber ja, Frau Hochberg, ich habe schon in der Laube den Frühstückstisch decken lassen. Sie können alle Mahlzeiten dort einnehmen, da sind Sie ganz ungestört. In den Teil des Gartens kommt ausser mir und meinen Leuten kein Mensch. Die kleine Liselotte kann da auf den Rasenplätzen spielen, so viel sie will.“
Das war Maria Hochberg sehr angenehm. Und so nahm sie in Zukunft alle Mahlzeiten in der Laube ein. Stets war der Tisch sauber gedeckt und Heinrich stellte immer ein Sträusschen in einem Wasserglas auf den Tisch.
Auch sonst sass Maria viel in der kleinen hübschen Laube. Zuweilen leistete ihr Frau Martha ein Stündchen Gesellschaft und erzählte ihr allerlei aus dem Dorf und aus dem Schlosse. Oder sie sass allein mit einem Buche oder einer Handarbeit. Liselotte spielte dann auf dem grossen Rasenplatz und durfte an warmen Tagen zu ihrer Wonne barfuss in dem weichen Rasen laufen.
Die Bewohner der „Weissen Taube“ hatten die kleine Liselotte fest ins Herz geschlossen. Heinrich schnitzte abends in seinen Mussestunden aus Holz allerlei Spielzeug für sie, die Köchin bereitete ihr kleine Leckerbissen und wurde ganz erfinderisch, sie so anzurichten, dass ein Kinderauge sich daran ergötzen konnte. Hanne, das Hausmädchen, wusch Puppenwäsche mit ihr und spannte ihr im Garten eine niedrige Leine auf, damit sie die zierlichen Sächelchen selbst aufhängen konnte, und Frau Martha zeigte ihr die jungen Hühnchen und die bunte Kuh, von der Liselotte täglich die köstliche, frische Milch bekam. Es drehte sich in der „Weissen Taube“ jetzt alles um Maria Hochberg und ihre kleine Tochter.
Und die blasse junge Frau dankte mit einem rührenden Lächeln für jede kleine Aufmerksamkeit. Heinrich hätte für dieses Lächeln freudig die schwersten Arbeiten vollbracht.
Sonst lebte Maria ganz still und zurückgezogen.
Die Bauern aus dem Dorfe waren gewohnt, dass sich die Sommerfrischler, die in der „Weissen Taube“ logierten, zuweilen zu ihnen gesellten und ein Spässchen mit ihnen machten. Maria Hochberg aber ging mit gesenktem Kopf an ihnen vorüber und erwiderte nur stumm die Grüsse der ihr Begegnenden.
Das missfiel den Bauern sehr. Sie forschten die Wirtin nach ihrem Gaste aus und erfuhren, dass sie nur eine arme Witwe sei, die darauf angewiesen war, sich ihr Brot zu verdienen, und nur erst Kräfte dazu sammeln wollte. Die Bauern von Bodenhausen waren meist wohlhabende Leute. Der fruchtbare Boden brachte ihnen reiche Ernten. Und sie schlugen protzig auf ihre Taschen, in denen die harten Taler klapperten, und stiessen sich an und redeten von „Bettelstolz“, wenn Maria stumm an ihnen vorüberging.
Vor Frau Martha durfte man das freilich nicht laut werden lassen. Die hielt grosse Stücke auf ihre Mieterin und hätte ihnen den Standpunkt energisch klar gemacht. Aber im ganzen Dorfe sprach es sich herum, die junge Frau, die in der „Weissen Taube“ wohne, sei eine „Gespreizte“, sie sei vom Bettelstolz besessen und gönne keinem Menschen Wort und Blick.
Das drang sogar bis ins Schloss zur Dienerschaft. Und die Lakaien, die nur ganz allein das Recht zu haben glaubten, stolz zu sein, sahen hochnäsig auf die schwarzgekleidete Frau, wenn sie ihr begegneten.
Maria ahnte nicht, dass man sie für stolz und hochmütig hielt. Sie hatte sich so in ihr Leid vergraben; dass sie nur wenig auf ihre Umgebung achtete.
Klein Liselotte fühlte sich glückselig, in Bodenhausen. Der grosse Obstgarten war ihr Königreich. Er lag längs der Fahrstrasse, die durch das Dorf nach dem Schlosse führte. Man konnte durch den weiss- und grüngestrichenen Lattenzaun alles sehen, was auf der Dorfstrasse passierte. Eine schmale Tür im Zaun führte direkt auf die Strasse. Liselotte unterhielt sich köstlich, wenn sie auf die Strasse blickte. Da fuhren allerlei Wagen vorüber, der Kuhhirt trieb seine Herde vorbei und der Gänsejunge führte die schnatternden Zweibeine auf die Weide. Und die Bauern schritten Sonntags mit ihren Frauen im schönsten Festputz zur Kirche, oder gingen in der Woche mit Harke und Sense auf das Feld hinaus.
Am meisten interessierte sich Liselotte jedoch für die Equipage aus dem Schlosse, die täglich einige Male vorüber fuhr. Manchmal ritt auch der Herr Baron von Bodenhausen mit seiner Gemahlin auf schönen; schlanken Pferden vorbei und zwischen ihnen auf einem hübschen Pony Junker Hans.
Zuweilen sass aber der Junker neben seiner kleinen Schwester, der Baroness Lori in der Equipage.
Frau Martha hatte erzählt, dass Junker Hans und Baroness Lori die einzigen Kinder des Barons waren, der in Schloss Bodenhausen wohnte. Der Junker zählte bereits dreizehn Jahre, die kleine Baroness aber war, wie Liselotte, fünf Jahre alt.
Liselotte interessierte sich brennend für die beiden Kinder. Wie gern hätte sie mit dem kleinen Mädchen aus dem Schloss gespielt. Jeden Tag wartete sie auf den Augenblick, wo die Equipage auftauchte, und sah dann mit grossen leuchtenden Augen zu den Kindern hinüber, winkte ihnen auch manchmal zu.
An einem heissen Sommertag stand sie wieder wartend an der schmalen Pforte im Zaun. Sie war barfuss und hatte gepflanzt und gegraben auf einem kleinen Beet, das ihr Heinrich zurecht gemacht hatte. Ihre Händchen und ihre Schürzchen zeigten die Spuren ihrer Arbeit, und die dunklen Locken hingen ein wenig zerzaust um das glühende Gesichtchen.
Sie wusste, dass der Wagen aus dem Schlosse bald kommen musste und stand nun sehnsüchtig wartend da.
Endlich kam er heran und jubelnd winkte Liselotte den beiden Kindern zu, die mit der Erzieherin der kleinen Baroness im Wagen sassen. Zu Liselottes Freude fuhr dieser heute einmal sehr langsam.
Junker Hans lachte über den drolligen Anblick des kleinen Barfüsschens und nickte ihm mit freundlichem Gesicht zu. Aber seine kleine Schwester, die wie eine kleine Dame im Fond lehnte, sah hochmütig auf sie herab und sagte entrüstet:
„Pfui Hans — lass doch das barfüssige, schmutzige Bettelkind.“
Klein Liselotte verstand diese Worte nicht. Sie lachte und winkte und freute sich, dass der Junker ihr zugenickt hatte. Und als der Wagen verschwunden war, eilte sie zu ihrer Mutter, die in der Laube sass und nähte.
„Oh Mami, sie sind wieder vorbeigefahren, das kleine Mädchen und der liebe, grosse Junge. Er hat mir zugenickt und gelacht. Warum fahren sie nur immer vorüber? Sie sollen halten und mit mir spielen. Ich will es so gern.“
Maria nahm ihr Kind auf den Schoss und sagte mit mattem Lächeln:
„Ei, wie werden sie sich über das kleine schmutzige Barfüsschen gewundert haben! Da schau die Händchen an! Sie sind voll Erde. Und das Schürzchen so nass und schmutzig. Da spielt niemand mit dir, der sich sauber hält. Komm, mein kleines Barfüsschen, wir müssen dich schnell sauber machen.“
Liselotte sah an sich herab und betrachtete ihre Hände.
„Ja — sie sind doll schmutzig, aber ich habe doch auch Blümchen gepflanzt in meinem Garten.“
Willig ging sie mit der Mutter ins Haus und liess sich sauber machen. Dabei plauderte sie immer noch aufgeregt von dem kleinen Mädchen im weissen Kleide und von dem lieben, grossen Jungen. —
Am nächsten Tage dehnte Maria Hochberg ihren Spaziergang im Walde mit Liselotte etwas weiter aus als sonst. Und plötzlich tauchte vor ihnen ein Parkgitter auf, hinter dem sie von fern Schloss Bodenhausen liegen sahen.
Liselotte hatte auf dem Wege Blumen gepflückt, die sie fest in ihren Händchen hielt.
Mutter und Tochter gingen langsam am Parkgitter entlang und nach einer Weile erblickten sie drinnen auf einer Parkwiese Junker Hans und Baroness Lori beim Reifenspiel.
Liselotte jauchzte auf und eilte dicht an das Gitter heran.
„O, Mami, sieh doch, da ist ja das kleine Mädchen im weissen Kleide und der liebe grosse Junge. Ich will mit ihnen spielen!“ rief sie der Mutter zu.
Und den beiden Kindern im glühenden Eifer zuwinkend, rief sie froh:
„Da bin ich, lasst mich mit euch spielen!“
Die kleine Baroness sah mit verächtlicher Miene herüber und wandte sich dann auffällig ab. Junker Hans stand halb lachend, halb verlegen, er wusste nicht, was er tun sollte. Sein gutes Herz sträubte sich, der Kleinen wehe zu tun, und doch sah er ein, dass man ihren Wunsch nicht erfüllen konnte. Während er noch im Kampf mit sich selber unschlüssig herüber sah, streckte Liselotte die Hand mit den Blumen durchs Gitter.
„Liebes, kleines Mädchen, da nimm meine schönen Blumen, ich schenke sie dir!“ rief sie mit ihrem lieben, weichen Stimmchen.
Aber Baroness Lori machte nur eine verächtliche Bewegung und sah so recht hochmütig auf die blonde Frau im schlichten, schwarzen Kleide, die nicht einmal einen Hut trug, und auf die bittende Liselotte. Sie hatte von den Dienstboten im Schlosse aufgeschnappt, dass die Fremde, die im Gasthof zur „Weissen Taube“ wohnte, eine arme Witwe sei, die sich Gott weiss was einbilde und sich grosstue.
Spöttisch mass sie Mutter und Kind und warf hochmütig den Kopf zurück. Sie wollte dem Bettelpack schon zeigen, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollte.
Liselotte konnte nicht verstehen, dass das kleine Mädchen nicht antwortete.
„Nimm du die Blumen, lieber, grosser Junge,“ bat sie ganz verzagt.
Junker Hans vermochte kaum dem flehenden, weichen Stimmchen zu widerstehen. Er war nicht so hochmütig wie sein Schwesterchen. Die Kleine gefiel ihm wohl und tat ihm leid. Sie meinte es gewiss gut. Er gab sich einen Ruck mit einem Blick auf seine Schwester und wollte schon zu Liselotte herangehen, um ihr einige freundliche Worte zu sagen. Da rief Lori mit schriller Stimme verächtlich:
„Lass doch, Hans, geh nicht hin! Das ist ja die barfüssige Bettelprinzess!“ Junker Hans wurde dunkelrot. Er schämte sich vor der Schwester und sah verlegen zu der blassen, blonden Frau hinüber, die herankam, um Liselotte fortzuholen. Etwas in den Augen dieser Frau wollte ihn bannen. Aber nach Jungenart schüttelte er trotzig den fremden Einfluss ab, wandte sich ebenfalls um und lief mit der Schwester tiefer in den Park hinein. Er schämte sich und wollte es sich doch nicht eingestehen.
Liselotte blickte ganz betrübt zur Mutter empor, als könne sie das nicht fassen.
„Sie wollen meine Blumen nicht, mögen nicht mit mix spielen, Mami!“ Maria Hochberg nahm ihr Kind empor und herzte und küsste es. In ihren Augen lag ein seltsam herber Ausdruck.
„Meine arme kleine Bettelprinzess,“ flüsterte sie mit wehem Herzen. Dann führte sie ihr Kind davon und suchte es abzulenken von diesem Erlebnis, das sich so tief in die Kinderseele eingeprägt hatte.
„Ist mir der liebe Junge böse, Mami?“
„Nein, mein Herzkind,“ tröstete die Mutter.
„Wird er mit mir spielen?“
Maria seufzte.
„Du weisst doch, meine Liselotte, das hohe Gitter war zwischen euch. Er konnte nicht zu dir und du nicht zu ihm.“
Liselotte wusste noch nicht in ihrem unschuldsvollen Kinderherzen, dass ein hohes, festes Gitter Menschen verschiedener Stände voneinander scheidet und dass auch sie, die arme kleine Bettelprinzess, solch ein Gitter von den Kindern des vornehmen Barons Bodenhausen trennte.
* * *
Jetzt müssen wir unsern lieben jungen Leserinnen erst etwas erzählen, was sich einige Zeit vor dem Eintreffen der kleinen Liselotte mit ihrer Mutter in der „Weissen Taube“ zugetragen hatte.
In einem wunderschönen, alten Schlosse, das stolz und imposant auf einem hohen, bewaldeten Berge lag, wohnte Graf Armin von Hochberg-Lindeck. So alt und vornehm sein Geschlecht war, so stolz war Graf Armin darauf, und sein höchstes Bestreben war stets gewesen, dass nicht ein leiser Schatten auf seinen Stammbaum fiel.
Er bewohnte jetzt das riesengrosse Schloss ganz allein mit seiner Gemahlin, der Gräfin Katharina und der zahlreichen Dienerschaft. Bis vor sechs Jahren war im Schloss Hochberg immer reges, festliches Treiben gewesen. Zahlreiche vornehme Gäste kamen und gingen, und es wurden grosse Jagden abgehalten und glänzende Feste gefeiert. Hauptsächlich geschah das, wenn der junge Graf Botho, der einzige Sohn des Grafen Armin, auf Urlaub zu Hause war. Er war Offizier bei einem der vornehmsten Regimenter. Nach Schloss Hochberg wurden auch nur vornehme Gäste aus alten Adelsgeschlechtern geladen. Graf Armin war Vollblutaristokrat, bei ihm fing der Mensch erst beim Freiherrn an. Was darunter war, galt ihm nichts.
Der junge Graf Botho war gar nicht nach seinem Vater geraten, sondern nach seiner milden, gütigen Mutter, die alle Menschen gleich gelten liess, wenn sie nur ein edles Herz hatten. Das durfte sie aber ihrem adelsstolzen Gemahl nicht merken lassen, und sie musste sich beugen unter seinen despotischen Willen.
Graf Armin wollte seinen Sohn durchaus mit einer ebenso vornehmen, jungen Aristokratin verheiraten, die dieser aber nicht leiden mochte. Trotzdem der Vater allerlei Feste veranstaltete, um Graf Botho mit der jungen Reichsgräfin zusammen zu bringen, wich dieser ihr aus, wo und wie er konnte. Und eines Tages gestand er seinem Vater, dass sein Herz schon lange einer armen, bürgerlichen Waise gehöre, die er in seiner Garnison kennen gelernt hatte. Er bat den Vater flehentlich, zu gestatten, dass er sie zu seiner Frau machen dürfe. Einer anderen Frau würde er niemals seine Hand reichen. Graf Armin war ausser sich. Er wollte nichts von dieser Heirat hören und verbot seinem Sohne jeden wei teren Verkehr mit der Waise.
Graf Botho war aber auch ein Mann mit festem Willen. Er weigerte sich, dieses Verbot anzuerkennen, und versicherte, dass er nie und nimmer von dem Mädchen lasse, das bereits seine Braut sei.
Es kam zu schlimmen, erregten Szenen zwischen Vater und Sohn, die auch die gütige Mutter mit allem guten Willen nicht ausgleichen konnte. Zwei harte Köpfe standen sich gegenüber, und keiner wollte nachgeben.
Graf Botho reiste damals ab, und wider Willen seines Vaters verheiratete er sich kurz darauf mit der armen Waise. Graf Armin aber sagte sich von Stund an los von seinem Sohne und erklärte, er sei tot für ihn, denn er habe seinen stolzen Namen durch diese Missheirat befleckt.
Seit jener Zeit lag Schloss Hochberg einsam und verlassen. Es kamen keine Gäste mehr ins Haus. Graf Armin grollte und haderte nicht nur mit seinem Sohne, sondern auch mit der ganzen Welt. Seine Gemahlin hatte einen schweren Stand mit ihm. Sie hätte so gern für ihren Sohn gebeten, aber ihr Gemahl verbot ihr jeden Verkehr mit ihm und litt nicht einmal, dass sie seinen Namen nannte.
Da Graf Armin seine Hand von dem Sohne gezogen hatte, musste dieser ein sehr bescheidenes Leben führen. Seinen Abschied als Offizier hatte er bereits genommen. Trotzdem lebte er sehr glücklich mit seiner jungen Frau, die ihm bald ein Töchterchen schenkte. Nur eins bedrückte ihn immer wieder — dass sein Vater ihm unversöhnlich grollte. Er hatte gehofft, dieser würde sich der vollendeten Tatsache fügen und ihm eines Tages verzeihen. Aber all sein Bitten blieb wirkungslos. Nur einmal antwortete ihm der Vater auf all seine flehenden Briefe. Es waren nur wenige Worte: „Löse die Bande, die dich an die Frau fesseln, die dir nicht ebenbürtig ist, dann will ich dich wieder als meinen Sohn aufnehmen. Sonst bist du tot für mich.“
Graf Botho liebte seine Frau aber viel zu sehr, um je in eine Trennung von ihr zu willigen. Und deshalb blieb alles beim alten.
So lagen die Verhattnisse bis wenige Monate vor dem Beginn unserer Geschichte. Nun hatte aber Graf Botho einen guten, ehrlichen Freund, den Baron Rainau, dessen Besitzungen an die des Grafen Armin von Hochberg-Lindeck grenzten. Er hatte mit Graf Botho zusammen in einem Regiment gedient und kannte auch flüchtig die junge Frau desselben, deren Güte und Schönheit ihn verstehen liess, dass der Freund alles um diese Frau aufgegeben hatte. Baron Rainau hatte auch den Abschied genommen, hatte sich verheiratet und lebte nun auf seinen Gütern. Gar zu gern hätte er dem Freund geholfen, sich mit dem Vater auszusöhnen. Er versuchte alles mögliche, Graf Armin milder zu stimmen, jedoch ohne Erfolg. Schliesslich empfing ihn der alte Herr gar nicht mehr.
Aber Baron Rainau gab die Hoffnung noch nicht auf. Eines Tages schrieb er an den Freund:
„Lieber Botho! Leider kann ich bei Deinem Vater nichts mehr für Dich tun, er nimmt meine Besuche nicht an. Nur Deine Mutter sehe ich zuweilen auf einen Augenblick. Von ihr soll ich Dir sagen, dass sie Dich unentwegt von Herzen liebt und nie die Hoffnung aufgeben wird, dass Dein Vater eines Tages Erbarmen haben wird. Sie hofft, dass es vielleicht von Nutzen sein könnte, wenn Du plötzlich vor Deinem Vater ständest und ihn um Verzeihung anflehtest. Und so haben wir einen Plan geschmiedet. Komme, sobald es möglich ist, auf einige Zeit nach Rainau als mein Gast. Ich habe ohnedies Sehnsucht nach Dir, und ein frischfröhlicher Pürschgang im Wald wird Dir gut tun. Die Hauptsache aber ist, dass Du eine Begegnung mit Deinem Vater herbeiführst. Er geht jetzt stets allein auf die Jagd, höchstens der alte Förster darf ihn begleiten, und der ist Dir treu ergeben und wird von der Bildfläche verschwinden, wenn es not tut. Stehst Du Deinen Vater erst einmal wieder gegenüber, da müsste er doch von Stein sein, wenn er Dir nicht verzeiht. Deine verehrungswürdige gute Mutter, die unter der Trennung von Dir sehr leidet, hofft sehnlichst auf Dein Kommen. Also schreib mir, wenn ich Dich erwarten darf. Empfehle mich Deiner Frau Gemahlin. Ich hoffe, sie schickt Dich schnell zu mir. Der Tag, da Du mit Weib und Kind in Hochberg einziehst, wird ein Glückstag sein für
Deinen Freund Herbert Rainau.“
Graf Botho zeigte den Brief seiner jungen Frau. Diese war in allem Glück doch sehr betrübt, dass sie Schuld trug an dem Zerwürfnis ihres Gatten mit seinem Vater. Sie hatte ihn aber zu sehr geliebt, um von ihm lassen zu können.
Nun redete sie ihm dringend zu, die Einladung des Barons Rainau anzunehmen und zu versuchen, den Vater zu versöhnen, damit auch dieser Schatten von ihrem Glück genommen würde. So sagte er zu.
Nach einem zärtlichen, innigen Abschied von Weib und Kind reiste Graf Botho ab.
Es kam dann auch wirklich zu einer Begegnung zwischen Vater und Sohn im Walde. Heimlich war seine Mutter vorher nach Rainau gekommen, um den Heissgeliebten Sohn wiederzusehen. Sie vermochte sich nachher kaum von ihn zu trennen. Auf ihren Wunsch gab er ihr eine Photographie seiner Frau und seines Kindes, die er bei sich trug. Ein Bild wollte sie wenigstens von ihrer Enkelin haben. Und als sie das liebe, schöne Antlitz ihrer Schwiegertochter sah, verstand sie den Sohn. Um solch eine Frau konnte ein Mann alles aufgeben.
Gräfin Katharina verriet dann dem Sohne, dass der Vater am nächsten Tage einen Hirsch schiessen wollte. Da sollte er versuchen, ihn zu sprechen.
Vater und Sohn trafen am nächsten Tag zusammen. Graf Botho flehte den Vater in herzbewegenden Worten an, ihm zu verzeihen und ihn in Gnaden wieder aufzunehmen. Aber Graf Armin schien wirklich wie von Stein. Er blieb dabei, dass er die unebenbürtige Heirat seines Sohnes nicht anerkenne, und dass er dem Sohn nur verzeihen und ihn wieder aufnehmen werde, wenn er sich von der bürgerlichen Frau lossage.
„Du kannst sie ja mit Geld abfinden,“ sagte er schroff.
Graf Boto verlor nun seine Ruhe.
„Wie wenig kennst du meine Frau, wenn du meinst, dass sie mit schnödem Gelde abzufinden sei. Entweder du heisst auch sie an meiner Seite willkommen, mit meinem Kinde, oder ich muss dem Vaterhause fernbleiben,“ sagte er erregt.
„So bleibe fern — ich habe dich nicht gerufen,“ erwiderte Graf Armin hart und wandte sich zum Gehen.
„Vater, ist das dein letztes Wort?“ rief ihm der Sohn schmerzlich nach.
„Mein letztes. Ich habe keinen Sohn mehr, wenn er nicht allein zu mir zurückkommt.“
Damit war Graf Armin zwischen den Bäumen verschwunden. Ganz so ruhig und steinern, wie er schien, war er aber doch nicht. Aber er wollte seinen Willen durchsetzen. Niedergeschlagen kehrte Graf Botho nach Rainau zurück.
„Mein Vater ist unerbittlich,“ sagte er zu dem Freunde.
Dieser suchte ihn zu trösten, so gut es ging.
„Verzage noch nicht. Deine Mutter wird schon deine Sache führen, wenn dein Vater etwas ruhiger geworden ist. Die Zeit wird ihn auch milder stimmen. Wir versuchen es später noch einmal,“ sagte er.
Graf Botho wollte sofort wieder abreisen, aber der Freund liess ihn nicht fort.
„Du bleibst noch einige Tage. Mein Förster hat einen kapitalen Sechzehnender auf den Rohre. Morgen wollen wir ihm zu Leibe gehen.“
Als Graf Rainau das gesagt hatte, liess sich eben sein Förster melden und berichtete zornig und aufgeregt, dass die im Forste seit einiger Zeit hausenden Wilderer den Sechzehnender weggeschossen hätten. Der Baron war wütend.
„Jetzt lasse ich mir Tag und Nacht keine Ruhe, bis ich die Kerle ertappt habe. Sie schiessen mir frech und ungeniert das beste Wild vor der Nase weg,“ sagte er.
Graf Botho erbot sich, den Wilderern ebenfalls mit aufzulauern.
Das geschah dann auch. Die beiden Herren und der Förster bezogen Wachtposten im Walde. Es kam zu einem Zusammenstoss mit den Wilddiehen. Dieser Zusammenstoss fand statt an der Grenze zwischen Hochberger und Rainauer Gebiet, nicht weit entfernt vom Schloss Hochberg. Es gab einen Kampf auf Tod und Leben — und die Kugel eines Wilderers durchbohrte Graf Botho das Herz. Was half es nun, dass sie einen der Wilddiebe gefangen hatten? Es war nicht einmal der, welcher den Schuss auf Graf Botho abgegeben hatte.
Während der Förster den gefangenen Wilddieb davonführte und die andern entflohen, brachte Baron Rainau, bis ins Innerste erschüttert, die Leiche seines Freundes mit einigen Wildhütern nach Schloss Hochberg.
Es war im Morgengrauen, alles schlief noch im Schloss, man musste die Bewohner wecken.
Als man den Toten in der grossen Schlosshalle niedergelegt hatte, erschien die Gräfin Katharina, im Nachtgewand und ganz verstört.
Ohnmächtig brach sie über der Leiche ihres Sohnes zusammen.
Auch Graf Armin kam herbei. Seine hohe Gestalt schwankte, und sein Antlitz glich selbst dem eines Toten — aber er verlor die Haltung nicht vor all den Leuten, die ihn umgaben.
Welchen Kampf er später in der Stille seines Zimmers mit sich ausgefochten hatte, das erfuhr nie ein Mensch.
Gräfin Katharina lag bewusstlos in schwerer Krankheit, als man die Leiche ihres Sohnes in der Gruft der Schlosskapelle beisetzte.
Niemand ausser dem Baron Rainau dachte in dieser schrecklichen Zeit an die junge Gräfin Hochberg-Lindeck, die nun Witwe geworden war. Er wäre am liebsten selbst zu ihr geeilt, um ihr das Unglück schonungsvoll zu melden. Aber er konnte nicht abkommen, da die eingetroffenen Gerichtspersonen seine Anwesenheit unerlässlich fanden. So schrieb er an die junge Gräfin, so schonungsvoll er konnte, und fragte an, was er für sie tun könne. Gräfin Katharina sei schwer erkrankt und ohne Bewusstsein, und Graf Armin weigere sich selbst an der Leiche seines Sohnes, sie und ihr Kind anzuerkennen. Sie möge ihm mitteilen, was er für sie tun können.
Erst nach einigen Wochen bekam Baron Rainau auf diesen Brief eine Antwort.
Diese lautete:
„Sehr geehrter Herr Baron!
Erst heute bin ich imstande, Ihnen auf Ihren Brief zu antworten und Ihnen für Ihre Güte zu danken. Wenn Sie mir nicht den Tod meines unvergesslichen, teuren Gatten gemeldet hätten, so hätte ich wohl seinen Tod erst aus den Zeitungen erfahren. Ich konnte bisher nicht schreiben, weil ich wie von Sinnen war, nicht fähig, einen Gedanken zu fassen — Sie wissen ja — wie wir einander geliebt haben. Aber nicht von meinem Leid will ich sprechen — das ist unaussprechlich tief und schwer. Dass Graf Armin auch jetzt noch sich weigert, mein Kind und mich anzuerkennen, nimmt mich nicht wunder. Warum sollte en es auch jetzt noch tun? Wenn er sich nicht aus Liebe zu seinem Sohne entschliessen konnte, uns anzuerkennen, so hat er jetzt keine Veranlassung dazu. Wir sind ihm fremde, lästige Menschen, nichts weiter. Mein und meiner Tochter Schicksal wird in Zukunft ganz losgelöst sein von Graf Armin. Es schmerzt mich qualvoll, dass es mir nicht einmal vergönnt ist, am Grabe meines geliebten Mannes zu beten. Aber ich muss es verwinden, Graf Armin würde mich wie eine Bettlerin von der Tür weisen, wenn ich ihn darum bitten wollte. Und so muss ich mich fügen. Ich trage das Bewusstsein in mir, dass die Seele meines geliebten Toten überall bei mir sein wird, dass wir auch über den Tod hinaus unzertrennlich sind.
Ich muss leben — um meines Kindes willen — wenn es mich auch unsäglich schwer dünkt. Und ich werde leben, werde für mein Kind und mich arbeiten, wie ich es früher nur für mich getan. Deshalb danke ich Ihnen für Ihr freundliches Anerbieten, das, wie ich weiss, aus ehrlichem Herzen kommt. Aber Graf Bothos Frau darf kein Almosen annehmen und ist auch zu stolz, es zu tun. Sorgen Sie sich nicht um uns. Vorläufig besitze ich noch genug, um zu leben. Auch einen Notgroschen werde ich haben. Ich will irgendwo in Stille und Einsamkeit untertauchen und um den Frieden meiner qualzerrissenen Seele ringen. Den Grafentitel werde ich nicht mehr führen, er passt nicht zu meiner bescheidenen Existenz, und Graf Armin soll nicht zu fürchten brauchen, dass eine Gräfin Hochberg-Lindeck ums Brot arbeiten muss. Dies alles schreibe ich Ihnen, sehr geehrter Herr Baron, ehe ich die Schiffe hinter mir verbrenne.
Ich danke Ihnen für die treue Freundschaft, die Sie meinem geliebten Gatten allezeit bewiesen haben. Sie sollen sich nicht, wie Sie mir schrieben, einen Vorwurf machen, dass Sie Botho nach Rainau einluden. Wir sind alle hilflose Werkzeuge einer himmlischen Macht, die unsern Weg bestimmt. Und Sie haben es gut gemeint. Dafür danke ich Ihnen herzlich.
Wenn Sie an die Gruft meines geliebten Mannes gehen können, so legen sie bitte die beiden Rosen zu seinen Füssen nieder mit einem stillen Gruss von Tochter und mir, die ich Ihnen zugleich sende. Wir haben sie bei einem Gärtner selbst gepflückt und sie an unsere Lippen, an unsere Herzen gedrückt. Sind sie auch welk geworden, bis sie ihr Ziel erreichen — unsere Liebe bleibt frisch und stark, die mit ihnen geht. Nehmen Sie meinen herzlichen Dank im voraus und leben Sie wohl — für immer.
Ihre Maria Hochberg.“
Bald nachdem Baron Rainau diesen Brief erhalten hatte, konnte er sich für einige Tage losmachen und beeilte sich, Bothos Witwe aufzusuchen. Er hoffte, sie zu bestimmen, eine Hilfe anzunehmen von ihm oder von der Gräfin Katharina, die sicher nach ihrer Genesung wünschen würde, in aller Stille etwas für ihre Schwiegertochter und ihre Enkelin zu tun.
Aber er kam schon zu spät. Die junge Gräfin war mit ihrem Kinde abgereist, niemand musste, wohin. In ihrer Wohnung hielten schon fremde Mentschen ihren Einzug. Er konnte nur in Erfahrung bringen, dass sie ihre Möbel an einen Händler verkauft hatte. Baron Reinau kehrte betrübt nach Hause zurück. Er hätte so gern etwas für die junge Gräfin und ihr Kind getan. Aber er konnte auch ihren Stolz verstehen. Er konnte sich jedoch nicht versagen, der Gräfin Katharina später den Brief der jungen Frau zu übergeben.
Vorläufig war die Gräfin allerdings noch schwer krank, sie genas nur sehr langsam. Und ihr schwacher Wille schien durch die Krankheit vollends gebrochen zu sein. Stumm lebte sie neben ihrem Gemahl dahin. Sie fühlte freilich, dass dieser auch innerlich darunter litt, dass er den einzigen Sohn in der Blüte seiner Jahre verloren hatte. Aber er gab die Schuld an allem, was geschehen war, der Frau, die ihm den Sohn abtrünnig gemacht hatte. Wenn dieser nicht gegen seinen Willen diese Ehe geschlossen hätte, dann wäre alles anders gekommen. Davon war er nicht abzubringen.
Nie durfte seine Gemahlin wagen, ein gutes Wort einzulegen für die Witwe und die Tochter seines Sohnes. Graf Armin redete sich in einen wahren Hass gegen die beiden Menschen, die ihm doch jetzt nach dem Tode seines Sohnes nach seiner Gemahlin die nächsten hätten sein müssen. Gräfin Katharina aber sass manch liebes Mal in der Stille ihrer Gemächer und las den rührenden Brief, den ihre Schwiegertochter an Baron Reinau geschrieben hatte. Und tränenden Auges sah sie dann herab auf das Bild, das ihr der Sohn beim letzten heimlichen Wiedersehn geschenkt hatte, das Bild seiner Frau und seiner Tochter.
Sehr betrübt war sie, als sie nach ihrer Genesung von Baron Reinau erfuhr, dass ihre Schwiegertochter und ihre Enkelin verschwunden waren. So gern hätte sie im Stillen etwas für die beiden getan. Ach, wie gern hätte sie sich aufgemacht, um nach ihrem Enkelchen zu suchen. Aber der strenge Wille ihres Gemahls bannte sie an seine Seite. Sie konnte nichts tun als beten, dass Gott das harte Herz ihres Gemahls rühren möge.
* * *
Nun können wir wieder in das kleine Dörfchen Bodenhausen zurückehrer.
Seit mehreren Wochen weilte Maria Hochberg mit ihrer kleinen Tochter im Gasthof zur „Weissen Taube“. Die Ruhe und Stille taten ihren Nerven wohl, aber das Leid, das in ihrer Seele wohnte, wollte nicht zur Ruhe kommen.
Immer wieder sahen der lange Heinrich und die mitleidige Frau Martha Schulz, dass Marias Augen frühmorgens von den in der Nacht vergossenen Tränen gerötet waren. Sie konnten sich gar nicht genug tun, der Aermsten etwas zuliebe zu tun. Heinrich schob seine Mütze unruhig auf dem flachsblonden Haarschopf hin und her, wenn er ihre verweinten Augen sah und machte sich unbeholfen in ihrer Nähe zu tun, bis ein blasses, mattes Lächeln auf ihren Zügen erschien. Und Frau Martha quirlte heimlich ein frisches Eigelb in die Frühstücksschokolade, weil die junge Frau gar zu wenig ass.
Klein-Liselotte aber fühlte sich von Tag zu Tag wohler und heimischer in der „Weissen Taube“. Noch immer stand sie täglich am Gartenzaun und wartete auf den Wagen aus dem Schlosse. Glückstrahlend sah sie aus, wenn es ihr gelang, einen verstohlenen Gruss des Junker Hans zu erhaschen. Er winkte ihr auch immer lächelnd zu, wenn er auf seinem Pony vorüberritt. Dann war die hochmütige kleine Schwester nicht dabei, die ihn ausschalt, wenn er freundlich mit der „Bettelprinzess“ war.
Dieser Name, den Baroness Lori für Liselotte aufgebracht hatte, war durch die Dienerschaft aus dem Schlosse bald im ganzen Dorf verbreitet. Frau Maria nannte man Bettelkönigin und Liselotte Bettelprinzess.
Der lange Heinrich und Frau Martha Schulz durften das freilich nicht hören. Die wären wohl beide mit einer geharnischten Strafpredigt auf denjenigen losgegangen, der es gewagt hätte, etwas gegen Maria Hochberg und ihr Kind zu sagen. Und Heinrich hätte dann kaum gezögert, seine derben Bauernfäuste energisch zu gebrauchen.
Maria ahnte nicht, dass die Leute im Schloss und im Dorfe so unzufrieden mit ihr waren. Sie tat niemand etwas zuleide, lebte nur still vor sich hin und wollte nichts als Ruhe.
Dann glaubte sie aber, nun lange genug die Hände in den Schoss gelegt zu haben. Sie schrieb an die grosse Firma, für die sie früher gearbeitet hatte, ob man ihr wieder Aufträge in Malereien geben wollte, die sie in Bodenhausen ausführen wollte. Sie bekam sofort zusagenden Bescheid. Die zarten, duftigen Blumenstücke, die sie zu malen verstand, waren sehr beliebt gewesen. Nun hatte Maria eine lange, ernste Unterredung mit der Wirtin. Sie sagte ihr, dass sie gern dauernden Aufenthalt in der Weissen Taube nehmen möchte, weil sie sich da nicht um die Wirtschaft zu kümmern brauche und den ganzen Tag ungestört malen könne. Ob ihr unter diesen Umständen Frau Martha Schulz den Pensionspreis noch etwas herabsetzen könne. Sie würde gern mit noch einfacherer Kost zufrieden sein.
Die gutmütige Wirtin freute sich, dass Maria mit dem Kinde für immer bleiben wollte. Sie hatte schon mit Schrecken an die Zeit der Trennung gedacht. Und sie wollte sich gewiss nicht an Maria bereichern.
„Meine liebe Frau Hochberg,“ sagte sie, mit Herzenstakt vermeidend, Maria zu demütigen, „wenn Sie das ganze Jahr bei mir wohnen wollen, dann kann ich Ihnen natürlich ganz andere Preise machen. Ob das Giebelstübchen leer steht oder ob Sie darinnen wohnen ist gleich. Sie machen uns so wenig Arbeit, dass wir Sie kaum merken. Und ich bin froh, dass ich so liebe Gesellschaft im Hause habe. Und wenn Sie gar noch mitessen wollen, was ich für mich und meine Leute koche, dann merken wir Sie kaum. Ich werde Ihnen also dann den Pensionspreis um die Hälfte nachlassen. Ist es so recht?“
Maria wollte das erst nicht annehmen, aber die Wirtin setzte ihr so überzeugend auseinander, dass sie dabei immer noch nicht zu kurz käme, dass Maria sich dankbaren Herzens fügte.
„Sie sind so gut zu mir, liebe Frau Schulz. Ich danke Gott, der mich in meiner Verlassenheit gerade zu Ihnen geführt hat,“ sagte sie bewegt.
Frau Martha hätte nun gleich vor Rührung losheulen können. Die junge Frau hatte in ihrem ganzen Wesen so etwas Hilfloses, Trauriges, dass es ihr immer ans Herz griff, wenn sie in die leidvollen jungen Augen sah.
Maria Hochberg schrieb nun wieder an die Firma und bat um Zusendung von Aufträgen.
Dann ging sie am nächsten Tage zum Pfarrer Helmers, der in dem kleinen freundlichen Pfarrhof neben der Kirche mit seiner Frau und zwei erwachsenen Töchtern wohnte. Sie hatte den alten Herrn und seine Gattin kennen gelernt, als sie Sonntags aus der Kirche kam.
Sie bat ihn um eine Unterredung. Er führte sie voll Freundlichkeit in sein Studierzimmer und fragte sie, womit er ihr dienen könne.