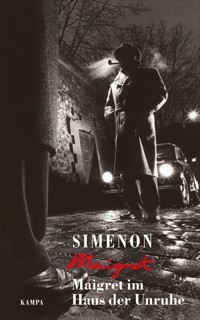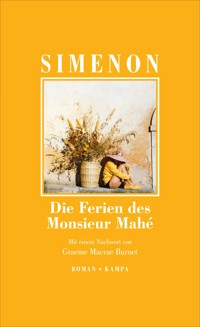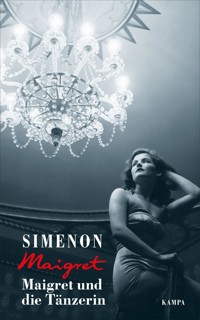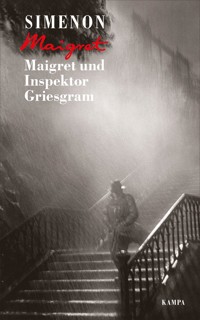10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die großen Romane
- Sprache: Deutsch
"Wer im 21. Jahrhundert erfahren will, wie im 20. Jahrhundert tatsächlich gelebt und gefühlt worden ist, muss Simenon lesen. Andere Autoren mögen mehr wissen über die Gesellschaft. Über den einzelnen Menschen weiß keiner so viel wie er." Georg Hensel Der wohlhabende Fischereibesitzer Jules Guérec überfährt mit seinem Wagen den kleinen Joseph Papin, einen Jungen aus seiner Nachbarschaft. Jules war in Gedanken gewesen, wie er seinen Schwestern bloß das fehlende Geld erklären sollte, mit dem er sich zuvor bei einer Prostituierten vergnügt hat. Zunächst weist kein Verdacht in seine Richtung. Doch geplagt von Gewissensbissen, sucht er bald auf auffällige Weise die Nähe von Josephs Familie. Grund genug, das Misstrauen von Jules' Schwester Céline zu wecken, die fortan alles daran setzt, Ruf und Vermögen der Familie Guérec zu retten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Georges Simenon
Die bösen Schwestern von Concarneau
Die großen Romane – Band 17
Aus dem Französischen von Ingrid Altrichter
Mit einem Nachwort von Markus Meyer
Atlantik
1
Es waren zu viele Kurven, und auch zu viele Steigungen und Gefällstrecken, nicht sehr lang, aber steil.
Und da war auch und vor allem das Problem mit den fünfzig Francs, das er, koste es, was es wolle, lösen musste, bevor er in Concarneau eintraf.
Nur: Jules Guérec kam nicht dazu nachzudenken, sich wenigstens fünf Minuten lang auf ein und dieselbe Sache zu konzentrieren. Eine Flut von Überlegungen lenkte ihn ständig ab, während er sich verkrampft und aufs äußerste angespannt gegen seinen Sitz stemmte, die Hände auf dem Lenkrad, den Blick starr nach vorn gerichtet.
Es war das erste Mal, dass er abends fuhr, bei Dunkelheit, und die aufgeblendeten Scheinwerfer des eigenen Autos beängstigten ihn. Schon deshalb, weil sie die Landschaft, die Dinge um ihn herum und sogar die Menschen bis zur Unkenntlichkeit verwandelten. So hatten sie in der letzten Wegbiegung ein Fuhrwerk mit zwei massigen Gäulen samt dem Bauern, der mit der Peitsche in der Hand nebenherging, in ihr fahles Licht getaucht, und dieser alltägliche Anblick hatte plötzlich nahezu dämonische Züge angenommen.
Das Fernlicht seiner Scheinwerfer machte ihm auch deshalb Angst, weil er es ausschalten oder wenigstens abblenden musste, sobald ihm ein anderes Auto begegnete, und er fürchtete, er könnte den Knopf ganz herumdrehen und einen Augenblick lang völliger Finsternis ausgesetzt sein.
Dabei raste zwischen Concarneau und Quimper ein grässlicher Linienbus hin und her, der mindestens ein Auto pro Woche zuschanden fuhr, und Guérec zählte die Minuten, während er sich fragte, ob er die kurvenreiche Strecke schon hinter sich haben würde, ehe er ihm in die Quere kam.
Wie sollte er unter diesen Umständen an die fünfzig Francs denken? Er würde sagen … Er könnte sagen, er habe Freunde auf ein Glas eingeladen, aber seine Schwestern wussten genau, dass man keine fünfzig Francs vertrank, auch nicht zu fünft oder sechst …
Obendrein hatte er vergessen, die schwarze Wolle zu kaufen, um die Françoise ihn gebeten hatte …
Er meinte jeden Augenblick das Getöse des Autobusses zu hören. Er beugte den Kopf vor, als könnte er in dieser Haltung besser sehen, aber in Wirklichkeit nützte das nichts. Was würde passieren, wenn der Motor auf einer Steigung oder an einer abschüssigen Stelle plötzlich aussetzte?
All das war seine eigene Schuld. Er wusste es, und er war nicht gerade stolz darauf. Hatte er sich nicht noch fast eineinhalb Stunden lang in den Straßen herumgetrieben?
Er hatte seine beste Jacke aus blauem Tuch angezogen und sich beim Friseur so gründlich rasieren lassen, dass ihm beim Weggehen noch Reste von Seifenpulver hinter den Ohren hafteten. Er hatte seine Mütze mit dem schwarzen Seidenband aufgesetzt, die Mütze eines Fischereibesitzers.
In Quimper hatte er an der Versammlung seines Verbands teilgenommen, bei der er die Thunfischer von Concarneau vertreten hatte. Sie waren dieses Mal früh dran. Es war erst November, und die Thunfischsaison würde erst Monate später beginnen. Doch es hatte zu viel Verdruss mit den Konservenherstellern gegeben, sodass sie ihre Vorkehrungen trafen und sich Klarheit über die Bedingungen verschafften, die sie stellen wollten, bevor sie die Boote ausrüsteten.
Um drei Uhr war die Versammlung zu Ende gewesen. Jules Guérec hätte vor Einbruch der Dunkelheit nach Concarneau zurückfahren können, aber er wusste genau, dass dies beinahe unmöglich war. Jedes Mal, wenn er nach Quimper kam, war es das gleiche Drama. Ihm war klar, in welche Straße er, koste es, was es wolle, seine Schritte lenken würde, in eine Straße, in der zu jeder beliebigen Tageszeit zwei oder drei Frauen aus Paris flanierten und sich nach den Männern umdrehten.
Auch diesmal hatte es sich wie immer abgespielt! Nie war er mit dem zufrieden, was ihm begegnete. Zehnmal lief er durch die Straße, unschlüssig, ob er sich woanders umsehen sollte, und letzten Endes besann er sich doch darauf, die erste Frau, die er entdeckt hatte, unbeholfen anzusprechen.
Deshalb würde er also eine Erklärung für die fehlenden fünfzig Francs brauchen, wenn seine Schwestern am Abend mit ihm abrechneten!
Zu allem Überfluss begann es zu regnen, und der Autobus tauchte in einer Kurve auf. Er kam an ihm vorbei, ohne ihn zu rammen, aber danach war er noch fahriger, und er hätte es nicht noch einmal machen mögen. Er fuhr durch Rosporden, bog rechts ab, fürchtete sich im Voraus vor der langen Gefällstrecke nach Concarneau hinunter und empfand das Bedürfnis, auf Holz zu klopfen.
Was dann folgte … Ja, wie passierte es eigentlich? Er dachte immer noch an die fünfzig Francs. Er würde behaupten, er habe seinen Mitgliedsbeitrag für den Verband der Fischereibesitzer bezahlt …
Das Auto glitt zur Stadt hinunter, in der die Straßenlaternen wie Lichterketten strahlten. Kurz bevor er zum Quai de l’Aiguillon gelangte, bog er nach links ab, denn er wohnte auf der anderen Seite der Hafenbecken, im Quartier du Bois, und er musste um den Hafen herumfahren.
Flüchtig nahm er die in der Dunkelheit aufragende weiße Anhäufung der Thunfischboote wahr, die Bug an Bug vor Anker lagen, und, gegen den Himmel hin, das Spinnennetz aus Rahen, Wanten und Toppleinen.
Die Straßen waren menschenleer und glänzten nass. Sie waren von kleinen Häusern gesäumt, in denen hier und da ein Fenster erleuchtet war. Pfützen spritzten unter den Rädern auf, und auf der Windschutzscheibe setzten sich Sterne aus Schlamm fest.
Rechts von ihm bewegte sich plötzlich etwas, und, seinem Instinkt folgend, beschleunigte Guérec unwillkürlich. Im Halbdunkel zeichneten sich einen Augenblick lang die Umrisse eines Kindes ab, das Licht der Scheinwerfer erfasste für den Bruchteil einer Sekunde ein Gesicht, und da passierte es auch schon, er prallte gegen etwas Weiches, ihm drehte sich dabei der Magen um, während der Wagen weiterrollte, sich hob, immer noch rollte, und Guérec, vielleicht im Glauben, er bremse, noch mehr beschleunigte.
Es war kein Schrei zu hören gewesen: nichts als dieser Aufprall, dieses Etwas, das umfiel, nur ein Knirschen des Autos, als es darüberfuhr, und Guérec wagte weder sich umzudrehen, noch sich zu rühren; es schnürte ihm die Brust zusammen, seine Knie begannen zu zittern.
Der Junge – denn es war mit Sicherheit ein Junge gewesen, und noch dazu einer, der sich auf dem Heimweg von der Schule befand, seine Tasche unterm Arm trug – war wie ein Hase auf die Straße hinausgeschnellt.
Ob er liegengeblieben war, sich nicht mehr von der Stelle rühren konnte? Guérec wollte nur weg von hier. Er hatte Angst. Ihm war klar, dass er umkehren müsste, aber er konnte es nicht, schon deshalb nicht, weil die Straße für einen ungeübten Fahrer zu schmal war.
Er gelangte in die finsterste Gegend, weit hinter der Biegung, dorthin, wo er gerade ein Boot auf der Werft liegen hatte, und er kam endlich zum Stehen. Dann tastete er sich in eine Seitenstraße hinein, um sein Glück mit dem Rückwärtsgang zu versuchen und den Wagen zu wenden.
Es half alles nichts! Es musste sein … Er würde sagen … Er wusste nicht, was er sagen würde, aber er musste zurückfahren …
Er vergaß, den ersten Gang einzulegen, und wunderte sich, warum der Motor so aufheulte. Er sah die Straße wieder vor sich, bemerkte von weitem, dass die Lichter zahlreicher geworden waren, und im nächsten Moment hatte er die Stelle auch schon erreicht. Fast alle Türen waren jetzt offen, sie sahen aus wie leuchtende Rechtecke. Die Leute, die zu zweit oder zu dritt vor den Eingängen standen, schauten alle in dieselbe Richtung. Vor einem Haus, das sich durch nichts von den anderen unterschied, drängten sich mindestens zehn aufgeregte Menschen, aber es lag nichts mehr auf der Fahrbahn.
Guérec ahnte, ja, er spürte förmlich, dass man den Jungen in das kleine, weißgetünchte Haus hineingetragen hatte; drinnen hörte er eine Frau kreischen, doch er hielt nicht an, sondern fuhr weiter, als ob er nichts gemerkt hätte, gelangte erneut zum Quai de l’Aiguillon und erklomm die Steigung in Richtung Quimper …
Immer wieder wollte er umkehren und der Sache nachgehen, aber dazu war es jetzt zu spät, und er versuchte zu überlegen.
Beim ersten Mal hatte ihn niemand gesehen, weil niemand auf der Straße war, und beim zweiten Mal hatte man wohl nicht auf ihn geachtet, weil ein jeder an den Unfall dachte. Er durfte nicht zu früh nach Hause kommen. Noch besser war es, wenn er sich irgendwo blicken ließ, also fuhr er bis Rosporden und hielt vorm Café de la Gare.
Einige Bauern tranken Schnaps, und er trank auch einen, gleich neben dem Ofen, wobei er vorgab, sich die Hände aufzuwärmen.
»So eine verdammte Straße, mit diesen ganzen Kurven …«, brummelte er vor sich hin, ohne die Leute anzusehen.
»Kommen Sie von Quimper?«
»Ja …«
Das genügte. Ihm fiel sogar das Wort »Alibi« ein, dessen Gebrauch ihm nicht geläufig war, und er empfand eine gewisse Genugtuung darüber. Hingegen hatte er beinahe Angst davor, wieder in sein Auto einzusteigen, Angst vor einer falschen Bewegung, vor einer neuen Katastrophe. Er besaß seinen Führerschein erst seit acht Tagen, und bisher hatte immer eine seiner Schwestern neben ihm gesessen. Auch wenn sie nicht fahren konnten, so flößte ihm ihre Anwesenheit doch Zuversicht ein.
Als er wieder durch die grässliche Straße kam, standen nur noch zwei oder drei Türen offen; dafür lehnten nun zwei Fahrräder an dem bewussten Haus, die Fahrräder von Polizisten oder Gendarmen. Er fuhr langsam, um bloß nicht aufzufallen, erreichte schließlich die Kirche seines Viertels und steuerte das letzte abschüssige Stück an, den sehr steilen Abhang, der zum Kai hinunterführte, direkt zur Anlegestelle der Fähre.
Dieser Abhang war sein Albtraum, denn dort gab es keine Kaimauer, und Guérec befürchtete ständig, seine Bremsen könnten versagen oder er könnte aus Versehen aufs Gaspedal drücken. Sein Haus war das vorletzte, und es war, wie üblich, erleuchtet. Er stieg aus, um das Tor des ehemaligen Pferdestalls aufzumachen, den er zur Garage umgebaut hatte, und er sah, wie eine seiner Schwestern, Céline, ans Fenster trat und ihn beobachtete. Sie trug ihre schwarze, bretonische Tracht und die dazugehörende Haube. Wie sollte er ihr nur die fehlende Wolle und die fünfzig Francs erklären?
Er fuhr das Auto hinein und überlegte, ob er auch nichts vergessen hatte, wie etwa den Benzinhahn zuzudrehen oder die Zündung abzustellen; dann schloss er mit gemächlichen Bewegungen das Tor.
Als er das Geschäft betrat, schlug die Glocke an, wie sie schon vor seiner Geburt vor vierzig Jahren angeschlagen hatte, denn es war immer noch dieselbe. Es war auch dieselbe Holztäfelung an den Wänden, aus gefirnisster Tanne, wie die Planken eines gutgepflegten Schiffs. Und die gefirnissten Tische, die mit Linoleum belegte Theke und der Glasschrank mit den Aperitif und Likörflaschen waren auch noch dieselben.
Letzten Endes herrschte auch noch derselbe Geruch: eine Mischung aus Teer und Tauwerk, Kaffee, Zimt und Branntwein. Es war keine richtige Kneipe. Es war aber auch keine gewöhnliche Kolonialwarenhandlung. Sie schenkten zwar Getränke aus, gewiss, aber es kam nicht ein jeder zu den Guérecs, denn sie belieferten hauptsächlich Schiffe mit Tauen, Seilrollen und Proviant.
Die beiden Schwestern, Céline und Françoise, die älteste, saßen mit ihren Handarbeiten an einem der Tische.
»Guten Tag …«, sagte Jules Guérec, während er seine Mütze abnahm.
Es war Céline, die intelligentere, wenngleich die jüngere, denn sie war erst zweiundvierzig, die sofort etwas witterte. Da sie ihn mit leeren Händen kommen sah, stellte sie als Erstes fest:
»Du hast die Wolle vergessen …«
»Ja … Die Versammlung hat lange gedauert und …«
»Was hast du denn?«
Er musste sich auf der Stelle eine Erklärung einfallen lassen, andernfalls würde sie ihm die Würmer aus der Nase ziehen. Im Übrigen kam ihm gerade der rettende Einfall.
»… Eine echte Katastrophe … Stellt euch vor, ich hab meine Brieftasche verloren …«
Ihm war unbehaglich zumute, denn die Brieftasche steckte in seiner Tasche und Céline war imstande, selbst nachzusehen, ob er sie wirklich verloren hatte. Nicht, dass sie ihm etwa misstraute! Aber sie wusste, dass er manchmal zerstreut war.
»Wie hast du denn das geschafft?«
»Ich weiß es nicht … Ich habe es eben erst gemerkt … Vielleicht habe ich sie im Café Jean auf dem Tisch liegenlassen … Ich rufe gleich mal an …«
Und schon war er draußen. Im Hause Guérec gab es kein Telefon. Er musste zur Telefonzelle gegenüber der Kirche gehen, hundert Meter die Straße hinauf. Er beeilte sich und überlegte, wie er seine Brieftasche loswerden sollte.
Darüber vergaß er den Jungen, den er umgefahren hatte, er klopfte auf seine Tasche und schaute auf die erleuchteten Fenster seines Hauses zurück. Es gab nur eine Möglichkeit, er musste die Brieftasche in den Hafen werfen! Mit einem Stein beschwert …
Aber, um zum Hafen zu gelangen, musste er an seinem Haus vorbei! Er telefonierte zunächst und rang in der Zelle nach Atem, während im Schankraum neben ihm Matrosen zechten. Mit seltsamer Stimme und nach Worten suchend sagte er:
»Ist dort das Café Jean? … Jules Guérec am Apparat … Aus Concarneau, ja … Ich habe in Quimper meine Brieftasche verloren, und ich frage mich …«
Man ging in die Gaststube suchen. Er wartete und beobachtete durch die Glastür der Telefonzelle die Kunden am Tresen des Tabakladens.
»Wir können nichts finden …«
Da er nicht zum Hafen hinunter konnte, ohne Gefahr zu laufen, dass man ihn sah, blieb ihm nur ein Ausweg. Es war ein bisschen lächerlich, weil er nur ein paar Schritte von zu Hause entfernt war. Doch er tat so, als hätte ihn ein plötzliches Bauchgrimmen befallen, rannte nach hinten in den Hof und entschwand in eine Bretterbude.
Als er wieder herauskam, hatte sich seine Angst bereits ein wenig gelegt.
»Ich zahle morgen … Ich bin ohne Geld losgegangen …«
Es war idiotisch: Er hatte nicht nur seine Brieftasche wegwerfen müssen, sondern auch das, was sie enthielt, unter anderem seinen Führerschein, seinen Kraftfahrzeugschein und zwei quittierte Rechnungen! Er ging langsam, um sich zu erholen, und überlegte, dass er nicht nachgeschaut hatte, ob vorn an seinem Auto vielleicht Spuren des Unfalls zu sehen waren.
Die Glocke schlug wieder an. Françoise begann im hinteren Zimmer, das vom Verkaufsraum nur durch eine stets offene Tür getrennt war, den Tisch für das Abendessen zu decken.
»Hat man sie wiedergefunden?«
»Nein … Sie haben nichts entdeckt …«
Er wurde rot, während er hinzufügte:
»Aber sie werden noch einmal suchen …«
»Ist das Auto gut gelaufen?«
»Da fällt mir ein, dass ich noch nachschauen muss, ob ich das Benzin abgestellt habe …«
Er stürzte zur Garage, und nach einem lauernden Blick zur Tür, um sich zu vergewissern, dass er nicht beobachtet wurde, zündete er ein Streichholz an und untersuchte den Kühler, die Räder und die Kotflügel. Es war kein neues Auto, sondern ein Gebrauchtwagen, und es waren die Schwestern gewesen, die es haben wollten. Die Karosserie, die von jemandem, der nicht vom Fach war, neu lackiert worden war, blieb allen Poliermitteln zum Trotz glanzlos.
Keine Spuren, nein. Kein Kratzer! Und vor allem, was er am meisten befürchtet hatte, kein Blutfleck …
»Na?«
»Ich hatte es abgestellt …«
»Wir müssen die Polizei benachrichtigen … Du brauchst es nur Émile zu sagen, er wird das Nötige veranlassen … Er kommt ja nachher …«
Ein großer Ofen thronte mitten im Geschäft, und Jules Guérec war es heiß.
»Ziehst du dich nicht um?«
Zu Hause behielt er nie seine guten Kleider an, deshalb raffte er sich auf, in den ersten Stock hinaufzugehen. Die Stufen der Treppe knarrten wie eh und je. Sein Zimmer war zwar vor zwei Jahren neu tapeziert worden, aber nach wie vor mit einer blaugrundigen Tapete, weil Céline behauptete, Rosa passe nicht zu einem Mann.
Der Spiegel überm Kamin verzerrte sein Bild so sehr, dass er als Kind davon überzeugt gewesen war, er hätte eine schiefe Nase.
Die fünfzig Francs … Was war nur in ihn gefahren? Er sollte sich wirklich nicht damit beschäftigen, sondern mit etwas anderem … Da war doch der Junge … War er vielleicht? …
Nicht dieses Wort! Bloß dieses Wort nicht aussprechen, nicht einmal in Gedanken! Es waren die linken Räder gewesen, die sich gehoben hatten, ausgerechnet die Seite des Autos, auf der Guérec gesessen hatte …
Émile Gloaguen würde herkommen … Guérec zog sich geistesabwesend aus, schlüpfte in ein Flanellhemd mit angenähtem, statt abknöpfbarem Kragen und in seinen Alltagsanzug.
Es war absurd! Es war ungeheuerlich! Niemand würde das glauben … Denn zu keinem Zeitpunkt hatte er vordergründig daran gedacht, seine eigene Haut zu retten. Er konnte nicht umkehren, das war alles, weil die Straße zu schmal war und weil er noch nicht wusste, wie man wendet. Später, als er die Leute vor den Türen stehen sah, da hatte er Angst … Weniger vor seiner Verantwortung als davor, Auge in Auge dem Jungen gegenüberzutreten! …
Er kannte niemanden in dieser Straße … Oder vielmehr doch! Sein Maschinist wohnte in einem der kleinen Häuser, die alle gleich aussahen, vielleicht im Dritten oder Vierten nach dem Haus …
Er hörte die Glocke anschlagen. Sie begleitete das Leben im Hause, jedes einzelne Ereignis. Mit einem hellen, kurzen Ton, wenn die Tür sich öffnete … Mit einem dunkleren und etwas längeren Ton, wenn sie sich wieder schloss … Sodass man, wenn die Spanne zwischen den beiden Tönen lang war, gleich wusste, dass mehrere Personen hereinkamen, oder dass der Besucher – etwa ein Bettler – auf der Türschwelle verharrte.
»Jules!«
»Ja …«
»Émile ist da.«
»Ich komme.«
Er mochte ihn nicht, und an Bord seiner Schiffe – denn er besaß zwei Thunfischboote – sagte er, sobald er von ihm redete, zu seinen Männern sogar:
»Das Rattengesicht …«
Allerdings konnte er sich darauf verlassen, dass keiner jemals ausplaudern würde, was auch immer er an Bord erzählen mochte. Es waren zwei verschiedene Welten.
Guérec hatte drei Schwestern, die alle drei älter waren als er. Und, höchst seltsam, es war nicht einmal die jüngste, die geheiratet hatte.
Die älteste war Françoise, die so um die fünfzig sein musste, was man ihr aber trotz der feinen Fältchen und der vereinzelten grauen Haare, die ihren Knoten durchzogen, nicht anmerkte. Sie verrichtete die gröbste Arbeit, sie kochte zum Beispiel oder machte den Hausputz, wenn sie gerade keine Aufwartefrau hatten.
Die jüngste, Céline, die mit zweiundvierzig Jahren, sah immer gepflegt aus und glich in ihrer bretonischen Tracht einem Holzschnitt; sie führte die Bücher, schrieb an die Lieferanten und empfing die wichtigsten Kunden.
Zwischen den beiden kam Marthe, die vor zwei Jahren plötzlich geheiratet und die Tracht abgelegt hatte, um sich wie eine Städterin zu kleiden.
Seither hatte sie sich verändert. Sie wirkte jetzt jünger. Sie kam immer noch beinahe jeden Tag ins Geschäft, strickte mit den anderen, und zweimal in der Woche aß sie, zusammen mit ihrem Mann, im Haus zu Abend.
Es war einer dieser Abende, was Jules Guérec vergessen hatte. Und nun war das Rattengesicht unten!
Ob er es bereits wusste? Denn er war der Schreiber des Polizeikommissars von Concarneau! Er war ein hagerer, blonder, ganz vertrockneter Mann in mittleren Jahren, der gestreifte Hosen, ein enganliegendes schwarzes Sakko und eine Brille mit Goldrand trug und ganz bleiche Hände hatte.
Als Jules hinunterkam, traf er ihn im Esszimmer an, denn Gloaguen hielt sehr darauf, nie im Saal Platz zu nehmen.
Sie sagten seit jeher »Saal«, schon zur Zeit, als die Eltern noch lebten, weil es weder eine Schänke, noch ein Wirtshaus, aber auch kein gewöhnliches Lebensmittelgeschäft war, sondern eine Mischung aus alledem.
An den Wänden des Esszimmers hingen zwei Aquarelle, die die beiden Thunfischboote der Guérecs darstellten: die Françoise und die Céline.
Françoise, weil sie die älteste war. Logischerweise wäre beim zweiten Schiff, das sie hatten bauen lassen, Marthe an der Reihe gewesen, aber irgendwie, keiner wusste warum, war Céline seine Taufpatin geworden.
Marthe sollte nun freilich auch zum Zuge kommen, denn ein drittes Boot lag schon auf dem Stapel, ein Kutter, zu dessen Bau sie sich entschlossen hatten, da aufgrund der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit die Preise günstig waren. Der Thunfisch würde sich eines Tages schon wieder verkaufen lassen und dann …
»Wie geht’s?«
»Ganz gut … Viel Arbeit und viel Verantwortung.«
Émile Gloaguen liebte es, sich verantwortlich zu fühlen.
Jules küsste seine Schwester, die seit einigen Wochen blasser als sonst aussah, und Céline hatte ihm verraten, dass sie sich fragte, ob sich da nicht ein großes Ereignis ankündigte.
»Warst du in Quimper?«
»Er hat sogar seine Brieftasche dort verloren …«
Guérec wandte den Blick ab, denn das Rattengesicht vom Kommissariat wusste von der Existenz dieser Straßendirnen aus Paris, die für ihn immer noch ein Rätsel waren. Wie konnten sie nur so gut gekleidet sein? Und vor allem, wie kam es, dass sie meistens so liebenswürdig waren?
In der Mitte des gedeckten Tisches stand die riesige Suppenterrine aus weißer Fayence. Françoise hantierte in der Küche, wo noch Zwiebeln in der Pfanne brutzelten.
»Ich rufe gleich morgen an«, versprach Gloaguen.
»Im Café Jean hab ich schon angerufen …«
»Warst du sonst nirgends?«
»Nein, nirgends.«
»Sag mal«, rief Céline plötzlich, »ist dir deine Brieftasche vielleicht im Auto runtergefallen? Ich gehe nachschauen …«
Sie griff nach der Taschenlampe, die immer auf dem Büfett lag, und verschwand, während er von Neuem Angst bekam und sich fragte, ob sie vielleicht etwas merken würde.
»Rüstest du kein Boot für die Küstenfischerei aus?«
»Ich weiß es noch nicht … Ich warte ab, ob Malou weitermacht …«
Malou war ein anderer Kapitän, der nur ein Thunfischboot besaß. Um die fangfreien Wintermonate zu überbrücken, war er in der Woche davor zur Küstenfischerei ausgelaufen. Früher war das üblich gewesen, vor allem dann, wenn ein Schiff mit einem Motor ausgestattet war.
Aber lohnte es die Mühe noch?
»Ich hab gehört, er hat den Meeraal für zwei Francs und die Seezunge für fünfzehn verkauft, und auf vier Kisten Rochen ist er sitzengeblieben …«
Émile rauchte eine Zigarette. Guérec rauchte gar nicht, weil ihn seine Schwestern seit seiner Jugend davon abhielten. So, wie er auch in ihrer Gegenwart nie Schnaps trank.
Er war groß und breitschultrig, hatte einen auffallend frischen Teint, dunkles Haar und sanfte Augen. Als er nach seiner Rückkehr aus Quimper auch die Stiefel ausgezogen hatte, war er in seine gewachsten Holzschuhe geschlüpft, und nun war ihm warm und er fühlte sich eigentlich behaglich.
Aber warum dieser Unfall? … So sehr er sich auch bemühte, an etwas anderes zu denken, er fiel ihm immer wieder ein, und er hätte gern seinen Schwager danach gefragt. Wer weiß, vielleicht war es das Kind von jemandem, den er kannte, von einem seiner Männer, etwa von seinem Maschinisten?
»Zu Tisch! …«, befahl Françoise, während sie die Suppenterrine holte, um sie zu füllen. »Nanu! Wo ist denn Céline?«
Eben trat sie wieder herein und knipste die Taschenlampe aus.
»Sie ist nicht da … Es sei denn, sie ist dir hinuntergefallen, als du die Tür aufgemacht hast … Hast du unterwegs angehalten?«
»Ja doch …«
Das hatte er ganz vergessen! Beinahe hätte er nein gesagt!
»Wo denn?«
»In Rosporden, beim Café de la Gare …«
»Was hast du denn dort gemacht?«
Er brauchte nicht nach Worten zu suchen. Sie kamen wie von selbst.
»Ich hatte das Gefühl, dass der Kühler kochte … Deshalb bin ich vor dem Gasthaus ausgestiegen, es hätte ja sein können, dass ich Wasser hätte nachfüllen müssen …«
»Was hast du getrunken?«
»Ein Bier …«
Und niemand wunderte sich darüber. Daran war nichts Ungewöhnliches.
War das Kind etwa tot? Während er sich mit dem Rücken zum Feuer, mit bequemen Holzschuhen an den Füßen, an den gedeckten Tisch setzte und Marthe ihm die duftende Suppe auf den Teller schöpfte …
Seine Gefühle waren in Aufruhr. Er sah niemanden an. War das Kind verletzt, war es beinahe noch schlimmer, denn dann würde es Schmerzen haben, und er konnte sich seine Mutter vorstellen, wie sie neben ihm saß, die erwachsenen Leute, die ihm keine Linderung verschaffen konnten, den besorgten Arzt, den Geruch der Medikamente …