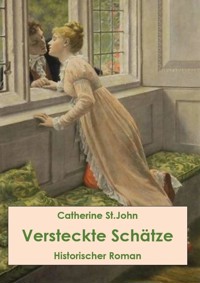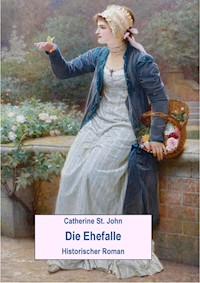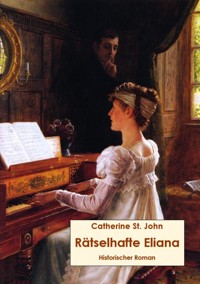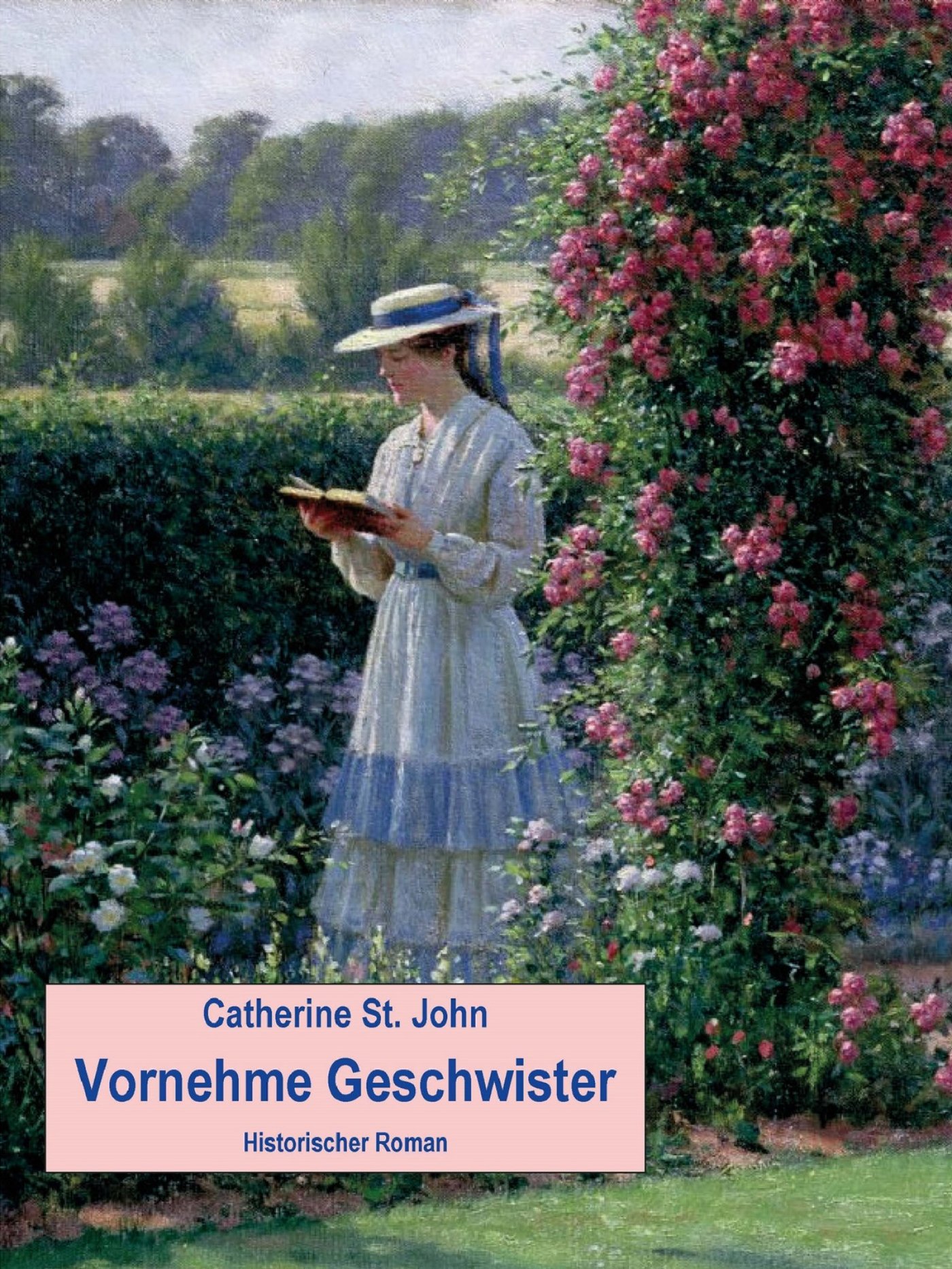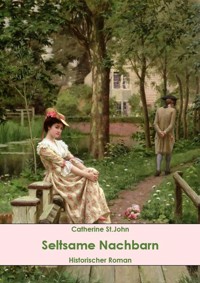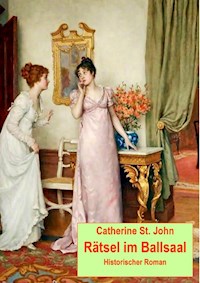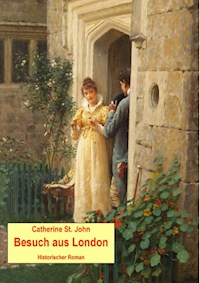Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Geneviève de Deaubray flieht 1792 unter skandalösen Umständen vor der Revolution nach England, um bei ihrer Tante zu leben, die zur besten Gesellschaft Londons zählt. Sie wird zwar mehr als freundlich aufgenommen und genießt die Vergnügungen der Saison, aber mehrere Herren bereiten ihr zunehmend Kopfzerbrechen: Der eine versucht, herauszubekommen, wie ihre Reise wirklich vonstatten gegangen ist, der andere betrachtet ihr Verhalten in der Gesellschaft mehr als kritisch - und der dritte stammt aus ihrer Vergangenheit und versucht, sie damit unter Druck zu setzen. Und dann gibt es in ihrer neuen Familie noch Paare, die einfach nicht zueinander finden wollen. Hier muss Geneviève natürlich helfend eingreifen - und schließlich kommt sie dabei auch selbst zu ihrer großen Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint
Die Cousine aus Frankreich. Historischer Roman
Catherine St. John
published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de Copyright: © 2015 Catherine St. John
ISBN 978-3-7375-4805-2
I
„Wie heiße ich eigentlich?“
Der alte Mann auf dem Kutschbock zeigte sich ob dieser immerhin ungewöhnlichen Frage weniger erstaunt, als man hätte erwarten können. Nach kurzer Verwirrung antwortete er: „Was - ? Ach so! Henri. Henri Letellier.“
Sein Beifahrer nickte befriedigt. Es handelte sich um einen sehr jungen Burschen, mittelgroß und schmächtig gebaut, mit stark sonnenverbranntem Gesicht und strähnigen dunklen Locken, die im Nacken auf die übliche Art schlampig zu einem Zopf gebunden waren. Seine Kleidung - Hose, Jacke und Umhang aus derbem Stoff, dazu grobe Wollsocken und abgeschabte Holzpantinen - entsprach der üblichen Tracht der Bauern in diesem Landstrich Frankreichs und war ganz besonders schmutzig und abgetragen.
Die nächsten Worte des Jungen hätten einen zufälligen Lauscher gewiss noch mehr verwundert, denn nachdem er ein wenig über seinen neuen Namen nachgesonnen hatte, sagte er: „Dann fang wohl besser gleich an, mich zu duzen, und pass auf, dass du nicht mehr Comtesse zu mir sagst, sonst werden mir die Posten nie glauben, dass ich dein Neffe bin.“
„Zu Befehl, Com- ganz wie du willst, Henri. Aber vor der Abzweigung nach Deauville gibt es eigentlich nie einen Posten, und bis dahin werde ich mich schon daran gewöhnt haben.“
„Hoffentlich!“, war die kurze Antwort.
Während der Wagen dahinrumpelte, versank der junge Bursche in Gedanken. Nun verließ also Geneviève de Deaubray, alias Henri Letellier, ihr väterliches Schloss… wenn man diesen Trümmerhaufen überhaupt so nennen konnte, dachte sie nicht ohne Erbitterung. Und das, um vor der Revolution nach England zu fliehen.
Zwar war diese Gegend bisher noch erstaunlich friedlich geblieben: Hier hatten, soweit sie wusste, noch keine Schlösser gebrannt, was wohl auf die relative Armut des hiesigen Adels zurückzuführen war, die mit dem Bild des arroganten Aristokraten in Samt und Seide, der die Bauern für sein Wohlleben ausblutete, schlecht zusammenpasste. Andererseits erging es der Bevölkerung hier auch nicht besser als in anderen Teilen des Landes. Irgendwann musste sie auch hier aufstehen: Besser, sie brachte sich vorher in Sicherheit!
Es musste natürlich erst eine Revolution kommen, damit sie etwas von der Welt sah! Ihr verstorbener Vater, der Comte Armand de Deaubray, hatte stets sehr zurückgezogen gelebt, ohne sich allerdings allzu sehr mit der Verwaltung seines Gutes zu befassen, wie Geneviève wieder einmal feststellen musste, als sie in der Dämmerung an den verwahrlosten Bauernkaten vorbeifuhren, die noch zu Deaubray gehörten. Nie hatte Papa einen Sou dafür aufgewendet; für seine Tochter allerdings auch nicht.
Ja, sie war noch nicht einmal in Paris gewesen, und nun würde sie es wohl nie sehen, denn wer wusste, wann sie nach Frankreich zurückkehren konnte?
Schon drei Jahre dauerte diese schreckliche Revolution nun an und es war kein Ende abzusehen – ja, es schien täglich schlimmer zu werden! Immer mehr Menschen wurden umgebracht, hingerichtet, wie man es nannte, als ob es ein Verbrechen wäre, von Adel zu sein!
Man hatte vor einem Monat, am 10. August 1792, sogar die Monarchie abgeschafft. Genevièves Lippen kräuselten sich, als sie an die grausige Szene dachte. Ihr Vater hatte müßig und mit spitzen Fingern nach dem Moniteuruniversel gegriffen (er hasste dieses offizielle Blatt, las es aber doch), als er plötzlich aufsprang, entsetzt auf die Titelseite starrte, sich an die Brust griff und schwer zu Boden stürzte. Weder die Bemühungen der zu Tode erschrockenen Geneviève noch die des eiligst herbeigeholten Dr. Tissot hatten ihn zu retten vermocht; die Nachricht war zuviel für sein Herz gewesen.
Geneviève, die den König insgeheim für einen unfähigen Tropf hielt, schnaubte verächtlich, als sie daran dachte. Hätte man dem Grafen mitgeteilt, seine einzige Tochter habe sich bei einem Reitunfall das Genick gebrochen, wäre ihm das Herz ganz gewiss nicht stehen geblieben!
Ihr Vater hatte sie nie viel beachtet, da sie nur ein Mädchen war, und sich praktisch für kinderlos gehalten, seit seine Frau vor vierzehn Jahren mit seinem einzigen Sohn im Kindbett gestorben war. Geneviève hatte ihren Vater nicht besonders geliebt. Sein plötzlicher Tod war zwar ein Schock für sie gewesen, da sie ihn miterleben musste, aber als die Betäubung nachließ, war sie insgeheim erleichtert: Nun konnte sie endlich nach England reisen! Die Nachrichten aus Paris klangen täglich bedrohlicher; einerseits nahm sie es dem Volk und vor allem den Bauern nicht übel, dass sie sich erhoben hatten, denn auch ihr waren die Zustände des ancien régime unhaltbar erschienen (wenn auch ein Gutteil dieser Ansicht Lucien zu verdanken war), aber andererseits wollte sie doch lieber bei Tante Anne in London Zuflucht suchen, bevor man sie als aristo verhaftete und womöglich auf dieses neuartige Schafott schleppte, das ausgerechnet ein Arzt, ein gewisser Dr. Guillotin, erfunden haben sollte. Ihr Vater aber hatte allen ihren Vorstellungen von Gefangenschaft und Tod nur stereotyp entgegengesetzt: „Wir Deaubrays schleichen uns nicht wie Diebe davon!“
Offensichtlich zog er es vor, mit der alten Ordnung unterzugehen. Nun, sie vertrat da eine andere Ansicht!
Ihre Schultern strafften sich entschlossen, als Jean-Baptiste, der Kutscher ihres Vaters, sie anstieß und murmelte: „Da vorne geht´s nach Deauville, und da sind auch schon die Posten. Achtung jetzt, Henri!“
„Schon gut, Onkel“, antwortete sie, nicht ohne spitzbübische Betonung des letzten Wortes. Er warf ihr einen irritierten Blick zu – dass sie auch immer ihre Witze machen musste! – und ließ das Pferd in Schritt fallen, bis man die beiden Soldaten erreicht hatte. Dort zog er die Zügel an, bevor noch das „Halt! Im Namen der Republik!“ der Soldaten ertönte, und tippte grüßend an die Mütze.
Einer der Posten hob die Laterne und leuchtete den nächtlichen Passagieren ins Gesicht. Während Jean-Baptiste umständlich nach dem Pass kramte, gähnte Geneviève ungeniert, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten, und rülpste sodann ausführlich. Dieser Beweis schlechter Manieren überzeugte die Wächter mehr als der ordnungsgemäß ausgestellte Pass für Jean-Baptiste Moulon und seinen Schwestersohn Henri Letellier (der an diesem Abend friedlich zu Hause saß), dass hier keine Aristokraten aus dem Lande geschmuggelt werden sollten.
„In Ordnung. Fahrt zu, Bürger!“
Erleichtert trieb Jean-Baptiste das Pferd an, und als sie außerhalb der Hörweite der beiden waren, entfuhr Geneviève ein langes „Puh!“
„Ja, das hätten wir, lieber Neffe!“, stimmte Jean-Baptiste zu, der sich umso leichter in seine Onkelrolle fand, als hauptsächlich er die kleine Comtesse großgezogen hatte, die unentwegt ihren Gouvernanten entwischt war, um sich von ihm das Reiten, das Kutschieren und andere interessante Fertigkeiten beibringen zu lassen, anstatt sittsam über ihrem Stickrahmen oder am Pianoforte im schäbigen Salon von Schloss Deaubray zu sitzen. Papa wusste davon natürlich nichts, er glaubte, seine Tochter werde so streng behütet, wie es sich für eine Comtesse de Deaubray schickte – und alle Angestellten ließen ihn gerne in dem Glauben, auch die jeweilige Gouvernante, die um ihre Stellung bangte. Da der Graf den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer über den Reliquien vergangener Glorie der Familie brütete, die mit ihm aussterben würde, bereitete das Versteckspiel keine großen Schwierigkeiten.
Ja, er hatte es nicht einmal bemerkt, dass seine streng bewachte Tochter es fertig gebracht hatte, sich zu verlieben – in den Sohn des Maître Tournier, eines Advokaten im nahegelegenen Evreux. Er hätte diese - obendrein so gar nicht standesgemäße – Beziehung auf das Heftigste missbilligt, denn Maître Tournier hatte als Deputierter des Dritten Standes für Evreux an den Generalständen teilgenommen, und sein Sohn war ein glühender Revolutionär, der sogar ein Zerwürfnis mit seinem gemäßigten Vater riskiert hatte, um in Paris zu bleiben und „dabei zu sein“, wie er es nannte, während sein Vater nach der Verabschiedung der Verfassung im letzten Jahr wieder nach Evreux in seine Kanzlei zurückgekehrt war.
Lucien hatte Geneviève gelegentlich besucht, wenn er einige Tage bei seinem Vater verbrachte, und ihr von den neuesten Entwicklungen in der Hauptstadt vorgeschwärmt. Aus diesen Gesprächen hatte Geneviève auch hauptsächlich ihre politischen Ansichten bezogen. Wenn sie auch – oft rein instinktiv – nicht alle Thesen Luciens gut heißen konnte, so hing sie doch begierig an seinen Lippen, wenn er erzählte. Ihr war dann zumute, als käme ein Stück von Paris und seinen aufregenden Ereignissen nach Deaubray, wo nicht einmal jetzt, während der größten Umwälzung, die Frankreich je erlebt hatte, irgendein besonderes Vorkommnis das tägliche Einerlei störte.
Lucien hatte diese Begeisterung natürlich außerordentlich geschmeichelt und er hatte sich die Verliebtheit der kleine Comtesse gerne, wenn auch etwas gönnerhaft, gefallen lassen, sie in einem gewissen Maße vielleicht sogar erwidert, bis er im Juli zum letzten Mal aufgetaucht war, seltsam erregt, aber ohne ihr zu sagen, was er eigentlich vorhatte. Seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört; wahrscheinlich war es für einen jungen Mann, der in der Revolution Karriere machen wollte, ungünstig oder sogar gefährlich, sich mit einer – wenn auch noch so ärmlichen - Aristokratin abzugeben. Nun würde sie ihn wohl überhaupt nicht mehr wiedersehen…
Sie versuchte, die aufkommende trübe Stimmung zu verscheuchen, und zwang sich, sich auf England zu freuen. Schließlich lag eine aufregende Reise voller Gefahren und Abenteuer vor ihr, wie in einem der Romane, die sie (natürlich ohne Wissen ihres Vaters) verschlungen hatte! Es konnte tatsächlich noch allerlei passieren; sie hatte sich zwar verkleidet, sich mutwillig einen Sonnenbrand zugezogen und von Jean-Baptiste ihre kupferroten Locken etwas stutzen und dunkelbraun färben lassen – aber wer konnte wissen, ob man sie nicht doch erkennen würde? Ein angenehmer Schauer, kaum durch einen Hauch von Furcht getrübt, lief ihr den Rücken hinunter: endlich ein Abenteuer, nach achtzehn Jahren der Langeweile auf Schloss Deaubray!
Jean-Baptiste unterbrach ihre Gedanken mit einer geradezu unpassend nüchternen Frage: „Hast du auch genug Geld dabei?“
Sie lachte. „Das fällt dir jetzt ein? Willst du zurückfahren, wenn ich sage, nein, daran habe ich gar nicht gedacht? Keine Angst, in Papas Schreibtisch waren noch sechsundzwanzig Louis d´or. Das dürfte doch reichen, oder?“
Sie hielt bekräftigend ein Lederbeutelchen hoch, das sie an einer Schnur um den Hals trug.
Er nickte. „Gut. Georges verlangt fünf Louis d´or für die Überfahrt – ziemlich billig. Den Rest heb nur gut auf, du wirst in England gewiss auch Geld brauchen. Dort bekommst du auch gewiss keinen Ärger, wenn du richtiges Geld statt dieser wertlosen Fetzen hast.“
„Statt der Assignaten, meinst du?“
„Ja. Papiergeld! Hat man so etwas Seltsames schon gehört?“
Nun kam ihr ein anderer Gedanke: „Denke daran, morgen früh einen anderen Weg zurück zu nehmen, damit niemand merkt, dass ich dir sozusagen verloren gegangen bin!“, ermahnte sie Jean-Baptiste, der aber nur unwillig grunzte.
„Glaubst du, ich bin blöde? Natürlich fahre ich einen anderen Weg zurück. Und dann schlage ich sofort Krach und zeige an, dass du geflohen bist, kaum dass ich den Rücken gewendet hatte -“
„Voll republikanischer Entrüstung!“, lachte Geneviève.
„Na sicher, ich bin doch ein guter citoyen!“ Er warf sich ironisch in die Brust.
***
Gegen halb zehn Uhr abends kamen sie nach Seyeux, dem kleinen Küstenort, wo Jean-Baptistes Vetter Georges zu Hause war. Sie hielten vor einem baufälligen, aber peinlich sauberen Häuschen am Ende des Ortes; Jean-Baptiste sprang vom Wagen und wollte Geneviève aus alter Gewohnheit vom Sitz herabhelfen. Gerade noch rechtzeitig, wie sie meinte, flüsterte sie: „Lass das – bist du verrückt?“, und hüpfte leichtfüßig auf den Boden.
Jean-Baptiste verstand zuerst nicht recht, aber dann kam ihm die Erleuchtung: „Was -? Ach, glaubst du, die hier halten dich für Henri? Den kennen sie doch, so gut wie mich! Nein, nein, Georges und Marthe sind eingeweiht, wir brauchen uns nicht zu verstellen, wenn kein Fremder da ist. Außerdem ist es ja schon stockfinster.“
„Du hast recht“, meinte Geneviève etwas beschämt, da sie sich gerade ganz besonders geistesgegenwärtig und umsichtig gefühlt hatte. Sie ärgerte sich über sich selbst und befürchtete plötzlich, die ganze Fahrt werde so zahm verlaufen wie ihr bisheriges Leben – dann aber schalt sie sich eine Närrin: Sie konnte doch froh sein, wenn sie heil und ganz nach England gelangte!
Sie betraten das Häuschen, das nach landesüblicher Bauweise aus grauem Stein errichtet war. Die Haustüre führte direkt in das einzige ebenerdige Zimmer, das offensichtlich als Wohnraum und Küche zugleich diente, wie die offene Feuerstelle mit der rußgeschwärzten Decke rund um den Abzug darüber verriet. Geneviève hatte noch nie eine solche Behausung von innen gesehen, da ihr Vater ihr den Umgang mit den Bauern von Deaubray verboten hatte; nicht einmal die Kranken durfte sie besuchen, da ihr Vater den verweichlichenden Einfluss der Mildtätigkeit auf seine Bauern fürchtete – wie der Teufel das Weihwasser, um einen Ausdruck Jean-Baptistes zu verwenden.
So sah sie sich nun neugierig um. Der Raum war ziemlich niedrig und wurde von einigen Talgkerzen und dem schwachen Herdfeuer nur unzureichend erhellt; Geneviève, die ja aus der Dunkelheit kam, erkannte trotzdem einiges: einen Tisch mit den dazugehörigen Stühlen in der Nähe der Feuerstelle, einen wackligen Schrank neben der Tür; im Hintergrund führte eine steile Stiege ins Dachgeschoss, das wahrscheinlich als Schlafkammer diente.
Am Herd stand eine Frau, die sich nun umwandte und ihnen entgegenkam. Als sie sich näherte, sah Geneviève, dass sie etwa Ende vierzig und auf eine etwas derbe Art recht hübsch war. Lebhaft begrüßte sie die Ankömmlinge: „Da seid ihr ja endlich – keine Schwierigkeiten auf dem Weg hierher? Georges, Georges, sieh mal, wer da ist!“
Georges, der neben dem Tisch saß und ein Netz flickte, sah kaum auf und brummte nur zur Begrüßung. Geneviève fand ihn nicht sehr freundlich und war nicht mehr ganz so sicher, ob die Überfahrt ein herrliches Abenteuer werde würde.
„Nun kommt erst einmal und setzt euch. Habt ihr Hunger? Aber natürlich habt ihr Hunger, ihr wart ja mindestens drei Stunden unterwegs!“ Mit diesen gastfreundlichen Worten stellte Georges´ Frau einen Topf auf den Tisch, aus dem ein verlockender Duft aufstieg, und legte einen dunklen Brotlaib und ein Messer daneben.
Geneviève spürte ihren Magen knurren und langte kräftig zu, obwohl sie diese Art von Fischsuppe noch nie gegessen hatte. Sie war noch nicht fertig, als sich Georges erhob und meinte: „Ich hole Louis und die anderen; wir segeln dieses Mal nur zu viert – das ist sicherer. Wir bleiben zwei Nächte weg; wenn jemand fragt, warum, dann sagst du, wir wollten nach Brest – im offenen Meer sind die Fischgründe besser. Hast du verstanden, Marthe? Wir müssen langsam los, der Wind steht genau richtig und weht auch schön kräftig; so können wir es in zwölf Stunden schaffen, wenn alles gut geht. Aber essen Sie nur ruhig fertig“, beruhigte er Geneviève, die hastig aufbrechen wollte, und verließ das Häuschen.
Als Geneviève aufgegessen hatte, erinnerte Jean-Baptiste sie an das Geld. Sie reichte Marthe die fünf Louis d´or, die sie in der Jackentasche trug (der Rest war in dem Lederbeutelchen sicher verwahrt), wickelte sich fester in ihren Umhang und machte sich mit Jean-Baptiste auf dem Weg zu dem kleinen Hafen.
Es erstaunte sie, dass Georges einen fast neuen, stattlichen Kutter sein eigen nannte, den er gerade zusammen mit drei anderen Männern startklar machte. Der Wind blies tatsächlich recht kräftig vom Land her – so konnte die Reise wohl nicht allzu lange dauern.
„Ja…“, meinte Jean-Baptiste leise, „viel Glück, Comtesse. Passen Sie gut auf sich auf, da drüben in England.“
„Ich schreibe dir, ganz bestimmt“, versprach Geneviève, nun doch von Rührung und Abschiedsschmerz übermannt, mit erstickter Stimme.
„Lieber nicht“, wehrte Jean-Baptiste ab, „das wäre zu gefährlich. Ich werde Ihnen schreiben, wenn es gefahrlos möglich ist.“
Die Abschiedsszene fand ein abruptes Ende, als Georges rief: „He, Henri, herauf mit dir, wir sind soweit!“ Sie küsste den verlegenen Jean-Baptiste rasch auf die Wange, lief auf den Kutter zu und kletterte hinein. Die Segel rauschten herab und füllten sich mit Wind; langsam glitten sie aus dem kleinen Hafen aufs Meer hinaus.
II
Geneviève kauerte in einer Ecke des Hecks, um den Männern nicht im Wege zu sein, die bei der kräftigen Brise alle Hände voll zu tun hatten. Schließlich – sie wusste gar nicht, wie viel Zeit schon vergangen war, aber es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, denn ihr war kalt und die vier Männer waren ihr nicht ganz geheuer – wandte sich einer der anderen Männer nach ihr um.
„Sag mal, Georges, der Kleine sitzt hier nur so herum, der könnte uns doch wenigstens ein bisschen helfen. Ich versteh´ ja sowieso nicht, wieso wir heute nur zu viert rausgefahren sind – gerade, wenn wir eine lange Fahrt vorhaben.“
„Halt´s Maul, Louis, der versteht doch gar nichts vom Segeln.“
„Was? Und wozu hast du ihn dann mitgenommen? Vielleicht wegen der guten Nachtluft? Da ist doch was faul! Sag mal, ist das etwa ein Flüchtling – ein Feind der Republik?“
„Quatsch“, brummte Georges, aber es klang wenig überzeugend.
„Na, also mir kommt das spanisch vor.“
„Ist mir egal, wie dir das vorkommt. Blas dich hier nicht so auf, Louis, zieh lieber das Tau da vorne mal fester an, das Segel flattert ein bisschen.“
Während Louis achselzuckend die wenigen Schritte zum Bug stiefelte, wo die beiden anderen Männer sich die ganze Zeit aufhielten, eilte Georges zu Geneviève und flüsterte hastig: „Tut mir Leid, mein normaler Bootsmann ist krank; wir müssen ihn bestechen – für Geld übersieht der alles. Haben Sie noch etwas Geld übrig?“
„Ja“, flüsterte Geneviève zurück.
„Wie viel?“
„Fünf Louis d´or“, antwortete sie vorsichtig, wenn auch nicht unbedingt wahrheitsgemäß.
„Ich werde es versuchen. Drei müssten aber reichen. Die anderen sind harmlos – sie machen alles, was ich sage, und können Louis nicht leiden. Lassen Sie mich nur machen.“
Mit diesen Worten trat er einen Schritt zurück und wandte sich dem zurückkommenden Louis zu. „He – Louis! Wie wär´s mit einem Spielchen? Jetzt haben wir ja etwas Ruhe.“ Dabei holte er schon ein abgegriffenes Päckchen Karten aus seiner hinteren Hosentasche. Geneviève war gespannt, was nun folgen würde - das jedenfalls hatte sie nicht erwartet! Georges freilich schien genau zu wissen, was er tat. Louis zögerte, schielte aber begehrlich auf die Karten, soweit Geneviève das in der Dunkelheit erkennen konnte, während sie unauffällig einige Münzen aus ihrem Beutelchen in die Jackentasche praktizierte.
„Lust hätte ich schon… aber ich weiß nicht. Ich hab gestern schon zwei Louis d´or im Lion Rouge verspielt – weiß gar nicht, wie mir das passiert ist. Meiner Alten hab ich das noch gar nicht gesagt. Mann, die wird mir vielleicht was erzählen!“
„Gleich zwei ganze Louis d´or? Aber Louis – so viel Geld!“
„Hör bloß auf, du redest schon wie meine Alte.“
„Ja, ja, die gute Anne“, sinnierte Georges nicht ohne Schadenfreude. Interessiert fragte er weiter: „Hat sie dir wegen sowas nicht mal eine Flasche über den Schädel gehauen?“
„Verdammt, erinnere mich bloß nicht daran!“, stöhnte Louis auf.
„Ein resolutes Weibsbild, deine Anne“, gab Georges sein Urteil ab. „Na, dann schau nur, dass du das Geld schnell wieder auftreibst. Eine ganze Menge, zwei ganze Louis d´or.“
Damit wandte er sich ab und machte sich an einem Tau zu schaffen. Geneviève hatte seine Taktik schon durchschaut: Er wollte Louis ein bisschen schmoren lassen. Tatsächlich biss dieser nach einigen Minuten stummen Kampfs mit sich selbst auf den so geschickt ausgelegten Köder an: „Sag mal, Georges, du könntest mir nicht vielleicht…?“
„Was? Geld pumpen? Schlecht, weißt du… Meine Marthe lässt mir auch nicht viel übrig; wenn ich so viel spielen würde wie du, hätte ich auch nie einen Sou. Jean und Michel brauchst du übrigens gar nicht erst zu fragen, die haben mir vorhin erst erzählt, dass sie völlig pleite sind. Tja, ich fürchte, du wirst Anne alles beichten müssen. Schau, so schlimm kann es ja auch nicht werden. Vielleicht wirft sie dir einen Kochtopf an den Kopf und verbietet dir für die nächste Zeit, in den Lion Rouge zu gehen – aber daran wirst du schon nicht sterben.“
Louis schien aber den Tod den in Aussicht gestellten Strafen vorzuziehen; er stöhnte mehrmals ganz erbärmlich und nahm schließlich einen neuen Anlauf: „Und der Kleine da?“
„Was soll mit dem sein? Ach so - ! Das hab ich gerne: erst die Leute für Flüchtlinge halten und sie dann anpumpen! Das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun. Stell dir vor, du nimmst Geld von ihm und dann ist er tatsächlich ein Flüchtling: Schön stehst du da, wenn das rauskommt.“
Louis widersprach ganz entrüstet. „Natürlich ist der kein Flüchtling! Sieht man doch!“ Offensichtlich war er bereit, jeden für einen guten Bürger der Republik zu halten, der ihm Geld leihen konnte. Die Aussicht auf zwei Louis d´or ließ ihn vor Erleichterung fast stottern, denn er hatte tatsächlich entsetzliche Angst vor seiner herrschsüchtigen und vor allem schlagkräftigen Frau.
Auf einen Wink von Georges reichte Geneviève Louis drei Goldstücke, nach denen dieser hastig griff, erfreut über die unvermutete Großzügigkeit des jungen Mannes.
„Na“, sagte Georges gleichmütig, „dann wären deine Probleme ja gelöst – aber solltest du eines Tages doch wieder glauben, Henri wäre ein Flüchtling, dann vergiss nicht, dass du dir von ihm hast aus der Patsche helfen lassen. Bestechung wäre das dann, jawohl.“
„Schon recht“, brummte Louis und nickte Geneviève zu, „schönen Dank auch, Bürger – oder soll ich Monsieur sagen?“
„Mir egal“, brummte Geneviève zurück und versuchte, ihre Stimme möglichst tief und männlich klingen zu lassen, was ihr aber nicht besonders gut gelang. Erleichtert sah sie Louis wieder zum Bug des Kutters stapfen, während Georges sich am Heck um das Ruder kümmerte.
„Wenn er merkt, dass wir gar nicht Richtung Brest segeln, fängt er bestimmt wieder an. Spätestens, wenn wir an Cap Hague vorbei sind, müssten wir nämlich nach Westen segeln anstatt weiter nach Norden. Aber jetzt hängt er schon mit drin, und das weiß er auch, also machen Sie sich mal keine Sorgen um ihn.“
Wirklich begann Louis nach einiger Zeit, sich mit zunehmender Lautstärke über die Route zu wundern. Die beiden anderen verhielten sich so blind, taub und stumm, dass Geneviève daraus den Schluss zog, Georges habe sie eingeweiht.
Louis jedoch wurde unruhig: „Sag mal Georges, wo willst du verdammt noch mal hin? Wir sind schon lange am Kap vorbei – hältst du mich für blöde? Wenn wir nach Westen segeln würden, müsste es seit Neuestem im Norden hell werden. Also was soll das alles?“
Tatsächlich war backbord – welche Himmelsrichtung es auch immer sein mochte, auf die Louis´ anklagender Zeigefinger wies – eine schwache hellere Färbung wahrzunehmen.
Georges antwortete zunächst nicht. Während der lastenden Stille lief es Geneviève trotz der tröstenden Worte von Georges kalt über den Rücken: Bestimmt war jetzt alles aus: Louis würde verhindern, dass man sie in England absetzte, und in Frankreich ungeheuren Krach schlagen – sie würden alle auf der Guillotine sterben. Nur mühsam bewahrte sie äußerlich die Ruhe und zwang sich, auf Georges zu vertrauen: Hoffentlich fiel ihm etwas ein, um Louis zu beruhigen!
Da hörte sie Georges bedächtig sagen: „Wohl, Louis, da magst du schon recht haben. Wir fahren tatsächlich nicht nach Westen, sondern nach Norden.“
„Nach Norden? Aber – nach England?!“
„Nach England“, bestätigte Georges mit bewunderungswürdiger Gelassenheit.
„Das dulde ich nicht! England ist ein feindliches Land! Du verrätst die Revolution, wenn du einem Feind der Republik zur Flucht verhilfst!“
Das hatte sie befürchtet. Um Gottes willen – was sollte sie jetzt tun? Geneviève wurde von einer derartigen Verzweiflung erfasst, dass sie sich vornahm, eher über Bord zu springen und zu ertrinken, als sich nach Frankreich zurückschaffen zu lassen – sterben müsste sie ja auf jeden Fall. Aus diesen morbiden Gedanken wurde sie durch Georges´ Stimme gerissen, die Louis antwortete: „Das duldest du nicht? Du hängst ja auch schon mit drin. Schließlich sehen es die guten republikanischen Bürger gar nicht gerne, wenn man von einem Flüchtling Geld annimmt – sie schimpfen doch immer über die Korruption. Du kannst es ihm natürlich wieder zurückgeben -“
Er hielt inne und registrierte befriedigt, dass sich bei Louis die erwartete Wirkung einstellte: Sein Gesicht wurde immer länger. Dann sprach Georges weiter: „Ich würde ja sagen, die Gefahr ist geringer, dass das hier rauskommt, als dass deine Frau von deinen Spielschulden erfährt und dir den Kopf abreißt – aber natürlich musst du das selber entscheiden. Ich will dir da nicht reinreden, schließlich leben wir in einer freien Republik.“
Der spöttische Unterton war unverkennbar; Geneviève, die gebannt lauschte, konnte sich trotz ihrer Befürchtungen ein Lächeln nicht verkneifen.
Louis stand einige Minuten stumm da und wog die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander ab; dann gab er sich einen Ruck und erklärte: „Na gut, mir soll´s recht sein. Aber wo willst du fischen?“
„Auf dem Rückweg – von hier bis Cap Hague gibt es ausgezeichnete Fischgründe, da kriegen wir bestimmt genug zusammen.“
Die Nacht neigte sich mehr und mehr ihrem Ende zu; allmählich tauchten aus der nächtlichen Schwärze Meer und Himmel in einer fahlen graublauen Tönung auf; in ihrer näheren Umgebung nahm Geneviève Farben wahr, die sich aus dem Dämmerungsgrau immer deutlicher herausschälten: Louis´ knallrotes Halstuch, sein Haar von stumpfem Braun, Georges´ blau gestreifte Hosen, eine gelb gestrichene Tonne, neben der sie die ganze Nacht gesessen hatte, ohne sie auch nur bemerken. Sie bildete sich ein, in der Ferne die englische Küste erkennen zu können. Der Wind blies unvermindert kräftig: eigentlich erstaunlich, dass sie nicht seekrank geworden war, denn das Meer war nicht besonders ruhig zu nennen.
Plötzlich spürte sie, wie steif und klamm ihre Glieder von der langen Nacht waren, die sie fast unbeweglich in der Kälte des Windes verbracht hatte; vor Aufregung, es könnte etwas schief gehen, hatte sie gar nicht so sehr gefroren. Nun erhob sie sich ungelenk und streckte sich ausgiebig, die Arme weit nach hinten ausgestreckt.
Unglücklicherweise ah Louis gerade in diesem Augenblick in ihre Richtung und stellte zu seiner Verblüffung fest, dass der junge Bursche eine etwas ungewöhnliche Figur besaß: zwar schlank, fast mager, aber an gewisser Stelle doch unverkennbar sanft gerundet. Na, das war aber mal eine angenehme Überraschung!
„He! Georges! Stell dir vor – das ist ja ein Mädchen!“, rief er aufgeregt und näherte sich, ein schmieriges Grinsen, das er wohl für sehr verführerisch hielt, im Gesicht, der zu Tode erschrockenen und völlig erstarrten Geneviève.
„Na“, fuhr er fort, während er sie auf eine Weise musterte, die ihr das Blut in die Wangen trieb, „so ein hübsches Kind! Steht dir gut, die Hose da. Und dir ist es nur drei lumpige Louis d´or wert gewesen, dass sie dir nicht deinen niedlichen Hals abgeschnitten haben? Also das nenne ich ganz schön undankbar. Da möchte ich schon noch ein bisschen mehr haben!“
Louis´ erste begeisterte Ausrufe hatte das Möwengeschrei übertönt. Nun erst bemerkte Georges, der am Bug beschäftigt war und dort Louis´ helfende Hand vermisste, dass am Heck offensichtlich etwas vor sich ging. Er befahl den beiden anderen, gut aufzupassen, und begab sich gemächlich nach hinten – gerade recht, um zu sehen, wie Louis Geneviève bei den Schultern gepackt hielt und sich über ihr abgewandtes Gesicht beugte. Sie wehrte sich verzweifelt, stemmte beide Hände gegen seine Brust und versuchte, ihn wegzuschieben – vergeblich, er war ja so viel stärker als sie und lachte nur über ihre wütenden Anstrengungen, sich von ihm zu befreien, ja, es schien ihn sogar nur noch mehr zu reizen.
„Lassen Sie mich los – ich will nicht – nein!! Georges, Georges, zu Hilfe! Nehmen Sie sofort ihre Hände weg! Georges!!“
Louis packte sie nur noch fester, zog sie noch enger an sich und knurrte gereizt: „Nun zier´ dich doch nicht so! Kannst deinem Retter ja wohl einen kleinen Gefallen tun. So ein leckeres Püppchen hab ich noch -“
An dieser Stelle seiner feurigen Liebeserklärung fühlte er sich plötzlich um die eigene Achse gedreht, verlor das Gleichgewicht und wurde unsanft auf das Deck geschleudert. Bevor er sich wieder aufrappeln konnte, stand Georges breitbeinig über ihm, eine Hand in der Hosentasche und in den Augen einen Ausdruck, der Louis nichts Gutes ahnen ließ.
„Das wirst du gefälligst schön bleiben lassen, du Widerling!“, fauchte er den Verdutzten an, der unsicher zu ihm aufblinzelte. „Wir schaffen sie bestimmt nicht deshalb nach England, damit du sie belästigen sollst. Also lass gefälligst deine dreckigen Pfoten von ihr, hast du verstanden?“
Das nahm Louis denn doch übel auf: „Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Bist du vielleicht was Besseres als ich? Und die da, die ist sich wohl zu schade für einen ehrlichen Kerl? Aber jetzt weht ein anderer Wind – feine Leute gibt´s in Frankreich nicht mehr!“
Mit diesen Worten sprang er auf und wollte auf Georges los. Doch der machte sofort einen Satz zurück und zog die Hand aus der Hosentasche. Der im fahlen Morgenlicht blinkende Gegenstand in seiner Hand ließ Louis auf der Stelle zur Salzsäule erstarren – mit diesem scharfen Messer wollte er nicht so gerne Bekanntschaft schließen.
Gebannt starrte er auf Georges´ Hand und schluckte trocken, als Georges leise und überdeutlich sagte: „Ich stech´ dich ab wie ein Schwein, Louis, wenn du noch einmal deine dreckigen Hände nach dem Mädchen ausstreckst – ist das klar? Also benimm dich gefälligst!“
„Das wirst du noch bereuen“, zischte Louis erbost.
Geneviève, die dem Gespräch atemlos gelauscht hatte, erschauerte, als sie seinen bösartigen Unterton wahrnahm. Ob er wohl Georges, Jean-Baptiste, ja, alle ihre treuen Freunde vor eines dieser Revolutionstribunale schleppen würde – aus Rache?
Doch Georges schien von solchen Ängsten nichts zu spüren; offensichtlich hatte er sich schon öfter in einer derartigen Situation befunden. „Wenn ich das bereue“, erwiderte er gelassen und begann, sich mit dem mörderischen Instrument gemächlich die Fingernägel zu säubern, „dann wirst du es noch viel mehr bereuen. Du hast dich bereitgefunden, für Geld einer Feindin der Republik“, dabei zwinkerte er Geneviève, zu, „ja, einer Feindin der Republik zur Flucht zu verhelfen -“
„Dazu hast du mich gezwungen!“
„Kannst du nicht beweisen. Du hast schon vorher davon gewusst und hundert Louis d´or dafür bekommen-“
„Was?“, heulte Louis auf, dem ja nicht einmal ein Zwanzigstel dieser märchenhaften Summe angeboten worden war.
„Hundert Louis d´or“, wiederholte Georges seelenruhig, weiter seine Nägel putzend und scheinbar ganz in diese Arbeit vertieft, ohne jedoch Louis auch nur einen Moment aus den Augen zu lassen.
„Ich konnte dich ja nicht davon abhalten – ja, du hast mich gezwungen, meinen Kutter zur Verfügung zu stellen. Das wird das Gericht gar nicht freuen. Und die liebe Anne wird es auch nicht gerne hören, dass du von unserem Passagier hier nicht die Finger lassen konntest – wahrscheinlich lässt sie dem Gericht dann gar nicht mehr viel zu tun übrig.“
„Das wird dich den Kopf kosten!“, schleuderte Louis ihm wutentbrannt entgegen.
„Mag sein, aber wenn ich zum Schafott gehe, gehst du mit – das verspreche ich dir. Wenn ich auch nur den geringsten Ärger mit den Behörden habe, dann ziehe ich dich sofort mit hinein, da kannst du sicher sein.“
Georges´ entschlossene Haltung machte auf Louis endlich den gewünschten Eindruck; er zuckte mit den Schultern und gab mürrisch nach: „Also schön – aber schade ist es doch. Ich habe noch nie eine feine Dame – das ist sie doch, sonst müsste sie ja nicht abhauen, oder? – ich hab noch nie eine feine Dame ge-“
„Jetzt halt endlich dein verdammtes Maul und scher dich nach vorne!“
Louis knurrte noch etwas Unfreundliches und trollte sich.
Geneviève duckte sich tiefer in ihre Ecke und dachte über das Gehörte nach. Ganz genau wusste sie ja nicht, was Louis mit ihr vorgehabt hatte, aber sie konnte es sich schon denken. Entsetzlich, wenn Georges ihn nicht an seinem abscheulichen Vorhaben gehindert hätte! Sie versank in Gedanken und schreckte erst nach längerer Zeit wieder hoch. Immer mehr Möwen umkreisten kreischend den Kutter, die Sonne stand schon recht hoch am Himmel, es wurde erheblich wärmer – und die Felsenküste Englands war schon ein gutes Stück näher gerückt. Nach ihrer Ansicht musste es mindestens Mittag sein. Nachdem weitere Zeit verstrichen war, konnte sie fasziniert beobachten, wie die Felsen von Minute zu Minute größer wurden und schließlich zum Greifen nah schienen. Das mussten wohl diese Kreidefelsen sein, von denen Miss Carpenter, ihre Gouvernante, immer erzählt hatte. Georges und die anderen manövrierten herum, bis der Kutter in eine kleine Bucht glitt, wo er vor neugierigen Augen geschützt war. Geneviève blickte ins Wasser: Das Meer schien so hell, dass es nicht mehr sehr tief sein konnte; sie bildete sich sogar ein, den Boden erkennen zu können.
Vor ihr dehnte sich ein breiter Schlammstreifen, dem ein kleiner Strand folgte; danach erhob sich unmittelbar die Felswand, die, wie sie nun erkennen konnte, nicht ganz so steil war wie zunächst vermutet und dafür mit Gras und Sträuchern bewachsen war.
Sie ging auf Georges zu, der einige Schritte von ihr entfernt stand und mit dem Ruder hantierte, und fragte ihn, warum er denn nicht näher an die Küste heranfahre. George blickte kaum auf. „Näher geht es nicht, sonst laufen wir auf Grund. Ich muss Sie hier absetzen. Das Wasser ist höchstens hüfthoch, Sie müssen an Land waten. Tut mir leid, aber in der Sonne werden Sie ja bald trocknen. Wenn Sie an den Steilhang kommen, werden Sie merken, dass da ein Weg hinaufführt – ich kenne diese Bucht ganz gut. Ober gibt´s ein Wirtshaus und wahrscheinlich auch eine Poststation. Tja, und jetzt steigen Sie wohl am besten aus.“
Sie nickte, dann gab sie sich einen Ruck, wandte sich dem äußerst mürrischen Louis zu und streckte ihm die Hand entgegen, die er nach anfänglicher Verblüffung ergriff. „Leben Sie wohl – und vielen Dank, Sie haben mich gerettet!“ Das Lächeln, das diese Worte begleitete, verfehlte nicht seine Wirkung, nämlich Louis von seinen Rachegedanken abzubringen. Er schenkte ihr ein schiefes Grinsen und sagte widerstrebend: „Na, viel Glück – und nichts für ungut!“
Sie lächelte ihm noch einmal zu und lief zum Heck des Kutters zurück, wo Georges auf sie wartete, um ihr beim Aussteigen behilflich zu sein. Sie dankte auch ihm und sprach die Hoffnung aus, ihm möchten aus diesem Unternehmen keine Unannehmlichkeiten erwachsen. Er beruhigte sie: „Mit Louis werde ich schon fertig, dem ist bloß die lange Nacht zu Kopf gestiegen.“
Auf ihre Anfrage hin teilte er ihr noch mit, es sei jetzt – er blicke schätzend zum Himmel – etwa elf Uhr. „Wir haben also dreizehn Stunden gebraucht – keine schlechte Leistung, oder?“ Geneviève versicherte ihm höflich, wenn auch völlig unzutreffend, die Zeit sei ihr wie im Fluge vergangen. Sie entledigte sich ihrer Schuhe und Strümpfe und krempelte die Hosenbeine hoch, so gut es eben ging; Georges stützte sie, als sie sich vorsichtig ins Wasser hinabließ, um nicht nasser zu werden als es unbedingt nötig war. Georges reichte ihr Schuhe und Strümpfe nach; zum Dank dafür teilte sie ihm erfreut mit, das Wasser sei kaum noch knietief.
Darüber war Georges nun weniger glücklich; er stieß einen kräftigen Fluch aus und schickte sich an, sofort aus diesen seichten Gewässern zu verschwinden, bevor sie womöglich noch festsaßen.
Geneviève winkte ihm noch einmal zu und watete vorsichtig ans Ufer, Holzschuhe und Strümpfe in der hoch erhobenen Hand. Als sie den feuchten Schlickstreifen erreichte und sich umdrehte, sah sie den Kutter mit vollgeblähten Segeln bereits erstaunlich weit vor der Küste kreuzen. Am Strand angekommen, setzte sie sich auf einen großen Stein, der einladend in der vollen Mittagssonne stand, und dachte über ihre Lage nach, während ihre Beine trockneten.
Was sollte sie jetzt wohl am besten tun? Mit der Sprache hatte sie zwar keine Schwierigkeiten, da ihr Vater seltsamerweise gewünscht hatte, dass sie die englische Sprache erlernte – deshalb hatte sie zwei Jahre lang eine englische Gouvernante gehabt, eben jene Miss Carpenter; aber ansonsten fühlte sie sich hilflos wie ein neugeborenes Kind.
Sie besaß achtzehn Louis d´or, Kleider, in denen sie bewohnte Gegenden am besten mied, und hatte keine Ahnung von den englischen Sitten und Gebräuchen, da sich in ihrem Kopf die halb vergessenen Erläuterungen von Miss Carpenter und die zahlreichen Vorurteile ihres Vaters zu einem kunterbunten Durcheinander mischten. Durfte sie überhaupt gestehen, dass sie aus Frankreich kam und geflohen war? Sie wusste, dass Frankreich Krieg führte gegen Österreich, die Heimat der Königin, aber ob es sich auch mit England im Kriegszustand befand, war ihr nicht ganz klar.
Und falls Frieden herrschte zwischen England und Frankreich, wie konnte sie sicher sein, dass es nicht auch hier Revolutionsfreunde gab, die sie irgendwie nach Frankreich zurückschaffen würden? Die Engländer, das wusste sie aus den Äußerungen ihres Vaters, waren ein raues und rasch entschlossenes Volk, mit barbarischen Manieren und ohne Kultur; sie würden gewiss äußerst unfreundlich zu ihr sein. Warum nur hatte Tante Anne einen solchen Barbaren geheiratet? Aber hätte sie es nicht getan, so hätte Geneviève überhaupt nicht gewusst, wohin sie hätte gehen können. Nur musste sie erst einmal zu ihr gelangen!
Sie fühlte sich seltsam verzagt, die ganze Abenteuerlust, die es ihr ermöglicht hatte, die vergangene Nacht ohne hysterische Anfälle zu überstehen (selbst in den kritischsten Situationen hatte sie ein Gefühl der Spannung nicht ganz unterdrücken können), schien verflogen zu sein.
Schließlich gab sie sich einen Ruck und zwang sich, ihre Gedanken dem Nächstliegenden zuzuwenden: Hier konnte sie jedenfalls nicht bleiben.
Sie beschloss, den Steilhang zu erklimmen, sobald sie getrocknet war, und nach dem Wirtshaus zu suchen, von dem Georges gesprochen hatte. Vielleicht gab es dort eine Wirtin, der sie sich anvertrauen und die ihr mit einem alten Kleid aushelfen konnte. Von dort aus musste sie dann versuchen, nach London zu gelangen – hoffentlich gab es hier in der Nähe eine Poststation! Die Adresse ihrer Tante wusste sie auswendig, South Audley Street – im feinsten Teil von London sei das, hatte ihr Miss Carpenter einmal versichert. Immer mehr bereute sie, dass sie Miss Carpenter eigentlich nur dann aufmerksam zugehört hatte, wenn es um die englische Sprache ging, die ihr Spaß machte, aber nie bei allgemein kulturellen Belehrungen.
Sie hatte auch nicht die blasseste Ahnung, wie viel achtzehn Louis d´or in englischem Geld wert waren und ob man damit überhaupt die Post nach London bezahlen konnte – aber das würde sich schon finden.
Sie stellte fest, dass während dieser Überlegungen die Sonne das Ihrige getan und sie getrocknet hatte. So schlüpfte sie wieder in Strümpfe und Schuhe, nicht ohne sich erneut zu fragen, wie die Bauern nur in diesen Dingern gehen konnten, und suchte den Pfad, der Georges zufolge die Küste hinaufführen sollte. Er war, wie sie entdeckte, geradezu schwindelerregend steil; mit Holzpantinen würde sie jedenfalls niemals dort hinaufkommen, so viel stand fest. Also zog sie die Schuhe wieder aus und stopfte sie nach kurzem Überlegen in ihre Jackentaschen. Dort waren sie ihr zwar ziemlich im Weg, aber eine andere Möglichkeit fiel ihr nicht ein.