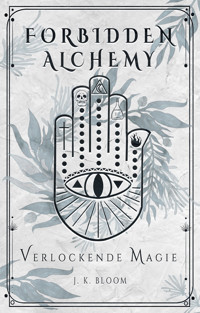Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Drachenhexe
- Sprache: Deutsch
Einst belegte eine mächtige Hexe Prinzessin Freyja mit einem Fluch. Dieser war so abscheulich, dass sie zu einem wahren Monster ohne Gewissen heranwuchs, während dämonische Kräfte in ihr erwachten. Sie stürzte ihre Eltern vom Thron und ummantelte ihr Königreich mit ewiger Dunkelheit, in die kein Außenstehender mehr einen Fuß zu setzen wagte. Erst als mit Lucien ein Engel geboren wird, schöpfen die fünf Lande wieder Hoffnung. Denn seine Aufgabe soll es sein, die dunkle Königin nach einem Jahrhundert ihrer Herrschaft zu vernichten und dem Verderben ein Ende zu setzen. Doch als Licht und Schatten aufeinandertreffen, merkt Lucien, dass da noch ein Funken der guten Prinzessin in Freyja verborgen zu sein scheint – und begeht einen verhängnisvollen Fehler: Er zögert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Landkarte
Zur Hexe geboren
Zur dunklen Königin erkoren
Die erste Vision
Das Engelskind
Engelserwachen
Die Drachenhexe
Der Engel
Ein Schicksal voller Unklarheiten
Die Prinzessin
Die zweite Vision
Verlust der Macht
Gebrochenes Herz
Die dritte Vision
Die Dunkelheit
Lia
Die vierte Vision
Bittere Kälte
Der Rote Korn
Freundschaft auf dunklen Pfaden
Das Spiel mit dem Hexenkuss
Die Rückkehr der Dunkelheit
Im Garten der Prinzessin
Das Schneefeuer
Trümmer und Scherben
Vertrauen und Liebe
Dunkle Schatten
Die Bürde einer Königin
Der wahre Schein
Das dunkle Engelsmal
Dank
J. K. Bloom
Die
Drachenhexe
Band 1: Licht und Schatten
Fantasy
Die Drachenhexe (Band 1): Licht und Schatten
Einst belegte eine mächtige Hexe Prinzessin Freyja mit einem Fluch. Dieser war so abscheulich, dass sie zu einem wahren Monster ohne Gewissen heranwuchs, während dämonische Kräfte in ihr erwachten. Sie stürzte ihre Eltern vom Thron und ummantelte ihr Königreich mit ewiger Dunkelheit, in die kein Außenstehender mehr einen Fuß zu setzen wagte.
Erst als mit Lucien ein Engel geboren wird, schöpfen die fünf Lande wieder Hoffnung. Denn seine Aufgabe soll es sein, die dunkle Königin nach einem Jahrhundert ihrer Herrschaft zu vernichten und dem Verderben ein Ende zu setzen.
Doch als Licht und Schatten aufeinandertreffen, merkt Lucien, dass da noch ein Funken der guten Prinzessin in Freyja verborgen zu sein scheint – und begeht einen verhängnisvollen Fehler: Er zögert.
Die Autorin
J. K. Bloom schreibt schon, seit sie elf Jahre alt ist. Das Erschaffen neuer Welten ist ihre Leidenschaft, seitdem sie das erste Mal ein Gefühl für ihre Geschichten bekam. Sie ist selbst abenteuerlustig und reist sehr gern. Wenn sie ihre Nase nicht gerade zwischen die Seiten eines Buches steckt, schreibt sie, beschäftigt sich mit ihren zwei Katzen oder plant schon die nächste Reise an einen unbekannten Ort.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Oktober 2019
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2019
Umschlaggestaltung: Jaqueline Kropmanns
Lektorat: Sternensand Verlag GmbH | Natalie Röllig
Korrektorat: Jennifer Papendick
Karte: J. K. Bloom
Illustration S. 100: Laura Battisti |The Artsy Fox
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-089-8
ISBN (epub): 978-3-03896-090-4
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Regina,
weil wir einfach das Böse lieben
Zur Hexe geboren
Freyja
Ich atmete den Duft von Rosenblüten und Veilchen ein. Um mich herum zwitscherten die Vögel, und der Wind brachte durch seine sanften Böen die Blätter zum Rascheln.
Gelangweilt lag ich auf einer Bank im Schlossgarten, den Blick zum hellblauen Himmel gerichtet, und ließ in meiner Hand eine Flamme entstehen. Ihre Kraft entfachte ein Kribbeln an meinen Fingerspitzen und ich war erstaunt, mit welcher Leichtigkeit ich das Feuer mittlerweile beschwören konnte. Die Magie, die mir innewohnte, war ebenso wie ich noch jung und entsprechend klein, doch ich wusste, dass sie mit jedem Jahr, mit dem ich älter wurde, wuchs.
Als ich gerade wieder die handgroße Flamme verschwinden ließ, hörte ich ein Rascheln, das in unmittelbarer Nähe bis zu meinen Ohren drang. Neugierig erhob ich mich und erschrak, als ich in die blauen Augen eines Adelskindes schaute, das hier am Hofe lebte. In seinem Ausdruck las ich Zorn.
»Hexe!«, beschuldigte es mich.
»Hexe!«, ertönte eine weitere Stimme hinter einem der Rosenbüsche.
Wut keimte in mir auf. »Ihr wagt es, eure künftige Königin zu beleidigen?«, warf ich den Kindern an den Kopf, die schon zum zweiten Mal kamen, um mir meinen Fluch vorzuhalten.
Die Geschichte der verfluchten Prinzessin von Menam – meine Geschichte – war in aller Munde. Ein Magier des königlichen Hofes hatte damals, als meine Kräfte im Kleinkindalter das erste Mal sichtbar wurden, den Fluch festgestellt und behauptet, dass nur eine Hexe zu so etwas imstande sei. Wer sie war oder warum sie das getan hatte, konnte allerdings niemand sagen. Natürlich hatte ich seither versucht, herauszufinden, was es mit diesem Fluch auf sich hatte, aber ich war noch ein Kind und meine Möglichkeiten waren begrenzt. Und meine Eltern schwiegen eisern, sobald ich ihnen Fragen stellte – als ob sie dadurch den Fluch ungeschehen machen könnten. Stattdessen schleppten sie mich in die Kirche, wollten, dass ich jeden Tag zu Gott betete, und versuchten, mich mit heiligen Ritualen zu läutern. Bisher hatte jedoch nichts gewirkt, meine Kräfte waren geblieben und mit jedem Jahr noch stärker geworden.
»Hexen muss man verbrennen«, hörte ich ein Mädchen rufen, das aus einer der geschnittenen Lorbeer-Hecken sprang. »Nur Feuer kann sie töten.«
Ich sah mich um und erkannte die vielen Kinder, die mich nun umzingelt hatten. Einige kamen hinter den Büschen hervor und traten auf dem knirschenden Kiesweg zu mir. Es waren nicht nur adelige darunter, sondern auch welche vom gemeinen Volk, die sich anscheinend Zutritt zum Schlossgarten verschafft hatten. In ihren Augen konnte ich Hass und Abscheu lesen, als wäre ich die Verkörperung eines Monstrums.
Gerade als ich mich ihnen entziehen wollte, da ihre Überzahl mir Unbehagen bereitete, packte der Junge mit den blauen Augen mein Handgelenk.
Ich schaute ihn erschrocken an und bemühte mich, mich aus seiner Umklammerung zu befreien, doch er ließ nicht von mir ab. »Du gehst nirgendwohin, Hexe!«
Im selben Moment, in dem ich nach ihm treten wollte, landete eine Faust schmerzhaft auf meinem linken Auge. Ich schrie auf, riss mich endlich von dem Jungen los und hielt mir beide Hände an die pochende Stelle.
»Wie kannst du es wagen?«, knurrte ich in einem gebieterischen Ton – genauso wie es meine Mutter, die Königin, tat, wenn sie jemanden ihren Zorn spüren ließ.
Doch im Gegensatz zu ihr war es mir nicht möglich, Gnade walten zu lassen. Mitleid, Güte, Vergebung … das waren für mich, seit ich denken konnte, nur leere Worte. Dinge, die mich die Kirche lehren wollte, um mich zu einem besseren Menschen zu machen. Früher hatte ich noch versucht, solche Gefühle zu empfinden, aber inzwischen war ich überzeugt, dass es einen guten Grund gab, warum ich es nicht können sollte. Mitleid war Schwäche, Güte Verschwendung, Vergebung eine Lüge. Das waren die Worte, die mir eine innere Stimme immer zuflüsterte, wenn ich mich einsam fühlte. Dann ging es mir sofort wieder besser, und mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt, allein zu sein, weil niemand mit mir spielen wollte. Ich war sogar froh darüber.
Aber diese Kinder hatten mich zu ihrem Feind gemacht und diesen sollten sie nun kennenlernen.
»Auf sie!«, schrie der Blauäugige, und die Kinder kamen aus ihren Deckungen hervorgeschossen. Sie quetschten sich teilweise durch die hohen Hecken und Büsche, ignorierten die Dornen, die ihnen dabei ihre Haut und die Kleidung aufkratzten.
Dornen … kam es mir in den Sinn.
Da ich nicht größer als diese Kinder war, traten sie mich mit Leichtigkeit nieder. Auf dem Boden zerrten die Mädchen an meinen Haaren und die Jungs stießen mir ihre Füße hart in die Magengrube. Schmerzhaft krallten die Kinder ihre Fingernägel in meine makellose Haut, hinterließen mit ihren Faustschlägen pochende Stellen in meinem Gesicht, während ich laut aufschrie und innerlich darum flehte, von der Erniedrigung befreit zu werden.
Ich schloss die Augen und krümmte mich auf dem Boden zusammen. Sie wollten einfach nicht aufhören, mir weiterhin wehzutun.
Was habe ich ihnen denn getan?
Wenn sie glaubten, dass ich – das Böse – den Tod verdient hätte, weil ein Fluch auf mir lag, dann sollten sie auch meine Macht zu spüren bekommen.
Dornen sollen ihre Haut genauso leidvoll zerkratzen, wie sie meine mit ihren Fingern aufschürfen. Die scharfen Stacheln sollen sich um ihre kleinen Körper winden und sie zerquetschen. Wenn sie dann, in all ihrer Pein, um Gnade flehen, werde ich ihnen keine gewähren. Sie sollen schreien, weinen und den Fehler bereuen, ihrer Königin Leid zugefügt zu haben …
Kaum hatte ich an dieser Vorstellung festgehalten, die so mächtig und stark in meinen Gedanken klang, hörten die Schläge abrupt auf.
Als ich die Augen öffnete, sah ich Blutstropfen in den grauweißen Kies fallen. Ich erblickte neben den roten Flecken eine dicke Dornenranke, die sich aus dem Boden um eines der Kinder geschlungen hatte. Als ich mich umsah, erkannte ich, dass jedes der Kinder an einer der Ranken hing. Die scharfen Stacheln hatten sich durch ihr Fleisch gefressen, ihre Knochen gebrochen und ihnen das Leben ausgehaucht.
Ich schaute zu den blassen Gesichtern hinauf, deren Augen geschlossen waren. Selbst der Mund war zu einem Schrei geöffnet, doch die Dornen hatten ihnen keine Zeit gegeben, diesen aus ihrer Kehle herauszulassen.
Ich erhob mich vom Boden und zählte acht Dornenranken, wovon jede ein Kind umschlungen hielt. Als ich an den Toten vorbeilief, fand ich ein Mädchen mit aschblonden Haaren vor, aus dessen Mund Blut rann, das am Kinn zusammenlief und hinabtropfte. Der kleine Körper zuckte und aus der Kehle drangen erstickte Laute. Ihre ängstlichen Augen baten mich still um Gnade, flehten darum, verschont zu werden.
Doch statt Mitleid zu empfinden, überkam mich Hochmut.
Ich hatte gesiegt. Ich war ihre Königin. Und sie waren selbst schuld daran, dass ich ihnen ihr kostbarstes Gut genommen hatte. Ihr Leben.
Ausdruckslos ging ich auf das blonde Adelskind zu und musterte den blutenden Körper. Dabei ließ ich die Hände über sein aufgeschürftes Gesicht gleiten – stolz auf mein vollendetes Werk. Aus dem Mundwinkel lief ein Blutrinnsal, das ich sorgsam mit dem Finger wegwischte.
»So zerbrechlich …«, hauchte ich und ein kleines Lächeln stahl sich auf meine Lippen. »Du hättest besser nicht mit dem Feuer spielen sollen.«
Das Mädchen versuchte ein letztes Mal, nach Luft zu ringen, bevor die schweren Wunden ihren Tribut forderten. Es tat einen letzten Atemzug und die hellblauen Augen wurden mit einem Mal leer.
»Oh Herr!«, hörte ich eine mir bekannte Stimme vor Entsetzen aufschreien. »Was hast du getan?«
»Freyja!«, rief mein Vater Aurum, der König Menams. »Sag mir nicht, dass du das warst, Kind.«
Ich drehte mich zu den beiden um und sah, ohne dabei eine Miene zu verziehen, in ihre ängstlichen Gesichter. »Ungehorsam muss bestraft werden.«
Danach wischte ich mir das Blut von der Stirn und kehrte ihnen den Rücken zu. Mutter hörte ich leise in ihre Hände weinen, während ich nicht einmal einen Gedanken daran verschwendete, meine Tat als Sünde anzusehen.
Am nächsten Tag …
Der Himmel war bewölkt, als ich am Fenster meines Schlafgemaches stand und zum Vorhof des Schlosses hinunterschaute. Regen prasselte unentwegt auf die Erde ein und vor den Toren des Schlosses entdeckte ich eine wütende Meute. Adelsleute und einige Mittelständler hielten brennende Fackeln in den Händen, von denen die meisten durch den Regen gelöscht wurden. Unter dem Steinbogen, am Gatter des Tores stehend, drückten die Menschen ihre Fackeln hindurch und forderten aufgebracht das Königshaus auf, die Hexe zu verbrennen. Mich, die Mörderin ihrer Kinder.
Der gestrige Vorfall hatte sich herumgesprochen und die Leute verurteilten mich als dämonisches Wesen mit dunkler Magie. Sie wollten mich an einen Pfahl binden und ein Feuer entzünden, um meinem Dasein ein Ende zu setzen. Die Eltern waren mehr als entsetzt über den Tod ihrer Adelskinder. Zornerfüllt hatten sie eine ganze Schar zusammengetrieben, die nun am Tor stand und meinen Kopf forderte.
»Freyja«, hörte ich die Stimme meines Vaters. »Bitte sieh dir das nicht an.«
Ich wagte es erst gar nicht, mich zu ihm umzudrehen, da ich wissen wollte, ob die Meute es schaffte, das Tor aus ihren Angeln zu reißen und ins Schloss einzudringen. Doch wie es schien, waren sie dafür nicht stark genug. »Warum nicht?«
»Deine Mutter und ich wissen, dass es ein Unfall gewesen ist. Du hattest deine Kräfte nicht unter Kontrolle«, erklärte mein Vater, doch seine Lippen zitterten, was mir Aufschluss darüber gab, dass er sich vor mir fürchtete.
Die Kinder hatten gestern ebenfalls Angst gehabt. Am Anfang erschien es ihnen ein Leichtes zu sein, auf mich einzuschlagen und meine Haut zu zerkratzen. Doch als sie Zeuge meiner Macht wurden, änderte sich diese Ansicht und sie verstanden viel zu spät, dass sie einen Fehler begangen hatten.
Ich bereute ihren Tod nicht. Keinen einzigen. Wenn ich an ihre leblosen, mit Blut besudelten Körper zurückdachte, überkam mich sogar Stolz. Diese Kinder hatten mich entwürdigen wollen und dafür waren sie bestraft worden.
»Sie haben mich geschlagen und getreten, Vater«, erklärte ich mit ausdrucksloser Stimme. »Sie haben mich als Hexe bezeichnet.«
»Du bist keine Hexe«, behauptete er. »Du bist meine Tochter.«
Nun wandte ich mich doch zu ihm und legte den Kopf schief. Unter Vaters Augen erkannte ich dunkle Ringe und er wirkte sehr müde, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. »Was ist eigentlich genau eine Hexe? Warum werden sie in allen Büchern für das Böse gehalten? Wegen ihrer Magie? Magier besitzen diese doch auch!«
Mein Vater setzte sich auf den Rand des Bettes. »Weißt du, die Hexen sind Diener des Teufels, Boten der Hölle. Ihre Magie ist dunkel und gefährlich. Sie bringt kein Leben, sondern nur den Tod.« Er presste die Lippen aufeinander und senkte den Blick. »Die Magier haben ihre Magie vom Himmel. Sie spendet Trost, heilt und vollbringt Gutes. Das ist etwas vollkommen anderes, verstehst du?«
Ich war also doch eine Hexe. Die Kinder starben durch meine Macht. »Aber dann haben diese Menschen da draußen doch recht. Ich bin eine Hexe, die dunkle Magie besitzt.«
Mein Vater sprang auf und schüttelte den Kopf. »So darfst du nicht denken. Es gibt auch … weiße Hexen, die ihre magischen Kräfte für das Gute verwenden und sich von der Hölle abgewandt haben.«
»Ich diene dem Teufel ja gar nicht. Wie kann ich dann über diese Kräfte verfügen?«, wollte ich wissen.
Er seufzte und nahm meine Hände in seine. »Freyja, bitte hör auf zu denken, du wärst eine Hexe. Du bist keine.«
Er zitterte, das konnte ich spüren. Warum log Vater mich an? Selbst in seinen Augen erkannte ich, dass er mir nur etwas vormachte.
Ich löste mich von ihm, drehte den Kopf weg und schaute wieder aus dem Fenster. In mir fühlte sich alles so leer an. Mein Vater wollte in mir irgendein Gefühl auslösen, über das ich allerdings nicht verfügte. Er glaubte, dass ich mich vor meinen Fähigkeiten fürchtete oder sie nicht akzeptieren konnte, doch da irrte er sich. Die Macht, die mir innewohnte, bläute den Menschen Angst und Respekt ein, was mir immer mehr gefiel. Schließlich hatte ich damit den Kindern Einhalt geboten, die auf mich losgegangen waren. Warum sollte es nicht auch mit dieser Meute klappen, wenn sie es schaffen würden, bis zu mir durchzudringen?
Nein, ich mochte meine Fähigkeiten. Sie waren stark, mächtig und schafften mir die Menschen vom Hals, die mir etwas Böses wollten.
»Freyja …«, begann mein Vater, doch dann kam eine dritte Stimme hinzu, die unser Gespräch unterbrach.
»Liebling, kommst du mal?«, hörte ich meine Mutter rufen, die in mein Gemach getreten war.
Ich drehte mich zu ihr. In ihrem Blick lag etwas Hoffnungsvolles, was mich gleich neugierig werden ließ. »Was gibt es, Mutter?«
Ihr goldblondes Haar, das meinem sehr ähnelte, hatte sie seitlich zu einem langen Zopf geflochten. Auf ihrem Kopf trug sie die gezackte Krone Menams. Sie verschränkte die Hände vor dem Körper und lächelte sanft. »Ich möchte dir etwas zeigen.«
Verwundert hob ich eine Augenbraue. »Und was?«
Sie wandte sich zum Gehen und schaute noch über ihre Schulter zu mir zurück. »Komm, ich zeige es dir.«
Da ich wissen wollte, was es war, folgte ich ihr zögerlich aus dem Zimmer heraus. Mein Vater gesellte sich schweigsam neben meine Mutter, als wüsste er bereits, um was es sich handelte.
Wir liefen in den Nordflügel und erklommen die Stufen des Turmes. Ich war hier noch nie gewesen, obwohl ich zwischen diesen kalten Steinwänden des Schlosses aufwuchs.
Als wir oben ankamen, standen wir vor einer massiven Eisentür, die mich beim bloßen Anblick frösteln ließ. In der Mitte entdeckte ich ein kleines Fenster mit Gitterstäben, durch das der Wind pfiff.
Was wollten wir hier?
Mutter öffnete die Tür mit einem rostigen Schlüssel und stieß sie mit einem Keuchen auf. Vater bedeutete mir hineinzugehen, doch ich zögerte.
Argwöhnisch blickte ich die beiden abwechselnd an. »Was ist dort?«
Mutters Lächeln verging, während sie den Raum betrat. »Es ist dein neues Schlafgemach.«
Aber ich mochte mein Zimmer. Wieso bekam ich ein neues?
»Das verstehe ich nicht«, entgegnete ich und spürte dabei gleichzeitig, wie Vater mir tröstend eine Hand auf die Schulter legte.
In seinem Blick lag etwas Einfühlsames. »Es ist nur vorübergehend.«
Da ich wissen wollte, wie das Zimmer von innen aussah, machte ich einen Schritt hinein und schaute um mich. In der hintersten Ecke entdeckte ich ein Bett, das mit weißen Seidenvorhängen verziert war, die von cremefarbenen Schleifen am Balken festgehalten wurden. Rosenroter Teppich überdeckte die Hälfte des kalten Steinbodens und ein Bücherregal füllte gemeinsam mit einem Holztisch die Leere. Trotz der kostbaren Möbel und der Aufwendigkeit fühlte ich mich hier unwohl.
Mit einem unzufriedenen Ausdruck wandte ich mich zu meinen Eltern. »Ich mag es nicht und will es nicht.«
Mutter stellte sich mit Vater an die Schwelle der Tür, sodass ich keine Chance hatte, an ihnen vorbeizugehen. »Es ist zu deinem Besten«, meinte er und Tivana nickte zustimmend.
Mein Blick glitt zu dem durch den Wind klappernden Fenster neben dem Bücherregal. »Aber … ich bin so weit weg von allem.«
Ich bemerkte, wie Mutter ihre Hand an die Klinke legte und meinen Vater zurück in den Flur drängte. In ihren Augen erkannte ich nun dieselbe Angst, die auch mein Vater zuvor gezeigt hatte. »Es ist nicht für immer.«
»Mutter!«, protestierte ich und wollte gerade auf sie zugehen, als bereits die Tür zuflog. Angsterfüllt stemmte ich die Arme gegen das massive Eisen und hämmerte mit meinen Fäusten darauf ein. »Lasst mich raus!«
»Wir wollen dich nur beschützen, Freyja«, rief mir meine Mutter noch zu. »Sie dürfen dich nicht auf dem Scheiterhaufen verbrennen.«
»Ich kann mich wehren«, schrie ich und schlug weiterhin auf das kalte Eisen. »Bitte!«
Doch es kam keine Antwort mehr. Ich hämmerte so lange auf die Tür ein, bis meine Hände wund wurden und zu brennen begannen. Als ich meine Magie zu Hilfe nehmen wollte, merkte ich, dass sie durch einen Bannzauber, der den Turm umgab, geschwächt wurde. Vermutlich steckte dahinter irgendein Magier, den meine Eltern beordert hatten.
Nach einer Weile ließ ich mich mit aufgeplatzten Händen und Blutergüssen an den Schultern an der Tür hinuntergleiten und blieb am Boden sitzen. Meine Heilungskräfte kümmerten sich nur langsam um die Verletzungen, sodass ich die Schmerzen noch ein wenig aushalten musste.
Wie konnten sie mir das nur antun? Sie sperrten mich einfach wie ein Tier in einen Käfig, um das Problem aus der Welt zu schaffen.
Neue Wut überkam mich und voller Verzweiflung schlug ich wild um mich, warf die Kissen quer durch das Zimmer, riss die Vorhänge von den Stangen und schleuderte einzelne Bücher gegen die Wand.
Ich verfluchte meine Eltern dafür, dass sie mich einfach hier zurückließen, um mich von der Außenwelt fernzuhalten. Warum taten sie mir das an? War das meine Bestrafung dafür, dass ich diese Kinder getötet hatte? Machten ihnen meine Kräfte solche Angst?
Irgendwann ließ ich mich auf die Knie fallen und legte das Gesicht in meine Hände. Tränen rannen mir über die Wangen und ich fühlte mich das erste Mal machtlos.
Machtlos, weil ich nicht fähig war, mich zu befreien.
Machtlos, weil ich durch meine Worte keine Freiheit gewann.
Machtlos, weil ich mich an meinen Eltern für ihre unverzeihliche Tat nicht rächen konnte.
In ihren Augen war ich schon immer das Böse gewesen. Die Hexe, die es einzusperren galt. Sie hatten mich nie wirklich als ihre Tochter betrachtet. Mit dem Turm schafften sie es, mich nun von den Menschen fernzuhalten, damit meine Kräfte keine weiteren Leben forderten.
Das werde ich ihnen niemals verzeihen. Niemals.
Nach ein paar Monaten erfuhr ich, dass meine Eltern die Lüge erzählten, sie hätten mich in ihrem Garten verbrannt und ich sei nun keine Bedrohung mehr für das Königreich.
Diese Behauptung machte mich rasend und ließ mich innerlich kochen. Wie konnten sie mich nur für tot erklären? Es bedeutete, dass sie mich aus diesem Turm nie wieder gehen lassen würden. Denn falls mich jemand erkannte, würde ihre Lüge auffliegen, und das durften sich meine Eltern als Herrscher von Menam nicht leisten.
Eine ewige Gefangenschaft also.
Das wäre die reinste Qual.
Ich fragte mich oft, wie sie behaupten konnten, meine Eltern zu sein, obwohl sie es zuließen, dass ich in all meiner Einsamkeit ertrank. Denn mit jedem Tag, der verging, wurde es schlimmer. Mein Hass wuchs und ich sehnte mich nach Vergeltung.
Eine Dienerin des Schlosses brachte mir immer dann etwas zu essen, wenn ich eingeschlafen war und sie sich in mein Turmzimmer hineinschleichen konnte. Zudem bekam ich einen großen Eimer mit frischem Wasser, wenn ich mich waschen sollte, und auch einen Nachttopf für meine menschlichen Bedürfnisse, den die Zofe regelmäßig leerte.
Meine Eltern ließen von den Magiern einen Magiewall in der Tür erstellen, der es verhinderte, dass ich entkam. Denn nachdem ich mehrmals versucht hatte, die Dienerinnen auszutricksen, um fliehen zu können – jedoch kläglich bei den Wachen scheiterte –, stellten sie jeden meiner Schritte unter Beobachtung, sobald jemand nur in meine Nähe kam. Vater rüstete seine Männer mit zusätzlichem magischen Schutz aus, den er in Alexandria, dem Magierorden, anfertigen ließ, damit diese meiner noch unausgereiften Macht trotzen konnten.
Sie wollten mit mir sprechen, um mir zu erklären, weshalb sie so handeln mussten. Doch ich hörte ihnen nicht zu.
Sie hatten mich einfach eingesperrt, weil sie meine Magie fürchteten. Aber was war mit ihrer Tochter, die sie angeblich nicht für eine Hexe hielten? Für das Böse? Warum sperrten sie mich dennoch ein, wenn sie von meiner Gutmütigkeit überzeugt waren? Ich könnte schließlich lernen, meine Macht zu kontrollieren.
An einem der heißen Sommertage las ich ein Buch, das mir eine der Dienerinnen brachte, da ich bereits alle anderen Geschichten kannte. Hier in dem Turm blieb mir nicht viel übrig, als zu tagträumen, aus dem Fenster zu sehen oder eben durch die Seiten eines Buches zu blättern.
Manchmal schaute mein Vater vorbei, um mit mir zu sprechen. Er kam nie herein, weil er noch immer Angst vor mir hatte. Stattdessen setzte er sich mit dem Rücken zur Tür und redete mit mir durch das kleine vergitterte Fenster.
Auch heute schien er nach mir zu sehen und ich schlug das Buch zu, als er durch die kleine Öffnung zu mir schaute. »Guten Abend, meine Kleine. Was liest du da?«
»Die schwarzen Seelen«, antwortete ich, legte die Geschichte auf den Nachttisch neben meinem Bett und ging zu meinem Vater hinüber.
Mit seinen grauen Augen blickte er in meine. »Und um was geht es?«
»Es geht um einen Krieger und eine Hexe. Sogar um dunkle Magie und Königreiche.« Ich strich mir eine aschblonde Strähne hinter das Ohr und verschränkte die Arme vor der Brust. »Alle sterben qualvoll.«
Er zog die Augenbrauen zusammen. »Wer hat dir das Buch gegeben?«
»Eine der Dienerinnen. Ich habe es ihr befohlen«, erklärte ich ihm mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen. »Alle anderen Bücher habe ich bereits gelesen.«
Mein Vater wirkte nervös und nicht glücklich darüber, dass ich diese Geschichte las. »Morgen bringe ich dir mal eines meiner Bücher mit, ja? Da geht es um Engel und Gott.«
Darüber hatte ich nur wenige Bücher gelesen, also nickte ich. Wenn ich schon keine Chance hatte, die Welt zu entdecken, dann musste ich es wenigstens durch die Geschichten tun. »Gut. Wo ist Mutter?«
Er senkte den Blick und umschloss mit den Fingern die Gitterstäbe des Fensters. »Ihr geht es nicht so gut.«
Obwohl ich noch immer Zorn für meine Eltern empfand, war da noch irgendetwas, was sich bei den Worten meines Vaters in mir regte. Es fühlte sich beinahe wie Angst an. »Wieso?«
»Sie ist krank und hat Fieber.« Er seufzte. »Aber langsam ist sie auf dem Weg der Besserung. Weißt du, deine Mutter sorgt sich um dich.«
Ich legte den Kopf schief. »Das verstehe ich nicht. Sie hat mich doch hier eingesperrt. Sollte sie dann nicht glücklich sein, mich weggeschlossen zu haben?«
Vater drückte seine Stirn gegen die Gitterstäbe. »Ja, ich weiß, aber genau das macht sie so traurig. Sie musste eine schwere Entscheidung treffen und hat deine Sicherheit gewählt. Wir brachten es nicht übers Herz, dich dem Feuer zu überlassen, also haben wir die Menschen angelogen, damit sie dich nach den Jahren irgendwann einfach vergessen.«
»Soll das etwa bedeuten, ich bleibe so lange hier, bis sie sich nicht mehr an mich erinnern können?«, wollte ich wissen.
Er nickte. »Genau. Und das wird auch nur noch eine Weile dauern. Dann kannst du wieder in dein altes Zimmer zurück. Ganz bestimmt.«
Meine Eltern sperrten mich also lediglich in den Turm, weil sie Angst hatten, dass ich verbrannt würde. Aber wie lange sollte es noch dauern, bis das Volk mich endlich vergessen hätte? Zehn Jahre? Zwanzig? Weniger als fünf?
»Ich will nicht warten. Es macht keinen Unterschied, ob ich in diesem Turm bin oder in meinem alten Zimmer«, protestierte ich weiter.
»Freyja«, begann mein Vater in einem traurigen Tonfall. »Bitte. Du wirst nicht ewig in diesem Turm bleiben.«
Aus irgendeinem Grund konnte ich seinen Worten keinen Glauben schenken. Sie würden mich niemals wieder gehen lassen – nicht solange meine Macht für sie eine Bedrohung darstellte. Eine leise, dunkle Stimme flüsterte innerlich: Er lügt.
Ich zischte herablassend und kehrte meinem Vater den Rücken zu. »Ich glaube dir nicht.«
»Freyja!«
Doch ich ignorierte ihn.
Eines Tages würde ich hier rauskommen. Aber nicht durch meine Eltern, sondern durch meine Kräfte. Und dann würde ich mich rächen. Rächen, für die qualvolle Zeit zwischen diesen kalten Wänden aus grauem Stein.
Sieben Jahre später …
Der Turm war mit der Zeit zu einem Ort geworden, den ich nur schwer akzeptieren konnte. Meine Eltern hatten sich immer mehr von mir distanziert, und ganz gleich, auf welche Weise ich auch versuchte zu entkommen, die Magie der Barriere, die in diesem Turm lag, war stärker.
Zweimal in der Woche kam ein Priester vorbei, der mit seinen Gebeten und Segnungen dunkle Magie bannen wollte. Dadurch schwächte er meine Kräfte und machte es mir unmöglich, diese gegen die magische Barriere einzusetzen.
Heute war mein sechzehnter Geburtstag und meine Eltern hatten beschlossen, mich besuchen zu kommen. In den letzten Jahren traute sich meine Mutter in mein Zimmer herein, um mir in all meiner Einsamkeit ein wenig Trost zu spenden. Wir wechselten nur wenige Worte, da ich ihre Anwesenheit nicht ertrug. Sie aus dem Weg zu räumen, hätte nichts gebracht, denn die Tür, durch die ich fliehen müsste, würde mich wegen ihrer Magie nicht hindurchlassen.
Ich hatte es schon oft genug versucht. Immer wieder und wieder plante ich neue Fluchtwege, doch jeder von ihnen war zum Scheitern verurteilt. Das Fenster konnte ich ebenfalls vergessen, denn ohne die Fähigkeit zu fliegen würde ich mich nur in den Tod stürzen.
Meine Magie war zwar mit den Jahren gewachsen, aber ich konnte sie nach wie vor nicht kontrollieren. Durch die regelmäßige Segnung des Priesters war es mir unmöglich, meine Macht zu entfalten, um Türen oder gar Wände zu zerbersten. Innerlich pochte sie jedoch wie ein wild schlagendes Herz, das sich mit jedem weiteren Klopfen durch meine Rippen zu drücken versuchte.
Als die Sonne am Horizont unterging, stand ich am Fenster und schaute auf die Stadt und damit auf die vielen Häuser hinunter, die unser Schloss umgaben. Zwischen den Straßen herrschte reges Treiben und auf dem großen Markt tummelten sich die Menschen für ein Fest.
Ich stellte mir vor, wie gern ich ebenfalls dort unten wäre und etwas anderes als diese grauen Wände und die trostlose Decke sehen könnte. Der Drang, nach draußen zu gehen, wurde mit jedem Jahr mächtiger.
»Freyja, wir wünschen dir alles Liebe zu deinem sechzehnten Geburtstag«, hörte ich meine Mutter vor der Tür sagen. »Dürfen wir reinkommen?«
Ich ignorierte sie schon seit vielen Monaten, gab ihr einfach keine Antwort mehr und tat so, als wäre sie nicht hier. Sieben verdammte Jahre hatten sie mich in diesem Raum gelassen und mir wieder und wieder versprochen, es wäre nicht für immer. Doch das hatte ich ihnen noch nie geglaubt. Sie sind Lügner.
Jemand kam ins Zimmer herein, und anhand der leichten Schritte wusste ich, dass es meine Mutter war. Der Magiewall flackerte hellblau auf, als würde er mich davor warnen, die nun geöffnete Tür zur Flucht zu nutzen. Kurz nach ihrem Eintreten fiel diese wieder ins Schloss und ich wusste, dass mein Vater draußen geblieben war. Mit den Jahren wurde seine Angst vor mir nur größer.
»Blau steht dir ausgezeichnet. Hat Ronja dir das Kleid genäht?«, fragte sie neugierig.
Ronja war unsere Schneiderin, die mir in den letzten Jahren meine Kleidung angefertigt hatte. Sie ließ sich nur dann sehen, wenn ihr keine andere Wahl blieb. Ihre Furcht spürte ich genauso deutlich wie die meines Vaters. Sie wusste um meine gefährliche Macht und wurde auch von meinen Eltern zur Verschwiegenheit verpflichtet. Genau wie einige Diener, die vorbeikamen, um mir etwas zu essen zu bringen.
Aber ich hatte all das langsam satt. Ihre falsche Liebe und dieser Turm trieben mich allmählich in den Wahnsinn. »Raus hier«, knurrte ich und ballte die Hand zur Faust. »Ihr habt hier nichts verloren.«
»Freyja, bitte.« Sie klang verzweifelt. »Wie lange willst du uns noch dafür hassen?«
»Ich werde nie wieder etwas anderes für euch empfinden können. Ihr seid die Monster, nicht ich«, fauchte ich und drehte mich wütend zu ihr um. »Ihr habt mich hier eingesperrt! Sieben verdammte Jahre lang! Also hört auf so zu tun, als würdet ihr damit etwas Gutes bezwecken.« Ich knirschte mit den Zähnen. »Ihr sorgt euch nur um eure eigene Sicherheit.«
Meine Mutter machte einen Schritt auf mich zu, doch ich wich ihr wieder aus, indem ich zurücktrat. »Du verstehst es einfach nicht, Liebes.«
Ganz gleich, wie viel Flehen auch in ihrem Blick lag, wie sehr sie versuchte, mich dennoch zu lieben, da ich ihr eigen Fleisch und Blut war, ich wollte ihre Geborgenheit nicht. »Verschwinde!«
»Tivana, lass sie«, hörte ich meinen Vater hinter der Tür rufen.
Sie wandte sich zu ihrem Ehemann. »Ich werde sie nicht aufgeben.«
Das ist absoluter Unsinn! »Ich habe gesagt, du sollst verschwinden.«
Meine Mutter zog die Augenbrauen zusammen und näherte sich mir erneut. »Nein.«
Da brach die aufgestaute Wut aus mir heraus. »VERSCHWINDE!« Doch sie dachte trotz meines lauten Schreis nicht daran, sich einschüchtern zu lassen. »Ich brauche euch nicht mehr!«
Der Zorn übermannte mich, nahm jede meiner Poren ein, sodass sich meine Macht wie eine alles überragende Mauer in mir aufbaute. Sie stieg immer höher und höher, bis ein schwarzer Nebel meinen gesamten Körper einhüllte.
›Vernichte sie‹, flüsterte eine weibliche Stimme in mir. ›Durchbrich die Magie. Du bist viel stärker.‹
Das Blut rauschte durch meine Adern wie eine brennende Glut. Mein Herz pochte unaufhaltsam in der Brust und eine enorme Kraft stieg von meinem Bauch zu meinen Schulterblättern, zwischen denen ich einen Druck spürte. Eine Art Glied oder Knochen drückte gegen meine Haut, wand sich und versuchte hervorzubrechen.
Ein kurzer Schmerz schoss durch meinen Rücken, als plötzlich etwas hinter mir explodierte.
»Großer Gott!«, rief mein Vater durch die Tür und riss diese auf. »Tivana, lauf!«
Meine Mutter stolperte rückwärts, als sie mich mit solcher Angst in den Augen ansah, wie ich es zuletzt bei dem Adelskind gesehen hatte, das ich vor sieben Jahren durch meine Dornenranken tötete.
Ehe ich begriff, was mit mir passiert war, nahm ich plötzlich ein neues Glied an meinem Rücken wahr, das ich sowohl lenken als auch bewegen konnte. Im Augenwinkel entdeckte ich das Daumengelenk eines Fledermausflügels, das eine tödliche Kralle besaß.
Moment mal. Das sind meine Flügel!
Fasziniert von dem, was ich sah, berührte ich die feinen Häute und die starken Gelenke. Sie fühlten sich kraftvoll an und ragten beinahe bis zur Decke.
»Tivana! Komm!«, rief mein Vater erneut und lief zu ihr hin, um ihr beim Aufstehen zu helfen.
›Nun flieg‹, flüsterte die innere Stimme mir zu. ›Flieg in deine Freiheit!‹
Ich wandte mich zum Fenster und spürte ein Zucken in meinem Arm. Wie aus einem Instinkt heraus hob ich diesen, und eine enorme Druckwelle schoss aus meiner Hand heraus, um das Fenster in tausend Splitter zu zertrümmern. Klirrend fielen die Scherben zu Boden, während meine Eltern mir entsetzt dabei zusahen, wie ich auf die Öffnung in der Wand zuging.
»Freyja, nein! Bitte! Bleib hier«, schrie meine Mutter angstvoll, doch mein Vater hielt sie zurück.
Ich ignorierte ihr Flehen und nutzte die Chance, die mir geboten wurde.
Feuchte, kühle Luft wehte in mein Gesicht, als ich an das Fenster herantrat und ein Bein auf den Rahmen setzte. Obwohl ich Angst davor hatte, meine Flügel nicht richtig benutzen zu können, war da wieder diese Stimme, die mir Mut machte.
›Du kannst das. Trau dich‹, hauchte sie in mir.
Schließlich wagte ich den Sprung ins Freie und stieß mich vom Fensterrahmen ab. Mein Körper fiel und der Wind riss an meinem Kleid und den Haaren. Bevor ich jedoch nur in die Nähe des Bodens kam, rettete mich erneut mein Instinkt, der mich dazu veranlasste, die Flügel auszubreiten, um meinen Sturz abzufangen. Die schwarzen Schwingen hoben mich in die Luft und ließen mich über die Stadt gleiten.
Von so weit oben wirkten die Menschen wie Ameisen und die Häuser wie Eicheln. Durch die enorme Kraft der Flügel befand ich mich nach nur wenigen Augenblicken über den Kronen der Bäume.
Am Horizont war bereits die Sonne verschwunden und ich flog den letzten Strahlen entgegen. Bevor ich darüber nachdenken konnte, wohin mich mein Weg nun führen würde, ertönte erneut die Stimme in mir.
›Ich wusste, du schaffst es. Nun komm zu mir, mein Kind. Folge dem hellsten Stern am Himmel.‹
Auch wenn ich keine Ahnung hatte, wer da mit mir sprach, folgte ich ihrer Anweisung dennoch. Alles war besser als meine Eltern und dieser grauenvolle Turm.
Obwohl ich das erste Mal mit den Schwingen durch die Lüfte zog, gewöhnte ich mich sehr schnell an das Gefühl.
Ein Kribbeln durchfuhr meinen Körper, als mir durch das Fliegen meine Freiheit noch viel bewusster wurde.
Ich bin diesem Turm entkommen! Diesem gottverdammten Königreich!
Genussvoll atmete ich die frische Luft ein, die nach Holz und Erde roch. Ich breitete neben mir die Arme aus und schloss für den Moment die Lider.
Sieben Jahre gefangen und nun bin ich frei.
Die dunkle Macht rettete mich, indem sie mir Flügel schenkte. Die Finsternis in meinem Inneren war kein Feind, sondern ein Freund, der mir seine Hand gereicht hatte, um mich zu beschützen.
Es dauerte eine Weile, bis ich endlich ein Zeichen erhielt. Mit meinen Schwingen war ich beinahe dreimal so schnell wie ein Pferd und erreichte daher einen hoch gelegenen Ort in den Bergen, weit im Norden des Königreiches.
Ich konnte eine große Flamme knapp über einem Höhleneingang ausmachen, die offensichtlich für meine Ankunft bestimmt war. Zielsicher steuerte ich das Feuer an und landete auf einem Felsvorsprung.
Gespannt, wer mich hierhergerufen hatte, wartete ich geduldig vor der Höhle auf ein weiteres Zeichen. Tatsächlich schlurfte aus der Dunkelheit eine alte, gebrechlich wirkende Frau mit einem Ast als Gehstock in der linken Hand auf mich zu. »Hallo, mein Kind.«
Ich hob eine Braue. »Wer seid Ihr?«
Die alte Dame grinste, sodass sie dabei gelbe, teils fehlende Zähne entblößte. »Mein Name ist Ravaga und ich bin die Hexe, die dich als Kind zusammen mit einem Dämon verflucht hat.«
Mir stockte der Atem bei dem, was sie sagte. Empörung überschäumte mich, da nur durch sie all diese Erschwernisse angefangen hatten. Wegen ihr musste ich die Kinder töten, wegen ihr wollten die Menschen mich brennen sehen und wegen ihr sperrten mich meine Eltern in einen Turm ein.
Sie hatte mir die dunkle Magie gegeben. Die Magie, die ich nicht richtig kontrollieren konnte.
Ich ballte eine Hand zur Faust und ging auf sie zu. »Du warst das?«, schrie ich erzürnt. »Nur wegen dir musste ich sieben Jahre …«
»Das war es wert. Deine Zeit kommt erst, Freyja«, entgegnete sie mit ruhiger Stimme und schien sich an meiner Wut auf sie nicht zu stören.
»Was sagst du da?«
Sie nickte mit einem schelmischen Lächeln auf den Lippen. Dabei fiel ihr eine grauweiße Strähne ihres dünnen Haares in die Stirn. »Du wirst in dein Königreich zurückkehren und Königin werden. Das verspreche ich dir. Doch bevor wir dies tun, muss ich dich noch eine Menge lehren. Deine Magie ist unkontrolliert und deine Gefühle ebenso. Du musst lernen, sie zu beherrschen.«
Ich wollte dieser Hexe nicht glauben und trat einen Schritt zurück. »Ich werde niemals Königin. Meine Eltern würden mir ihr Erbe nicht überreichen.«
Sie stieß mit dem Gehstock auf den Boden. »Alles zu seiner Zeit, mein Kind. Zuallererst will ich dich lehren, deine dunkle Magie zu kontrollieren. Wir haben noch viel vor uns. Komm!«
Sie kehrte mir den Rücken zu, doch ich folgte ihr nicht. Warum verfluchte mich diese Hexe erst, bescherte mir die qualvollsten sieben Jahre meines Lebens und bot mir dann an, mich mit meiner Magie vertraut zu machen? Soviel ich aus Büchern wusste, würde eine Hexe solche Gutmütigkeit niemals freiwillig aufbringen. »Halt!«
Ravaga blieb stehen, wandte sich jedoch nicht zu mir.
»Wieso? Eine Hexe tut niemals etwas freiwillig. Also, warum?«, hinterfragte ich und verschränkte die Arme trotzig vor der Brust.
»Ich habe der Hölle geschworen, dich zur Königin Menams zu machen. Falls du es noch nicht weißt, Freyja, wenn man einen Pakt mit der Hölle eingeht, sollte man ihn ernst nehmen.«
Mich zur Königin?
»Was hast du davon?« So leicht würde ich nicht aufgeben. Wenn ich mich ihr anvertrauen sollte, musste sie mir alles erzählen, was sie wusste.
»Ewiges Leben. Meine Magie ist bereits stark verbraucht, sodass ich nicht mehr lange auf dieser Erde weilen werde. Wenn ich meinen Teil des Paktes erfülle, ist es mir gewährt, ewig zu leben«, erklärte sie.
»Erlange ich das auch?«
Ihre Hand umschloss den Stock fester, sodass die Knöchel weiß hervorstachen. »Ja. Wir beide werden niemals von der Zeit eingeholt werden.« Sie räusperte sich. »Und jetzt hör auf, weitere Fragen zu stellen. Dafür haben wir keine Zeit.«
Ich stieß einen Schwall Luft aus und war mir noch immer nicht sicher, ob ich ihr vertrauen sollte. Immerhin war sie eine Hexe und hatte dazu auch noch Kontakt zur Hölle. Sollte man solch eine Person nicht eher fürchten?
Vor mir hatten die Menschen ebenfalls Angst und wollten mich als Hexe auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Wohin sollte ich also sonst gehen? Niemand wollte mich haben, und wenn doch, dann würde ich erneut in einem Turm landen, eingesperrt und allein gelassen.
Aber … ich wollte zurück nach Menam. Vielleicht würde ich mithilfe der Hexe eines Tages zurückkehren und regieren. Meine Eltern glaubten, ich wäre nicht dazu auserkoren, Königin zu werden, aber mit Ravaga an meiner Seite könnte ich ihnen das Gegenteil beweisen.
Ich presste die Lippen aufeinander und stellte fest, dass meine Entscheidung längst gefallen war. Ravaga konnte mich lehren, meine Kräfte richtig einzusetzen, um noch mächtiger zu werden. Die dunkle Magie war es gewesen, die mich aus meiner Gefangenschaft befreite. Möglicherweise war sie auch meine einzige Waffe, um mich an meinen Eltern zu rächen.
Entschlossen machte ich einen Schritt nach vorne und folgte der Hexe in ihre Höhle hinein.
Anfangs beherrschte mich der Drang, meine verlorenen Jahre wieder aufzuholen, die meine Eltern mir genommen hatten. Ich wollte Dörfer besuchen, mir Feste ansehen und all das tun, was mir verwehrt geblieben war. Durch die vielen Bücher, die ich gelesen hatte, besaß ich den einen oder anderen Wunsch, doch Ravaga verbot es mir, allein loszuziehen. Erst wenn ich meine Kräfte unter Kontrolle hätte, dürfte ich mich von unserer Höhle entfernen – aber auch nur eine gewisse Distanz.
Um mich also zufrieden zu stimmen, zeigte sie mir in einer Wasserschale all die Dinge, die ich sehen wollte. Denn Ravagas vertraute Spione waren die Raben, die sich in ganz Menam verstreuten. In die Nähe des Schlosses gingen sie jedoch nicht, aus Angst, einer der Magier würde ihre Magie spüren.
Die alte Hexe zeigte mir das Leben in den Dörfern und in den kleineren Städten. Außerdem überflogen wir Orte, die ich kennen sollte, um die Welt und vor allen Dingen das System hinter den fünf Landen zu verstehen. Ravaga erzählte mir von Alexandria, dem Orden, der hinter einem magischen, unsichtbaren Wall lag, welcher keine dunkle Magie hindurchließ. Unzählige Hexen und sogar Dämonen hatten vor vielen Jahrhunderten versucht ihn zu durchdringen, jedoch erfolglos. In den Büchern hatte ich ab und zu etwas über ihn gelesen, brachte allerdings nur wenige Details in Erfahrung.
Sie zeigte mir noch viele andere Orte und als meine Neugierde allmählich gestillt wurde, brach sie ab und wendete sich der wirklich wichtigen Aufgabe zu. Mich zu einer erbarmungslosen Königin zu machen.
Ravaga war eine harte und grausame Lehrerin. Denn bevor wir uns meiner wahren Macht widmeten, wollte sie erst meinen Körper abhärten und zwang mich zu waghalsigen, beinahe schon tödlichen Aufgaben, die mich an meine Grenzen trieben. Sie unterrichtete mich im Kämpfen und ließ mich ständig gegen Schattengestalten antreten, die mich gnadenlos blutig schlugen. Meistens hatten sie die Gestalt eines riesigen Tieres oder eines muskelbepackten Mannes und bewegten sich übernatürlich schnell. Sie besaßen kein Gesicht, sondern wirkten wie schwarze Silhouetten.
Anfangs hätte ich niemals geglaubt, dass diese Hexe so erfahren wäre, doch sie belehrte mich eines Besseren. Selbst wenn ich auf die Knie fiel oder niedergestreckt am Boden lag, gebot sie dem Kampf keinen Einhalt. Das Schattenwesen prügelte weiter auf mich ein, bis ich das Bewusstsein verlor.
Ravagas Macht verwehrte es mir, meine eigene im Kampf anzuwenden, da ich sie noch nicht richtig unter Kontrolle hatte. Schwerter zu schwingen und Magie einzusetzen, wollte sie zunächst trennen, um mir in Ruhe sowohl das eine als auch das andere beizubringen.
Als ich Ravaga fragte, wie sie nur so grausam sein könne, erklärte sie mir immer wieder, der Schmerz sei es, der mich lehrte. In den ersten Monaten wollte ich dieser Theorie nicht glauben, doch nach und nach verstand ich, was sie meinte.
Wenn das Schattenwesen mich erneut niederzustrecken drohte, erwachten in mir ungeahnte Überlebensinstinkte. Ich spürte dabei die Angst vor dem Schmerz, der mich erwarten würde, wenn ich der Qual kein Ende bereitete. Dieser Gedanke begleitete mich bei jedem Kampf, bis ich eines Tages das Schattenwesen mit meinem Schwert zerschlug.
Ravaga meinte, dass ich schnell lernte. Um die dunkle Magie zu praktizieren, begannen wir mit einer kleinen Geschichtsstunde über den Teufel, die Hölle und den Himmel. Jeder kannte die Geschichte um Luzifer, den Sohn Gottes, der Neid für die Menschen empfand und sich gegen seinen Vater auflehnte.
Er wurde dadurch aus dem Himmel verbannt und herrschte nun im tiefsten und dunkelsten Winkel der Welt. Der Hölle.
Hexen waren Dienerinnen der Hölle und durch Ravagas Fluch hatte sie mich zu einer gemacht. Jedwede Art von dunkler Magie ging auf die Dämonen zurück, da wir von ihnen unsere Kräfte erhielten. Diese wiederum bekamen ihre vom Teufel.
Ravaga erzählte mir, dass sie noch nie Kontakt zu Luzifer gehabt habe, aber öfter mit Dämonen spreche, den Wächtern der Hölle. Sie besaßen eine weitaus größere Magie als Hexen, waren jedoch nicht fähig dazu, lange in der Menschenwelt zu verweilen – es sei denn, sie handelten im Auftrag des Teufels.
Die dunkle Magie zu verstehen, war kein Leichtes. Ravaga gab jedoch nicht so schnell auf und ließ mich wieder und wieder dasselbe tun, selbst wenn ich es bereits im Schlaf konnte. Sie glaubte, dass ich dadurch meine Fähigkeiten besser und schneller hervorrufen könnte.
»Eine langsame Hexe ist eine tote Hexe«, zitierte sie zum gefühlt hundertsten Mal, während ich auf einem Schemel saß und mich auf die Flammen des Lagerfeuers konzentrieren sollte, um ihre Bewegungen zu kontrollieren.
Doch wie sollte ich es schaffen, das Feuer zu beherrschen? Ich konnte es in meiner Hand entstehen lassen, es aber nicht dazu zwingen, sich in bestimmte Richtungen zu bewegen, als würde ich eine Marionette am Faden führen.
»Noch mal!«, brüllte sie streng.
Ich streckte die Hand aus und versuchte nach den Flammen zu greifen, doch außer stark zitternden Fingern und einem Krampf im Oberarm geschah nichts.
»Oh Luzifer! Konzentrier dich endlich, Freyja«, schalt sie mich und verpasste mir einen Schlag auf den Kopf. Ich zuckte dabei zusammen und sah sie mit finsterer Miene an. »Los, noch mal!«
Als ich wieder meinen Arm ausstreckte, dachte ich darüber nach, Ravaga nicht erneut enttäuschen zu wollen. Dieses Mal hatte ich mir fest vorgenommen, meine Aufgabe zu erfüllen. Denn ich war keine Versagerin – als zukünftige Königin durfte ich mir so etwas nicht erlauben.
Ich beschwor all meine Kraft, die ich in mir spürte, herauf und dachte gar nicht daran, dem Schmerz, der sich in meiner Brust langsam ausbreitete, nachzugeben. Die Magie wollte aus meinem Brustkorb dringen und unkontrolliert in alle Richtungen schießen. Doch ich musste sie zu beherrschen lernen, damit sie mir eines Tages gehorchte.
Plötzlich zog sich ein brennender Schmerz durch meinen Arm und endete in meinen Fingerspitzen. Die Flammen verlangsamten sich vor meinen Augen und ich gab in meinem Kopf den Befehl, sie zum Stehen zu bringen.
Nur einen Wimpernschlag später waren die Flammen wie eingefroren und ihre Wärme ließ den Schmerz in meiner Brust verebben.
»Sehr gut, Freyja. Halte das Feuer fest und bringe es dazu, dass es sich nach deinen Vorstellungen bewegt«, wies Ravaga mich weiter an, während sie mich umkreiste.
Ihr Lob spornte mich nur noch mehr dazu an, meine Aufgabe zu bewältigen. Ich ignorierte das Pochen in meinem Arm und stellte mir eine Schlange vor, die sich durch den Sand bewegte. Genau dieselbe Bewegung befahl ich nun dem Feuer und tatsächlich formten sich die Flammen zu einer Linie, um sich vor meinen Augen durch die Luft zu winden.
Beeindruckt blickte ich der brennenden Silhouette nach und ließ diese Kreise in der Luft ziehen.
Ravaga legte eine Hand auf meine Schulter. »Wir kommen voran, Freyja. Nicht mehr lange, dann wirst du in dein geliebtes Königreich zurückkehren können und dir das nehmen, was dir rechtmäßig zusteht.«
Ich ließ die Flammen verschwinden und erwischte mich dabei, wie sich mir ein kleines, vergnügtes Lächeln auf die Lippen stahl.
Der Thron. Meine Krone. Mein Reich.
Zur dunklen Königin erkoren
Freyja
Es vergingen erneut viele Monate und es waren nur noch wenige Tage bis zu meinem siebzehnten Geburtstag. Ravaga hatte mir heute einen freien Tag gegeben, an dem ich tun und lassen konnte, was ich wollte.
Da ich nur selten im Wald unterwegs war, beschloss ich heute, mir die Zeit zwischen den Schatten der Bäume zu vertreiben.
Ich stellte mich an den Rand des Felsvorsprunges und blickte in die Ferne. Unter mir lag ein Meer aus Laubbäumen und Tannen, das von einem breiten Fluss gespalten wurde.
Da ich nun nicht mehr am Hofe war, hatte mir Ravaga eine einfache Lederrüstung angefertigt, mit der ich sowohl kämpfen als auch fliegen konnte. Die Schulterblätter waren am Rücken frei, sodass meine Flügel durch die Öffnungen explodierten, ohne dabei meine Kleidung zu zerreißen.
Ich breitete die Arme aus und ließ mich in den Abgrund fallen, während meine Flügel aus dem Rücken schossen. Die Schwingen fingen mich auf und ließen mich knapp über den Baumkronen des Waldes fliegen.
In den letzten Monaten hatte ich neben der Schwertkunst und der Magie meine Flugkünste erweitert, als Ravaga es mir erlaubte, die Höhle zu verlassen. Ich wollte selbst den Vögeln überlegen sein und die höchsten Berge überwinden.
Als ich eine Lichtung sichtete, machte ich auf dieser halt und setzte mich in das weiche Gras in der Nähe eines Baches. Ich beobachtete, wie am Horizont die Sonne unterging und die Sterne langsam im Dunkelblau der Nacht erschienen.
Ravaga sagte immer, dass ich als Hexe niemals Angst zeigen dürfe. Die Dunkelheit war mein Begleiter und die Finsternis floss durch meine Adern. Für mich gab es keinen Grund, mich vor den Schatten der Wälder zu fürchten. Vielmehr bemerkte ich, wie ich mich mit jedem Monat, der verging, der Nacht näher fühlte als dem Tag. Ich war lebendiger in der Dunkelheit, mächtiger und begann, den Tag und das Licht immer häufiger zu meiden. Die Schatten wurden zu meinen Gefährten und meinen Vertrauten.
Als der Mond hell am Nachthimmel leuchtete, beschloss ich, einen weiteren Flug über den Kronen der Bäume zu wagen. Doch das Geräusch von rauschendem Wasser erlangte meine Aufmerksamkeit und ich ging neugierig einen Hang hinab.
Am Ende entdeckte ich zwischen den vielen Tannen einen Felsen, aus dem Wasser in einen kleineren Fluss fiel. Ich beförderte mich in die Lüfte, um mir den Ort ein wenig näher anzusehen.
Beinahe wäre es mir nicht aufgefallen, aber hinter der Wassermasse gab es eine Höhle, die mich neugierig werden ließ. Die Bäume schienen ihn mit ihren Kronen von oben gut versteckt zu halten.
Ich glitt wieder zu Boden und erklomm die unebenen Felsen, bis ich hinter dem Wasserfall stand und die gigantische Höhle entdeckte.
Meine Augen brauchten dank der Magie in mir kein Licht, da sie auch so alles in der Dunkelheit sehen konnten. Von den Decken hingen große Felsenspitzen herab und aus einigen Rissen tropfte Wasser.
Als ich gerade einen Schritt nach vorne tat, knirschte etwas unter meinen Stiefeln und ich hob meinen Fuß an. Anscheinend war ich in das Nest einer Höhlenechse getreten, die ihre Eier auszubrüten versuchte.
Angewidert von der blutig klebenden Masse unter meinem Stiefel wischte ich die Schalen und das schleimige Innere an einer Steinkante ab und ging weiter. Nur wenige Augenblicke später hörte ich das Trippeln winziger Füße über dem Boden und drehte mich um.
Das weiß gefleckte Echsenweibchen stand nicht weit von ihren zertretenen Eiern entfernt und beobachtete mich aus der Ferne. Offensichtlich war sie wütend darüber, dass ich ihre Nachkommen mit einem einzigen Fußtritt vernichtet hatte.
Der Gedanke amüsierte mich und ich beschwor meine Magie herauf. »Glaub mir, damit tue ich dir sogar einen Gefallen«, flüsterte ich und ließ eine Flamme zwischen meinen Fingern entstehen, die ich mit einer kleinen Handbewegung auf die Echse schleuderte.
Das Feuer ummantelte ihren Körper und sie gab fiepende Geräusche von sich, bevor sie nach wenigen Sekunden verstummte. Das Feuer schmolz das Fleisch von ihren Knochen und verbrannte diese zu Asche.
Ich empfand kein Mitleid für dieses dumme Tier. Ihre Kinder wären früher oder später sowieso von einem Raubtier getötet worden oder an ihrer Sterblichkeit zergangen. Was kümmerte es mich also, ob sie heute oder in naher Zukunft starben?
Als ich den Blick von der toten Echse abwenden wollte, entdeckte ich im Augenwinkel, wie ein einzelnes Ei in eine Mulde rutschte. Mein erster Gedanke war, dass ich es einfach ignorieren sollte, um meinen Weg fortzuführen, doch dann kam mir eine Idee.
Ich ging zu dem winzigen Ei und hob es auf. Zwischen meinen Finger war es warm und ich konnte darin etwas Lebendiges spüren. In den anderen Eiern waren Echsen gewesen, die nicht mehr lange gebraucht hätten, bis sie geschlüpft wären. Hatte dieses also Glück gehabt und überlebt?
Da fiel mir etwas ein. Ich suchte mir eine geschützte Stelle an einer Wand, in der sich ein Loch befand. Das Ei legte ich hinein und beschwor meine Magie, die ich zu einer schwarzen Flüssigkeit werden ließ, wie es mir Ravaga vor wenigen Tagen beigebracht hatte. Darin waren mein Blut und die Magie enthalten, die durch meine Adern strömten. Sozusagen ein winziges Stück meiner selbst.
Ich ließ es in das Loch fließen und legte das Ei hinein. Morgen wollte ich wiederkommen, um mir anzusehen, was daraus geworden war. Vielleicht kreierte mein Blut aus der Echse ein Monstrum oder vernichtete das noch ungeschlüpfte Lebewesen qualvoll in seiner Schale.
Amüsiert über mein kleines Spiel mit meiner Macht drehte ich mich um und verließ die Höhle, um mich auf den Weg zu Ravaga zu machen.
Mit meinen Schwingen hob ich mich in die Lüfte und lenkte in die Richtung der Höhle.
Während ich mich knapp über den Baumkronen bewegte, bemerkte ich ein Licht inmitten des Waldes, das von einem Lagerfeuer stammen musste. Wer würde so tief zu den Bergen vordringen? Hier würde sie nichts erwarten außer karges Gestein und dunkle Wälder, in denen man sich verirrte.
Neugierig, wie ich war, flog ich in die Richtung des Lichtes und landete auf einem dicken Ast in den Bäumen. Aus dem Schatten heraus schaute ich auf das Feuer hinab und sichtete dabei einen Soldatentrupp. Ihre Embleme verrieten mir, dass sie zu den Männern des Schlosses gehörten.
Was taten sie hier?
Gespannt lauschte ich ihren Gesprächen, die dank meiner übernatürlichen Sinne leicht zu verstehen waren. »Sie ist vermutlich sowieso gestorben oder ein Opfer der Tiere geworden«, brummte einer und rieb die Hände aneinander, bevor er diese in die Nähe des Feuers hielt.
»Blödsinn«, stritt ein anderer mit murrendem Unterton ab. »Dieses Kind ist ein Monster und wird sich mit ihrer Magie verteidigen. Vermutlich hat sie sich in irgendeiner Höhle verkrochen oder ist sogar in ein anderes Land geflohen.«
Ein Dritter zischte und nahm einen kräftigen Schluck aus einem Becher, den er in der Hand hielt. »Wohin soll sie denn fliehen? Greystone? Snowcrow? Glaub mir, sie wäre in keinem der fünf Lande sicher. Hexen werden unverzüglich aufgespürt und verbrannt.«
»Sie sind ja auch die Diener des Teufels, Rim«, kommentierte der Soldat, der sich am Feuer aufwärmte. Er hatte seinen Helm abgelegt, sodass ich erkannte, dass er eine Glatze besaß.
Rim, der sich einen weiteren, großzügigen Schuss Wein in seinen Becher schenkte, schüttelte den Kopf. »Ich kann es einfach nicht fassen, dass der König uns all die Jahre belogen hat. Jetzt müssen wir uns vor diesem Miststück in Acht nehmen, weil es aus seinem Käfig entflohen ist.«
Diese Männer sprachen über mich? Und dann besaßen sie noch die Dreistigkeit, mich als Miststück zu bezeichnen?
Zorn wallte in mir auf. Dafür sollten sie büßen! Ich würde ihm schon zeigen, wie sehr er mich zu fürchten hatte.
»Die Macht der Magier und der Glaube an Gott werden uns beschützen«, warf der Kerl ein, der am Baum lehnte und die Hände vor dem Körper verschränkt hatte.
Rim schnaubte, dieses Mal lag jedoch Spott darin. »Wenn ich einem Monster gegenüberstehe, hilft mir nur noch eine Sache: mein Schwert oder meine Beine.«
»Schluss jetzt mit dem Gejammere«, meinte der Glatzkopf und erhob sich. »Wir haben eben den Befehl vom König erhalten, nach der Prinzessin zu suchen. Lasst uns noch ein paar Tage hierbleiben und dann mit der Kunde zurückkehren, dass wir nichts gefunden haben.«
Mein Zorn verebbte genauso schnell wieder, wie er gekommen war. Die Soldaten waren also gar nicht motiviert, nach mir zu suchen? Sie glaubten, ich wäre sowieso ein Opfer des Waldes geworden? Wie gern ich ihnen das Gegenteil beweisen würde, doch Ravaga hatte mir untersagt, mich irgendeinem Menschen zu zeigen. Sie sollten denken, ich wäre gestorben. Denn mit der Vollendung meines achtzehnten Lebensjahres würde ich zurückgehen und mir meine Krone nehmen.
Ich kehrte den Soldaten den Rücken und flog zu der Höhle zurück, in der mich die alte Hexe bereits erwartete.
Mit einem kalten Blick schaute ich zu ihr. »Soldaten des Königs sind hier. Sie haben den Befehl erhalten, nach mir zu suchen, doch sie glauben daran, dass ich längst das Weite gesucht habe.«
Ravaga hob eine Braue und sah mich mit ihren dunklen Augen an. »Soldaten? Sie werden nicht lange bleiben. Halte dich nur von ihnen fern.«
Ich hätte eine Idee, von der ich jedoch wusste, dass sie der Hexe nicht gefallen würde. »Und wenn wir sie einfach aus dem Weg räumen?«
»Vermisste Soldaten werden den König aufhorchen lassen. Also nein«, knurrte sie und wandte sich von mir ab, um sich zu ihrem Schlafplatz zu begeben. »Morgen liegt ein weiterer Tag vor uns, Freyja. Ruh dich also aus.«
Auch wenn es mir gefallen hätte, die Soldaten aufzumischen und sie das Fürchten zu lehren, hatte Ravaga recht. Damit würden nur noch mehr von ihnen folgen.
Aber vielleicht könnte jemand anderes, anstelle von mir, meine Todesgelüste besänftigen. Eine Art Bestie, zum Beispiel. Einen einzigen Soldaten würde ich am Leben lassen, damit er dem König berichten konnte, dass ein Monster in diesen tiefen Wäldern sein Unwesen trieb, weshalb sie nie wieder hierher zurückkehrten.
Mir kamen die Schatten in den Sinn, doch es waren eher schweigsame, für meinen Geschmack sogar zu langweilige Monster, die infrage kämen.
Nein, ich wollte eine Bestie in Furcht einflößender Form und Größe besitzen.
»Wann erlange ich meine Unsterblichkeit, Ravaga?«, wollte ich noch wissen.
»Bald, mein Kind. Sehr bald.«
Damit verschwand sie hinter einer Felswand und ließ mich zurück.
Ich ging zu dem gehäuften Stroh, das bereits in der Mitte durchgelegen war, und machte es mir darin gemütlich. Mein Körper sehnte sich danach, mich bald wieder in meinem alten Bett im Schloss ausruhen zu können. Kein Turm und keine Gefangenschaft mehr, sondern nur Menam und ich.
Mit diesem Gedanken sank ich in den Schlaf.
Am nächsten Morgen weckte mich Ravaga, die gerade dabei war, in einem Kessel etwas zuzubereiten. »Wir müssen unsere Lehrstunde verschieben. Ich habe Schreie im Wald ausgemacht. Vielleicht sind es die Soldaten. Kannst du nachsehen, was sie vorhaben? Aber halte dich zurück! Ich will nicht, dass sie dich sehen.«
Mit einem Gähnen erhob ich mich aus dem ungemütlichen Strohbett, nickte und trat zum Höhleneingang. »Schreie?«
»Von einem Tier oder etwas Ähnlichem. Es wird von den Rufen der Soldaten begleitet, deshalb dachte ich zunächst, sie würden etwas jagen, doch das zähe Geschöpf scheint ihnen eine riesige Angst zu bereiten«, erklärte sie mir und ich ging zum Felsvorsprung, wovon ich den besten Überblick hatte.
Als ich nach merkwürdigen Geräuschen lauschte, bemerkte ich tatsächlich nicht weit von der Höhle entfernt ein furchtbar qualvolles Schreien.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, beschwor ich meine Flügel und stürzte mich in die Lüfte. Am Tag musste ich viel eher aufpassen, nicht gesehen zu werden, da es keine Schatten mehr gab, die mich versteckt hielten.
Die Schreie und Rufe führten mich zu einem mir bekannten Ort. Es handelte sich dabei um den Wasserfall, hinter dem sich eine Höhle befand. Sechs Soldaten standen mit erhobenen Schwertern auf dem unebenen Pfad, der hinter die Wassermasse führte.
»Töte es endlich, Rim!«, brüllte einer der Männer, die sich offensichtlich vor dem Tier zu fürchten schienen.
»Spieß den Drachen auf!«
Ein … Drache? In dieser Höhle? Sie würden niemals eine Chance gegen ihn haben. Kein Wunder, dass sie sich vor dem Geschöpf fürchteten. Ein bisschen bedauerte ich es, gestern dem Tier nicht begegnet zu sein – mich einem echten Drachen zu stellen, wäre eine Herausforderung gewesen.
Doch als ich einen tierisch gellenden Schrei hörte, wusste ich, dass es kein ausgewachsenes Exemplar war. Es handelte sich dabei um ein Jungtier, das um sein Überleben kämpfte.
Mir fiel wieder mein Ei ein, das ich am Tag zuvor mit meiner Macht zurückgelassen hatte. Aber das wäre unmöglich. Soweit es mir Ravaga erzählt hatte und es auch in den Büchern stand, wurden die Drachen auf eine Insel – abseits der fünf Lande – zurückgetrieben. Damals hieß es, sie wären durch Dämonenblut entstanden, andere behaupteten jedoch, sie seien schon immer ein Teil der Natur gewesen. Also, wie sollte ich mit meiner Magie einen erschaffen haben?
Da es mich nicht kümmerte, ob dieser überlebte oder nicht, kehrte ich den Soldaten den Rücken zu und hoffte inständig, dass das Jungtier sogar einen von ihnen tötete, bevor es selbst starb.
Als ich gerade zurückfliegen wollte, erklang erneut ein erbitterter Schrei, der mein dunkles Herz höherschlagen ließ. Offensichtlich hatte einer der Soldaten den Drachen erwischt, und dieser musste nun eine tödliche Wunde erlitten haben.
Obwohl mich das Ganze eigentlich nichts anging, konnte ich mir nicht erklären, weshalb mich mit einem Mal doch der Drang überkam, das Jungtier zu retten. Drachen waren sehr selten, besonders in unserer heutigen Zeit. Legenden besagten, dass sie vor vielen Jahrhunderten auch Chimären genannt wurden, sogenannte Mischwesen, die zur Hälfte Tier und Dämon waren. Man machte Jagd auf sie und schaffte es sogar, ihre Art zu vermindern. Wenn es sie überhaupt noch gab, dann nur noch vereinzelt und selten.
Möglicherweise könnte ich auch meinen Nutzen aus diesem Geschöpf ziehen, wenn ich es rettete. Wie mächtig würde eine Hexe sein, die an ihrer Seite einen tödlichen Drachen hatte? Er wäre dazu fähig, für mich eine ganze Stadt in Brand zu setzen, die Menschen das Fürchten zu lehren, und durch seine einzigartige Drachenhaut böte er mir Schutz.
Von meinem neuen Gedanken angetan, wandte ich mich wieder zum Soldatentrupp und dachte fieberhaft darüber nach, wie ich ungesehen das verletzte Wesen retten könnte.