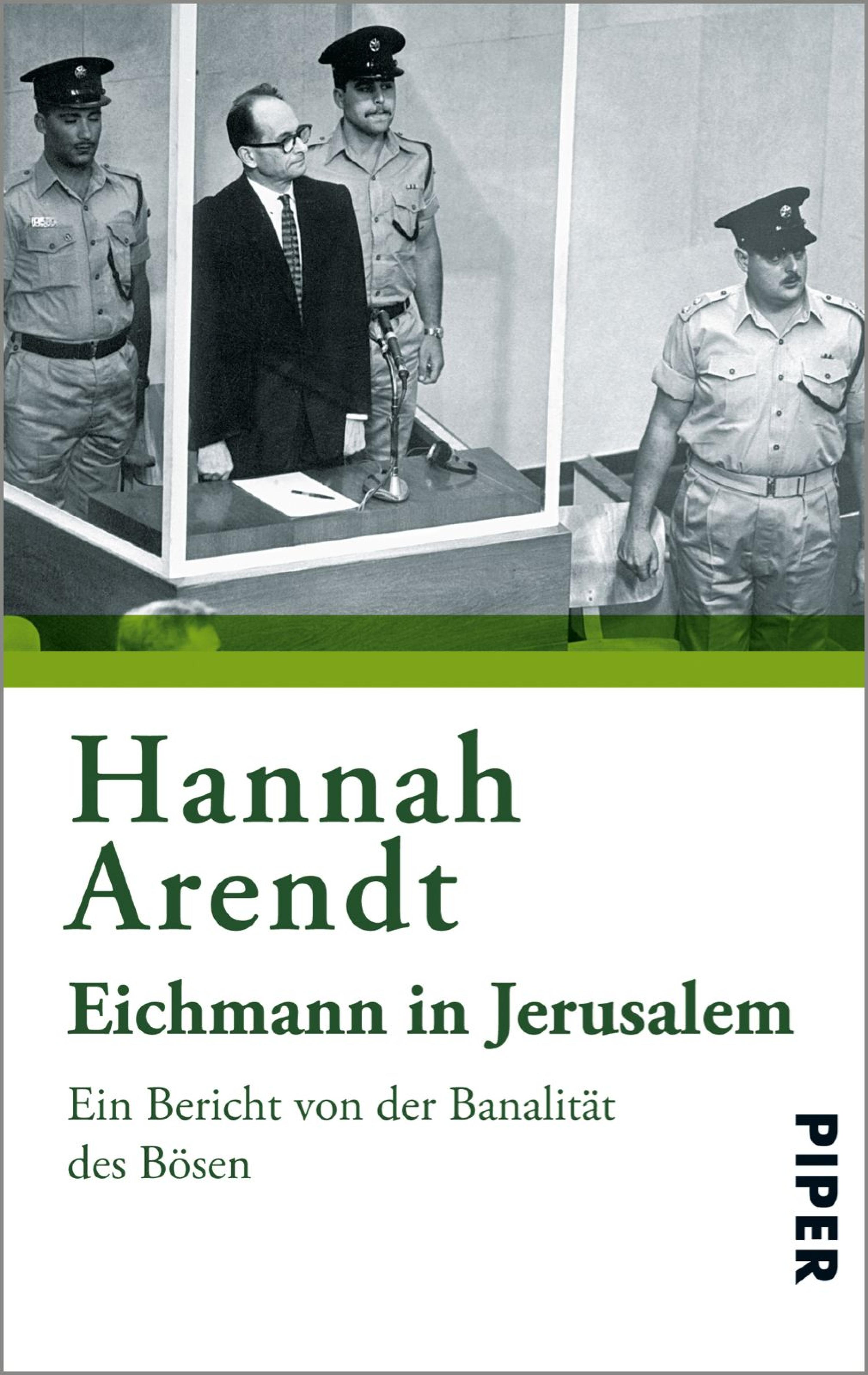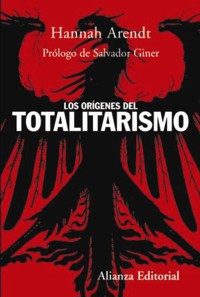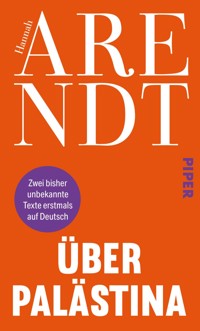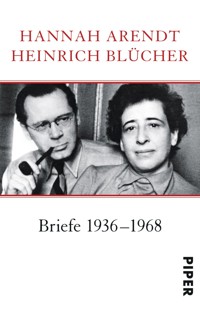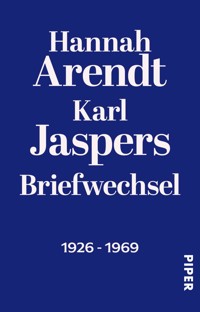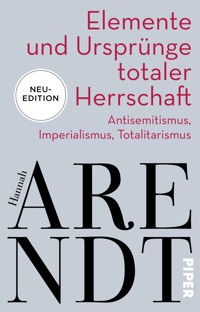6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Mein Thema heute, so fürchte ich, ist fast schon beschämend aktuell.« Was ist Freiheit, und was bedeutet sie uns? Begreifen wir sie nur als die Abwesenheit von Furcht und von Zwängen, oder meint Freiheit nicht vielmehr auch, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen, eine eigene politische Stimme zu haben, um von anderen gehört, erkannt und schließlich erinnert zu werden? Und: Haben wir diese Freiheit einfach, oder wer gibt sie uns, und kann man sie uns auch wieder wegnehmen? In diesem bisher auf Deutsch unveröffentlichten Essay zeichnet Hannah Arendt die historische Entwicklung des Freiheitsbegriffs nach. Dabei berücksichtigt sie insbesondere die Revolutionen in Frankreich und Amerika. Während die eine in eine Katastrophe mündete und zu einem Wendepunkt der Geschichte wurde, war die andere ein triumphaler Erfolg und blieb doch eine lokale Angelegenheit. Aber warum?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch
In diesem erstmals veröffentlichten Essay zeichnet Hannah Arendt die historische Entwicklung des Freiheitsbegriffs nach. Was ist Freiheit, was bedeutet sie uns? Und: Haben wir sie einfach, oder wer gibt sie uns, und kann man sie uns auch wieder wegnehmen?
Arendt berücksichtigt dafür insbesondere die Revolutionen in Frankreich und Amerika. Während die eine in eine Katastrophe mündete und zu einem Wendepunkt der Geschichte wurde, war die andere ein triumphaler Erfolg und blieb doch eine lokale Angelegenheit. Aber warum?
Hannah Arendt
Die Freiheit, frei zu sein
Aus dem amerikanischen Englisch von Andreas Wirthensohn
Mit einem Nachwort von Thomas Meyer
Die Freiheit, frei zu sein
Mein Thema heute ist, so fürchte ich, fast schon beschämend aktuell. Revolutionen sind inzwischen alltägliche Ereignisse, denn mit der Beendigung des Imperialismus haben sich viele Völker erhoben, um »unter den Mächten der Erde den selbstständigen und gleichen Rang einzunehmen, zu dem die Gesetze der Natur und ihres Schöpfers es berechtigen«. So, wie zu den dauerhaftesten Folgen der imperialistischen Expansion der Export der Idee vom Nationalstaat noch in den hintersten Winkel dieser Welt gehörte, so führte das Ende des Imperialismus unter dem Druck des Nationalismus dazu, dass sich die Idee der Revolution über den gesamten Erdball ausbreitete.
All diese Revolutionen, mag ihre Rhetorik auch noch so gewaltsam antiwestlich sein, stehen im Zeichen traditioneller westlicher Revolutionen. Der heutigen Situation ging eine ganze Reihe von Revolutionen nach dem Ersten Weltkrieg in Europa selbst voraus. Seither – und noch markanter seit dem Zweiten Weltkrieg – scheint nichts gewisser, als dass es nach einer Niederlage in einem Krieg zwischen den verbliebenen Mächten – natürlich nur, wenn es sich nicht um eine völlige Vernichtung handelt – zu einer revolutionären Veränderung der Regierungsform (im Unterschied zu einem Regierungswechsel) kommen wird. Allerdings sei darauf verwiesen, dass Kriege, schon bevor technologische Entwicklungen kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten buchstäblich zu einem Kampf auf Leben und Tod gemacht haben, politisch gesehen zu einer Frage von Leben und Tod wurden. Das war beileibe keine Selbstverständlichkeit, sondern zeigt an, dass die Protagonisten zwischenstaatlicher Kriege nunmehr so agierten, als seien sie an Bürgerkriegen beteiligt. Und die kleinen Kriege der letzten zwanzig Jahre – Korea, Algerien, Vietnam – waren eindeutig Bürgerkriege, in welche die Großmächte hineingezogen wurden, weil eine Revolution entweder ihre Herrschaft bedrohte oder für ein gefährliches Machtvakuum gesorgt hatte. In diesen Fällen war es nicht mehr der Krieg, der eine Revolution herbeiführte; die Initiative war vom Krieg auf die Revolution übergegangen, auf die in einigen – aber beileibe nicht allen – Fällen ein militärisches Eingreifen folgte. Es ist, als befänden wir uns plötzlich wieder im 18. Jahrhundert, als der Amerikanischen Revolution ein Krieg gegen England und der Französischen Revolution ein Krieg gegen die verbündeten Monarchien Europas folgte.
Und wieder wirken militärische Interventionen trotz der völlig andersgearteten Umstände – technologisch, aber auch sonst – relativ hilflos gegenüber dem Phänomen. In den letzten zweihundert Jahren haben zahlreiche Revolutionen ein schlimmes Ende genommen, aber nur wenige wurden dadurch zerschlagen, dass überlegene Gewaltmittel zum Einsatz kamen. Umgekehrt haben sich Militärinterventionen, selbst wenn sie erfolgreich waren, oft als bemerkenswert wirkungslos erwiesen, wenn es darum ging, wieder für Stabilität zu sorgen und das Machtvakuum zu füllen. Selbst ein Sieg, so scheint es, ist nicht in der Lage, Stabilität an die Stelle von Chaos, Integrität an die Stelle von Korruption, Autorität und Vertrauen in die Regierung an die Stelle von Verfall und Auflösung zu setzen.
Eine Restauration, Folge einer unterbrochenen Revolution, sorgt in der Regel für wenig mehr als einen dünnen und sichtlich provisorischen Deckmantel, unter dem die Auflösungsprozesse ungehindert weitergehen. Andererseits aber wohnt bewusst gebildeten neuen politischen Körperschaften ein enormes Potenzial für künftige Stabilität inne, wie beispielhaft die amerikanische Republik zeigt; das Hauptproblem besteht natürlich darin, dass erfolgreiche Revolutionen so selten sind. Selbst in der heutigen Welt, in der, im Guten wie im Schlechten, Revolutionen zu den bedeutsamsten und häufigsten Ereignissen geworden sind – und das wird in den kommenden Jahrzehnten höchstwahrscheinlich so weitergehen –, wäre es nicht nur klüger, sondern auch angemessener, wenn wir nicht dauernd damit prahlen würden, dass wir das mächtigste Land auf Erden sind, sondern wenn wir sagen, dass wir seit der Gründung unserer Republik ein außergewöhnliches Maß an Stabilität genossen haben und dass diese Stabilität unmittelbare Folge der Revolution war. Denn weil sich der Wettstreit zwischen den Großmächten nicht mehr durch einen Krieg entscheiden lässt, wird er sich langfristig daran entscheiden, welche Seite besser begreift, was Revolutionen sind und was dabei auf dem Spiel steht.
Ich glaube, es ist – spätestens seit dem Vorfall in der Schweinebucht – niemandem verborgen geblieben, dass die Außenpolitik dieses Landes nicht einmal in Ansätzen eine Ahnung davon hat, wie sie revolutionäre Situationen einschätzen oder die Dynamik revolutionärer Bewegungen beurteilen soll. Zwar wird das Scheitern der Invasion in der Schweinebucht oft mit falschen Informationen oder einem Versagen der Geheimdienste erklärt, doch tatsächlich liegen die Ursachen dafür tiefer. Der Fehler bestand darin, dass man nicht begriffen hat, was es bedeutet, wenn eine verarmte Bevölkerung in einem rückständigen Land, in dem die Korruption das Ausmaß völliger Verdorbenheit erreicht hat, plötzlich befreit wird, nicht von der Armut, sondern von der Undeutlichkeit und damit der Unbegreiflichkeit des eigenen Elends; was es bedeutet, wenn die Leute merken, dass zum ersten Mal offen über ihre Lage debattiert wird, und wenn sie eingeladen sind, sich an dieser Diskussion zu beteiligen; und was es heißt, wenn man sie in ihre Hauptstadt bringt, die sie nie zuvor gesehen haben, und ihnen sagt: Diese Straßen, diese Gebäude, diese Plätze, das gehört alles euch, das ist euer Besitz und damit auch euer Stolz. Das – oder zumindest etwas Ähnliches – geschah zum ersten Mal während der Französischen Revolution.
Kurioserweise war es ein alter Mann aus Ostpreußen, der seine Heimatstadt Königsberg nie verließ, ein Philosoph und Liebhaber der Freiheit, nicht unbedingt bekannt für aufrührerische Gedanken, der das sofort verstanden hat. Immanuel Kant nämlich sagte: »Denn ein solches Phänomen in der Menschengeschichte vergißt sich nicht mehr.« Und tatsächlich wurde es nicht vergessen, sondern spielte im Gegenteil seither eine wichtige Rolle in der Weltgeschichte. Und auch, wenn viele Revolutionen in der Tyrannei endeten, so erinnerte man sich doch immer daran, dass sich, mit den Worten Condorcets, »das Wort revolutionär (…) mithin nur auf Revolutionen anwenden [lässt], die die Freiheit zum Ziel haben«.