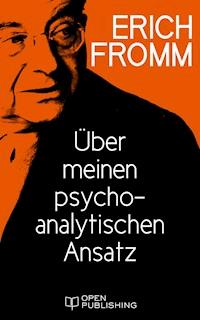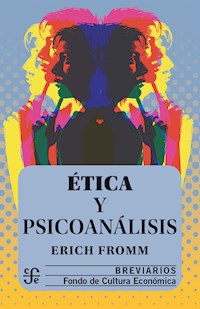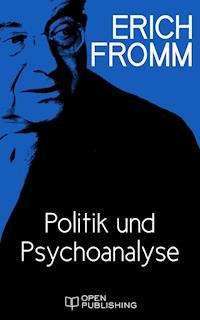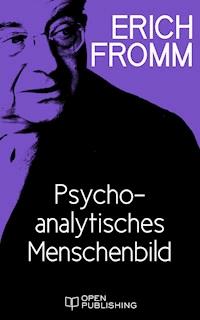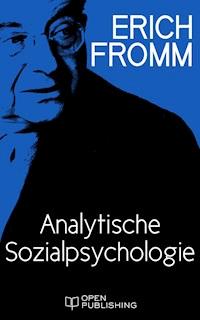6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Erich Fromm
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die „Furcht vor der Freiheit“ ist eines der grundlegenden Werke Fromms, in dem er sich mit der Bedeutung von Freiheit für den modernen Menschen beschäftigt. Seine These lautet, dass sich der moderne Mensch von den Fesseln der vor-individualistischen Gesellschaft befreit hat; da diese ihm gleichzeitig Sicherheit gab und ihm Grenzen setzte, fühlt er sich isoliert und allein und entwickelt eine „Furcht vor der Freiheit“. Der Einzelne meidet die Freiheit, weil er mit ihr noch nicht umzugehen weiß. Somit bleibt der Mensch aus Fromms Sicht noch hinter seinen intellektuellen, emotionalen und sinnlichen Möglichkeiten zurück. Hieraus ergibt sich für ihn die Konsequenz, dass der Mensch aufgrund von Ohnmachtsgefühlen und der daraus entstehenden Angst neue Ausformungen von Hörigkeitssystemen aufsucht, die ihm scheinbare Sicherheit bieten. Dieses Werk ist die erste Monographie Erich Fromms und legt mit der Entwicklung des „autoritären Charakters“ den Grundstein zu seinen Charakterstudien, die er in späteren Werken weiter ausformuliert. Aus dem Inhalt: • Freiheit – ein psychologisches Problem? • Das Auftauchen des Individuums und das Doppelgesicht der Freiheit • Freiheit im Zeitalter der Reformation • Die beiden Aspekte der Freiheit für den modernen Menschen • Fluchtmechanismen • Die Psychologie des Nazismus • Freiheit und Demokratie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die Furcht vor der Freiheit
(Escape from Freedom)
Erich Fromm (1941a)
Als E-Book herausgegeben und kommentiert von Rainer Funk Übersetzung aus dem Amerikanischen Liselotte und Ernst Mickel überarbeitet von Rainer Funk
Erstveröffentlichung unter dem Titel Escape from Freedom 1941 bei Holt, Rinehart and Winston, New York; die englische Erstveröffentlichung 1942 im Vereinigten Königreich trug den Titel The Fear of Freedom. Eine erste deutsche Übersetzung von Rudolf Frank unter dem Titel Die Furcht vor der Freiheit erschien 1945 beim Steinberg Verlag, Zürich. 1966 wurde das Buch neu aufgelegt bei der Europäischen Verlagsanstalt, Frankfurt/Köln. Im Zusammenhang mit der Edition der Erich Fromm Gesamtausgabe wurde von Liselotte und Ernst Mickel eine neue Übersetzung angefertigt. Diese Übersetzung liegt auch der Einzelausgabe von Die Furcht vor der Freiheit zugrunde, die ab 1980 bei der Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart, herauskam. Die E-Book-Ausgabe orientiert sich an der von Rainer Funk herausgegebenen und kommentierten Textfassung der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag) 1999, Band I, S. 215-392. Die Zahlen in eckigen Klammern (zum Beispiel: [I-250]) geben den Band und den Seitenwechsel auf die betreffende Seite in der Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden wieder. Auf diese Weise lassen sich auch aus dem E-Book Zitate nach der Printversion nachweisen.
© 1941, 1965, 1969 Erich Fromm / 1981 The Estate of Erich Fromm; für diese digitale Ausgabe © 2015 The Estate of Erich Fromm
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Freiheit – ein psychologisches Problem?
2 Das Auftauchen des Individuums und das Doppelgesicht der Freiheit
3 Freiheit im Zeitalter der Reformation
a) Mittelalterlicher Hintergrund und Renaissance
b) Das Zeitalter der Reformation
4 Die beiden Aspekte der Freiheit für den modernen Menschen
5 Fluchtmechanismen
a) Flucht ins Autoritäre
b) Flucht ins Destruktive
c) Flucht ins Konformistische
6 Die Psychologie des Nazismus
7 Freiheit und Demokratie
a) Die Illusion der Individualität
b) Freiheit und Spontaneität
Anhang: Charakter und Gesellschaftsprozess
Literaturverzeichnis
Hinweise zur Übersetzung
Der Autor
Der Herausgeber
Impressum
Wenn nicht ich für mich bin, wer ist dann für mich? Wenn ich nur für mich bin, was bin ich dann? Wenn nicht jetzt – wann sonst?Talmud
Nicht himmlisch, nicht irdisch, nicht sterblich und nicht unsterblich haben wir dich erschaffen, auf dass du mögest frei sein, deinem eigenen Willen und deiner Ehre gemäß, auf dass du mögest dein eigner Schöpfer und Bildner sein. Dir allein gab ich die Fähigkeit zu wachsen und dich nach deinem eigenen freien Willen zu entfalten. Du trägst in dir den Keim eines allumfassenden Lebens. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate
Nichts ist unveränderlich, nur die dem Menschen eigenen und unveräußerlichen Rechte nicht. Thomas Jefferson
Vorwort
Dieses Buch[1] ist Teil einer umfassenden Untersuchung, welche die Charakterstruktur des modernen Menschen und die Probleme der Wechselwirkung zwischen psychologischen und soziologischen Faktoren behandelt, mit der ich mich seit mehreren Jahren beschäftige und die noch lange nicht abgeschlossen ist. Die gegenwärtigen politischen Entwicklungen und die Gefahren, die sie für die größte Leistung der modernen Kultur – für die Individualität und Einmaligkeit des Menschen – mit sich bringen, haben mich jedoch bewogen, meine Arbeit an einer umfassenderen Untersuchung zu unterbrechen und mich auf einen bestimmten Aspekt zu konzentrieren, der mir für die kulturelle und gesellschaftliche Krise unserer Tage besonders wichtig ist: die Bedeutung der Freiheit für den modernen Menschen. Es würde mir die Arbeit erleichtern, könnte ich in diesem Buch den Leser auf eine abgeschlossene Untersuchung der menschlichen Charakterstruktur hinweisen, weil man die Bedeutung der Freiheit nur wirklich verstehen kann, wenn man die gesamte Charakterstruktur des modernen Menschen analysiert. So muss ich mich immer wieder auf bestimmte Begriffe und Schlussfolgerungen beziehen, ohne sie so ausführlich erläutern zu können, wie ich es getan hätte, wäre die ganze Weite des Problems bereits erfasst. Was andere, ebenfalls höchst wichtige Probleme betrifft, so konnte ich oft nur im Vorübergehen und manchmal überhaupt nicht auf sie eingehen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Psychologe unverzüglich zum Verständnis der gegenwärtigen Krise alles beisteuern sollte, was er zu bieten hat, selbst unter Aufgabe seines Wunsches nach Vollständigkeit.
Wenn ich die Bedeutung psychologischer Erwägungen beim gegenwärtigen Stand der Dinge hervorhebe, so möchte ich damit die Psychologie nicht überbewerten. Die reale Grundlage des gesellschaftlichen Prozesses ist das Individuum, seine Wünsche und Ängste, seine Leidenschaften und seine Vernunft, seine Neigung zum Guten und zum Bösen. Um die Dynamik des gesellschaftlichen Prozesses zu verstehen, müssen wir die Dynamik der psychologischen Prozesse begreifen, die sich im Individuum abspielen, genauso wie wir den Einzelnen im Kontext der ihn formenden Kultur sehen müssen, wenn wir ihn verstehen wollen. Die These dieses Buches lautet, dass der moderne Mensch, nachdem er sich von den Fesseln der vor-individualistischen [I-218] Gesellschaft befreite, die ihm gleichzeitig Sicherheit gab und ihm Grenzen setzte, sich noch nicht die Freiheit – verstanden als positive Verwirklichung seines individuellen Selbst – errungen hat; das heißt, dass er noch nicht gelernt hat, seine intellektuellen, emotionalen und sinnlichen Möglichkeiten voll zum Ausdruck zu bringen. Die Freiheit hat ihm zwar Unabhängigkeit und Rationalität ermöglicht, aber sie hat ihn isoliert und dabei ängstlich und ohnmächtig gemacht. Diese Isolierung kann der Mensch nicht ertragen, und er sieht sich daher vor die Alternative gestellt, entweder der Last seiner Freiheit zu entfliehen und sich aufs Neue in Abhängigkeit und Unterwerfung zu begeben oder voranzuschreiten zur vollen Verwirklichung jener positiven Freiheit, die sich auf die Einzigartigkeit und Individualität des Menschen gründet. Wenngleich dieses Buch eher eine Diagnose als eine Prognose – eher eine Analyse als eine Lösung – bietet, kommt es doch zu Ergebnissen, die unser Handeln beeinflussen könnten, denn nur wenn wir die Gründe für die totalitäre Flucht vor der Freiheit erkennen, können wir uns so verhalten, dass wir die totalitären Kräfte besiegen.
1 Freiheit – ein psychologisches Problem?
Im Mittelpunkt der modernen europäischen und amerikanischen Geschichte steht das Bemühen, sich von den politischen, wirtschaftlichen und geistigen Fesseln zu befreien, welche die Menschen gefangen hielten. Der Kampf um die Freiheit wurde von den Unterdrückten, die neue Freiheiten beanspruchten, gegen jene ausgefochten, die Privilegien zu verteidigen hatten. Immer wenn eine Klasse um ihre eigene Befreiung kämpfte, so tat sie das in dem Glauben, für die menschliche Freiheit als solche zu kämpfen, so dass sie an ein Ideal, an die Sehnsucht nach Freiheit bei allen Unterdrückten appellieren konnte. In diesem langen und praktisch noch immer andauernden Kampf um die Freiheit liefen jedoch Klassen, die gegen die Unterdrückung gekämpft hätten, in einem gewissen Stadium zu den Feinden der Freiheit über, nämlich dann, wenn der Sieg errungen war und es galt, neue Privilegien zu verteidigen.
Trotz vieler Rückschläge sind für die Freiheit manche Schlachten gewonnen worden. Viele sind in diesen Schlachten in der Überzeugung gestorben, es sei besser, im Kampf gegen die Unterdrückung zu sterben, als ohne Freiheit zu leben. Ein solcher Tod war für sie die höchste Bestätigung ihrer Individualität. Die Geschichte schien zu beweisen: Der Mensch kann sich selbst regieren, er kann selbst seine Entscheidungen treffen und denken und fühlen, was er für richtig hält. Die volle Entfaltung aller im Menschen schlummernden Möglichkeiten schien das Ziel zu sein, dem sich die gesellschaftliche Entwicklung mit raschen Schritten näherte. In den Grundsätzen des ökonomischen Liberalismus, der politischen Demokratie, der religiösen Autonomie und des Individualismus im persönlichen Leben kam die Sehnsucht nach Freiheit zum Ausdruck. Diese Prinzipien schienen die Menschheit der Verwirklichung dieser Sehnsucht näherzubringen. Eine Fessel nach der anderen wurde gesprengt. Der Mensch befreite sich aus seiner Beherrschung durch die Natur und machte sich zu ihrem Herrn; er beseitigte seine Beherrschung durch die Kirche und durch den absolutistischen Staat. Die Abschaffung der äußeren Botmäßigkeit schien die notwendige, aber auch hinreichende Vorbedingung für die Erreichung des ersehnten Ziels zu sein: der Freiheit des Individuums.
Viele sahen im Ersten Weltkrieg den Endkampf und in seinem Abschluss den endgültigen Sieg der Freiheit. Die bereits vorhandenen Demokratien schienen gestärkt [I-220] daraus hervorzugehen, und neue Demokratien traten an die Stelle früherer Monarchien. Aber bereits nach wenigen Jahren tauchten neue Systeme auf, die alles verleugneten, was die Menschen in Jahrhunderte langen Kämpfen errungen zu haben glaubten. Denn das Wesen dieser neuen Systeme, die sich des gesamten gesellschaftlichen und persönlichen Lebens der Bevölkerung bemächtigten, war die völlige Unterwerfung aller unter die Autorität einer Handvoll von Menschen, gegen die sie machtlos waren.
Zunächst trösteten sich viele mit dem Gedanken, der Sieg des autoritären Systems sei auf die Geistesverwirrung einiger weniger Einzelner zurückzuführen, die von ihrem Wahnsinn schon rechtzeitig wieder abgebracht werden könnten. Andere wiegten sich im Glauben, die Italiener und die Deutschen besäßen nur noch nicht genügend Übung in Demokratie, und man könne daher ruhig zuwarten, bis sie die politische Reife der westlichen Demokratien erreicht hätten. Eine andere weitverbreitete Illusion – vielleicht die allergefährlichste – war die, dass Menschen wie Hitler allein durch ihre List und Tücke die Macht über den großen Staatsapparat errungen hätten, dass sie und ihre Gefolgsleute allein durch nackte Gewalt regierten und dass die Bevölkerung nur das willenlose Objekt von Betrug und Terror sei.
Inzwischen haben sich diese Ansichten als Irrtum herausgestellt. Wir mussten erkennen, dass Millionen von Deutschen ebenso bereitwillig ihre Freiheit aufgaben, wie ihre Väter für sie gekämpft hatten; dass sie, anstatt sich nach Freiheit zu sehnen, sich nach Möglichkeiten umsahen, ihr zu entfliehen; dass weitere Millionen gleichgültig waren und nicht glaubten, dass die Verteidigung der Freiheit es wert sei, für sie zu kämpfen und für sie zu sterben. Wir haben weiterhin erkannt, dass die Krise der Demokratie kein spezifisch italienisches oder deutsches Problem ist, sondern dass jeder moderne Staat sich damit auseinanderzusetzen hat. Auch macht es keinen Unterschied, welche Symbole sich die Feinde der menschlichen Freiheit wählen: Die Freiheit ist nicht weniger gefährdet, ob sie im Namen des Antifaschismus oder im Namen des Faschismus selbst angegriffen wird. (Unter Faschismus oder Autoritarismus verstehe ich ein diktatorisches System vom deutschen oder italienischen Typ. Wenn ich mich speziell auf das deutsche System beziehe, bezeichne ich es als „Nazismus“.) John Dewey hat dies so eindrucksvoll formuliert, dass ich ihn wörtlich zitieren möchte: „Die ernste Gefahr für unsere Demokratie besteht nicht in der Existenz totalitärer fremder Staaten. Sie besteht darin, dass in unseren eigenen persönlichen Einstellungen und in unseren eigenen Institutionen Bedingungen herrschen, die der Autorität von außen, der Disziplin, der Uniformität und Abhängigkeit vom Führer in diesen Ländern zum Sieg verhelfen. Demnach befindet sich das Schlachtfeld hier – in uns selbst und in unseren Institutionen“ (J. Dewey, 1939a). Wenn wir den Faschismus bekämpfen wollen, müssen wir ihn verstehen. Wunschdenken hilft uns dabei nicht weiter. Auch die Wiederholung optimistischer Devisen nützt so wenig wie das Ritual eines indianischen Regentanzes.
Neben den ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen, die zum Faschismus geführt haben, gibt es ein den Menschen selbst betreffendes Problem, das wir verstehen müssen. Zweck dieses Buches ist es, jene dynamischen Faktoren in der Charakterstruktur des modernen Menschen zu analysieren, die in den faschistischen Ländern [I-221] dazu geführt haben, die Freiheit aufzugeben, und die bei Millionen Menschen in unserem eigenen [amerikanischen] Volk ebenfalls stark verbreitet sind.
Wenn wir den menschlichen Aspekt der Freiheit, die Sehnsucht nach Unterwerfung und das Streben nach Macht ins Auge fassen, so stellen sich vor allem folgende Fragen: Was bedeutet Freiheit als menschliche Erfahrung? Ist das Verlangen nach Freiheit etwas, das der menschlichen Natur innewohnt? Handelt es sich bei Freiheit um die gleiche Erfahrung ohne Rücksicht auf die Art der Kultur, in der jemand lebt, oder ist sie jeweils etwas Verschiedenes entsprechend dem Grad des in einer bestimmten Gesellschaft bereits erreichten Individualismus? Bedeutet Freiheit nur die Abwesenheit äußeren Drucks, oder bedeutet Freiheit auch das Vorhandensein von etwas – und wenn ja, wovon? Welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren in der Gesellschaft fördern das Streben nach Freiheit? Kann Freiheit zu einer Last werden, die den Menschen so schwer bedrückt, dass er ihr zu entfliehen sucht? Woher kommt es dann, dass Freiheit für viele ein hochgeschätztes Ziel und für andere eine Bedrohung bedeutet?
Gibt es vielleicht außer dem angeborenen Wunsch nach Freiheit auch eine instinktive Sehnsucht nach Unterwerfung? Und wenn es diese nicht gibt, wie ist dann die Anziehungskraft zu erklären, welche die Unterwerfung unter einen Führer heute auf so viele ausübt? Unterwirft man sich nur einer offenen Autorität, oder gibt es auch eine Unterwerfung unter internalisierte Autoritäten, wie die Pflicht oder das Gewissen, unter innere Zwänge oder unter anonyme Autoritäten wie die öffentliche Meinung? Gewährt es eine geheime Befriedigung, sich zu unterwerfen, und was liegt ihr zugrunde?
Was erzeugt im Menschen eine unersättliche Gier nach Macht? Ist es die Stärke seiner Lebenskraft – oder ist es eine grundsätzliche Schwäche und Unfähigkeit, das Leben spontan und liebevoll zu erleben? Welches sind die psychologischen Bedingungen, die diese Strebungen so stark machen? Und welches sind die gesellschaftlichen Bedingungen, auf denen derartige psychologische Bedingungen ihrerseits beruhen?
Die Analyse des menschlichen Aspekts der Freiheit und des Autoritarismus zwingt uns, uns mit einem allgemeinen Problem zu beschäftigen – mit der Rolle nämlich, welche psychologische Faktoren als aktive Kräfte im gesellschaftlichen Prozess spielen; und dies führt uns schließlich zum Problem der Wechselwirkung von psychologischen, ökonomischen und ideologischen Faktoren im gesellschaftlichen Prozess. Jeder Versuch, die Anziehungskraft zu begreifen, welche der Faschismus auf große Nationen ausübt, zwingt uns, uns mit der Rolle der psychologischen Faktoren zu beschäftigen. Denn wir haben es hier mit einem politischen System zu tun, das seinem Wesen nach nicht an die rationalen Kräfte des Selbstinteresses appelliert, sondern das im Menschen diabolische Kräfte weckt und mobilisiert, von deren Existenz wir nichts wussten oder von denen wir zumindest annahmen, sie seien schon lange ausgestorben. In den letzten Jahrhunderten pflegte man sich den Menschen als ein vernünftiges Wesen vorzustellen, das in seinem Handeln von seinem Selbstinteresse bestimmt wird. Selbst Schriftsteller wie Hobbes, der die Machtgier und Feindseligkeit als die treibenden Kräfte im Menschen ansah, erklärten, sie seien die logische Konsequenz des Selbstinteresses: Da die Menschen alle gleich und daher vom gleichen Wunsch nach Glück [I-222] beseelt seien und da nicht genug Güter vorhanden seien, um sie alle gleichmäßig zufriedenzustellen, müssten sie notwendigerweise miteinander kämpfen und nach Macht streben, um sicherzustellen, dass sie auch in Zukunft genießen könnten, was sie gegenwärtig besäßen. Aber das Menschenbild von Hobbes traf bald nicht mehr zu. Je mehr es dem Bürgertum gelang, die Macht der früheren politischen und religiösen Herrscher zu brechen, je besser es den Menschen gelang, die Natur zu meistern, und je mehr Millionen Menschen wirtschaftlich unabhängig wurden, umso mehr glaubte man an eine rationale Welt und an den Menschen als Vernunftwesen. Die finsteren, diabolischen Kräfte in der menschlichen Natur wurden ins Mittelalter oder in noch frühere Epochen verwiesen, und man erklärte sie mit dem Mangel an Wissen oder mit dem Ränkespiel betrügerischer Könige und Priester.
Man blickte auf diese Epochen zurück wie auf einen Vulkan, der seit langem erloschen ist und von dem keine Gefahr mehr droht. Man fühlte sich sicher und vertraute darauf, dass die Errungenschaften der modernen Demokratie alle finsteren Mächte verscheucht hätten; die Welt erschien so hell und sicher wie die gut beleuchteten Straßen einer modernen Großstadt. In den Kriegen sah man die letzten Relikte vergangener Zeiten und war der Ansicht, dass man nur noch einen einzigen, letzten Krieg brauche, um Krieg ein für allemal abzuschaffen. Wirtschaftskrisen betrachtete man als Pannen, auch wenn sie sich weiterhin mit einer gewissen Regelmäßigkeit einstellten.
Als der Faschismus an die Macht kam, waren die meisten weder theoretisch noch praktisch darauf vorbereitet. Sie konnten einfach nicht glauben, dass der Mensch einen solchen Hang zum Bösen, eine solche Machtgier, eine solche Missachtung der Rechte der Schwachen und ein solches Verlangen nach Unterwerfung bekunden konnte. Nur wenige hatten das unterirdische Grollen vor dem Ausbruch des Vulkans bemerkt. Nietzsche hatte den selbstgefälligen Optimismus des 19. Jahrhunderts aufgestört; das gleiche hatte Marx, wenn auch auf andere Weise, getan. Eine weitere Warnung kam etwas später von Freud. Zwar hatten er und die meisten seiner Schüler nur eine sehr naive Auffassung davon, was in der Gesellschaft vor sich geht, und seine Versuche, die Psychologie auf gesellschaftliche Probleme anzuwenden, waren meist irreführende Konstruktionen. Aber dadurch, dass er sein Interesse den Erscheinungen individueller emotionaler und geistiger Störungen zuwandte, führte er uns auf den Gipfel des Vulkans und ließ uns in den kochenden Krater hinunterschauen.
Freud hat die Aufmerksamkeit mehr als jeder andere auf die Beobachtung und Analyse der irrationalen und unbewussten Kräfte gelenkt, die das Verhalten der Menschen mitbestimmen. Er und seine Schüler haben in der modernen Psychologie nicht nur den irrationalen und unbewussten Bereich der menschlichen Natur entdeckt, dessen Existenz der moderne Rationalismus übersehen hatte, Freud hat auch gezeigt, dass diese irrationalen Phänomene bestimmten Gesetzen folgen und daher rational zu verstehen sind. Er hat uns gelehrt, die Sprache der Träume und der somatischen Symptome ebenso wie die Irrationalitäten im menschlichen Verhalten zu verstehen. Er hat entdeckt, dass sowohl das irrationale Verhalten eines Menschen als auch seine gesamte Charakterstruktur die Reaktion auf Einflüsse ist, welche die Außenwelt insbesondere während seiner frühen Kindheit auf ihn ausübte. [I-223]
Aber Freud war so sehr vom Geist seiner Kultur durchtränkt, dass er über ihre Grenzen nicht hinwegkam. Eben diese Grenzen schränkten sein Verständnis für den kranken Menschen ein und sie waren ein Hindernis für sein Verständnis des normalen Menschen und der irrationalen Phänomene im Leben der Gesellschaft.
Da dieses Buch die Rolle, welche die psychologischen Faktoren im gesellschaftlichen Gesamtprozess spielen, in den Vordergrund stellt, und da sich diese Analyse auf einige der grundlegenden Entdeckungen Freuds gründet – besonders auf jene, welche das Wirken unbewusster Kräfte im Charakter des Menschen und ihre Abhängigkeit von äußeren Einflüssen betreffen – halte ich es für angebracht, den Leser schon jetzt auf die allgemeinen Grundsätze der hier vertretenen Auffassung und auf die Hauptunterschiede zwischen dieser Auffassung und den klassischen Freudschen Vorstellungen hinzuweisen.[3]
Freud übernahm die traditionelle Überzeugung von der grundsätzlichen Dichotomie zwischen Mensch und Gesellschaft und die Lehre, dass der Mensch von Natur aus böse sei. Für ihn ist der Mensch grundsätzlich antisozial. Die Gesellschaft muss ihn erst domestizieren. Sie muss zwar die direkte Befriedigung einiger biologischer und daher unausrottbarer Triebe zulassen, aber sie muss die meisten Basisimpulse im Menschen verfeinern und geschickt in Zaum halten. Infolge dieser Unterdrückung der natürlichen Impulse durch die Gesellschaft geschieht etwas Wunderbares: Die unterdrückten Triebe verwandeln sich in kulturell wertvolle Strebungen und werden so zur Grundlage der menschlichen Kultur. Freud hat diese merkwürdige Umwandlung des Unterdrückten in ein zivilisiertes Verhalten als Sublimierung bezeichnet. Wenn mehr unterdrückt werden muss als sublimiert werden kann, so wird der Betreffende neurotisch; dann muss man ihm erlauben, weniger zu unterdrücken. Im allgemeinen besteht jedoch ein umgekehrtes Verhältnis zwischen der Befriedigung der menschlichen Triebe und der Kultur: je größer die Unterdrückung, umso mehr Kultur (und umso größer ist die Gefahr, dass es zu neurotischen Störungen kommt). Die Beziehung des Einzelnen zur Gesellschaft ist nach Freuds Theorie ihrem Wesen nach statisch: Der Einzelne bleibt sich praktisch immer gleich und ändert sich nur insoweit, als die Gesellschaft einen größeren Druck auf seine natürlichen Triebe ausübt (und so eine noch stärkere Sublimierung erzwingt) oder ihm mehr Befriedigung erlaubt (und dafür Kultur opfert).
Genau wie die früheren Psychologen die Existenz von Grundinstinkten annahmen, sah auch Freud die menschliche Natur im Wesentlichen als eine Widerspiegelung der wichtigsten beim modernen Menschen zu beobachtenden Triebregungen. Für ihn repräsentiert der einzelne Vertreter seiner Kultur „den Menschen“ schlechthin, und er sah in den für den Menschen der modernen Gesellschaft kennzeichnenden Leidenschaften und Ängsten ewige, in der biologischen Konstitution des Menschen wurzelnde Kräfte. [I-224]
Wir könnten für diese Sicht Freuds viele Beispiele anführen (etwa die gesellschaftliche Ursache der heute so weit verbreiteten Feindseligkeit, den Ödipuskomplex oder auch den sogenannten Kastrationskomplex der Frau[4]). Ich möchte mich jedoch auf ein Beispiel beschränken, das mir deshalb besonders wichtig erscheint, weil es die Gesamtauffassung vom Menschen als einem sozialen Wesen betrifft. Freud betrachtet den Einzelnen stets in seinen Beziehungen zu anderen. Diese Beziehungen sind jedoch nach Freuds Ansicht annähernd gleichbedeutend mit den wirtschaftlichen Beziehungen, welche für den Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft charakteristisch sind. Ein jeder arbeitet für sich selbst, individualistisch auf sein eigenes Risiko und nicht in erster Linie in Zusammenarbeit mit anderen. Aber er ist auch kein Robinson Crusoe; er ist auf die anderen angewiesen als Kunden, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber. Er muss kaufen und verkaufen, geben und nehmen. Der Markt reguliert diese Beziehungen, ob es sich nun um den Gebrauchsgütermarkt oder um den Arbeitsmarkt handelt. Daher ist der Einzelne in erster Linie allein und selbstgenügsam. Knüpft er mit anderen wirtschaftliche Beziehungen an, so geschieht das nur zu dem einen Zweck: zu verkaufen und zu kaufen. Freuds Auffassung von den menschlichen Beziehungen entspricht im Wesentlichen dieser Auffassung: Der Einzelne ist mit biologischen Trieben ausgestattet, die unbedingt befriedigt werden müssen. Um sie zu befriedigen, tritt er mit anderen „Objekten“ in Beziehung. So sind ihm die anderen Menschen stets Mittel zum Zweck, zum Zweck der Befriedigung von Strebungen, die im Individuum bereits vorhanden sind, bevor es mit anderen in Kontakt kommt. Der Bereich menschlicher Beziehungen im Sinne Freuds gleicht dem Markt: Es handelt sich dabei um einen Austausch von Befriedigungen biologisch bedingter Bedürfnisse, wobei die Beziehung zu anderen Personen stets ein Mittel zum Zweck und niemals Selbstzweck ist.
Im Gegensatz zu Freuds Standpunkt gründet sich meine Analyse in diesem Buch auf die Überzeugung, dass das Schlüsselproblem der Psychologie die spezifische Art der Bezogenheit des Individuums zur Welt und nicht die Befriedigung oder Nicht-Befriedigung dieses oder jenes triebhaften Bedürfnisses an sich ist. Außerdem gehe ich von der Annahme aus, dass die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft keine statische ist. Es ist nicht so, als ob es da einerseits einen Einzelmenschen gäbe, der von der Natur mit bestimmten Trieben ausgestattet wurde, und andererseits die Gesellschaft als etwas, das außerhalb von ihm existiert und diese angeborenen Strebungen entweder befriedigt oder unbefriedigt lässt. Wenn es auch gewisse allen Menschen gemeinsame Bedürfnisse gibt, wie etwa Hunger, Durst und Sexualität, sind jene Triebe, welche die Unterschiede im Charakter der Menschen bedingen – etwa Liebe und Hass, das Streben nach Macht und das Verlangen, sich zu unterwerfen, die Freude an sinnlichem Genuss und die Angst davor –, sämtlich Produkte des gesellschaftlichen Prozesses. Die schönsten wie auch die abscheulichsten Neigungen des Menschen sind kein festgelegter, biologisch gegebener Bestandteil seiner Natur, sondern das Resultat des gesellschaftlichen Prozesses, der den Menschen erzeugt. Die Gesellschaft hat also nicht nur die Funktion, etwas zu unterdrücken – obwohl sie auch diese Funktion hat –, sondern auch eine kreative Funktion. Die Natur des Menschen, seine Leidenschaften und seine Ängste, sind ein Produkt der Kultur. Tatsächlich ist der Mensch [I-225] selbst die wichtigste Schöpfung und Errungenschaft des unaufhörlichen menschlichen Bemühens, die Dokumentation dessen, was wir Geschichte nennen.
Es ist die besondere Aufgabe des Sozialpsychologen, diesen Prozess der Selbsterzeugung des Menschen in der Geschichte verstehen zu lernen. Wieso kommt es beim Übergang von einer historischen Epoche zur anderen zu bestimmten Veränderungen im menschlichen Charakter? Weshalb ist der Geist der Renaissance so anders als der des Mittelalters? Weshalb ist die Charakterstruktur des Menschen im Zeitalter des Monopolkapitalismus anders als die im 19. Jahrhundert? Aufgabe der Sozialpsychologie ist es zu erklären, wieso neue Fähigkeiten und neue Leidenschaften – schlechte oder gute – entstehen. So finden wir zum Beispiel, dass seit der Renaissance bis in unsere Tage der Mensch von einem brennenden Ehrgeiz nach Ruhm erfüllt ist, während dieses uns heute so selbstverständlich erscheinende Streben in der mittelalterlichen Gesellschaft kaum vorhanden war (vgl. J. Burckhardt, 1928, 3. Kap., 2. und 4. Abschnitt). In der Renaissance entwickelten die Menschen auch ein Gefühl für die Schönheit der Natur, das sie zuvor nicht besaßen. Dann aber erwarb der Mensch in den Ländern des Nordens seit dem 16. Jahrhundert ein zwanghaftes Streben zu arbeiten, wie es bis dahin bei freien Menschen nicht zu beobachten war.
Der Mensch wird jedoch nicht nur von der Geschichte geschaffen. Die Geschichte wird auch ihrerseits vom Menschen geschaffen. Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs bildet das Aufgabenfeld der Sozialpsychologie.[5] Die Aufgabe besteht darin, nicht nur zu zeigen, wie die Leidenschaften, Wünsche und Ängste sich als Resultat des gesellschaftlichen Prozesses ändern und entwickeln, sondern auch wie die so in bestimmte Formen geprägten Energien des Menschen ihrerseits zu Produktivkräften werden, welche den gesellschaftlichen Prozess formen. So sind zum Beispiel das Streben nach Ruhm und Erfolg und der Trieb zur Arbeit Kräfte, ohne die sich der moderne Kapitalismus nicht hätte entwickeln können. Ohne diese und eine Reihe anderer menschlicher Kräfte hätte dem Menschen der Antrieb gefehlt, sich den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfordernissen des modernen Wirtschafts- und Industriesystems entsprechend zu verhalten.
Hieraus folgt, dass der in diesem Buch vertretene Standpunkt sich von dem Freuds insofern unterscheidet, als ich seine Interpretation der Geschichte als Resultat psychologischer Kräfte, die ihrerseits nicht gesellschaftlich bedingt sind, nachdrücklich ablehne. Ebenso nachdrücklich lehne ich jene Theorien ab, die außer acht lassen, dass der Faktor „Mensch“ eines der dynamischen Elemente im gesellschaftlichen Prozess ist. Diese Kritik richtet sich nicht nur gegen soziologische Theorien, die – wie die von Durkheim und seiner Schule – psychologische Probleme ausdrücklich aus der Soziologie heraushalten möchten, sondern auch gegen Theorien, die mehr oder weniger an einer behavioristischen Psychologie orientiert sind. Allen diesen Theorien ist die Annahme gemeinsam, dass die menschliche Natur keine eigene Dynamik besitzt, so dass psychologische Veränderungen nur als Entwicklung neuer Gewohnheiten, als Anpassung an neue kulturelle Muster aufzufassen sind. Diese Theorien reden zwar [I-226] auch von dem psychologischen Faktor, doch reduzieren sie ihn zum bloßen Schatten kultureller Muster. Nur eine dynamische Psychologie, zu der Freud die Grundlagen gelegt hat, kann dem Faktor „Mensch“ wirklich gerecht werden. Wenn es auch keine von vornherein festgelegte menschliche Natur gibt, so darf man sie doch auch nicht als etwas unbegrenzt Formbares ansehen, das sich an Bedingungen jeder Art anpassen könnte, ohne eine eigene psychologische Dynamik zu entwickeln. Wenngleich die menschliche Natur das Produkt der historischen Entwicklung ist, so besitzt sie doch bestimmte ihr innewohnende Mechanismen und Gesetze, deren Aufdeckung die Aufgabe der Psychologie ist.
Hier scheint es mir zum vollen Verständnis des bereits Gesagten wie auch des noch Folgenden angebracht, auf den Begriff der Anpassung näher einzugehen. Diese Diskussion soll gleichzeitig veranschaulichen, was wir unter psychologischen Mechanismen und Gesetzen verstehen. Dabei scheint es mir angebracht, zwischen einer „statischen“ und einer „dynamischen“ Anpassung zu unterscheiden. Unter statischer Anpassung verstehe ich eine Anpassung an Verhaltensmuster, bei der die gesamte Charakterstruktur unverändert bleibt und bei der es nur darum geht, sich an eine neue Gewohnheit anzupassen. Ein Beispiel für diese Art der Anpassung ist ein Chinese, der sich an Stelle der eigenen Essgewohnheiten an die Benutzung von Messer und Gabel gewöhnt. Ein Chinese, der nach Amerika kommt, wird sich zwar an diese für ihn neue Gewohnheit anpassen, doch wird diese Anpassung kaum einen Einfluss auf seine Persönlichkeit haben; sie erzeugt bei ihm keine neuen Triebe oder Charakterzüge.
Unter dynamischer Anpassung verstehe ich dagegen die Art von Anpassung, zu der es beispielsweise kommt, wenn ein kleiner Junge sich den Geboten eines strengen, bedrohlichen Vaters unterwirft – weil er zu große Angst vor diesem hat, um sich anders zu verhalten – und so zu einem „braven“ Jungen wird. Während er sich den Notwendigkeiten der Situation anpasst, geschieht etwas mit ihm. Er entwickelt vielleicht eine intensive Feindseligkeit gegen seinen Vater, die er verdrängt, weil es zu gefährlich wäre, sie offen zu äußern oder sich ihrer auch nur bewusst zu werden. Diese verdrängte Feindseligkeit ist jedoch, obwohl sie nicht manifest ist, ein dynamischer Faktor in seiner Charakterstruktur. Sie kann neue Angst erzeugen und so zu einer noch stärkeren Unterwerfung führen; sie kann aber auch zu einer unbestimmten Trotzhaltung führen, die sich nicht gegen jemand besonderes, sondern vielmehr gegen das Leben im Allgemeinen richtet. Während sich hier – genau wie im ersten Fall – ein Mensch bestimmten äußeren Umständen anpasst, erzeugt diese Art der Anpassung in ihm etwas Neues, erregt in ihm neue Triebe und neue Ängste. Jede Neurose ist ein Beispiel für eine solche dynamische Anpassung; sie ist ihrem Wesen nach eine Anpassung an äußere Bedingungen (besonders in der frühen Kindheit), die in sich selbst irrational und ganz allgemein dem Wachstum und der Entwicklung des Kindes abträglich sind. Es gibt auch sozio-psychologische Phänomene, die neurotischen Phänomenen ähnlich sind. (Wir werden noch darauf zurückkommen, weshalb man sie nicht als neurotisch bezeichnen sollte.) Hierzu gehören etwa starke destruktive und sadistische Impulse in sozialen Gruppen, die ein Beispiel für die dynamische Anpassung an gesellschaftliche Bedingungen geben, welche für die Entwicklung der Menschen [I-227] irrational und schädlich sind. Neben der Frage, um welche Art von Anpassung es sich jeweils handelt, sind noch weitere Fragen zu beantworten: Was ist es, das den Menschen zwingt, sich fast jeder nur vorstellbaren Lebensbedingung anzupassen, und welche Grenzen sind einer solchen Anpassungsfähigkeit gesetzt?
Wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir uns zunächst damit befassen, dass es gewisse Bereiche in der menschlichen Natur gibt, die flexibler und anpassungsfähiger sind als andere. All jene Strebungen und Charakterzüge, durch die sich die Menschen voneinander unterscheiden, sind bis zu einem gewissen Grad elastisch und formbar: z.B. Liebe, Destruktivität, Sadismus, die Neigung, sich anderen zu unterwerfen, Machtstreben, Absonderung von anderen, das Verlangen nach Selbstverherrlichung, übertriebene Sparsamkeit, die Freude an sinnlichem Genuss und die Angst vor der Sinnlichkeit. Diese und viele andere Strebungen und Ängste, die im Menschen zu finden sind, entwickeln sich als Reaktion auf bestimmte Lebensbedingungen. Sind diese Ängste und Bestrebungen erst einmal zu einem Bestandteil des Charakters eines bestimmten Menschen geworden, verlieren sie ihre Flexibilität, verschwinden nicht mehr so leicht und verwandeln sich auch nicht mehr in andere Triebe. Aber sie sind doch in dem Sinn flexibel, als einzelne Menschen – insbesondere in ihrer Kindheit – entsprechend ihrer jeweiligen Lebensumstände das eine oder andere Bedürfnis entwickeln. Keines dieser Bedürfnisse ist so definitiv festgelegt und starr, als wenn es ein angeborener Bestandteil der menschlichen Natur wäre, der sich entwickelt und unter allen Umständen befriedigt werden muss.
Im Gegensatz zu diesen Bedürfnissen gibt es noch andere, bei denen es sich um unentbehrliche Teile der menschlichen Natur handelt und die unbedingt befriedigt werden müssen, nämlich jene Bedürfnisse, die in der physiologischen Organisation des Menschen wurzeln, wie etwa Hunger, Durst, Schlafbedürfnis und dergleichen. Bei jedem dieser Bedürfnisse gibt es eine bestimmte Schwelle, jenseits derer eine fehlende Befriedigung unerträglich ist. Wird sie überschritten, so gewinnt das Bedürfnis nach Befriedigung die Qualität einer unwiderstehlichen Strebung. Alle diese physiologisch bedingten Bedürfnisse lassen sich in den Begriff des Bedürfnisses nach Selbsterhaltung zusammenfassen. Dieses Bedürfnis nach Selbsterhaltung ist der Teil der menschlichen Natur, der unter allen Umständen befriedigt werden muss, und stellt daher das primäre Motiv menschlichen Verhaltens dar.
Auf eine einfache Formel gebracht heißt das: Der Mensch muss essen, trinken, schlafen, sich gegen Feinde schützen usw. Um all das tun zu können, muss er arbeiten und produzieren. „Arbeit“ ist jedoch nichts Allgemeines oder Abstraktes. Bei der Arbeit handelt es sich stets um konkrete Arbeit, das heißt um eine spezifische Art der Arbeit in einem spezifischen Wirtschaftssystem. Jemand kann als Sklave in einem Feudalsystem, als Bauer in einem indianischen Pueblo, als selbständiger Geschäftsmann in einer kapitalistischen Gesellschaft, als Verkäuferin in einem modernen Warenhaus oder als Arbeiter am Fließband einer großen Fabrik arbeiten. Diese verschiedenen Arten der Arbeit erfordern völlig unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und führen zu unterschiedlichen Arten der Bezogenheit zu anderen. Wenn ein Mensch geboren wird, ist der Schauplatz seines Lebens bereits festgelegt. Er muss essen und trinken, und deshalb muss er arbeiten; er muss also unter den spezifischen [I-228] Bedingungen und auf eben die Art arbeiten, die ihm durch die Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde, vorgeschrieben ist. Beide Faktoren, sein Bedürfnis zu leben und das Gesellschaftssystem, kann er als Individuum prinzipiell nicht ändern, und es sind diese Faktoren, die die Entwicklung jener anderen, flexibleren Charakterzüge bestimmen. So wird die Lebensweise, wie sie für den Einzelnen durch die Besonderheit eines Wirtschaftssystems gegeben ist, zu dem Faktor, der primär seine gesamte Charakterstruktur bestimmt, weil der gebieterische Selbsterhaltungstrieb ihn zwingt, die Bedingungen, unter denen er leben muss, zu akzeptieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass er nicht zusammen mit anderen versuchen könnte, gewisse ökonomische und politische Veränderungen herbeizuführen. Aber primär wird seine Persönlichkeit durch die besondere Lebensweise bestimmt, mit der er schon als Kind durch das Medium seiner Familie konfrontiert wurde und die alle Merkmale aufweist, die für eine bestimmte Gesellschaft oder Klasse typisch sind.[6] Die physiologisch bedingten Bedürfnisse sind nicht der einzige gebieterische Bestandteil der menschlichen Natur. Sie hat noch einen anderen ebenso zwingenden Aspekt, der nicht in körperlichen Prozessen wurzelt, sondern der im Wesen der menschlichen Lebensweise und Lebenspraxis begründet liegt: das Bedürfnis, auf die Welt außerhalb seiner selbst bezogen zu sein, und das Bedürfnis, Einsamkeit zu vermeiden. Wenn man sich völlig allein und isoliert fühlt, so führt das zur seelischen Desintegration, genau wie das Fehlen von Nahrung zum Tode führt. Diese Bezogenheit auf andere ist nicht dasselbe wie körperlicher Kontakt. Ein Mensch kann in physischer Beziehung viele Jahre lang für sich allein leben und trotzdem mit Ideen, Werten oder wenigstens mit gesellschaftlichen Verhaltensmustern verbunden sein, die ihm ein Gefühl der Gemeinsamkeit geben, das Gefühl „dazu zu gehören“. Andererseits kann man unter Menschen leben und trotzdem von einem Gefühl unbeschreiblicher Vereinsamung überwältigt werden, das – wenn es eine gewisse Grenze überschreitet – zu einer Geisteskrankheit mit schizophrener Symptomatik führt. Diese fehlende Beziehung zu Werten, Symbolen oder bestimmten Verhaltensmustern können wir als „seelische Vereinsamung“ bezeichnen. Diese ist ebenso unerträglich wie die körperliche Vereinsamung, oder – besser gesagt – die körperliche Vereinsamung wird erst unerträglich, wenn die seelische Vereinsamung hinzukommt. Die geistige Bezogenheit auf die Welt kann viele Formen annehmen. Der Mönch, der allein in seiner Zelle lebt, aber an Gott glaubt, und der politische Gefangene, der in Isolierhaft gehalten wird, sich aber mit seinen Mitkämpfern eins fühlt, sind seelisch nicht allein.
Auch der englische Gentleman, der [I-229] noch in der fremdesten Umgebung seinen Smoking trägt, ist es nicht, genauso wenig wie der Kleinbürger, der zwar von seinen Mitbürgern völlig isoliert lebt, sich aber mit seinem Volk oder dessen Symbolen eins fühlt. Die Bezogenheit auf die Welt kann von hohen Idealen getragen oder trivial sein, aber selbst wenn sie noch so trivialer Art ist, ist sie dennoch dem Alleinsein noch unendlich vorzuziehen. Die Religion und der Nationalismus oder auch irgendeine Sitte oder ein noch so absurder und menschenunwürdiger Glaube sind – wenn sie den Einzelnen nur mit anderen verbinden – eine Zuflucht vor dem, was der Mensch am meisten fürchtet: die Isolation.
Das zwingende Bedürfnis, die seelische Isolierung zu vermeiden, hat Balzac in den Leiden eines Erfinders besonders eindrucksvoll geschildert:
Aber merke dir eines und präge es deinem noch so formbaren Geist ein: Der Mensch hat eine panische Angst vor dem Alleinsein. Und von allen Arten des Alleinseins ist das seelische Alleinsein die schrecklichste. Die ersten Einsiedler lebten mit Gott, sie bewohnten die am dichtesten bevölkerte Welt, die Welt der Geister. Der erste Gedanke des Menschen, sei er ein Aussätziger oder ein Gefangener, ein Sünder oder ein Krüppel, ist stets der, einen Schicksalsgefährten zu finden. Um diesen Drang, der das Leben selber ist, zu stillen, nimmt er seine ganze Energie, seine ganze Kraft zusammen. Hätte wohl Satan jemals Gefährten gefunden ohne diesen übermächtigen Drang? Man könnte über dieses Thema ein ganzes Epos schreiben, das der Prolog zum Verlorenen Paradies wäre, weil das Verlorene Paradies nichts anderes ist als die Apologie der Rebellion. (H. de Balzac, 1965.)
Der Versuch, die Frage zu beantworten, weshalb die Angst vor der Isolation im Menschen so mächtig ist, würde uns vom Hauptziel dieses Buches zu weit abführen. Doch möchte ich immerhin andeuten, in welcher Richtung meiner Ansicht nach die Antwort zu suchen ist, um beim Lesen nicht den Eindruck zu erwecken, als ob an dem Bedürfnis, sich mit anderen eins zu fühlen, etwas Geheimnisvolles sei.
Eine wichtige Rolle spielt die Tatsache, dass der Mensch nicht leben kann, ohne irgendwie mit anderen zusammenzuarbeiten. In jeder nur vorstellbaren Kultur muss der Mensch, wenn er am Leben bleiben will, mit anderen zusammenarbeiten, entweder indem er sich mit ihnen gemeinsam gegen Feinde oder Naturgewalten verteidigt, oder um arbeiten und produzieren zu können. Selbst Robinson Crusoe hatte seinen Gefährten Freitag; ohne diesen wäre er vermutlich nicht nur wahnsinnig geworden, sondern tatsächlich umgekommen. Jeder erlebt die Hilfsbedürftigkeit besonders drastisch als Kind. Da das Kind tatsächlich noch nicht in der Lage ist, sich hinsichtlich der lebenserhaltenden Funktionen selbst zu versorgen, ist die Kommunikation mit anderen eine Frage auf Leben und Tod. Die Möglichkeit, allein gelassen zu werden, ist deshalb zweifellos die schwerste Bedrohung im Leben.
Aber noch etwas anderes macht das Bedürfnis „dazuzugehören“ so überwältigend stark, nämlich die Tatsache, dass der Mensch sich seiner selbst bewusst ist, dass er die Fähigkeit zu denken hat, wodurch er sich seiner selbst als einer individuellen Größe bewusst wird, von der Natur und von anderen Menschen unterschieden. Obwohl der Grad dieses Bewusstseins variiert, wie wir im nächsten Kapitel zeigen werden, sieht sich der Mensch hierdurch doch mit einem Problem konfrontiert, das seinem Wesen nach ein menschliches Problem ist: Dadurch, dass er sich als von der Natur und den [I-230] anderen Menschen unterschieden erfährt, und dadurch, dass er sich – wenn auch nur vage – bewusst ist, dass es Tod, Krankheit und Alter gibt, empfindet er unvermeidlich seine Bedeutungslosigkeit und Kleinheit im Vergleich zum All und zu allen anderen, die nicht „er“ sind. Wenn er nicht irgendwo dazugehörte, wenn sein Leben keinen Sinn und keine Richtung hätte, würde er sich wie ein Staubkörnchen vorkommen und von seiner individuellen Bedeutungslosigkeit überwältigt werden. Er wäre nicht fähig, zu einem anderen System in Beziehung zu treten, das seinem Leben Sinn und Richtung gibt. Er wäre voller Zweifel, und dieses Zweifeln würde schließlich seine Fähigkeit zu handeln – d.h. zu leben – lähmen.
Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich noch einmal zusammenfassen, was bisher über unsere allgemeine Methode gesagt wurde, die Probleme der Sozialpsychologie anzugehen. Die menschliche Natur ist weder eine biologisch von vornherein festgelegte, angeborene Summe von Trieben, noch ist sie der leblose Schatten kultureller Muster, dem sie sich reibungslos anpasst. Sie ist vielmehr das Produkt der menschlichen Entwicklung, doch besitzt sie auch ihre eigenen Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten. Es gibt in der menschlichen Natur gewisse Faktoren, die festgelegt und unveränderlich sind: die Notwendigkeit, die physiologisch bedingten Triebe zu befriedigen, und die Notwendigkeit, Isolierung und seelische Vereinsamung zu vermeiden. Wir sahen, dass der Einzelne die Lebensweise akzeptieren muss, die im besonderen Produktions- und Verteilungssystem seiner Gesellschaft verwurzelt ist. Im Prozess der dynamischen Anpassung an die Kultur entwickeln sich eine Anzahl mächtiger Triebe, welche die Handlungen und Gefühle des Einzelnen motivieren. Der Einzelne kann sich dieser Triebe bewusst sein oder auch nicht. Sie sind in jedem Fall mächtig in ihm und verlangen nach Befriedigung, wenn sie sich einmal entwickelt haben. Sie werden zu machtvollen Kräften, die ihrerseits den gesellschaftlichen Prozess mitgestalten. Wie die wirtschaftlichen, die psychologischen und ideologischen Faktoren sich wechselseitig beeinflussen und welche weiteren Schlüsse aus dieser Interaktion zu ziehen sind, wird Gegenstand unserer Analyse der Reformation und des Faschismus in einem späteren Kapitel sein. (Im Anhang werde ich die allgemeinen Aspekte der Wechselbeziehung zwischen psychologischen und sozio-ökonomischen Kräften eingehender erläutern.)
Im Mittelpunkt dieser Erörterung wird stets das Hauptthema dieses Buches stehen: die Freiheit. Der Mensch hat – je mehr er aus seinem ursprünglichen Einssein mit seinen Mitmenschen und der Natur heraustritt und „Individuum“ wird, keine andere Wahl, als sich entweder mit der Welt in spontaner Liebe und produktiver Arbeit zu vereinen oder aber auf irgendeine Weise dadurch Sicherheit zu finden, dass er Bindungen an die Welt eingeht, die seine Freiheit und die Integrität seines individuellen Selbst zerstören.[7]
2 Das Auftauchen des Individuums und das Doppelgesicht der Freiheit
Bevor wir uns nun unserem Hauptthema zuwenden – der Frage, was die Freiheit dem heutigen Menschen bedeutet und weshalb und auf welche Weise er ihr zu entrinnen trachtet – müssen wir zunächst noch eine bestimmte Auffassung erörtern, die uns vielleicht nicht eben aktuell vorkommen mag, ohne die wir jedoch nicht verstehen können, was Freiheit in der modernen Gesellschaft bedeutet. Ich meine die Auffassung, dass Freiheit ein charakteristisches Merkmal der menschlichen Existenz ist und dass ihre Bedeutung sich ändert, je nachdem in welchem Grad der Mensch sich seiner selbst als einem unabhängigen und separaten Wesen bewusst ist und sich als solches begreift.
Die Geschichte des Menschen als eines gesellschaftlichen Wesens begann damit, dass er aus einem Zustand des Einsseins mit der Natur heraustrat und sich seiner selbst als einer von der ihn umgebenden Natur und seinen Mitmenschen abgesonderten Größe bewusst wurde. Allerdings blieb dieses Bewusstsein während langer Geschichtsperioden sehr vage und unbestimmt. Noch immer blieb der Einzelne an die Welt der Natur und an die Gesellschaft, aus der er hervorgegangen war, gebunden, und wenn er sich auch bis zu einem gewissen Grad bewusst war, eine separate Größe zu sein, so fühlte er sich doch gleichzeitig als Teil der ihn umgebenden Welt. Der Prozess der immer stärkeren Loslösung des Individuums von seinen ursprünglichen Bindungen, den wir als „Individuation“ bezeichnen können, scheint in den Jahrhunderten zwischen der Reformation und der Gegenwart seinen Höhepunkt erreicht zu haben.
In der Lebensgeschichte des Einzelnen begegnen wir dem gleichen Prozess. Ein Kind wird geboren, wenn es mit seiner Mutter keine Einheit mehr bildet und zu einer von ihr getrennten biologischen Größe wird. Obwohl diese biologische Trennung den Anfang der individuellen menschlichen Existenz darstellt, bleibt das Kind doch, was seine Lebensfunktionen anbetrifft, noch ziemlich lange eine Einheit mit seiner Mutter.
In dem Maße wie der Einzelne – bildlich gesprochen – die Nabelschnur, die ihn mit der Außenwelt verbindet, nicht völlig durchtrennt hat, ist er noch nicht frei; andererseits verleihen ihm diese Bindungen Sicherheit und Verwurzelung. Ich möchte die [I-232] Bindungen, die bestehen, bevor der Prozess der Individuation zur völligen Loslösung des Individuums geführt hat, als „primäre Bindungen“ bezeichnen. Sie sind organisch in dem Sinne, als sie ein Bestandteil der normalen menschlichen Entwicklung sind; sie implizieren einen Mangel an Individualität, aber sie verleihen dem Betreffenden auch Sicherheit und ermöglichen ihm eine Orientierung. Es sind jene Bindungen, die das Kind mit der Mutter, den Angehörigen eines primitiven Stammes mit seiner Sippe und der Natur oder den mittelalterlichen Menschen mit der Kirche und seinem sozialen Stand verbinden. Ist einmal das Stadium der völligen Individuation erreicht und hat sich der Einzelne von diesen primären Bindungen gelöst, so sieht er sich vor eine neue Aufgabe gestellt: Er muss sich jetzt in der Welt orientieren, neu Wurzeln finden und zu einer neuen Sicherheit auf andere Weise gelangen, als dies für seine vorindividuelle Existenz charakteristisch war. Freiheit hat demnach jetzt eine andere Bedeutung als vor dieser Entwicklungsstufe. Wir müssen hier kurz innehalten, um diese Begriffe klarzustellen, indem wir sie anhand der Entwicklung der Einzelmenschen und der Gesellschaft konkreter erörtern.
Der verhältnismäßig plötzliche Übergang vom Fötus zur menschlichen Existenz und das Durchschneiden der Nabelschnur ist ein Zeichen dafür, dass das Kind vom Mutterleib unabhängig geworden ist. Aber diese Unabhängigkeit ist nur in dem Sinne wirklich eingetreten, als beide Körper jetzt voneinander getrennt sind. In Bezug auf seine Körperfunktionen bleibt das Kleinkind noch ein Teil der Mutter. Es wird von ihr gefüttert, getragen und sein Leben hängt von ihrer Fürsorge ab. Langsam nur gelangt das Kind dazu, die Mutter und Gegenstände als von ihm getrennte Größen zu erkennen. Bei diesem Prozess spielt die neurologische und die allgemeine körperliche Entwicklung des Kindes eine wichtige Rolle, dass es lernt, Gegenstände – körperlich und geistig – zu erfassen und mit ihnen umzugehen. Durch die eigene Aktivität lernt es die Welt außerhalb seiner selbst kennen. Der Individuationsprozess wird durch die Erziehung gefördert. Dieser Prozess bringt eine Reihe von Versagungen und Verboten mit sich, wodurch die Rolle der Mutter sich verändert. Sie wird zu einer Person, die nun Dinge vom Kind verlangt, welche seinen Wünschen entgegenstehen, und erscheint ihm jetzt oft als eine feindselige und gefährliche Person.[8] Dieser Antagonismus, der einen Teil des Erziehungsprozesses – wenn auch keineswegs die ganze Erziehung – ausmacht, spielt eine wichtige Rolle dabei, dass das Kind lernt, schärfer zwischen dem „Ich“ und dem „Du“ zu unterscheiden.
Nach der Geburt vergehen einige Monate, bevor das Kind andere Personen auch nur als solche erkennt und fähig ist, mit einem Lächeln auf sie zu reagieren, und es dauert Jahre, bis es gelernt hat, sich nicht mehr mit dem All zu verwechseln. (Vgl. J. Piaget, 1932, S. 407; sowie H. S. Sullivan, 1940, S. 10 ff.) Bis dahin zeigt es die besondere Art von Ich-Bezogenheit, die für das Kind typisch ist, eine Ich-Bezogenheit, die eine zärtliche Liebe zu anderen und ein Interesse an ihnen nicht ausschließt, wobei es die [I-233] „anderen“ aber noch nicht als tatsächlich von ihm getrennt erlebt. Aus dem gleichen Grund bedeutet es auch etwas anderes, wenn das Kind sich in seinen ersten Lebensjahren an eine Autorität anlehnt, als wenn jemand das später tut. Die Eltern – oder wer immer sonst diese Autorität sein mag – werden vom Kind noch nicht als eine grundsätzlich von ihm getrennte Größe angesehen; sie sind Teil seiner Welt, und diese Welt ist noch ein Teil des Kindes; die Unterwerfung unter sie besitzt deshalb eine andere Qualität als jene Art der Unterwerfung, um die es sich dann handelt, wenn zwei Menschen wirklich zwei voneinander getrennte Persönlichkeiten sind.
Eine bemerkenswert scharfsinnige Schilderung, wie ein zehnjähriges Mädchen sich plötzlich der eigenen Individualität bewusst wird, gibt Richard Hughes in dem Roman A High Wind in Jamaica:
Und dann ereignete sich etwas, was für Emily sehr wichtig war. Sie merkte plötzlich, wer sie war. Es ist schwer zu sagen, weshalb sie es nicht schon fünf Jahre früher oder auch erst fünf Jahre später merkte; und es bleibt auch unklar, weshalb es gerade an diesem Nachmittag dazu kam. Sie hatte „Haus im Winkel“ gespielt, direkt am Bug hinterm Ankerspill (an das sie einen gespaltenen Haken als Türklopfer gehängt hatte); dann war sie des Spiels überdrüssig geworden und war ziemlich ziellos nach achtern geschlendert, wobei sie träumerisch über Bienen und die Feenkönigin nachdachte – als ihr plötzlich durch den Sinn fuhr, dass sie sie war. Sie blieb wie angewurzelt stehen und fing an, sich über alles Rechenschaft zu geben, was sie von sich sehen konnte. Viel war das gerade nicht, nur eine verkürzte Ansicht ihres Kleides und ihre Hände, als sie sie hochhielt, um sie zu betrachten. Aber das genügte, um ihr eine Vorstellung von ihrem kleinen Körper zu geben, von dem sie plötzlich merkte, dass es ihrer war. Sie lachte ein bisschen spöttisch und dachte ungefähr Folgendes: „Stell dir bloß mal vor, dass von allen Leuten ausgerechnet dir so etwas passiert! – Jetzt kommst du da nicht mehr raus, wenigstens sehr lange nicht. Du musst es erst hinter dich bringen, dass du ein Kind bist und größer wirst und alt wirst, bevor du aus dem verrückten Kram wieder rauskommst!“ Fest entschlossen, sich auf keinen Fall bei diesem höchst wichtigen Ereignis stören zu lassen, kletterte sie an der Strickleiter zum Mastkorb, ihrem Lieblingsplatz, hoch. Aber jedesmal wenn sie bei dieser einfachen Tätigkeit einen Arm oder ein Bein bewegte, war sie immer wieder verwundert darüber, dass sie ihr so bereitwillig gehorchten. Natürlich sagte ihr ihr Gedächtnis, dass sie das früher auch getan hatten, aber sie hatte sich niemals klargemacht, wie erstaunlich das war. Als sie oben auf ihrem Sitz saß, fing sie an, die Haut ihrer Hände mit größter Sorgfalt zu untersuchen, denn sie gehörten ja ihr. Sie schlüpfte mit einer Schulter aus ihrem Kleid und guckte an sich herunter, um festzustellen, ob sie wirklich unter ihren Kleidern weiterging, und hob dann die Achsel, bis sie damit ihre Wange berührte. Die Berührung ihres Gesichts mit der warmen nackten Schulter ließ sie auf angenehme Weise erschauern, so als ob ein lieber Freund sie gestreichelt hätte. Aber sie hätte nicht sagen können, ob dieses Gefühl von ihrer Wange oder ihrer Schulter ausging – wer da gestreichelt hatte und wer die Gestreichelte war. Nachdem sie endlich von der erstaunlichen Tatsache, jetzt Emily Bas-Thornton zu sein, ganz überzeugt war (warum sie das „jetzt“ einschob, hätte sie nicht sagen können [I-234] – denn ganz bestimmt dachte sie nicht an so einen Blödsinn wie Seelenwanderung und dass sie vielleicht früher jemand anders gewesen wäre), fing sie an, ernsthaft über die Folgen dieser Erkenntnis nachzudenken“ (R. Hughes, 1956).
Je mehr das Kind heranwächst und sich von den primären Bindungen löst, umso mehr entwickelt sich bei ihm ein Suchen nach Freiheit und Unabhängigkeit. Aber wir können das Schicksal dieses Suchens nur ganz verstehen, wenn wir uns die Dialektik im Prozess der zunehmenden Individuation klarmachen. Dieser Prozess hat zwei Aspekte. Der eine besteht darin, dass das Kind körperlich, seelisch und geistig kräftiger wird. In jedem dieser Bereiche nehmen Intensität und Aktivität zu. Gleichzeitig werden die Sphären immer mehr integriert. Es entwickelt sich eine organisierte Struktur, die vom Willen und von der Vernunft des Betreffenden gelenkt wird. Wenn wir dieses organisierte und integrierte Ganze der Persönlichkeit als das Selbst bezeichnen, so können wir auch sagen, dass die eine Seite des Wachstumsprozesses der Individuation das Wachstum der Stärke des Selbst ist. Dem Wachstum der Individuation und des Selbst sind Grenzen gesetzt, teils durch individuelle Bedingungen, aber im Wesentlichen durch die gesellschaftlichen Umstände. Denn wenn auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen in dieser Hinsicht groß erscheinen mögen, so kennzeichnet doch jede Gesellschaft ein gewisses Individuationsniveau, über das der normale Einzelne nicht hinausgelangen kann. Der andere Aspekt des Individuationsprozesses ist die zunehmende Vereinsamung. Die primären Bindungen bieten Sicherheit und eine ursprüngliche Einheit mit der Welt außerhalb. Je mehr das Kind aus dieser Welt herauswächst, desto mehr merkt es, dass es allein und eine von allen anderen getrennte Größe ist. Diese Lostrennung von einer Welt, die im Vergleich zur eigenen individuellen Existenz überwältigend stark und mächtig, oft auch bedrohlich und gefährlich ist, erzeugt ein Gefühl der Ohnmacht und Angst. Solange man ein integrierter Teil jener Welt war und sich der Möglichkeiten und der Verantwortlichkeit individuellen Tuns noch nicht bewusst war, brauchte man auch keine Angst davor zu haben. Ist man erst zu einem Individuum geworden, so ist man allein und steht der Welt mit allen ihren gefährlichen und überwältigenden Aspekten gegenüber.
Es kommen Impulse auf, die eigene Individualität aufzugeben und das Gefühl der Einsamkeit und Ohnmacht dadurch zu überwinden, dass man völlig in der Außenwelt aufgeht. Diese Impulse und die neuen Bindungen, die sich daraus ergeben, sind jedoch mit den primären, im Wachstumsprozess gelösten Bindungen nicht identisch. Genau wie ein Kind physisch niemals in den Mutterleib zurückkehren kann, so kann es auch psychisch den Individuationsprozess niemals wieder rückgängig machen. Alle Versuche, es doch zu tun, nehmen daher zwangsläufig den Charakter einer Unterwerfung an, bei dem der grundsätzliche Widerspruch zwischen der Autorität und dem Kind, das sich unterwirft, nie beseitigt wird. Bewusst mag das Kind sich sicher und zufrieden fühlen, aber unbewusst merkt es, dass es dies mit dem Preis der Stärke und Integrität seines Selbst bezahlen muss. So hat die Unterwerfung genau das Gegenteil dessen zur Folge, was damit beabsichtigt war: Sie vergrößert die Unsicherheit des Kindes und erzeugt gleichzeitig Feindseligkeit und Aufbegehren, was umso Angst erregender ist, als es sich eben gegen die Personen richtet, von denen das Kind auch weiterhin – oder wieder erneut – abhängig ist. [I-235]
Aber die Unterwerfung ist nicht der einzige Weg, der Einsamkeit und der Angst zu entgehen. Der andere Weg – der einzige, der produktiv ist und nicht mit einem unlösbaren Konflikt endet – besteht darin, dass man mit seinen Mitmenschen und der Natur spontan in Beziehung tritt, und zwar in eine Beziehung, welche den Einzelnen mit der Welt verbindet, ohne seine Individualität auszulöschen. Diese Art der Beziehung – deren beste Äußerungsformen Liebe und produktive Arbeit sind – wurzelt in der Integration und Stärke der Gesamtpersönlichkeit, weshalb ihr dieselben Grenzen gesetzt sind wie dem Wachstum des Selbst.
Wir werden weiter unten noch ausführlicher auf das Problem der Unterwerfung und des spontanen Tätigseins als zwei möglichen Resultaten der zunehmenden Individuation eingehen; hier möchte ich nur auf das allgemeine Prinzip, den dialektischen Prozess, hinweisen, der aus der wachsenden Individuation und Freiheit des Individuums resultiert. Das Kind kann sich freier entfalten und sein individuelles Selbst zum Ausdruck bringen, ohne dass es dabei durch jene hemmenden Bindungen behindert wird. Aber das Kind wird auch stärker von jener Welt frei, die ihm Sicherheit und Geborgenheit gab. Der Individuationsprozess ist ein Prozess der wachsenden Stärke und Integration der Persönlichkeit, bei dem die ursprüngliche Identität mit anderen verlorengeht und bei dem das Kind stärker von ihnen abgesondert wird. Diese fortschreitende Loslösung kann zur Isolierung führen, die trostlos ist und intensive Angst und Unsicherheit hervorbringt. Sie kann aber auch zu einem neuartigen Gefühl von Nähe und Solidarität mit anderen führen, wenn es dem Kind gelingt, die innere Stärke und Produktivität zu entwickeln, welche die Vorbedingung für diese neue Art der Bezogenheit zur Welt ist.
Wenn jeder Schritt, der zur Loslösung und zur Individuation führt, mit einem entsprechenden Wachstum des Selbst Hand in Hand ginge, so würde dies zu einer harmonischen Entwicklung des Kindes führen. Leider ist das aber nicht der Fall. Während der Individuationsprozess automatisch vor sich geht, wird das Wachstum des Selbst aus einer Reihe von individuellen und gesellschaftlichen Gründen behindert. Die Kluft zwischen diesen beiden Tendenzen führt zu einem unerträglichen Gefühl der Isolierung und Ohnmacht; diese ihrerseits lösen psychische Mechanismen aus, auf die wir später unter dem Begriff der „Fluchtmechanismen“ näher eingehen werden.
Auch phylogenetisch kann man die Menschheitsgeschichte als einen Prozess wachsender Individuation und Freiheit verstehen. Der Mensch taucht aus seinem vormenschlichen Zustand empor, indem er die ersten Schritte unternimmt, von seinen zwangsmäßigen Instinkten freizukommen. Wenn wir unter Instinkt ein spezifisches Handlungsmuster verstehen, das durch eine ererbte neurologische Struktur bedingt ist, so kann man im Tierreich eine deutlich ausgeprägte Entwicklungstendenz beobachten. (Diesen Begriff des Instinkts darf man jedoch nicht mit den physiologisch bedingten Trieben – wie Hunger, Durst etc. – verwechseln, bei denen die Art der Befriedigung nicht festgelegt und durch Vererbung determiniert ist.) Je tiefer ein Tier auf der Entwicklungsleiter steht, umso mehr wird es in seinem gesamten Verhalten von instinktiven und reflexbedingten Mechanismen beherrscht. Die berühmten sozialen Organisationen gewisser Insektenarten sind völlig instinktbedingt. Andererseits ist die Flexibilität der Handlungsmuster umso größer und die strukturierte [I-236] Anpassung bei Geburt umso geringer, je höher ein Tier auf der Entwicklungsleiter steht. Diese Entwicklung erreicht beim Menschen ihren Höhepunkt. Er ist bei seiner Geburt das hilfloseste aller Lebewesen. Seine Anpassung an die Natur beruht im Wesentlichen auf einem Lernprozess und nicht auf instinktbedingter Determination. „Der Instinkt (...) ist eine ständig geringer werdende, wenn nicht ganz verschwindende Kategorie bei den höheren Formen der Lebewesen, besonders beim Menschen“ (L. L. Bernard, 1924, S. 509).
Die menschliche Existenz nimmt in dem Augenblick ihren Anfang, wo die Instinktbedingtheit des Handelns unter einen bestimmten Punkt abgesunken ist, wo die Anpassung an die Natur nicht mehr zwangsmäßig erfolgt, wo das Verhalten nicht länger durch erbmäßig gegebene Mechanismen festgelegt ist. Mit anderen Worten: Menschliche Existenz und Freiheit sind von Anfang an nicht zu trennen. Freiheit ist hier nicht in ihrem positiven Sinne als „Freiheit zu etwas“, sondern in ihrem negativen Sinne als „Freiheit von etwas“ zu verstehen, nämlich im Sinn der Determination des Verhaltens durch Instinkte.
Freiheit im eben besprochenen Sinne ist ein zwiespältiges Geschenk. Der Mensch wird ohne die für ein zweckmäßiges Handeln geeignete Ausrüstung, wie sie das Tier besitzt, geboren. (Vgl. R. Linton, 1936