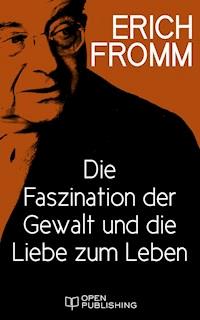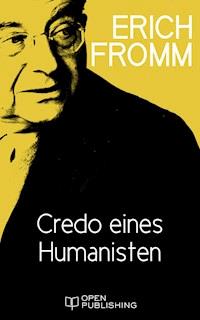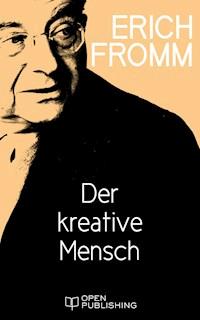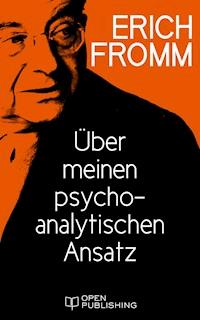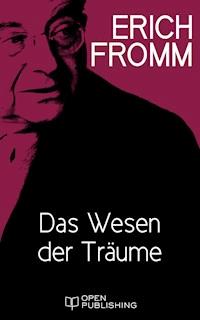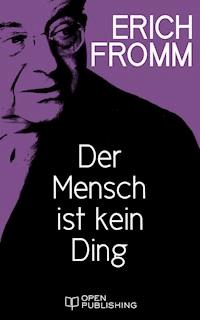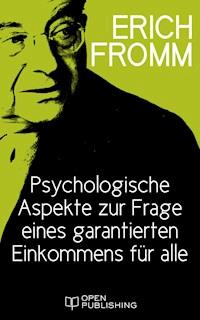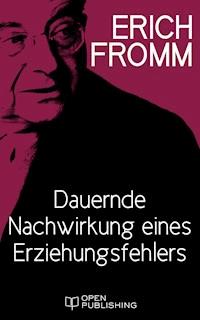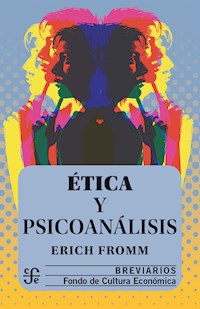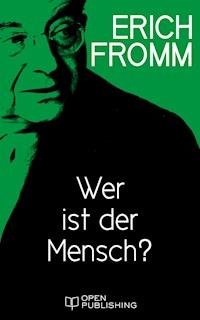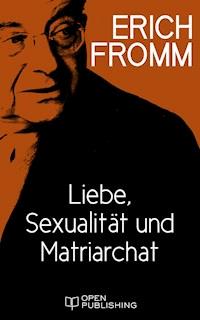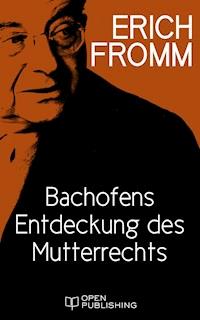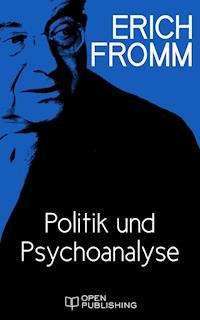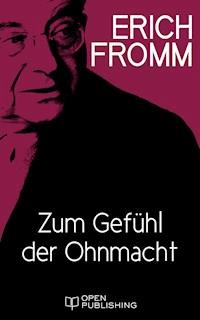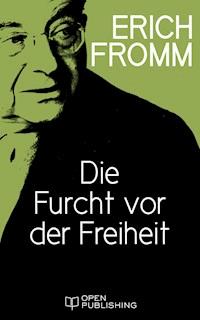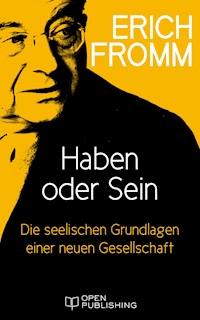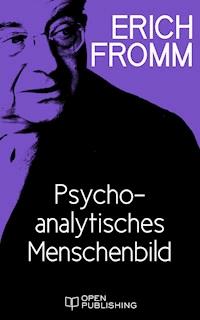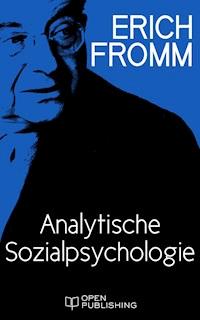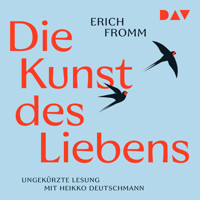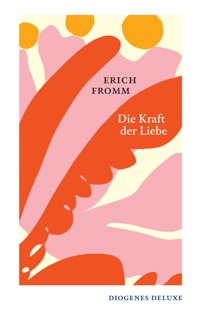
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Einsichten und Gedanken aus Erich Fromms Werk – aus seiner Tätigkeit als Psychoanalytiker, aus seiner Erfahrung als Mensch. Erich Fromm war zeit seines Lebens bemüht, Wege zur Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten in einer unmenschlich gewordenen Gesellschaft aufzuspüren. Die ausgewählten Gedanken spiegeln sein Lebenswerk in wenigen prägnanten Worten wider. Ob zum Thema Liebe oder Gewalt, Aktivität oder Passivität, Haben oder Sein, Kunst oder Technik – ihre Einfachheit ist bestechend, sie regen zum Nachdenken an und geben neue Antworten auf die eigenen Fragen des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Erich Fromm
Die Kraft der Liebe
Über Haben und Sein, Liebe und Gewalt, Leben und Tod
Herausgegeben und mit einer Einleitung von Rainer Funk und einem Nachwort von Gerhard Wehr
Diogenes
Einleitung
Viele, die Erich Fromm lesen, fühlen sich auf eine besondere Weise angesprochen. Da schreibt jemand in einer Sprache, die wenig Aufhebens von sich macht. Und doch lösen seine einfachen und verständlichen Worte etwas beim Leser aus. Sie sind fast alltäglich und dienen offensichtlich nur als »Transportmittel« für jene Art von Mitteilung und Verstehen, die für Fromm typisch ist.
Seine Worte bringen in den Lesern etwas zum Schwingen, das diese aufmerken lässt und wach macht. Diese Wirkung hat sicher etwas mit dem Inhalt zu tun. Doch auch diese Antwort erklärt nicht ganz das Besondere seiner Art zu kommunizieren. Es entsteht vielmehr eine Nähe, Direktheit und Unmittelbarkeit, die an eine präverbale Kommunikation erinnert, bei der man ein Interesse spürt, vom anderen »berührt« wird und sich verstanden fühlt, ohne dass es hierzu vieler Worte bedarf.
Wer immer als Patient oder Gesprächspartner mit Fromm ins Gespräch kam, machte eine ähnliche Erfahrung wie die eben beschriebene. Das Interesse Fromms an seinem Gegenüber zeigte sich nicht nur in einem warmen und zugleich unverwandten, manchmal fast zu intensiven Blick. Das Überraschende war vielmehr, wie er sein Interesse an seinem Gegenüber zum Ausdruck brachte.
Als ich in den Siebzigerjahren Fromms Assistent in Locarno war, stellte er mir oft ganz einfache und naheliegende Fragen, die aber »trafen« und Stück für Stück in die Tiefe führten. So konnte er fragen, welches Buch ich im Moment lese; was mich dazu bringe, gerade dieses Buch zu lesen; was mich bei der Lektüre anspreche und was nicht. Äußerte ich, dass ich das Gelesene eher unwichtig oder gar langweilig finde, wollte er wissen, warum ich dann mit etwas Unwichtigem meine Zeit vertue. Auch interessierte ihn, was mir selbst eigentlich wichtig sei, was mich wirklich anspreche und womit ich am liebsten meine Zeit verbringe.
In Wirklichkeit stellte Fromm nur jene Fragen, die ich mir eigentlich selbst hätte stellen müssen, es aber nicht tat. Ich stellte sie mir nicht, weil sie mich vielleicht hätten armselig erscheinen lassen oder weil sie mich gar beschämt hätten. Ich hätte unter Umständen die Konsequenzen ziehen und mein Leben ändern müssen. Auch gibt es Fragen wie z.B. die, warum gerade mir etwas Leidvolles zustößt, auf die es keine Antwort gibt, die man aber dennoch als Fragen zulassen und ertragen muss. Fromm stellte die von mir gemiedenen, verdrängten und ignorierten Fragen.
Das Besondere der Verständigung im persönlichen Gespräch mit Fromm war die Direktheit und Nähe, die Fromm dadurch herstellte, dass er mit seiner Aufmerksamkeit und seinem Interesse zu mir hinüberreichte und stellvertretend für mich selbst Fragen stellte. Die Fragen konnten bohrend sein; sie gingen unter die Haut. Eine Schutzbehauptung und Scheinbegründung nach der anderen wurden hinterfragt.
Dass ich Fromms Fragen nicht als beschädigend und vernichtend wahrnahm, verweist auf eine weitere Besonderheit des Gesprächs mit ihm. Ich fühlte mich zwar angesichts seiner Fragen nackt und bloß, aber nicht bloßgestellt, verurteilt oder schlechtgemacht. So durchdringend sein Blick und seine Fragen auch waren, sie hatten dennoch etwas Wohlwollendes. Sie zeichneten sich durch ein »wissendes Verstehen« aus. Zu einem solchen Verstehen ist man nur fähig, wenn man sich solchen Fragen selbst ausgesetzt hat.
Das Interesse, das mir Fromm mit seinen Fragen entgegenbrachte, war Ausdruck und Ergebnis jener Fragen, die er sich selbst stellte und auf die er selbst Antworten zu geben versuchte. Er wusste, wovon er schreibt, wenn er jene demaskierenden Fragen stellte, die die Oberfläche zu durchdringen imstande sind. Der eigene Umgang mit Fragen und Infragestellungen ermöglicht ein »wissendes Verstehen«. Ein solches »wissendes Verstehen« ist aber, wie Fromm in Die Kunst des Liebens ausgeführt hat, eine »Kraft der Liebe«, die wie die »Fürsorge«, das »Verantwortungsgefühl« und die »Achtung vor dem anderen« Kennzeichen von tatsächlicher Liebesfähigkeit sind.
Wird man mit Fragen und Infragestellungen konfrontiert, bei denen dieses »wissende Verstehen« spürbar ist, dann fühlt man sich zwar provoziert und getroffen, aber nicht verurteilt und beschämt. Im Gegenteil, die Anfragen können zu eigenen Fragen werden mit dem Ergebnis, dass man sich verstanden fühlt.
Das ist in meinen Augen der tiefere Grund, warum sich viele Menschen von Fromm auf eine besondere Art angesprochen fühlen. Ob es um das gesprochene oder geschriebene Wort geht – Fromm spricht nie theoretisch oder konstruiert, sondern von etwas, mit dem er selbst umgegangen ist.
Seine bleibende Bedeutung ist gerade darin zu sehen, dass er nie aufhörte, Fragen zu formulieren und sich diesen Fragen – als Mensch und als Wissenschaftler – selbst auch zu stellen. Mit dem so erarbeiteten »wissenden Verstehen« hat er gesprochen und geschrieben und fragt er andere an. Mit ihm vermag er jene Leser zu aktivieren, die noch für Fragen und Infragestellungen offen sind.
Die nachfolgenden Zitate sind der Gesamtausgabe Erich Fromms entnommen und verschiedenen Stichworten zugeordnet. Sie sind ihres Kontextes entkleidet, wodurch sie noch mehr zum Nachdenken oder Widerspruch reizen. Als Behauptungen, Einsichten, Weisheiten, Sentenzen wollen sie einen inneren Dialog im Leser hervorrufen, indem sie jene Antworten wiedergeben, die Fromm auf seine Fragen gefunden hat. Sie sollen nicht Antworten für den Leser sein, sondern dessen Fragen herausfordern.
Wer heute wachen Auges durchs Leben geht, sieht sich einer Flut von Antworten in Gestalt von Ratgebern, Anleitungen, Manualen und Hilfsangeboten gegenüber. Diese Antworten haben meistens eines gemeinsam: Sie stellen ein Verkaufsangebot, eine Ware dar. Die Antworten lassen sich als Lösungen und Lösungsstrategien aneignen, ohne dass es dabei zur Aktivierung eigener geistig-spiritueller, seelischer oder körperlicher Kräfte und zu einer menschlichen Anstrengung kommen müsste. Sie geben vor, man müsse nur wissen, wie es geht. Sie bieten das Know-how an – wie man erfolgreich ist, soziale Kompetenz erwirbt oder eine authentische Persönlichkeit inszeniert – und das alles ohne eigene Mühe und Infragestellungen.
Kräfte der Liebe lassen sich so nicht entwickeln. Antworten setzen den eigenen, oft mühsamen Umgang mit Fragen und Infragestellungen voraus. Und nur, wenn es ein wissendes Verstehen der Fragen im anderen gibt, weil man auf diese Fragen bei sich selbst eine Antwort gefunden hat, kann man sich für den anderen vorbehaltlos interessieren und die Nähe suchen. So ist denn der Sinn der nachfolgend aufgereihten Antworten Fromms der, in den Leserinnen und Lesern jene Fragen hervorzurufen, auf die nur sie selbst eine Antwort geben können.
Rainer Funk
Die Kraft der Liebe
Aktivität und Passivität
Tätigsein heißt, seinen Anlagen, seinen Talenten, dem Reichtum menschlicher Gaben Ausdruck zu verleihen.
Es gibt »gute« Bedürfnisse und »schlechte« Bedürfnisse. Die guten Bedürfnisse sind jene, die die Lebendigkeit, die Produktivität, die Sensibilität, das Interesse, die Aktivität des Menschen fördern. Schlechte Bedürfnisse sind solche, die den Menschen unlebendiger, passiver, weniger interessiert machen.
Jedes Tätigsein, das Konzentration, Aufmerksamkeit und die Ausübung einer Fertigkeit erfordert, ist interessant.
Produktives Tätigsein bezeichnet den Zustand innerer Aktivität, sie muss nicht notwendigerweise mit der Hervorbringung eines künstlerischen oder wissenschaftlichen Werkes bzw. von etwas »Nützlichem« verbunden sein.
Produktivität ist die Fähigkeit des Menschen, seine Kräfte zu gebrauchen und die in ihm liegenden Möglichkeiten zu verwirklichen.
Produktivität bedeutet, dass der Mensch sich selbst als Verkörperung seiner Kräfte und als Handelnder erlebt; dass er sich mit seinen Kräften eins fühlt und dass sie nicht vor ihm verborgen und ihm entfremdet sind.
Die Fähigkeit zu handeln schafft auch das Bedürfnis, diese Fähigkeit zu nutzen; und Funktionsstörung und Unglück entstehen, wenn die Fähigkeit nicht genutzt wird.
Ist der Mensch passiv, gelangweilt, gefühllos und einseitig verstandesorientiert, dann entwickelt er pathologische Symptome wie Angst, Depression, Depersonalisierung, Gewalttätigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben.
Wille gründet sich auf innere Aktivität; ein spontaner Impuls hingegen auf Passivität.
Aktivität im modernen Sinn unterscheidet nicht zwischen Tätigsein und bloßer Geschäftigkeit.
Entfremdete Aktivität im Sinne bloßer Geschäftigkeit ist in Wirklichkeit »Passivität«, das heißt Unproduktivität.
Angst
Mangel an Selbst erzeugt eine tiefe Angst.
Wenn man unsere heutige Zeit mit Recht als das Zeitalter der Angst bezeichnet hat, dann hauptsächlich wegen jener Angst, die durch das Fehlen des Selbst entsteht.
Wir rennen vor dem Leben weg.
Bei jedem neuen Schritt, bei jedem neuen Stadium unserer Geburt geraten wir aufs Neue in Angst.
Die Menschen fürchten deshalb die totale Vernichtung nicht, weil sie das Leben nicht lieben.
Jemand kann furchtlos sein, weil ihm nichts am Leben liegt. Häufig befindet er sich geradezu auf der Suche nach gefährlichen Situationen, um seiner Furcht vor dem Leben, vor sich selbst, vor anderen Menschen zu entrinnen.
Die Angst, zum Außenseiter zu werden, ist noch größer als die Angst vor dem Tode.
Es gibt auch eine Furchtlosigkeit, die man bei vollentwickelten Menschen findet, die in sich selber ruhen und das Leben lieben.
Die psychische Aufgabe, der man sich stellen kann und muss, ist nicht, sich sicher zu fühlen, sondern zu lernen, die Unsicherheit ohne Panik und unangebrachte Angst zu ertragen.
Erkenntnis
Der einzige Weg zu ganzer Erkenntnis ist der Akt der Liebe.
Im Akt der Liebe, im Akt der Hingabe meiner selbst, im Akt des Eindringens in den anderen finde ich mich selbst, entdecke ich mich selbst, entdecke ich uns beide, entdecke ich den Menschen.
Im Akt der Vereinigung erkenne ich dich, erkenne ich mich, erkenne ich alle anderen, und ich »weiß« doch nichts.
Unbewusst wissen wir alles, und doch wissen wir es nicht, weil dieses Wissen zu schmerzvoll wäre.
Unbewusstes ist identisch mit dem Nicht-Gewahrsein der Wahrheit; des Unbewussten gewahr werden heißt die Wahrheit entdecken.
Wir verwenden einen großen Teil unserer Energie darauf, vor uns selbst zu verbergen, was wir wissen; das Ausmaß dieses verdrängten Wissens ist kaum zu überschätzen.
Die gründliche Erforschung des Unbewussten stellt einen Weg dar, die Menschheit in sich selbst und in jedem anderen menschlichen Wesen zu entdecken.
Die Undurchsichtigkeit des anderen wird innerhalb des menschlich Möglichen transparent, wenn wir für uns selbst transparent werden.
Man kann einen anderen Menschen nur insoweit wirklich kennen, als man das Gleiche erfahren hat.
Wer glaubt, man könne sein Inneres sehen, für die Außenwelt aber blind sein, gleicht einem, der sagt, eine Kerze gebe ihr Licht nur in eine Richtung und nicht in alle.
Wer Sicherheit statt Erkenntnis will, braucht ein Dogma, welches das Denken erspart.
Wir hören auf jede Stimme und auf jeden, wer es auch sein mag, nur nicht auf uns selbst.
Der rationale Zweifel stellt alle Voraussetzungen infrage, deren Gültigkeit vom Glauben an eine Autorität, nicht aber von der eigenen Erfahrung abhängt.
Logik schließt Wahnsinn nicht aus.
Nur wer paradox zu denken vermag, wird das Leben verstehen.
Familie
Die mit Liebe beginnende Ehe verwandelt sich manchmal in eine freundschaftliche Eigentümergemeinschaft, eine Körperschaft, in der zwei Egoismen sich vereinen: die »Familie«.
Die wichtigste Vorbedingung für die Entwicklung der Lebensliebe beim Kind ist das Zusammenleben mit Menschen, die das Leben lieben.