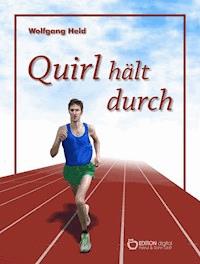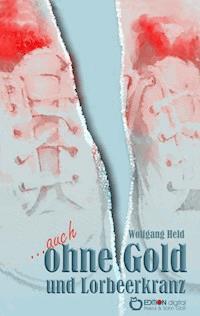8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1866, als der erste der Steinhüters bei Carl Zeiss in Jena zu arbeiten beginnt, gibt es in den Optischen Werkstätten 25 Gehilfen und Lehrlinge, den Obermeister Löber und den Prinzipal, mehr nicht. Sechs Tage in der Woche, 11 3/4 Stunden am Tag, werden unter primitivsten Bedingungen die ersten Mikroskope mehr gebastelt als gebaut. Das ändert sich, als Carl Zeiss den von der Forschung besessenen Ernst Abbe zum Teilhaber macht, später kommt Glasmacher Schott aus Witten dazu, und die Verbindung von solidem Handwerk und schöpferischer Wissenschaft begründet eine Tradition, die die Entwicklung der Optischen Werkstätten zum weltbekannten Kombinat »VEB Carl Zeiss JENA« möglich machte. Wolfgang Held gestaltet in dem Roman, der dem gleichnamigen Fernsehfilm folgt, am Beispiel des Schicksals einer Thüringer Arbeiterfamilie die wechselvolle Geschichte des Zeiss-Werkes. Er erzählt von den Anfängen und der »Gründung«, von der besonderen sozialen Rolle durch die »Stiftung« und davon, wie das Werk, immer stärker in die Rüstungsproduktion für den Ersten Weltkrieg einbezogen, zur »Waffenschmiede« wird. Die Steinhüters sind durch ihre Arbeit existentiell mit diesen Ereignissen verflochten. Während die einen auf der Seite der Arbeiter kämpfen, lassen sich die anderen »von denen da oben Stückchen für Stückchen ihr Herz abkaufen«. Der spannende Roman ist Familienchronik, Werkschronik und Chronik deutscher Geschichte zugleich. Er erschien erstmals 1989 im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig. Der gleichnamige siebenteilige Fernsehfilm mit Alfred Müller, Ulrike Mai, Jürgen Reuter, Jürgen Zartmann, Walfriede Schmitt, Hanns-Jörn Weber, Renate Blume-Reed, Horst Drinda u. a. wurde 1989 erstmals im DDR-Fernsehen gesendet. INHALT: 1. Buch: Die Gründung 2. Buch: Die Stiftung 3. Buch: Die Waffenschmiede
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Die gläserne Fackel
Roman
ISBN 978-3-86394-943-3 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1989 im Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.ddrautoren.de
I. Buch: Die Gründung
I. Kapitel
Jena ... Die freundliche Lage der Stadt, viel gerühmt, soll selbst dem viel gereisten Kaiser Karl V. das Geständnis entlockt haben, dass er außer Florenz kaum eine schönere Gegend gesehen habe. J. zählt 7233 Einwohner und besitzt ein altes Schloss ... Ihren weltgeschichtlichen Namen verdankt die Stadt der Universität und der Schlacht vom 14.Oct. 1806 ...(Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände - Leipzig: F. A. Brockhaus 1866)
Über das Gesicht des Ausreißers floss Schweiß. In seiner Brust stach es wie mit Nadeln. Brennnesseln klatschten blasig-rote Male auf die nackten Waden. Der rechte Fuß blutete. Der barfüßige Junge rannte, als ginge es um sein Leben. Keuchend flüchtete er hangaufwärts. Weit hinter ihm kläffte unter den Apfelbäumen einer großen Plantage die Dogge an der Seite des Feldhüters.
Nur wenige Meter trennten den Jungen vom oberen Rand des Hanges, wo schulterhoch gewachsener Mais angrenzte. Er rätselte, weshalb der Flurwächter nicht den immer noch dumpf und zornig bellenden Hund losmachte.
Ein Flintenschuss krachte!
Der Schreck brachte den Jungen ins Stolpern. Mit den Armen fing er den Sturz ab. Das Hemd klaffte. Gelbgrüne Sommeräpfel kullerten. Hastig griff er zu, raffte, was er schnappen konnte, hastete weiter.
Ein zweiter Schuss!
Die Schrotladung flog an dem Fliehenden vorbei. Bleiperlen prasselten in den Mais.
»Lumpenpack, elendiges!« Die Stimme des Schützen dröhnte hinter dem Jungen her, der im dichten Grün verschwand.
Das Gebell der Dogge rückte in die Ferne und verstummte schließlich.
Der Halbwüchsige rannte weiter, bis er auf der anderen Seite des Feldes endlich zur Landstraße kam. Eine kurze Strecke lief er noch, hin und wieder einen Blick über die Schulter werfend. Er wurde nicht verfolgt.
Doch erst eine knappe Meile vor Jena, wo der spärlich befestigte Fahrweg zwischen der Residenz des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach und der altehrwürdigen Universitätsstadt wieder in bewaldete Region gelangte und schlängelnd hinab ins Saaletal führte, gönnte sich der nun doch ziemlich erschöpfte Junge eine Rast.
Der Vierzehnjährige hieß Franz Steinhüter. Ohne jegliches Gepäck, ohne Wegzehrung, ohne einen einzigen Pfennig in der Tasche war er bereits den vierten Tag unterwegs. Sein ganzer Besitz bestand aus der knielangen, derbleinenen Hose, dem über den Hüften mit Strick zusammengehaltenen, arg verwaschenen Kittelhemd, einem scharfen Klappmesser und einem Tabakpfeifenkopf, von geübter Hand in Ruhla aus türkischem Meerschwamm geschnitten.
Auf der langen Wanderung aus dem Bergwald, vom Rennsteig herab, entlang der Ilm bis hierher ins Weimarische, hatte der Junge den Hunger notdürftig mit dem gestillt, was sich am Weg fand. Heidelbeeren oder frühe Kirschen, Möhren oder junge Erbsen, Feldgurken oder halb reife Sommeräpfel. Wer sein Streben ganz und gar auf ein einziges Ziel richtet, lässt sich nicht ohne äußerste Not aufhalten. Nachtlager in verwitterten Scheunen, unter freiem Himmel im Schutz eines Haselnussstrauches oder an einem feuchtkaltem Felsen nahe am Fluss hatten den mageren Jungen in keiner Stunde entmutigt. Vom Schnupfen belästigt, mehr als eine halbe Woche lang nicht gewaschen und nun ganz hingegeben dem Genuss herbsüßen, beim Kauen leicht schäumenden Apfelfleisches, so hockte er, an einen Buchenstamm gelehnt, unweit der im Mittagslicht wie stets einsamen Straße.
Obwohl Franz Steinhüter von klein auf durch alle vier Jahreszeiten vertraut war mit den unterschiedlichen Geräuschen und Gerüchen des Waldes, entgingen ihm jetzt Zeichen, die ihn hätten warnen müssen.
Nahezu von einer Minute zur nächsten breitete sich eine beklemmende Stille aus. Zuerst erlosch das Rauschen in den Baumwipfeln, gleich darauf verstummten die Vögel. Nirgendwo im Gras zirpte noch eine Grille. Nichts davon drang dem Jungen ins Bewusstsein. Er war mit seinen Gedanken in Regionen, die von diesen sicheren Signalen eines schnell heraufziehenden Unwetters nicht berührt werden konnten.
Das Kinn auf die Brust gesenkt, die Augen geschlossen und reglos, so erweckte der Rastende den Anschein, als habe ihn Schlaf übermannt. Der Eindruck täuschte. Aus der Meerschaumpfeife, die er in Nasennähe hielt, sog er den bissigen Rauchgeruch verbrannten, billigen Knasters ein. Er gab sich Erinnerungen hin, die bis tief in seine Seele schmerzten. Tränen liefen über sein schmutziges Gesicht.
Ferner Gewitterdonner, Peitschenknall und langsam näherkommender Hufschlag holten den Jungen am Straßenrand aus bitteren Vorwürfen gegen den Herrgott, der das Sterben über die Menschen so ungerecht ausgestreut hat. Er sprang auf, steckte den Pfeifenkopf hastig ein und suchte Deckung hinter der Buche. Gespannt sah er in die Richtung, aus der das Knarren und Klirren eines Fuhrwerkes kam.
Eine vierspännige Reisekutsche holperte über Rinnen und Wegelöcher. Die Pferde trotteten. Der livrierte Mann auf dem Kutschbock blickte immer wieder besorgt nach Südwesten, wo eine schwarze Wolkenfront, wetterleuchtend und grollend, den Himmel verdunkelte. Seinem wachen Gespür blieb nicht verborgen, dass sich dicht hinter dem Fuhrwerk ein Junge aus dem Wald löste und schnell in den lehmgelben Staubschweif eintauchte, der an dem Wagen hing. Er wusste sofort, was der kaum wahrnehmbare Ruck und das kurze, seitliche Wippen der Karosserie zu bedeuten hatte, aber er unternahm nichts gegen den blinden Passagier, der sich nun am Kutschenheck neben der regenfesten Gepäcktruhe festklammerte.
Freue dich nicht vor der Zeit, Freundchen, dachte der Kutscher. Er grinste vergnügt und warf mit viel Geschick die bereitliegende, knöchellange Kalmuck-Pelerine über seine Schultern. Deine Abreibung, die schickt dir gleich der Herr Petrus höchstpersönlich.
Fünf Fahrgäste hatten an diesem schwül-heißen Sommertag des Jahres 1866 in Weimar vor dem Thurn-und-Taxisschen Postamt am Karlsplatz die Kutsche nach Jena bestiegen. Ein hagerer, junger Mann, dazu ein älterer Herr mit Zwicker und grau meliertem, bis zum Gürtel herabfallendem Bart sowie zwei füllige Damen vorgerückten Alters. Sie alle waren mit der Eisenbahn in der Residenzstadt angekommen und dort zum Umsteigen in das weit weniger komfortable Gefährt gezwungen. Die Universitätsstadt drüben an der Saale besaß noch keinen Eisenbahnanschluss.
Ein fünfter Mitreisender stammte aus Weimar. Ihm gehörten hier Anteile einer großen Mühle. Er hatte gehört, dass in einer Jenaer Kammgarnspinnerei eine Dampfmaschine aufgestellt worden sei. Zwar zählte man zurzeit in den deutschen Staaten schon mehr als fünfzehntausend dieser Maschinen mit insgesamt fast zweihundertfünfzigtausend Pferdekräften, aber in der Residenzstadt gab es noch keines dieser technischen Wunderwerke, deren Verwendbarkeit im Mühlenbetrieb der Mann nun in Jena erkunden wollte. Man sah ihm an, dass er viel von gutem und reichlichem Essen hielt. Die Kutsche hatte kaum die Ilmbrücke passiert, als er schon seinen Proviantkorb öffnete. Nun stopfte er seit einer Stunde Hühnerfleisch, Knackwurst, Semmeln und Kuchen in sich hinein, spülte dauernd mit kräftigen Schlucken aus einer Weinflasche nach und würdigte die anderen Fahrgäste keines Blickes. Außer krachenden Rülpsern war von ihm während der ganzen Fahrt bisher nicht ein Laut zu vernehmen gewesen.
Das Zischen des Zündholzes, mit dem der junge, gerade in seiner Coupéecke sitzende Mann nun die dritte Zigarette innerhalb einer Stunde ansteckte, weckte den gegenüber schlummernden Herrn. Der Vollbärtige rückte seinen Zwicker zurecht und bekam offenbar Lust auf eine Unterhaltung mit dem Raucher.
Die zwei Damen rümpften hingegen zum wiederholten Male ihre Nasen. Sie schickten vorwurfsvolle Blicke zur Coupéecke, blieben aber weiter bei dem Gesprächsthema, das sie bereits eine ganze Weile beschäftigte.
»Es heißt ja überall, dass diese Eisenbahn eine Menge Krankheiten und noch anderes Unheil verbreitet«, räsonierte eine der beiden. Sie hob ihre Lorgnette und musterte den jungen Herrn mit der Zigarette. »Der Rauch, der Gestank ... Impertinent!«
»Und dazu der Lärm.« Ihre Begleiterin pflichtete ihr eifrig bei. »Aber glauben Sie mir, Gnädigste, alles, was Gottes herrliche Natur derart beleidigt und so zerstört wie diese grässlichen, Funken speienden Lokomotiven, diese eisernen Schienen kreuz und quer durch Wald und Flur, dieses teuflische, alle Kreatur schreckende Getöse ... das hat keine Zukunft, liebe Freundin, da bin ich ganz sicher!«
Der Raucher in seiner Ecke lächelte. Auf Sticheleien gegen das Rauchen reagierte er seit Jahren nicht.
»Nune griechen mir gleich was runder, Herrschaften«, sagte der dicke Weimarer plötzlich zwischen zwei Bissen. Er kaute weiter, während er hinaus zum Himmel deutete. Seine Worte glichen einem Kommando. Regen prasselte herab wie aus hundert Schläuchen.
Beim ersten blitzenden Krachen erbleichten die beiden Damen und wurden sehr schweigsam.
Die Herren in den gegenüberliegenden Coupénischen schenkten dem Geschehen draußen nur mäßige Aufmerksamkeit. Sie hatten sich soeben einander vorgestellt und fanden sichtlich Interesse an dieser Reisebekanntschaft.
Der bärtige Professor Doktor Helbach, von der Universität in Halle kommend, betrachtete den jüngeren Mitreisenden über den Zwickerrand hinweg. »Abbe, Abbe ... Doch nicht gar verwandt mit unserer hallischen Kaufmannsfamilie dieses Namens, Herr Doktor?« Er spielte mit dem über seinen Bauch wallenden Bart und ließ den Blick nicht von dem Raucher.
»Nein, ich bin Eisenacher, Herr Professor.«
»Ach ...!« Die Stimme Helbachs klang enttäuscht. »Sehr renommierte Leute, die Abbes bei uns in Halle an der Saale, müssen Sie wissen.«
»Die Abbes in Eisenach ganz und gar nicht, leider.« Der Doktor aus der Wartburgstadt lächelte erneut. »Mein Vater arbeitet in einer Fabrik ... Werden Sie bei uns in Jena Vorlesungen halten, Herr Professor?«
Der Professor aus Halle nickte, doch seine Gedanken bewegten sich noch um die Antwort Abbes, der erst Mitte Zwanzig war und ihm imponierte.
»Der Vater in einer Fabrik und der Sohn unterm Doktorhut, das verdient wahrlich Respekt! Auch Mediziner, wenn die Frage erlaubt ist?«
»Physik und Mathematik. Vorläufig schlage ich mich noch so recht und schlecht als einer von fünfzehn Privatdozenten an unserer Alma Mater durch ... Bleiben Sie länger in Jena?«
Wieder verschmolzen draußen Blitz und Donner in einem infernalischen Knall. Die Pferde scheuten. Der Wagen schaukelte und ächzte wie unter Hammerschlägen. Die beiden Damen krochen zueinander, verbargen ihre Gesichter und wünschten sich nun doch in ein stabiles Eisenbahnabteil.
»Ha'ch 's nich gesachd!«, brummte der Weimarer. »Nune drööscht's!«
Die beiden Akademiker unterbrachen ihre Unterhaltung bloß für Sekunden.
»Ich werde mich nur zwei, drei Tage aufhalten«, antwortete der Professor Helbach dann dem jungen Doktor. »Wir haben ein Konzilium an der Medizinischen Fakultät. Aber zuerst werde ich mal jemandem gehörig die Leviten lesen ... Kennen Sie den Meister Zeiss?«
Doktor Abbe horchte auf. Auch der kauende Dicke aus Weimar wandte jetzt den Blick von draußen ab und schaute neugierig zu dem bärtigen Wissenschaftler.
»Carl Zeiss?«, fragte Doktor Abbe. »Unseren Universitätsmechanikus vom Johannisplatz?«
»Eben den«, bestätigte Professor Helbach. »Hat mich sehr enttäuscht, dieser Mann!«
Doktor Abbe schüttelte erstaunt den Kopf.
»Das wundert mich. Ich darf hin und wieder in seiner Werkstatt ein wenig basteln ...«
»Hilfsbereit, das war er seit eh und je, der Meister Zeiss!« Sein voller Mund hinderte den Dicken nicht, sich einzumischen. »Tüchtich! Hochanständisch! Das sacht Sie jeder bei uns hier!«
»Ich glaube, an der Universität gibt es niemanden, der die Arbeit vom Meister Zeiss nicht schätzt, Herr Professor«, führte Doktor Abbe seinen Einwand weiter. »Vorzügliche Mikroskope ...«
Der Dicke hatte seinen Bissen heruntergeschluckt und drängte sich erneut in das Gespräch. »Über tausend Stück hatt'r schon gemacht, der Meister. Er stammt nämlich von uns aus d'r Residenz. Bis ins Zarenreich solln seine Dinger gegangen sein. Ärscht neulich stand wieder was bei uns im Bladde drüwer!«
Der Professor musterte den dicken Mitreisenden streng, setzte zu einer Entgegnung an, besann sich dann aber anders und beließ es bei einer wegwerfenden, von einem Kopfschütteln begleiteten Handbewegung.
Die Reisekutsche erreichte die Gärten am Stadtrand von Jena. Der Himmel über der Saale hellte wie zu freundlicher Begrüßung langsam auf und spannte einen hohen Regenbogen über den Fuchsturm. Es regnete nur noch wenig. Kleine Wellenringe kräuselten die Pfützen. Die Wagenräder schnitten tiefe Rinnen in den Schlamm. Schmutz spritzte.
Der Junge hinten neben der Gepäcktruhe hatte keine Hand frei, um sein Gesicht zu schützen. Hemd und Hose klebten am Körper. Fröstelnd wartete er, bis rechts und links die ersten Häuser auftauchten, dann sprang er ab. Wenig später erkundigte er sich bei einem Mädchen, das ihm mit einem vollen Bierkrug entgegen kam, nach dem Weg zum Johannisplatz.
»Weniger als tausend Schritte geradeaus«, sagte die Kleine und musterte ihn argwöhnisch. »Bist du ein Zigeuner?«
Franz Steinhüter stutzte, dann schaute er an sich herab und begriff die Frage. Er sah aus wie einer, der im Sumpf gebadet hat. Die Zigeuner, die manchmal für ein paar Tage neben der Hütte des Großvaters ein Lager aufgeschlagen hatten, wären nicht bereit gewesen, ihn so in ihren Wagen zu lassen.
»Nein«, sagte er. »Ich bin ein verzauberter Prinz!« Das Mädchen blickte ihm ungläubig nach. Vom Rathaus her schallten drei Glockenschläge über die Dächer der Stadt.
Das Haus Nummer 10 am Johannisplatz gehörte dem Mechaniker- und Optikermeister Carl Zeiss. Seit neun Jahren besaß er hier mit seiner Familie Wohnung, Werkstatt und einen kleinen Laden unter einem Dach.
Eigentlich hatte der Sohn des Weimarer Holzdrechslers Johann August Gottfried Zeiss die Absicht gehabt, nach harten und lehrreichen Wanderjahren eine Werkstatt in seiner Heimatstadt zu eröffnen. Die großherzogliche Behörde zerstörte diesen Plan mit einem Federstrich. Gesuch auf Niederlassungsgenehmigung abgelehnt. Zwei bereits vorhandene Mechanikerwerkstätten genügen dem Hofstaat und der Bürgerschaft.
Der Hofdrechsler Zeiss hatte in seinem Sohn zeitig und gründlich alle Keime eines despektierlichen Aufmuckertums erstickt, das jedes geordnete Staatswesen bedroht wie zerstörerisch-schleichender Hausschwamm die stärksten Mauern. Carl Zeiss hatte seine geringe Habe samt einem Schraubstock geschultert und war den Dreistundenweg ins benachbarte Jena gewandert, um dort sein Glück zu versuchen. Er kannte das Saalestädtchen bereits recht gut. Bei dem Hofmechaniker Dr. Johannis Christian Friedrich Körner hatte er hier von 1834 bis 1838 nicht nur das Handwerk erlernt, sondern sich auch in der Bearbeitung optischer Gläser und im Glasschmelzen geübt.
In seinem ehemaligen Lehrherrn sowie in dessen langjährigen Kunden, den Professoren Schleiden, Haeser und Schmid, fand der damals dreißigjährige Weimarer angesehene Fürsprecher seines Antrags auf Ortsbürgerrecht und Konzession zur Fertigung wie auch zum Verkauf mechanischer und optischer Instrumente. Die Entscheidung im Rathaus fiel zu seinen Gunsten. Gegen Zahlung von 24 Talern durfte er in der Neugasse 7 seine erste Werkstatt nebst Laden eröffnen. Die in jenem Haus vor der Stadt herrschende Enge veranlasste ihn schon nach einem Jahr zu einem Umzug. Für die größeren Räume musste er allerdings jährlich 42 Taler Miete zahlen, bis ihm seine Einkünfte den Kauf des Hauses am Johannisplatz ermöglicht hatten.
Schräg gegenüber dem Zeissschen Gebäude gab es eine Toreinfahrt. Von hier aus beobachtete Franz Steinhüter an diesem späten Nachmittag das Haus. Er wagte keinen Schritt dorthin. Der Mut hatte ihn plötzlich verlassen. Erst hier, wenige Meter vor seinem Ziel, war ihm bewusst geworden, wie schmutzig und verwahrlost er in seiner noch immer feuchten, lehmbespritzten Kleidung aussah. Sollte er in diesem heruntergekommenen Zustand dem einzigen, geliebten Menschen, der ihm geblieben war, entgegentreten?
Ein Polizist schritt auf seiner Nachmittagsrunde über den Johannisplatz.
Unwillkürlich drückte sich der Junge tiefer in den Torwinkel. Er wagte den Blick erst wieder hervor, als der Uniformierte verschwunden war.
Hinter den Fenstern der Werkstatt wurde gearbeitet. Im Hintergrund des Raumes, wo das Tageslicht nicht ausreichte, brannten Öllampen.
Franz Steinhüter konnte einige Männer und zwei Halbwüchsige erkennen, die bei ihren Tätigkeiten kaum einmal den Kopf hoben.
Vom Pulverturm her strebte ein älterer Herr geradewegs auf das Zeisshaus zu. Es war jener Professor Helbach, den die Kutsche aus Weimar erst vor knapp zwei Stunden nach Jena gebracht hatte. Er trug eine kleine Holzkiste bei sich und hielt einen Regenschirm unter dem Arm.
Franz Steinhüter beobachtete, wie der Professor seinen Fuß auf die Stufen zur Haustür setzte und im nächsten Augenblick mit einer jungen Frau zusammenstieß, die mit einem leeren Einkaufskorb gerade eilig im Begriff war, das Haus zu verlassen.
Die Frau stieß einen Schreckenslaut aus.
»Tausendmal Pardon.« Dem Professor war die Situation peinlich. »Wie ungeschickt von mir ... Die Frau Meisterin?«
Fast erschrocken wehrte die junge Frau ab. »Aber nein, aber nein, gnädiger Herr. Die Dienstmagd, nur die Dienstmagd!«
Von seinem versteckten Platz aus konnte Franz Steinhüter nicht verstehen, was drüben an der Tür gesprochen wurde, aber es interessierte ihn auch nicht. Er hatte in dieser Minute nur Augen für die Frau mit dem Korb. Wie gebannt verfolgte er jede ihrer Bewegungen. Er sah, wie sie die Tür offenhielt, und wartete, bis der Besucher im Haus war. Von diesem Moment an überlegte er nicht mehr. Er lief hinüber und stand vor ihr, als sie sich zum Gehen wandte.
Ein paar Herzschläge lang schauten sie einander stumm an, die Frau verwirrt und ihren Augen noch nicht trauend, der Junge erwartungsvoll und mit einer Spur trotziger Herausforderung im Blick.
»Franzi!« Karoline Steinhüter trat auf ihren Sohn zu. Sie umarmte ihn. »Mein Gott, Junge.«
»Großvater ist tot«, presste er leise hervor. Die Wärme ihres Körpers und der Geruch von Kräutern gaben ihm für Augenblicke das Gefühl von Geborgenheit, wie er es stets an der Seite des verstorbenen alten Köhlers empfunden hatte, bei dem er aufgewachsen war. »Sie haben ihn unten im Dorf begraben ...«
Sanft löste Karoline Steinhüter die Umarmung.
Franz fuhr mit der Hand über die nassen Augen.
»Dein Onkel hat mir alles geschrieben«, sagte sie leise. Sie strich ihrem Sohn die zottigen Strähnen aus der Stirn. »Im Brief stand auch, dass er dich zu sich auf den Hof genommen hat. Dafür will er das Geld für die Köhlerhütte oben im Wald ...« Sie stockte. In Jena wusste kein Mensch von ihrem unehelich geborenen Kind. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass dieses streng gehütete Geheimnis jede Minute entdeckt werden konnte. Hastig griff sie nach dem Korb.
»Schlampenbankert hat er mich genannt, der Onkel«, Franz schluckte. Verletzter Stolz machte ihm die Kehle eng. »Und Kirmesbastard! Ich gehe da nicht wieder hin, Mama. Ich ... ich habe Hunger!«
Karoline Steinhüter schaute sich ängstlich um. Ein Bursche mit zwei gefüllten Wassereimern am Tragholz drehte im Vorübergehen nicht den Kopf. Auch die ältere Frau, die einen kleinen, mit Reisig beladenen Handwagen quer über den Johannisplatz stadteinwärts zog, sah nicht nach rechts oder links.
»Komm jetzt erst einmal schnell weg hier.« Sie schob ihren Sohn zur Haustür. »Und leise, hörst du! Drinnen im Haus keinen Laut, Franzi!« - Nur wenige Minuten vergingen, dann erschien die Dienstmagd der Familie Zeiss erneut und eilte zum Einkauf davon.
Aus der Werkstatt drang das helle, bohrende Sirren der mit Fußantrieb in Gang gehaltenen Drehbänke und das scharfe Knirschen der Schleif- und Poliermaschinen in den abgeteilten, engen Arbeitsraum des Meisters. Die Tür zum angrenzenden, kleinen Laden stand offen.
Professor Helbach saß vor dem Schreibtisch. Seine Rechte steckte unter dem Bart zwischen den Westenknöpfen, die Finger der Linken klopften einen langsamen Takt auf den Oberschenkel.
»Ich will ja gern zugeben, dass hundertfünfundachtzig Taler in diesen Zeiten nicht zu viel sind für ein System, das fünfhundertdreißig- oder neunhundertachtzig- oder gar tausendvierhundertvierzigfach vergrößert ...« Der Wissenschaftler ließ den Satz unbeendet, weil er nicht sicher war, ob der Mann auf der anderen Seite des Schreibtisches zuhörte.
Carl Zeiss, ein Mann Anfang Fünfzig mit grau meliertem Haar und gepflegtem Vollbart, die hohe Stirn jetzt gerunzelt, prüfte eines der Mikroskope, die in handwerklicher Einzelfertigung bei ihm hergestellt wurden. Durch dicke Brillengläser nahm er Teil für Teil genau in Augenschein, probierte Triebbewegungen, Tubusauszüge und Prismenführungen. Er kannte sich mit diesen Instrumenten aus wie kaum ein anderer Meister in Europa. Sein erstes, einfaches Mikroskop hatte er auf Vorschlag des Jenaer Professors Schleiden, noch ohne geeignete Maschinen, nur mit Feile, Blechschere und ein paar Hilfswerkzeugen, schon 1847 gebaut und in den folgenden fünf Jahren so viel Erfahrungen gesammelt, dass 1857 in seiner Werkstatt monatlich bereits bis zu vier Stück davon angefertigt werden konnten. Danach begann ihn der Bau komplizierterer und leistungsfähigerer Mikroskope zu interessieren.
Die beachtliche Qualität dieser Erzeugnisse verbreitete den guten Ruf von Carl Zeiss schnell weit über die Grenzen des Großherzogtums hinaus. 1860 hatte man ihn zum Jenaer Universitätsmechaniker ernannt, und die Goldmedaille für seine Mikroskope auf einer Thüringer Gewerbeausstellung brachte ihm den Titel eines Hofmechanikus ein. Man rühmte ihn überall als einen Meister und Unternehmer, dessen Name beste Handwerksarbeit garantierte. Um so mehr traf ihn nun die Beanstandung eines von ihm nach Halle gelieferten Mikroskopes.
Auch der neben Carl Zeiss am Schreibtisch stehende Altgehilfe und Vertraute August Löber, einst der erste Lehrling des Meisters, blickte ärgerlich auf das Instrument.
Die Stille wurde dem Professor aus Halle unbehaglich.
»Wir waren ja all die Jahre des Lobes voll, was Ihre Arbeiten betraf, Herr Meister, das kann ich nicht anders sagen«, meinte er vorsichtig. Es war ein Versuch, die unumgängliche Auseinandersetzung möglichst frei von feindseliger Schärfe zu halten. »Aber dieses eine Mal eben, so leid es mir tut - eine Enttäuschung, sit venia verbo.«
Carl Zeiss nickte. Es war nicht ganz klar erkennbar, ob er damit die Worte des unzufriedenen Kunden oder das Ergebnis seiner Untersuchung bestätigen wollte. Er reichte Löber das abgebaute Objektiv des bemängelten Instruments und wartete auf die Meinung seines bewährtesten Mitarbeiters. Der Altgehilfe hielt das Teil dicht an die Augen und verzog den Mund.
»Oswald«, sagte er knapp und bestimmt.
»Schick ihn zu mir«, befahl Carl Zeiss.
Löber deutete in Richtung des Professors aus Halle eine hölzerne Verbeugung an und verließ den Raum.
Langsam, wie von einer Anstrengung erschöpft, lehnte sich Carl Zeiss in seinem Schreibtischsessel zurück. Über die Brillengläser hinweg sah er dem Kunden gerade ins Gesicht.
»Das ist, bei Gott, sehr unangenehm. Aber zum Glück ist es auch eine Ausnahme. Sie bekommen selbstverständlich ein neues, einwandfreies Instrument. Das beste sogar, was ich zurzeit bieten kann ...« Er verstummte. Die Miene Helbachs ließ keinen Zweifel daran, dass dieses Angebot auf Ablehnung stieß. »Sie haben einen anderen Vorschlag?«
»Eigentlich dachte ich an die Rückerstattung des Kaufpreises.«
»Aber Sie schrieben damals doch, dass bei Ihnen ganz dringend ein gutes Mikroskop gebraucht wird?!«
»Zugegeben ...« Professor Helbach wich dem Blick des Meisters aus. Offensichtlich bewegte sich das Gespräch auf einen ihm unangenehmen Punkt zu.
»Sie werden nicht noch einmal enttäuscht sein, Herr Professor«, versicherte Carl Zeiss.
»Offen gestanden: Ich habe bereits, was nötig war, Herr Meister, und ich bin mit dem Instrument sehr zufrieden. Im höchsten Maße zufrieden sogar.«
Für eine Minute waren nur die Geräusche aus der Werkstatt zu hören.
»Ein Mikroskop aus Berlin, nehme ich an?«, fragte Carl Zeiss dann auffallend ruhig.
»Aus der Werkstatt Hartnack.« Professor Helbach war sichtlich erleichtert. »Die Berliner verbessern die Leistung der Mikroskope ganz beträchtlich mit Immersionssystemen, die ein Italiener eingeführt hat.«
»Amici«, sagte Carl Zeiss. Er wusste, dass man in der Berliner Werkstatt schon seit einiger Zeit die Erfindung des italienischen Astronomen und Mikroskopebauers benutzte, wonach zwischen Objektiv und Frontlinse eine Flüssigkeit gegeben und mittels eines vergrößerten Öffnungswinkels eine höhere Qualität erreicht wurde. Gemeinsam mit Löber hatte er bisher erfolglos versucht, diesen technischen Vorsprung aufzuholen. »Wenn Sie also darauf bestehen, Herr Professor Helbach ...«
Schüchternes Klopfen an der Tür unterbrach den Meister. Auf sein Wort hin trat der Gehilfe Oswald herein.
»Sie haben mich gerufen, Herr Prinzipal?« Der Blick des Mannes im grauen Arbeitskittel flog zwischen Meister, Besucher und dem Mikroskop auf dem Schreibtisch hin und her.
Carl Zeiss erhob sich. Der Wissenschaftler aus Halle stand ebenfalls auf.
»Ich denke, wir werden uns einig, Herr Professor«, erklärte der Meister und geleitete den Kunden zur Ladentür.
»Sie finden mich im Schwarzen Bären, Meister«, sagte Professor Helbach. »Vielleicht gegen sieben?«
»Besser morgen früh gleich vor acht, wenn es genehm ist?«, entgegnete Carl Zeiss. Der Besucher aus Halle war einverstanden.
Gleich darauf trug der Gehilfe Oswald das von ihm gefertigte und mit Mängeln behaftete Mikroskop hinter dem vorausgehenden Meister Zeiss durch die Werkstatt, vorbei an den Arbeitstischen der fünfundzwanzig Gehilfen und Lehrlinge. Sie gingen zur kleinen Schmiede. Von seinem Prinzipal hatte Oswald bis zu dieser Minute nur erfahren, dass es sich um ein von ihm hergestelltes und als einwandfrei abgeliefertes Instrument mit dem Zeichen der Zeissschen Werkstatt handelte. Kein einziges Wort mehr. Keine Andeutung, keine Rüge.
Nur, wer den Meister so genau kannte wie August Löber, las die zornige Erregung aus den von Energie und Selbstbewusstsein geprägten Zügen. Tatsächlich brannte der so gelassen wirkende Prinzipal innerlich vor Wut. Er hasste liederliche Arbeit. Für ihn war handwerkliche Pfuscherei gleichbedeutend mit Betrug. Ein kriminelles Delikt. Wer für eine schlampige Leistung das ehrlich verdiente Geld anderer Leute forderte und sie mit mangelhafter Ware betrog, der stand im Urteil von Carl Zeiss noch ein ganzes Stück unter den Spitzbuben, die auf Jahrmärkten die Hand in fremde Taschen steckten.
In der Schmiede bedeutete der Prinzipal dem Gehilfen schweigend, das beanstandete Mikroskop auf den Amboss zu stellen.
Die Gehilfen und Lehrlinge in der Werkstatt reckten die Köpfe. Löber kam bis zur offenen Tür der Schmiede.
Wortlos wählte Carl Zeiss den schwersten der vorhandenen Hämmer aus, schwang ihn hoch und schlug dreimal wuchtig zu. Die Hiebe verwandelten das Instrument in einen unansehnlichen Messingklumpen.
Schrott!
Oswald verharrte bleich, stumm und reglos.
Der Meister stellte den Hammer zur Seite und klopfte befriedigt die Handflächen gegeneinander. Dann erst wandte er sich an den Gehilfen.
»So, Oswald, nun sind wir beide miteinander fertig«, erklärte er ruhig. »Fristlos und ein für alle Mal!«
Ottilie Zeiss, die zweite Gattin von Carl Zeiss und wie dessen 1850 bei der Geburt des ersten Kindes Roderich gestorbene Frau Bertha ebenfalls Pfarrerstochter, achtete auf christliche Lebensführung, wobei sie Strenge und Enge nicht selten in Maßen walten ließ, welche den Gatten veranlassten, sein Weib eine geistliche Landpomeranze zu nennen. Der Vergleich zielte auf die stark bitterwürzige Schale und das sauere Fruchtfleisch jener nussgroßen, der Apfelsine und Pampelmuse verwandten Südfrucht. Das Bild entsprach ziemlich treffend der mürrischen Art und Weise, in der die Meisterin an diesem Abend die steile Stiege hinauf zu der unter dem Dach liegenden Gesindekammer ging. Sie wurde von dem Lehrling Heinz begleitet, der sie mit einer Entdeckung alarmiert hatte.
»Es sind Hirngespinste, Junge!« Ottilie Zeiss prustete leise. »Falsch Zeugnis ablegen verdient scharfe Strafe, weißt du das?!«
»Ich schwör's, Frau Meisterin.« Der Lehrling flüsterte. »Ich hab' es deutlich gesehen! Durchs Schlüsselloch! Splitternackt, so wahr mir Gott helfe!«
Vor der Kammertür blieb die Meisterin stehen. Einen Moment lang spielte sie wohl mit dem Gedanken, ebenfalls einen Blick durch das Schlüsselloch zu schicken. Als sie sah, dass der Lehrling ihr Verhalten belauerte, erinnerte sie sich ihrer Rechte als Dienstherrin und riss die Tür ohne vorheriges Anklopfen auf. Sie tat einen Schritt in die Kammer und erstarrte!
Aus dem Bett der Dienstmagd schreckte ein Halbwüchsiger hoch, starrte die Meisterin und den hinter ihr den Kopf hereinsteckenden Lehrling ängstlich an und zog die Decke bis ans Kinn.
»Das ... da soll doch ... Unglaublich!«, stammelte die Hausherrin, fasste sich aber sekundenschnell und wies zur Tür. »Raus! Ich sage nur: Raus hier und ganz schnell!«
Franz Steinhüter fand seine Sprache wieder.
»Ich ... Aber ...« Die Meisterin schnitt ihm das Wort ab.
»Kein Ich, kein Aber, das ist hier keine Herberge!«
Zaghaft schob Franz Steinhüter seine Beine aus dem Bett. »Meine Sa-sachen, sie hängen auf dem Trockenboden«, brachte er stockend hervor.
»Genau wie ich gesagt habe, Meisterin, das Ferkel ist nackig!«, triumphierte der Lehrling und grinste. Anstelle eines Lobes erhielt er von der Meisterin eine leichte Ohrfeige und den Befehl, zurück in die Werkstatt zu gehen.
Auf der Stiege kam dem Lehrling die Dienstmagd entgegen. Ihr Atem flog. Rote Flecken zeichneten ihr Gesicht. Gerade vom Einkauf zurückgekommen, hatte sie in der Küche von Hedwig, der zehnjährigen Tochter des Ehepaares Zeiss, erfahren, dass sich ein nackter Bursche in die Dachkammer eingeschlichen habe und die Meisterin im Begriff sei, den vorwitzigen Eindringling aus dem Haus zu werfen.
»Dir werde ich auf die Sprünge helfen.« Ottilie Zeiss schritt auf Franz Steinhüter zu. Sie packte ihn am Ohr und wollte ihn aus dem Bett zerren, als seine Mutter in die Kammer stürzte.
»Bitte, Frau Meisterin!«, rief sie und war mit zwei, drei Schritten an der Seite des Jungen. »Das ist Franzi ... Mein Sohn!«
Verblüfft gab die Hausherrin das Ohr frei.
»Sohn? Dein Sohn?« Sie starrte ihre Dienstmagd entgeistert an. »Und in der langen Zeit bei uns kein einziges Wort davon, keine Silbe? ... Weshalb, Karoline?«
»Weil alles mit einer Lüge angefangen hat, Frau Meisterin«, sagte die Mutter des Jungen leise. Sie legte den Arm um seine bloßen Schultern. »Wer nimmt eine Magd mit einem unehelichen Kind in den Dienst ... Ich glaube nicht, dass mir die schöne Stelle in Ihrem Haus vergönnt gewesen wäre.«
Ottilie Zeiss schwieg. Sie musste an einen Jahrmarkt denken, den sie als gerade erst konfirmierte Tochter des Pfarrers und Adjunktus Trinkler in ihrer Geburtsstadt Triptis miterlebt hatte. An einem hellen Nachmittag war damals die ledige, kaum siebzehnjährige Mutter eines erst wenige Monate alten Kindes von einigen angetrunkenen Burschen eingefangen worden. Die Kerle hatten der jungen Frau vor aller Augen gewaltsam die Röcke über dem Kopf zusammengebunden und sie dann, von den Füßen bis zur Taille völlig entblößt, auf dem Marktplatz umhergestoßen. Die Leute hatten zugeschaut, gespottet, gelacht, gespien oder ihre Bierneigen nach dem Opfer hin geschüttet. Erst Heinrich Trinkler, Ottilies Vater, hatte dem Treiben ein Ende gemacht. Die junge Frau war eine Woche später tot aus einem Teich gezogen worden.
»Und wie soll das weitergehen, Karoline?«, fragte die Gattin des Prinzipals endlich unsicher. »Hier kann er nicht bleiben, das weißt du.«
»Der Franzi hat nur noch mich, Frau Meisterin. Er ist ein braver, aufgeweckter Junge.« Karoline Steinhüters Blick war inniges Bitten.
»Ich kann arbeiten ... Alles!«, beteuerte Franz Steinhüter eifrig. Er spürte, dass in diesen Minuten alles vom Wohlwollen der Hausherrin abhängig war. »Und ich esse auch nur sehr wenig!«
Karoline Steinhüter legte dem Sohn sanft die Hand auf die Lippen. »Ich hab' mir gedacht ... Ich meine, wenn Sie vielleicht beim Meister ein gutes Won für meinen Franzi einlegen würden ...«
Ottilie Zeiss runzelte die Stirn. Sie begriff noch nicht, worauf die Dienstmagd mit ihrem Vorschlag hinaus wollte.
»Bei meinem Mann?«, fragte sie. »Was für ein gutes Wort?«
»Der Franzi würde gewiss ein fleißiger Lehrbub sein.«
»Hier, in unserer Werkstatt?« Die Meisterin schüttelte den Kopf. Ihre Stimme klang jetzt versöhnlicher und ein wenig mitleidig. »Aber Linchen, wie willst du das denn aufbringen: Hundert Taler Lehrgeld und noch einmal fünfzig Taler im Jahr für Kost und Logis ... Nein, Linchen, nein!«
»Ich würde auf alle freien Tage verzichten, den Garten draußen in Ordnung halten ...«
»Linchen! Du hast hier im Haus wirklich schon reichlich zu tun. Vielleicht bringen wir den Jungen auf dem Land unter. In der Nähe natürlich. Wenn ich mit dem Herrn Oberpfarrer rede ...«
»Bitte, Frau Meisterin! Ich lege auch meinen Lohn noch dazu. Sie sollen es nie bereuen, das schwöre ich bei Gott!«
Es war weniger Großherzigkeit als nüchternes Kalkül, was Ottilie Zeiss für die Bitte zugänglicher machte. In vier Lehrjahren würden die einer Dienstmagd jährlich zugestandenen zwölf freien Tage sowie dazu ihre paar Lohntaler das übliche Lehr- und Kostgeld längst nicht aufwiegen. Die Hausherrin bezog den erwiesenen Fleiß der Bediensteten sowie die von Mutter und Sohn gleichermaßen zu erwartenden, nutzbringenden Dankgefühle in die Überlegung ein. Sie wusste, dass ihr Mann kaum etwas gegen eine so vorteilhafte Übereinkunft haben würde, zumal diese über allen Gewinn hinaus billig im Zeichen gottgefälliger Wohltätigkeit stünde.
»Also gut, ich werde mit dem Prinzipal reden«, versprach sie endlich. »Richt dem Franzi drüben in der Lehrlingskammer eine Schlafstelle her. Ein ordentliches Hemd und eine saubere Hose für ihn finden wir zuvor sicher bei den Sachen von unserem Herrn Gymnasiasten.«
Sie meinte damit den aus erster Ehe des Meisters stammenden, inzwischen sechzehn Jahre alten Sohn Roderich. Als dessen Verhältnis zur Stiefmutter nach anfänglicher, gegenseitiger Zuneigung im Laufe der Jahre immer unfreundlicher geworden war, hatte ihn Carl Zeiss auf ein Gymnasium in Eisenach geschickt und nur die drei Kinder aus der zweiten Ehe, den jetzt zwölfjährigen Karl Otto, die zehnjährige Hedwig und die erst fünfjährige Sidonie im Haus behalten.
Karoline Steinhüter bekam vor Freude nasse Augen. Im Überschwang ihrer Gefühle wollte sie, was in all den vorangegangenen Dienstjahren niemals geschehen war, der Meisterin die Hand küssen, doch Ottilie Zeiss erlaubte das nicht.
»Du musst dich sputen, Linchen! Zuerst bereite das Abendbrot für den Prinzipal und den Löber. Ich bring' das dann selbst hinüber. Um den Franzi kannst du dich dann kümmern. Komm jetzt!« Sie drängte die Dienstmagd zur Tür. Auf der Schwelle drehte sie sich noch einmal zu dem Jungen im Bett um. »Du musst dem Herrgott sehr dankbar sein für so eine Mutter, Junge!«
Wer als Gehilfe bei Carl Zeiss zwischen vier und fünf Taler in der Dekade verdienen wollte, hatte einen langen Tag. Gearbeitet wurde von morgens 6 bis abends 19 Uhr. Dazwischen gab es am Vormittag eine Viertelstunde Frühstückspause und später für das Mittagessen noch einmal eine volle Stunde. Für den Meister war es ganz selbstverständlich, täglich in aller Frühe, noch vor seinen Mitarbeitern, in der Werkstatt zu sein, die er dann nach Feierabend stets als letzter verließ.
Wie oft zuvor, so brannten auch an diesem Tag noch zu später Stunde zwei Öllampen in der Werkstatt. An den verlassenen Arbeitsplätzen der Gehilfen und Lehrlinge lagen Werkzeuge und Halbfertigteile, wie mit Winkel und Lineal gerichtet, beieinander. Nirgendwo ein Stäubchen, nirgendwo ein Metallspan, ringsum vorbildliche Ordnung. Die Lehrlinge wussten, dass es Schläge setzte, wenn Meister oder Altgehilfe auch nur den kleinsten Grund zur Rüge entdeckten.
Carl Zeiss pröbelte, August Löber half ihm dabei.
Überall, wo in dieser Zeit Mikroskope gebaut wurden, ging man dabei ähnlich vor: Auf gut Glück, mit dem Einsatz langjähriger Erfahrungen und handwerklicher Übung, wurden Linsen aus mehr oder weniger geeignetem Glas geschliffen, zusammengestellt und in einen Tubus eingebaut. Danach folgte das oft stundenlange Pröbeln - Nerven zerreibendes Probieren und Korrigieren bis zu einem befriedigenden Ergebnis. Scheiterten alle Mühen, blieb am Ende nur der Wurf in die Schrottkiste. Eine zuverlässige Berechnungsgrundlage und feststehende Maße zur Herstellung gleichwertiger Mikroskope existierten nicht.
Der Gedanke, dass es Gesetzmäßigkeiten für den Bau von Mikroskopen geben müsse, beschäftigte Carl Zeiss seit Jahren. Er gehörte nicht zu den Leuten, die sich damit zufriedengaben, das eigene Dach dicht zu halten und die eigene Schüssel reichlich zu füllen. Ihn reizte das Unerforschte. Immer wieder faszinierte ihn die Vorstellung, ein hochleistungsfähiges Mikroskop so entstehen zu lassen wie der Architekt ein Bauwerk. Noch vor dem ersten handwerklichen Griff müsste das Instrument bereits in Strich und Zahl auf dem Papier fixiert sein, in seiner Verwendbarkeit völlig zuverlässig vorbestimmt.
Unzählige Stunden hatte Carl Zeiss seinem Traum schon geopfert - ergebnislos. Gegen ein für seine Verhältnisse beträchtlich hohes Entgelt hatte er zwei Jahre lang den Rechenmeister Barfuss für die Mitarbeit gewonnen. Er war damit keinen Schritt weiter gekommen. Trotzdem kam Aufgeben für ihn nicht infrage. Daran konnte selbst der Umstand nichts ändern, dass angesehene Experten inzwischen bezweifelten, dass ein wissenschaftlich entworfenes, also in allen Teilen vorausberechnetes Mikroskop überhaupt herstellbar sei.
Im Lampenschein prüfte Carl Zeiss eine weitere Kombination verschiedener Linsen. Löber arbeitete an der Schleifapparatur. Gesprochen wurde bisher wenig. Nun nahm der Meister die Brille ab und rieb sich die Augen.
Löber unterbrach das Nachmessen einer Linse, die nicht größer war als der Fingernagel eines Kindes. Er schaute herüber.
»Kann ich helfen, Meister?«
Carl Zeiss schüttelte den Kopf.
»Es ist Krümelzählerei, was wir hier tun«, sagte er leise, wie es stets seine Art war. Selbst in ärgerlichsten Situationen hatte ihn noch niemand schreien gehört. »Wir arbeiten mit verbundenen Augen, August. Ich habe sie satt, diese ewige Pröbelei, so satt!«
Wenn es auch recht selten passierte, so blieb der Universitätsmechaniker und Hofmechanikus doch nicht gänzlich verschont von jener Niedergeschlagenheit, die den schöpferisch Suchenden manchmal überkommt.
»Wir sind auf diese Weise immerhin an die Spitze gekommen«, wandte der Altgehilfe ein. »Wer außer uns vermag denn in den deutschen Staaten oder im Ausland aus eigener Herstellung dreißig verschiedene Mikroskope bester Qualität anzubieten? Wer kann einem knappbemittelten Studenten ein brauchbares Instrument schon um fünfzehn Taler und dem Höhergestellten Geräte bis zum gerechtfertigten Preis von zweihundert Taler verkaufen? Und nicht allein für unser Jenaisches Trichinen-Mikroskop gibt es mehr interessierte Käufer, als wir beliefern können. Nein Meister, besser als die Zeisswerkstatt ist keiner!«
Carl Zeiss lächelte. »Danke, August, aber da ist eben der Hartnack in Berlin, der mich heute hundertfünfundachtzig blanke Taler gekostet hat.«
»Bei Hartnack pröbeln sie auch!«
»Noch, August, noch!« Der Meister schaute zu Löbers Arbeitsplatz hinüber. »Dreh mal den Lampendocht herunter, Brennöl ist teuer!«
Sofort befolgte der Altgehilfe die Anweisung, dann ging er zu seinem Prinzipal, der die Unterhaltung offenbar fortsetzen wollte.
»Ich lasse mich nicht davon abbringen, dass es Gesetze geben muss, nach denen Mikroskope funktionieren.« Der Blick Carl Zeiss' verlor sich im düsteren Raum. Durch die von Löber geöffneten Fenster strömte klare Abendluft herein und nahm den stickigen Schmauch der Lampen fort. »Und wer diese Gesetze zuerst findet, als erster nutzt, hörst du, dem wird der Markt gehören, nicht nur in den deutschen Landen. Auf Jahre, August, auf Jahrzehnte sogar, denke ich.«
August Löber nickte. Zwar vermochte er dem Gedankenflug des Meisters nicht zu folgen, aber er wollte keinen Zweifel daran lassen, dass er jeden noch so beschwerlichen Weg an der Seite seines Prinzipals mitzugehen bereit war.
»Ich ... Also ... Wenn es dafür steht, Meister, so komme ich gern sonntags gleich nach der Kirche unauffällig hierher in die Werkstatt und helfe Ihnen wie jetzt an den Abenden. Ich möchte wetten, dass wir dahinterkommen, wenn es diese Gesetze tatsächlich gibt ... Gegen Fleiß bleibt kein Tor geschlossen!«
»Fleiß allein ist da kein Schlüssel, August.« Carl Zeiss putzte wie in Gedanken seine Brille, »Wissenschaft ... Handwerk und Wissenschaft, das müsste ein Paar werden in der Optik.«
Der Altgehilfe stutzte, lachte dann verhalten und abfällig. »Handwerker und diese hochnäsigen Universitätsherrschaften an einem Strang? Nee, Meister! So einer wie der Professor aus Halle, so einer sieht unsereinen nicht mal, wenn er uns auf die Zehen tritt!«
Carl Zeiss setzte seine Brille wieder auf und sah zur Tür. »Sie sind bei Weitem nicht alle von dieser Sorte, lieber Freund.«
Frau Ottilie erschien mit einem vollen Tablett. Abendbrot. Auch eine Mahlzeit für den Altgehilfen war, wie stets bei solchen Überstunden, dabei. Bier und schwarzes Brot mit Käse.
Während August Löber auf einen Wink des Meisters bereits aß und trank, tuschelte das Ehepaar noch eine Weile in der Werkstattecke. Nachdem die Hausherrin endlich wieder gegangen war, begann der Prinzipal ebenfalls zu essen und nahm dabei den Gesprächsfaden von zuvor noch einmal auf.
»Ich werd' sie unter eine Haube bringen, die Wissenschaft und das heilige Handwerk.« Er hatte den Anflug von Mutlosigkeit offenkundig überwunden. »Es gibt da einen Herrn, mit dem sich gewiss vernünftig reden ließe.«
»Reden ließ sich seinerzeit auch mit dem Rechenmeister Barfuss.« Löber war skeptisch, doch der Prinzipal hatte bereits einen Entschluss gefasst, und Löber hatte noch nie erlebt, dass er über eine getroffene Entscheidung nachträglich die Meinung anderer einholte oder gar darüber diskutierte. Er überraschte seinen Altgehilfen vielmehr mit einer ganz anderen Neuigkeit.
»Morgen früh fängt ein neuer Lehrling bei uns an«, sagte er zwischen einem langen Schluck Bier und einem Bissen. »Der Sohn unseres Linchens!«
August Löber schaute seinen Prinzipal erstaunt an, wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort über die Lippen. Nicht nur, dass die unverehelichte Karoline einen Sohn hatte, machte den Altgehilfen sprachlos. Allem Anschein nach wollte Meister Zeiss ausgerechnet in diesem moralisch doch höchst fragwürdigen Fall sogar das fällige Lehrgeld in den Schornstein schreiben!
In einem kleinen Unterrichtsraum der Jenaer Universität lauschten drei Physikstudenten den Worten des Doktor Ernst Abbe, der aufgrund seiner Habilitation die Berechtigung erworben hatte, als Privatdozent Vorlesungen und Übungen abzuhalten, allerdings ohne dafür von der Institution besoldet zu werden. Seine Hörer zahlten ihm ein geringes Stundengeld, gerade ausreichend für schmale Kost und die Miete, die er für eine enge Schlafkammer zu entrichten hatte.
Der Eisenacher mochte die meisten dieser jungen Studiosi nicht sonderlich. Seine heimliche Abneigung richtete sich gegen die aus reichen Familien nach Jena gesandten Söhne, von denen nur wenige das Studium so ernsthaft und diszipliniert betrieben, wie er es einst selbst hier in dieser Stadt und dann bis zur Promotion an der Göttinger Universität absolviert hatte. Bier- und Paukcomment waren ihm nicht allein deshalb zuwider, weil er dafür keinen Groschen erübrigen konnte. Saufgelage, bornierte Gesänge ebenso wie das Aufeinanderschlagen mit scharfen Klingen zum Zwecke gegenseitiger Gesichtsverstümmelung beschädigte nach seinem Gefühl die Würde des Menschen und beraubte ihn seiner Größe.
Von frühester Kindheit an bis in die Gegenwart war das Brot für den jungen Akademiker niemals reichlich gewesen. Was sein Vater als Arbeiter in der größten Eisenacher Spinnerei an sechs Werktagen der Woche jeweils von vier Uhr in der Frühe bis abends acht Uhr als Lohn erhielt, genügte der Familie gerade zum Leben. Der Gedanke an eine höhere Schulbildung für den Sohn Ernst wäre den Abbes nie von allein gekommen. Erst sein Volksschullehrer hatte die Eltern und vor allem die Besitzer der Spinnerei auf die besondere Begabung des Jungen hingewiesen.
Die Fabrikherrn galten als kluge, weitsichtige Unternehmer. Sie sahen voraus, dass technischer Fortschritt und damit einhergehendes, schnelles Wachstum ihrer Kammgarnspinnerei nicht nur im zunehmenden Maße kenntnisreiche Facharbeiter, sondern vor allem auch treu ergebene, mit höherer Schulbildung ausgerüstete Mitarbeiter in allen Bereichen der Fabrikführung unerlässlich machen würde. Ständig auf der Suche nach geeigneten Begabungen, nahmen sie den Wink des Volksschullehrers ohne langes Zögern auf. Die Empfehlung gab ihnen Gelegenheit, ihre mit öffentlichem Ansehen gepaarte Wohltätigkeit und unternehmerisches Kalkül sinnvoll zu verschmelzen. Sie dachten sich den Sohn ihres Werkmeisters Abbe als künftigen, ihnen ein Leben lang zur Dankbarkeit verpflichteten Kommis und streckten das Geld zum Besuch des Eisenacher Realgymnasiums vor.
Neben dem Lehrstoff, der dem jungen Ernst Abbe in keinem Fach und in keiner Stunde Schwierigkeiten bereitete, lernte er inmitten von Schülern angesehener, wohlhabender Bürger-, Kaufmanns- oder Adelsfamilien zeitig, dass Begabung und Fleiß für die Leute aus den Villenvierteln oder Patrizierhäusern zwar geschätzte, aber dennoch nur zweitrangige Werte waren. Besitz und Stand besaßen das weitaus größere Gewicht. Das bekam er beinahe täglich auf demütigende Weise zu spüren.
Ob im Winter der Klassenofen geheizt und gereinigt werden musste, ob der Rektor für seinen Garten einen Schüler zum Obstpflücken, zum Unkrautjäten oder zum Jauchen benötigte, ob im Biologieunterricht einer der Jungen als lebendes Modell fast nackt vor die Klasse gestellt wurde oder ein Schüler mangels Reisegeld an einer sommerlichen Studienfahrt nicht teilnehmen konnte und dafür dem Pedell beim Streichen des Schulzaunes zu helfen hatte - es traf immer wieder den Sohn des Werkmeisters.
Es gibt keinen wirkungsvolleren Beweis der Überlegenheit als allseitig-vortreffliche Leistungen. Ernst Abbe handelte mit Fleiß nach diesem Grundsatz. Er bestand das Abitur mit hoher Auszeichnung, doch der für ihn frei gehaltene Platz im Comptoir der Eisenacher Kammgarnspinnerei blieb leer. Dem Sohn des Spinnereimeisters stand der Sinn längst nicht mehr danach, seine Fähigkeiten allein dafür einzusetzen, dass die Reichen noch reicher wurden. Er wollte studieren. Um jeden Preis. Die Fabrikbesitzer forderten Ableistung oder Rückgabe des vorgestreckten Schulgeldes, doch in dieser Situation kam dem Abiturienten eine Entscheidung des Großherzoglichen Staatsministeriums in Weimar entgegen. Sie besagte, dass im Interesse der Förderung eines immer dringlicher gebrauchten akademischen Nachwuchses die Eisenacher Realschule geeignete, überragend begabte Absolventen zum Studium der Naturwissenschaften und der Mathematik entsenden durfte.
Zu jener Zeit galt Jena als die billigste aller deutschen Universitätsstädte. Ein Student musste hier trotzdem noch mit jährlichen Kosten von mindestens zweihundert bis zweihundertfünfzig Talern rechnen. Das war ein Betrag, den Ernst Abbes Vater unter gar keinen Umständen aufbringen konnte. Er wog alle unumgänglichen Ausgaben streng Pfennig um Pfennig gegeneinander ab und kam zu dem Ergebnis, dass zur Finanzierung des Studiums gerade noch fünfzig Taler oder zwei, drei Taler mehr aus dem Familieneinkommen abzuzweigen wären. Freilich durfte dann im Haus Fleisch, Zucker und ein Schluck Bier nur noch an Feiertagen erlaubt sein, in Herd und Ofen lediglich selbst gesammeltes Holz verbrannt werden und ein paar Jahre lang kein Gedanke sein an häusliche Anschaffungen, neue Kleidung oder Schuhe.
Ernst sollte entscheiden. Es fiel ihm nicht leicht. Er begriff, wie verpflichtend diese Einschränkungen der Familie für ihn sein würden. Die Annahme dieses Opfers erlaubte ihm künftig keine nutzlose Stunde, kein Versagen, keine Umkehr vor dem Ziel. Fast eine volle Woche schlug er sich mit Fragen und Zweifeln herum, dann entschied er sich. Er versprach seinem Vater, aus keinem der in der Familie gesparten Taler verlorenes Geld werden zu lassen. Mit Nachhilfestunden und jeder irgendwie greifbaren Arbeit, auch wenn sie nur ein paar Groschen einbrachte, wollte er den größeren Teil der Studienkosten selbst aufbringen.
1857, noch in seinem siebzehnten Lebensjahr, ließ er sich an der Jenaer Universität immatrikulieren. Er hörte Mathematik und Physik, Botanik, Kristallografie, Neuere Geschichte, Philosophie und Pädagogik. Nach zwei Jahren setzte er das Studium in Göttingen fort, wo er 1861 mit dem Prädikat summa cum laude die Doktorprüfung bestand. Leichter war sein Leben seither allerdings nicht geworden. Doch obwohl seine Einkünfte an manchem Wintertag selbst für ein Stück Brot, einen Salzhering oder einen warmen Ofen nicht reichten, machte ihn seine trostlose Lage keineswegs so verdrossen, dass er darüber das Lächeln und die Freundlichkeit verlor.
Schon während des Studiums hatte sich dem jungen Eisenacher eine Quelle erschlossen, die alle Misslichkeiten erträglicher machte. Er entdeckte in den mathematischen und physikalischen Gesetzmäßigkeiten jene Poesie, wie sie von einer Mehrheit der Menschen allein in der Begegnung mit den Künsten empfunden wird. Wenn er trotz der anderen in Jena um zahlende Hörer bemühten Privatdozenten nie ohne Schüler blieb, so beruhte das auch auf der in Studentenkreisen schnell bekannt gewordenen Tatsache, dass er über die Gesetze der Lichtbrechung, über die genaue Frauenhofersche Bestimmung der fixen Linien des Spektrums oder auch über die Methodenlehre des Archimedes mit einem Eifer und einer Anschaulichkeit sprechen konnte, als ginge es dabei um Kunstwerke.
Im kleinen Unterrichtsraum der Jenaer Universität näherte sich die Vorlesung Doktor Abbes an diesem Nachmittag dem Ende.
»Ich fasse also noch einmal zusammen«, sagte er zu seinen drei jungen Hörern. »Ein Gasquantum zeigt eine Erhöhung der Temperatur, wenn es verdichtet, beziehungsweise eine Erniedrigung derselben, wenn es verdünnt wird.« Er brachte aus seiner Aktentasche einen kleinen Metallgegenstand zum Vorschein. »Dies hier ist ein nach eben jener Erkenntnis geschaffenes, sehr nutzenreiches Gerät - ein pneumatisches Feuerzeug. Mithilfe des Kolbens wird die Luft in dem kleinen Zylinder zusammengedrückt, also verdichtet. Ergebnis: Die Temperatur steigt! Sehen Sie, meine Herren, so geht das!« Das Feuerzeug erwies sich als geeignetes Demonstrationsobjekt. »In der Hitze entzündet sich der Feuerschwamm am Kolbenkopf und - Ihr nun ein wenig ermüdeter Lehrer kann sich nach geleisteter Arbeit - ab igne ignem! - seinem Laster hingeben!«
Der Doktor zündete sich am glimmenden Feuerschwamm eine Zigarette an.
Die drei jungen Männer packten ihre Notizhefte zusammen. Einer trat zu Doktor Abbe und zählte ein paar Münzen auf den Tisch, dann legte er eine vorbereitete Quittung dazu.
»Bitte unterschreiben Sie's mir, Herr Doktor«, wünschte er ein wenig verlegen. »Mein alter Herr will's nun mal schwarz auf weiß, dass Sie Ihr Stundengeld wirklich bekommen haben.«
Während sich einer der Hörer schon von der Tür her verabschiedete, interessierte sich der andere für das auf dem Tisch liegende, pneumatische Feuerzeug.
»Wo kann man so was kaufen?«, fragte er. »Ist dieses Ding sehr teuer?«
Doktor Abbe hob beim Unterschreiben der Quittung nicht den Kopf.
»Ich habe es selbst gebaut. Fragen Sie doch mal in einem Tabakladen.«
»Und das hier ist von Ihnen gemacht worden?« Der Student war offenbar an einem Gespräch interessiert.
Doktor Abbe lächelte, gab die Quittung an den Hörer, der das schon seit einer Woche fällige Honorar gezahlt hatte.
»Sie finden das erstaunlich, wie ich sehe.«
»Allerdings, Herr Doktor.«
Sie verließen miteinander den Raum. Die beiden anderen Studenten waren schon verschwunden.
Das Universitätsgebäude wirkte um diese Stunde wie ausgestorben. Im Treppenhaus hallten die Schritte des Privatdozenten und des jungen Mannes unnatürlich laut.
»Die Praxis setzt unseren technischen Ideen leider immer wieder strenge Grenzen, junger Freund.« Das offenkundige Interesse des Studenten stimmte Doktor Abbe freundlich. »Und je besser wir sie kennen, diese Grenzen, um so erfolgreicher wird unser wissenschaftliches Bemühen sein, das Terrain für fortschrittliche Entwicklungen zu erweitern.« Er hielt inne und schaute dem jungen Mann ins Gesicht. »Lassen Sie sich einen Rat geben, falls Ihr Wissensdurst keine kurze Laune ist: Wenn Sie wirklich ein vorzüglicher Physiker werden wollen ...«
»Das will ich unbedingt«, beteuerte der Student sofort und mit Nachdruck.
»Dann schulen Sie nicht nur Ihren Verstand, üben Sie dazu auch mit Eifer das handwerkliche Können. Nicht selten ist eine Stunde an einem Schraubstock oder an einer Drehbank wertvoller als eine ganze Woche im Hörsaal ... Aber behalten Sie's für sich, ja?«
Doktor Abbe lächelte und ging weiter.
»Ich glaube nicht, dass alle Herren Professoren diesbezüglich Ihre Meinung teilen, Herr Doktor.« Der Student war ihm weiter gefolgt. »Jedenfalls habe ich ähnliches noch nie an unserer Alma Mater zu Ohren bekommen.«
»Eben.« Abbe nickte. »Eben darum, mein Freund!«
Ein paar Stunden später lag der junge Doktor am Saaleufer, unerwünschten Blicken hinter dichtem Buschwerk verborgen. Vor ihm spiegelte sich eine rote, tief stehende Sonne im ruhigen Wasser des Flusses. Der frühe Abend roch nach Moos und Lindenblüten. Milde, warme Luft streichelte das Schilf.
Er hatte Jacke, Weste und Krawatte abgelegt, das Hemd weit geöffnet, die Ärmel hochgeschlagen und auch die Stiefeletten abgestreift. Er war nicht allein.
»Ich verstehe dich nicht.« Das Mädchen Emmy flüsterte. Ihr Kopf ruhte auf der Brust Ernst Abbes. Sie genoss das Gefühl der langsam in ihrem Körper nachlassenden Hitze. Deutlich hörte sie sein Herz schlagen. Sein Atem bewegte sanft ihr rotblondes Haar. »Meinem Vater würdest du recht sein als Schwiegersohn, und Mama ist ja selbst ein bisschen verliebt in dich, glaube ich.«
»Du, einzige Tochter und Kronjuwel des ehrenwerten Metzgermeisters Börner als Gattin eines Habenichtses, der zudem keinen Schimmer vom Fleischerhandwerk hat. Du träumst, Emmy!«
»Mein Vater ist ein vorsichtiger Mann, Ernst. Er hat sich schon umgehört, weißt du.«
»Umgehört?«
»Die Herren von Eichel in Eisenach ...«
»Ach, meine sogenannten Wohltäter, siehe da ... Was ist damit?«
Emmy Börner richtete sich auf. Sie schloss ihr Mieder über der Brust und begann, das Haar zu flechten.
»Trotz allem, was gewesen ist, würden sie dir auf der Stelle eine Aufgabe in ihrem Unternehmen geben und dir dafür mehr zahlen, als für einen eigenen Hausstand nötig ist.« Sie sah ihn an und lächelte.
»Eisenach ist zwar weit, aber nicht aus der Welt, sagen die Eltern. Für einen studierten Schwiegersohn brächten sie manches Opfer!«
»Verrenn' dich nicht, Emmy, das macht nur Schmerz.« Er setzte sich ebenfalls auf und wollte ihr zärtlich die Hand auf die Schulter legen, doch die Fleischermeistertochter wich zur Seite.
»Du bist undankbar. Ich gebe dir alles, und du ... Nein, fass mich nicht an!«
»Sie hätten keine Freude mit mir, die Herren von Eichel«, versuchte er ihr zu erklären. »Ich bin kein Comptoirmensch, schon gar nicht im Stoffgeschäft!«
Die Finger des Mädchens ließen die Zopfsträhnen schneller springen. Sie presste die Lippen zusammen, hielt den Nacken steif.
»Die Fähigkeiten, die ein Mensch für seinen Weg durch das Leben mitbekommt, Emmy, die gehören ihm doch nicht allein. Seine Talente sind wie ein Auftrag, wie eine Pflicht ...«
»Und Familie?« Emmy sah ihn an und hatte Tränen in den Augen. »Ein Heim, Kinder, daran liegt dir wohl wenig mit deinen Talenten, wie?«
»Viel, Emmy, sehr viel sogar liegt mir daran.« Abbe blieb ruhig. »Aber nicht heute und morgen. In zwei, drei Jahren ...«
Das Mädchen Emmy ließ ihn nicht ausreden. Sie sprang auf, schaute auf ihn herab. »Jahre? Hast du eben von zwei, drei Jahren gesprochen?«
Er nickte, stand ebenfalls auf und brachte seine Kleidung in Ordnung.
»Möglicherweise hat die Universität schon etwas früher ein besoldetes Lehramt für mich, aber bis dahin ... Wir sind jung, Emmy!«
»Ich Schaf!«, murmelte sie. Ihre Miene widerspiegelte Bitterkeit. Sie sah zu, wie er Weste und Jacke anzog. Bisher war sie ihm immer dabei behilflich gewesen. Nun rührte sie keine Hand. Ihr Blick begegnete ihm, als sei er ein Fremder. »Ich dummes, einfältiges Schaf. Ich hätte wissen müssen, wie ihr Studierten mit unsereinem umgeht, ihr ... ihr ...« Sie brach ab, wandte sich jäh um und rannte durch die Büsche davon.
»Emmy! Emmy, warte doch!« Er folgte dem Mädchen ein paar Schritte, besann sich dann aber anders. Eine ganze Weile stand er nachdenklich und spielte unbewusst mit den Knöpfen seiner Jacke. Ihm dämmerte in diesen Minuten die freilich späte Erkenntnis, dass eine solche Trennung in unvermeidlicher Konsequenz allzu unterschiedlicher, zwischen ihm und der Fleischermeistertochter nicht zum ersten Mal gegeneinander geratener Lebensziele und Wertvorstellungen erfolgte. Er war traurig.
Offenbar gibt es Verluste, die zugleich schmerzlich und Gewinn sind, dachte er auf dem Heimweg entlang der Saale. Aber ob mir jemals wieder eine Frau mit so viel sinnlichen Reizen und so viel Lust begegnen wird, das ist höchst unwahrscheinlich und in der Tat ein Anlass zum Traurigsein. Doch was an den Zehen zusammenpasst, darf auch an der Ferse nicht drücken, sonst wird nun mal kein brauchbarer Schuh daraus ...
DAS GESCHLECHT DER FROMMEN WIRD GESEGNET SEIN lautet der in kunstvollgeschwungenen Buchstaben gemalte Leitspruch, den Carl Zeiss eigenhändig über der Tür der Werkstatt angebracht hatte. Es kam allerdings nur sehr selten vor, dass der Blick seines Gehilfen oder eines Lehrlings die biblischen Worte streifte. Die Pflichten erlaubten keine Ablenkungen.
An diesem Sonnabendvormittag schallte die zornige Stimme des Altgehilfen wieder einmal bis hinaus auf den Johannisplatz.
»Fast eine volle Stunde brauchst du Faulpelz für die hundert Schritte bis zum Bäcker«, wetterte er. Sein Zorn richtete sich gegen den Lehrling Franz Steinhüter. »Semmeln sollst du holen und nicht Maulaffen feilhalten! Dir werd' ich Beine machen! Hände herunter!«
Zwei kräftige Ohrfeigen klatschten.
Die Wangen des Jungen glühten.
»Ich hab' an der Zeitung gestanden«, stammelte er zu seiner Entschuldigung. »Sie hängen gerade die neuen Blätter aus. Königgrätz! Die Preußen haben achtzehntausend Gefangene gemacht. Hundertvierundsiebzig Geschütze ...«
»Papperlapapp!«, fuhr Löber den Jungen an, der sich unter der grimmigen Stimme duckte, als wären es erneut Schläge. »Preußen, Preußen! Hier bin ich Bismarck, merk dir das, du Lümmel!«
Franz machte seinen Rücken gerade, wollte gehorsam nicken und wurde von einer dritten Ohrfeige getroffen, bevor ihm Löber den Semmelbeutel abnahm und den Platz an einem Schraubstock zuwies.
Von einem der Arbeitsplätze im Hintergrund der Werkstatt hatte ein junger Mann im grauen Werkkittel die Züchtigung beobachtet, während die anderen Gehilfen und Lehrlinge dem Vorgang kaum Beachtung schenkten. Einen Augenblick lang schien es, als wolle er den Jungen in Schutz nehmen, doch er beherrschte sich eingedenk des Umstandes, dass er in diesem Raum nur Gast war. Verstimmt richtete er sein Interesse wieder auf die Tätigkeit, mit der er gerade beschäftigt war.
Carl Zeiss hatte in dem von der Werkstatt abgeteilten Raum anderen Ärger. Unzufriedenheit bei seinen Gehilfen empfand er wie frechen Trotz gegen väterliche Strenge. Nach seinem Verständnis von Sitte und Ordnung gebührte einem gerechten Prinzipal seiner Art von Leuten, die in seinem Dienst Lohn und Brot erwarben, neben dem selbstverständlichen Gehorsam auch ein Maß an respektvoller Dankbarkeit, das jeden Anflug von Widerspenstigkeit ausschloss. Um so mehr Mühe verlangte ihm in dieser Vormittagsstunde das Anhören einer Beschwerde ab.
»Ich bitte um Vergebung, Herr Prinzipal, aber für drei Groschen Brennöl habe ich ganz gewiss nicht verbraucht«, behauptete der Gehilfe Klaus, der schon seit über einem Jahr in der Werkstatt arbeitete und sich in dieser Zeit nichts zuschulden kommen lassen hatte. Er legte den Wochenlohnzettel auf den Schreibtisch. »Hier, drei Groschen! Das kann nicht sein, bei Gott!«
»Drei Groschen?« Carl Zeiss rückte an seiner Brille, nahm den Zettel, betrachtete die Eintragungen genau.
»Drei Groschen!«, bestätigte der Gehilfe Klaus entrüstet.
Carl Zeiss ließ den Zettel sinken, sah über den Brillenrand hinweg den Mann an und erklärte verhalten: »Dann gibt es wohl nur drei Möglichkeiten. Entweder ich betrüge dich ...«
»Aber Herr Prinzipal, um Himmels willen!« Der Gehilfe war erschrocken.
»Oder wir haben einen Dieb in unserer Werkstatt, der sich heimlich an deiner Lampe zu schaffen macht«, fuhr Carl Zeiss fort, doch der Mann schüttelte sofort entschieden den Kopf.
»So was tut keiner hier bei uns!«
»Oder du hast tatsächlich für drei Groschen Öl verbraucht!?« Der Prinzipal musterte seinen Gehilfen, der verstört auf seinen Lohnzettel blickte.
»So ... so wird es sein, Herr Prinzipal«, stammelte er. »Nichts für ungut, bitte!«
»Schon vergeben, Klaus.« Carl Zeiss gab ihm die Abrechnung zurück. »Und überleg dir besser, wie hoch du den Lampendocht drehen kannst, wenn du dein Brot nicht kleiner machen willst.«
Der Ärger des Prinzipals verflog schnell. Der Vorfall bestätigte ihm, wie nützlich es dem Unternehmen war, dass die Gehilfen das am Arbeitsplatz verbrauchte Lampenöl von ihrem wöchentlichen Lohn bezahlen mussten. Der auf diese Weise erzielte sparsame Verbrauch wäre auf Betriebskosten unerreichbar gewesen.
An dem in ein wenig ungünstigeren Lichtverhältnissen eingerichteten Arbeitsplatz ganz hinten in der Werkstatt schnitt Doktor Abbe mit viel handwerklichem Geschick ein feines Gewinde auf einen dünnen Messingstift. Die Arbeit erforderte eine ruhige Hand und hohe Konzentration. Der junge Wissenschaftler merkte nicht, wie Carl Zeiss herankam und ihm zuschaute. Erst die Stimme des Meisters schreckte den Doktor auf.
»Weiß Gott, es wäre eine Sünde, wenn an Ihnen ein begnadeter Optiker verloren ginge, Doktor. Trinken Sie einen Frühstückskorn mit? Auch eine frische Semmel ist da!«
Ernst Abbe nahm die Einladung erfreut an.
In seinem abgeteilten Arbeitsraum füllte der Prinzipal die daumenhohen Gläser mit klarem Kornbrand, während Ernst Abbes Interesse einem Mikroskop galt, das auf dem Schreibtisch stand. Der Universitätsmechanikus beobachtete beim Einschenken seinen Gast.
»Hannack, Berlin«, erklärte er. »Konkurrenz. Die Leute dort haben die Immersionssysteme des vor drei Jahren verstorbenen Italieners Amici verbessert, erheblich verbessert sogar. Das liegt uns nun wie eine Schlinge um den Hals ... Prosit, Herr Doktor!«
Die kleinen Gläser klirrten beim Anstoßen leise.
Die beiden Männer kippten den klaren Korn in einem Zug.
»Mal unter uns und in aller Offenheit.« Carl Zeiss wurde noch ernster. »Wenn es nicht recht schnell gelingt, einen neuen Anlauf zu nehmen, dann ist es bald zu Ende mit dem guten Namen Zeiss überall, wo es um gute Mikroskope geht. Das ist keine Übertreibung, glauben Sie mir, Herr Doktor!«
Ernst Abbe war erstaunt.
»Auch wenn Sie der erste Mensch sind, mit dem ich so offen darüber rede.«
»Sie machen mich betroffen, Herr Zeiss. So viel Vertrauen ...?!«
»Ich mag keine Umwege, Doktor Abbe. Ich will etwas von Ihnen. Also frei heraus: Helfen Sie mir!«
»Ich? Helfen? Wie denn?«
»Errechnen Sie uns ein ganz neues, besseres Immersionssystem!«
Die Bitte verblüffte den jungen Wissenschaftler. Doch je länger er über den Vorschlag nachdachte, um so reizvoller erschien ihm die Aufgabe. Wenn auch noch sehr verschwommen, ahnte er in diesen Minuten schon, dass ihm hier ein Weg in unerforschte Regionen gewiesen wurde.
»Das ist keine Angelegenheit, die man zwischen zwei Sonntagen erledigen kann. Vielleicht machen Sie sich keine rechte Vorstellung vom erforderlichen Zeitaufwand, Herr Zeiss.«
Der Prinzipal griff nach der Flasche, füllte die Gläser noch einmal. Er kannte sich gut genug mit Menschen aus, um zu spüren, dass sein Gesprächspartner mehr als nur höflich interessiert war.
»Vor allem überschaue ich, dass mein Anliegen für Sie im höchsten Maße verdienstvoll wäre. Allein im wissenschaftlichen Sinne, doch genauso vom Profit her!«
Doktor Abbe hob den Kopf.
»Ich könnte es ja nicht in Taler und Groschen vorrechnen, lieber Doktor, aber auf meinen Animus konnte ich mich in all den Jahren verlassen. Als ich damals mit knappen hundert Talern hier in Jena die eigene Werkstatt aufgemacht habe, weil die Herrn drüben in der Residenz für mich keinen Platz einräumen wollten, seinerzeit hatte ich ein Gefühl - präzise so wie in dieser Stunde, auf Ehre und Gewissen. Ein gutes Geschäft weiß man voraus, oder es wird nichts daraus, sage ich immer ... Bestimmt kennen Sie den Fraunhofer, oder?«
»Den Münchner? Was für eine Frage! Seine Fernrohre sind Meisterwerke ... Die dunklen Linien im Sonnenspektrum ...«
»Der selige Professor Fraunhofer hat uns die Sterne näher gerückt, und hier in meiner Werkstatt ist jetzt die Zeit, in der es an uns beide kommt, für den Menschen auch das Winzigste ganz scharf ins Licht zu heben. Nehmen Sie das Glas, Herr Doktor Abbe. Stoßen Sie mit mir an auf unsere künftige Zusammenarbeit!«
Carl Zeiss hielt seinem Gast das gefüllte Glas entgegen.
Ernst Abbe begriff, dass für den Meister jetzt das Zuprosten gleichbedeutend mit einem Vertrag sein würde, »Produktion auf der Basis wissenschaftlichen Denkens, wenn Sie das im Sinn haben, Herr Meister ...« Ernst Abbe schaute auf das Hartnacksche Mikroskop. »Ein weites, kahles Feld, was den Mikroskopebau angeht, das ist wahr.«
»Wir verstehen uns!«
Ernst Abbe zögerte noch einen Moment, dann griff er nach dem Korn, trank dem Meister zu: »Also, auf gute Zusammenarbeit, Herr Prinzipal!«
»Und auf hohen Nutzen, Doktor«, ergänzte Carl Zeiss. »Nutzen für die Wissenschaft und fürs Geschäft!«
Sie leerten beide ihre Gläser.
Nebenan in der Werkstatt zeigte Löber indessen dem Lehrling Franz Steinhüter, wie mit vorsichtigen Zangenkniffen aus einem kleinen, quadratischen Glasstück der kreisrunde Rohling für eine optische Linse hergestellt wird. Der Alt-Gehilfe war dabei völlig verwandelt. Keine Spur vom Gehabe eines hartherzigen Zuchtmeisters. Keine Drohungen, keine Beschimpfung. Mit erstaunlicher Geduld lehrte er den Jungen die Zange führen, tadelte jeden Fehler ohne Zorn, lobte jeden gelungenen Handgriff.
»Nein, das wird zu viel, Franz!«, warnte er rechtzeitig. »Etwas drehen ...Ja, so ist es richtig ... So ist es sogar sehr gut, Junge!«
Löber klopfte dem Lehrling anerkennend auf die Schulter.
Franz Steinhüter betrachtete stolz den ersten eigenhändig hergestellten, verwendbaren Rohling. Seine Augen strahlten, als hielte er ein kostbares Geschenk in der Hand.
II. Kapitel
»Irgendeine Handlung mag für sich selbst betrachtet sehr gut sein, wenn jedoch die Beweggründe, aus denen sie hervorgeht, nicht solche reiner Liebe zum Guten sind, wenn sie vielleicht durch irgendeinen weltlichen Vorteil hervorgerufen sind, so verschwindet ihr Wert, und der die Handlung Ausführende hat kein größeres Verdienst als irgendein anderer, der nach seinen materiellen Interessen handelt ...«(Aus dem englischen Abituraufsatz des Realgymnasiasten Ernst Abbe im Februar 1857 in Eisenach)
Für die Lehrlinge des Universitätsmechanikus und Prinzipals Carl Zeiss brachten die Sonntage kaum Freude. In aller Herrgottsfrühe hieß es noch vor der Frühstückssemmel: Fußböden und Treppen im ganzen Haus scheuern, sämtliche Fenster putzen, Kartoffeln schälen oder bei anderen Küchenarbeiten helfen. Im sauberen Hemd und ordentlich gekämmt ging es dann zur Kirche. Anschließend gab der Meister Unterricht im linearen Zeichnen, Katoptrik oder Dioptrik, womit die Jungen dann auch noch am Nachmittag beschäftigt blieben.
Auch Carl Zeiss verbrachte in aller Heimlichkeit immer häufiger die sonntäglichen Nachmittagsstunden in der Werkstatt. Die Ursache für seinen Eifer lag keineswegs allein in dem mit den Jahren unerträglicher werdenden, zänkischen Wesen seiner Gattin. Ihn trieben vor allem Bedenken. Er traf sich zu ungestörten Gedankenaustauschen mit dem jungen Doktor, der als 1. Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zeissschen Unternehmens nun schon seit knapp einem Jahr mit neuen, zuweilen befremdlich scheinenden Ideen verändernd in die jahrzehntealten Abläufe des Optikerhandwerks eingriff.
An diesem Nachmittag wollte Carl Zeiss mit dem jungen Privatdozenten über dessen neu entwickeltes Fokometer sprechen und Fragen einer möglichst kostengünstigen Herstellung dieses wichtigen Messgerätes für Brennweiten von Linsen und optischen Systemen beraten, doch der Doktor gab dem Gespräch wieder einmal eine völlig unerwartete Richtung.
»Meiner Meinung nach müssen wir zuerst einmal alle Fehlerquellen in der Fertigung ausschalten, und dies nicht nur, was unser Fokometer angeht, sondern generell«, sagte er. »Generell und umfassend!« Seine Hand schrieb einen Bogen über die Arbeitsplätze der Werkstatt, in der nun werktags schon einundzwanzig Gehilfen und einige Lehrlinge Mikroskope in verschiedenen Ausführungen herstellten.
»Leicht dahingesprochen.« Doch die hörbare Skepsis des Prinzipals konnte den Eifer des Doktors nicht bremsen.
»Die Lösung liegt in einem höheren Spezialisierungsgrad der Arbeit, Herr Meister. Ich stelle mir das so vor: Jeder Gehilfe übernimmt künftig an seinem Platz nur noch die Fertigung eines bestimmten Geräteteils, konzentriert darauf seine sämtlichen Fähigkeiten, und das bis zur höchsten Meisterschaft!«
Carl Zeiss wiegte den Kopf.
»Tchja, aber eben nur auf einem sehr schmalen Gebiet. Auf diese Weise könnte einer zwar beispielsweise im Linsenschleifen Hervorragendes leisten, aber das Fräsen, Drehen, Feilen - alle anderen Erfahrungen und Talente müssten unterdessen verkümmern.«
»Das mag sein.« Abbe trat einen Schritt auf den Meister zu. »Doch ich sehe keinen anderen Weg, der höchste Präzision vom Handwerklichen her möglich macht. Außerdem brauchen wir dazu natürlich auch Messgeräte, die uns selbst den winzigsten Fehler an einem Teil noch signalisieren.«
Es blieb eine Weile still zwischen den beiden Männern. Carl Zeiss rieb seinen Bart. Er schaute scheinbar abwesend über die Werktische. Ernst Abbe wartete.
»Bei unserer Zusammenarbeit dachte ich ja eigentlich eher an Ihre Rechenkünste, mal ganz offen gesprochen«, sagte der Meister endlich. »Was Sie vorbringen, mag ja alles sehr klug und richtig sein ...« Er schwieg und machte eine Geste des Zweifels.
»Wenn ich an die Zukunft denke, Herr Zeiss, dann meine ich, dass wir in neue Gebiete der Optik nur mit solchen Erzeugnissen eintreten sollten, die entweder überhaupt noch nicht oder mindestens nicht in gleicher ausgezeichneter Art und Qualität hergestellt werden.« Ernst Abbe merkte, wie es ihm langsam gelang, die Bedenken des Prinzipals zu zerstreuen. »Das Fokometer ist nur ein winziger Anfang. Doch immer zuerst die Steine und dann das Haus! In den bekannten Größen für unsere Rechnungen dürfen sich selbstverständlich von Anfang an keine Versehen verstecken. Ich meine solche Patzer, wie sie hier gegenwärtig noch an jedem Werktag begangen werden!« Wieder schrieb seine Hand den Bogen.
Carl Zeiss seufzte und nickte und massierte seinen Nacken.
»Spezialisierung ... Wie soll ich so was nur meinem guten alten August Löber beibringen!«, murmelte er. Seine Entscheidung war damit bereits gefallen.
Nachdem die beiden Männer im Arbeitsraum des Prinzipals noch eine Weile über die nun fälligen, ersten Schritte auf dem Weg zu den vorgeschlagenen, grundlegend geänderten Fertigungsmethoden in der Zeisswerkstatt gesprochen hatten, wurde der Doktor von Carl Zeiss bis zur Haustür geleitet. Dort gab der Meister die Hand des Wissenschaftlers beim Abschied nicht gleich frei. Er lud ihn zum Abendessen ein und lockte mit frischer Sülze, Bratkartoffeln und Bier.
»Sehr freundlich, Herr Meister, aber ich habe schon einer Einladung zugesagt.« Ernst Abbe lächelte. »Eine Herzenssache, wenn man fragen darf?« Carl Zeiss blinzelte über seine Brillengläser. Eine festere Bindung des Mitarbeiters an Jena wäre ihm nicht ungelegen gewesen. In seinen Augen waren Junggesellen wie Schiffe ohne Anker.