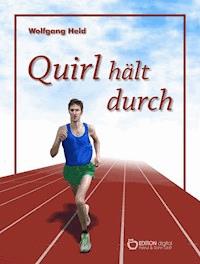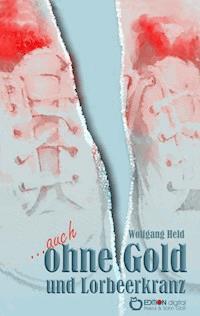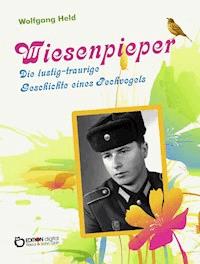7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer Sommernacht wird Hilde Reichelt, Mitbesitzerin der zwielichtigen Weimarer »Distel-Bar«, in ihrer Küche brutal ermordet. Der Mörder sticht wie besessen auf die Frau ein. Gehen die Männer der K um Hauptmann Seibt anfangs von einer Beziehungstat aus, müssen sie schnell erkennen, dass sie es mit einem Psychopathen zu tun haben. Und schlimmer noch: Der zu Brutalität und Grausamkeit neigende Täter könnte jederzeit wieder zuschlagen! Der Kriminalroman von Wolfgang Held beruht auf einem wahren Kriminalfall aus dem Jahr 1964. Der Viehpfleger Lothar W., 25 Jahre alt, schnitt einer 53-jährigen Küchenhilfe, die ihn bei einem Einbruch in der Weimarer »Distel-Bar« überraschte, mit einem Hirschfänger die Kehle durch. Der Roman erschien 1968 unter dem Titel »Der letzte Gast« und wurde 2011 vom Verlag Kirchschlager unter dem Titel "Mord in der Distel-Bar" neu aufgelegt. LESEPROBE: »Genug!«, sagte Hendrich so laut, als wäre Runge zehn Meter entfernt. Sein Blick ließ den erschrockenen zusammenzuckenden Mann nicht mehr los. »In der vergangenen Nacht zwischen zwölf und zwei wurde eine Frau getötet. Sie haben zugegeben am Tatort gewesen zu sein. Wir fanden dort Ihre Fingerabdrücke. Sie sind geflohen und versuchten, unseren Streifen zu entgehen. Sie hatten Angst, dass man Sie beim Einkaufen von Lebensmitteln erkennt, und haben die Mädchen vorgeschickt, die Ihnen aber hinter die Schliche kamen. Was auf dem Feldweg geschehen ist, werden wir bald wissen. - Sie sind in der >Distel-Bar< gesehen worden, Runge. Schon im Frühjahr!« »Das ist eine Lüge!« Runge war kreidebleich geworden. Furcht verzerrte sein Gesicht. »Ich habe nichts damit zu tun, hören Sie, nichts! Ich hätte mich doch nie freiwillig gemeldet, wenn ich ... Ich kann kein Tier töten, ich ... Glauben Sie mir doch!« »Neunzehnhundertvierundfünfzig zwei Jahre und drei Monate wegen Betruges, Heiratsschwindels und Körperverletzung, Sie Unschuldslamm. Körperverletzung! Und heute Nachmittag die Mädchen! Und in der vergangenen Nacht eine Frau namens Hedwig Rost. - Legen Sie doch endlich ein Geständnis ab, Mann!« Runge holte tief Luft, dann sackte er in sich zusammen, und seine Stimme war wie ein flackerndes Talglicht. »Ja«, sagte er leise. »Ja, ich habe Sie belogen. Als der Streifenwagen kam, war ich noch in den Schrebergärten. Ich dachte, dass Sie hinter mir her sind, weil ich ein paar Dumme geneppt habe.« Er stockte einige Atemzüge lang,
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Mord in der Distel-Bar. Der letzte Gast
Kriminalroman
ISBN 978-3-86394-960-0 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien unter dem Titel "Der letzte Gast" 1968 beim Verlag Das Neue Berlin. Dem E-Book liegt die unter dem Titel "Mord in der Distel-Bar" 2011 beim Verlag Kirchschlager, Arnstadt, erschienene Fassung zugrunde.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
I. Kapitel
»Hagenthal!«, sagte der Mann, vor dem sich die Wohnungstür öffnete. Er neigte leicht den Kopf, und sein Blick bat um Nachsicht. »Vom Städtischen Bestattungsinstitut, Frau Baumer ... Sie sind doch Frau Baumer?«
Die Frau in der Tür nickte. Sie musterte den Fremden neugierig. Er mochte Ende Vierzig sein und sah eigentlich nicht aus wie jemand, der seine Tage im Büro verbringt. Andererseits verliehen ihm der gut sitzende dunkelgraue Anzug und die schwarze Krawatte auf weißem Hemd jene dezente Würde, die man ganz allgemein bei einem Angestellten des Beerdigungsinstituts voraussetzt. Was mag er wollen, überlegte die Frau.
»Bitte erlauben Sie, Frau Baumer, dass ich Ihnen ganz persönlich mein Beileid zu dem schmerzlichen Verlust ausspreche, der Sie und Ihre Familie getroffen hat.« Er nickte mitfühlend.
»Danke«, sagte die Frau und war gerührt. Sicherlich macht er das überall so, dachte sie, aber es hört sich doch nett an und ganz aufrichtig. »Aber bitte, treten Sie doch ein!«
Auf dem Rauchtisch am Wohnzimmerfenster stand ein Nähkasten, daneben lag ein Berg gewaschener Männersocken. Aus dem Radio klang leise Tanzmusik. Eilig und mit einem Hauch von Verlegenheitsröte im Gesicht, schaltete Frau Baumer den Apparat aus, bevor sie ihrem Besucher Platz anbot. »Kannten Sie meine Schwiegermutter?«
Der Mann schüttelte den Kopf. Steif und sehr gerade saß er auf der Stuhlkante, die schmale Ledermappe an den Leib gepresst. Unauffällig taxierten seine Augen die ein wenig altmodische Einrichtung des Zimmers. »Ich habe keine angenehme Aufgabe«, meinte er dann bekümmert. Es handele sich um Geld. Er las die Summe von einem Quittungsblock ab, den er aus seiner Mappe zum Vorschein brachte. »Einhundertsiebenundneunzig Mark und fünfundvierzig Pfennig.« Ihm entging nicht, wie Frau Baumer betroffen an ihrer Unterlippe zu nagen begann. In seine Stimme schlich ein vorwurfsvoller Unterton. »Es war eine ergreifende Feier, Frau Baumer. Gewiss hat jeder, der dabei war, den tiefen Abschiedsschmerz Ihrer Familie mitempfunden. Sie müssen die Verstorbene sehr geliebt haben, glaube ich.«
»Natürlich«, sagte Frau Baumer, doch ihre Gedanken blieben weiter bei der Rechnung. Fast 200 Mark! Wieso sollen wir das überhaupt allein aufbringen? Schließlich hatte sie nicht nur den einen Sohn, und wir haben uns immerhin die letzten elf Jahre anständig um sie gekümmert ... Also die Hälfte muss sein Bruder beisteuern, das verlange ich von Hans!
»Wenn es Ihnen nicht allzu große Umstände macht, möchte ich den Betrag gern sofort kassieren ... Das geht doch?«
Der Mann setzte, ohne die Antwort abzuwarten, seine Unterschrift auf die Quittung, riss das Blatt vom Block und hielt es der Frau entgegen. Frau Baumer schaute unschlüssig auf die Zahlen, bat dann um einen Augenblick Geduld und verließ das Zimmer. Während sie bei der Nachbarin die fehlenden 75 Mark auslieh, saß der Mann vom Bestattungsinstitut wie festgewachsen auf seinem Stuhl.
Es war kurz nach sechzehn Uhr, als der Mann mit der schmalen Ledermappe das Haus in der Kiebitzstraße verließ und gemessenen Schrittes die Richtung zum Zentrum von Weimar einschlug. Da die Baumers an der Peripherie wohnten, war nichts Ungewöhnliches dabei, dass der Mann, den günstigen Zufall nutzend, einem stadteinwärts fahrenden Taxi winkte. Schon etwas merkwürdiger war das Ziel, das er dem Fahrer nannte: »Zum Hauptbahnhof!«
Die Lokalseite der Zeitung dieses Tages enthielt vier schwarz umrandete Danksagungsanzeigen, alle gezeichnet mit Namen und Anschrift der trauernden Hinterbliebenen. Bei drei dieser Familien hatte der Mann mit der Mappe kassiert, insgesamt 522 Mark und ein paar Pfennige. Es wäre normal gewesen, wenn er dieses Geld noch vor Dienstschluss bei der Kasse des Beerdigungsunternehmens abgerechnet hätte. Doch nichts dergleichen geschah. Vielmehr bezahlte er auf dem Bahnhofsvorplatz den Fahrer mit einem Zehnmarkschein aus der Haushaltskasse der Frau Baumer und verzichtete großzügig auf das Wechselgeld.
Ohne Hast ging der Mann, der sich Hagenthal nannte, durch die um diese Stunde recht belebte Bahnhofshalle bis zu der langen Wand, in der die Schließfächer eingebaut waren. Er öffnete das Fach Nummer 27, in dem ein brauner Reisekoffer stand. Der Mann nahm ihn heraus und verschwand damit in den Waschräumen. Es dauerte fast eine Viertelstunde, ehe er wieder erschien.
Allerdings wäre nur einem scharfäugigen Beobachter aufgefallen, dass es derselbe Mann war, der vor einer knappen Stunde im Wohnzimmer der Familie Baumer gesessen hatte. Der dunkelgraue Anzug, das weiße Hemd und die schwarze Krawatte befanden sich, sorgfältig zusammengelegt, im Koffer. Sogar die Halbschuhe hatte er gegen ein Paar feste Arbeitsstiefel ausgetauscht. Er trug jetzt eine abgenutzte Cordhose, ein schon recht verwaschenes, kariertes Oberhemd und eine verblichene Windjacke. Nichts war mehr von der Würde eines Bestattungsangestellten zu merken. In der Bahnhofshalle stand schlicht und unauffällig ein Mann, der von schwerer Tagesarbeit im Freien nach Hause kam.
Am Gepäckschalter zog ein griesgrämig dreinschauender Eisenbahner den Koffer über die Rampe. »Nach Neubrandenburg? Aber heute kommste da nicht mehr hier fort, Kollege.«
»Weiß ich«, erwiderte der Mann und nahm den Gepäckschein. Vor dem Bahnhof stieg er in den ersten Obus, der an der Haltestelle ankam, und blieb sitzen bis zum Wendepunkt am Westende der Stadt. Gemächlich bummelte er durch ein paar Straßen, bis er eine kleine Bierkneipe fand. Gegen achtzehn Uhr aß er ein Schnitzel, eine Stunde später bestellte er das fünfte Glas Bier, und kurz vor halb acht saß er als willkommener vierter Mann in einer Skatrunde. Den drei Mitspielern stellte er sich als »Ludwig« vor. Sie fragten nicht, ob das sein Vor- oder Familienname war. Eine Runde Korn und seine Fähigkeit, ein Schellenspiel ohne Dreien zu gewinnen, genügten ihnen als Beweis seiner Vertrauenswürdigkeit.
Nachdem der Wirt gegen Mitternacht die stuhlfesten Skater mit Nachdruck auf die Polizeistunde hingewiesen hatte, brachen die vier Männer gemeinsam auf. Der seltsame Bestattungsangestellte begleitete die drei noch bis zur nächsten Straßenkreuzung, wo er sich verabschiedete. »Ich wohne hier gleich um die Ecke. Mein Bruder wird ganz schön grunzen, weil ich so spät aufkreuze!«
Der Mann bog zwar um die Ecke, aber er betrat keines der Häuser dieser Straße. Die Hände in den Taschen, schlenderte er durch die warme Juninacht immer weiter stadtauswärts. Die Hausreihen brachen auseinander, zerstückelten in vereinzelte Wohngrundstücke, dann schnitten Bahngleise eine Grenze zwischen die Stadt und ihre Kleingärten.
Umringt von Stille und den schwarzen Konturen der Zäune, Obstbäume und Laubendächer, blieb der Mann stehen. Er sah den klaren Sternenhimmel über sich und wusste, dass es gegen Morgen kühl werden würde. Eine Weile stand er lauschend, dann ging er langsam auf dem Hauptweg der Kleingartenanlage weiter. Seine Haltung war jetzt nicht mehr die gleiche wie bisher. Er hatte die Hände aus den Taschen genommen und hielt den Kopf ein wenig vorgestreckt - wie in Erwartung einer unbekannten, irgendwo im Dunkel lauernden Gefahr. Noch zwei-, dreimal verharrte er, ehe er kurz entschlossen dicht an einen der Zäune herantrat.
Die Latten knirschten leise, als er sich daran emporzog, dann raschelten auf der anderen Seite die Zweige unter der Wucht seines Aufpralls. Wieder lauschte er, doch an sein Ohr drang nur das Geräusch seines eigenen, von der Anstrengung aufgepeitschten Atems. Vorsichtig tastete er sich aus dem Strauchwerk. Er schlug einen Bogen und gelangte zur Rückseite einer massiven Wohnlaube. Lautlos schlich er an der gekalkten Wand entlang bis zu einem der beiden Fenster. Es war halb geöffnet. Behutsam drückte er es ganz auf. Kein Geräusch. Nicht der Schimmer eines Lichtes. Er schwang sich auf das Sims, dann nahm ihn die Dunkelheit des Zimmers auf.
II. Kapitel
Das hysterische Warngebimmel und die schrillen Pfiffe der nahenden Lokomotive erreichten Fritz Lehnert dort, wo ihm noch Zeit geblieben wäre, mit eiligen Schritten das die Straße kreuzende Gleis zu überqueren. Aber er blieb stehen, sah dem Zug entgegen und kniff vor dem harten Dröhnen der Eisenräder die Augen zusammen. Unwillkürlich zählte er die an ihm vorüberpolternden Güterwaggons mit: eins, zwei, drei ...
Fritz Lehnert war seit einunddreißig Jahren Berufskraftfahrer. Die Summe der von ihm am Lenkrad eines Lkws bewältigten Kilometer konnte durchaus neben den Entfernungen bestehen, die die ersten Kosmonauten zurückgelegt hatten. Heute hatte er seinen ersten freien Tag, aber er war dennoch zeitiger aufgestanden als sonst, obwohl es am Vorabend recht spät geworden war. Schuld daran hatten ein Fernsehkrimi und der »Nachhole-Bedarf«, wie Fritz Lehnert das Bier nannte, das er an den Arbeitstagen mied wie ein Nichtschwimmer tiefes Wasser. Gestern waren es elf halbe Liter gewesen.
Sieben, acht, neun, zählte Fritz Lehnert. Der Zug fuhr nicht sehr schnell. Durch die vorbeiziehenden Lücken über den Puffern blitzte immer wieder das gebogene weiße, von der Frühsonne angestrahlte Eingangsschild der Kleingartenanlage »Rosenhafen« zu ihm herüber. Dort lag sein Ziel, eine der drei unverrückbaren Säulen seines Daseins. Die beiden anderen waren seine Familie und sein Beruf, die dritte wartete drüben hinter dem Schild: sein Garten!
Dreizehn, vierzehn - Blödsinn! Fritz Lehnert gab es auf.
Die Zählerei kam ihm plötzlich lächerlich vor. Er wurde ungeduldig. Der blassblaue Himmel verhieß einen heißen Junitag. Die Beete brauchten Wasser, ehe die Sonne stach. Und der Zug wollte nicht enden. Fritz Lehnert merkte, dass er ein Bier nötig hatte gegen den schalen Geschmack im Munde und den dumpfen Druck hinter seiner Stirn. Da, der letzte Waggon. Endlich!
Auf den Grasrändern des Hauptweges glitzerten Tauperlen. Vögel zwitscherten über den Sträuchern und in den Kirschbäumen. Fritz Lehnert schaute über den Zaun seines Gartens, aber er ging nicht hinein. Durst geht vor. Erst wollte er sich in der »Distel-Bar« ein paar Flaschen für den Vormittag holen.
Besitzer des massiven, eingeschossigen Hauses, das die Gartenfreunde »Distel-Bar« nannten, war das aus Berlin stammende Ehepaar Reichelt. 1946, als Anton Reichelt aus der Kriegsgefangenschaft heimgekommen war, hatte er seine Frau nach wochenlangem Suchen hier in Weimar wiedergefunden. Die Berliner Wohnung mit den mühsam zusammengesparten Möbeln, Hilde Reichelts volle Wäscheschränke und ihres Mannes ganzer Stolz, ein Blaupunkt-Super-Radio, das alles hatte eine amerikanische Zwanzigzentnerbombe in Sekundenbruchteilen zerfetzt.
Anton Reichelt fand sich keine Stunde ab mit der kümmerlichen Dachkammer, in der seine Frau auf ihn gewartet hatte. Er bekam Arbeit in einem Sägewerk, mietete im »Rosenhafen« einen Garten und baute aus Trümmersteinen, Schwarzmarkt-Zement und Buchenbalken, die er im Betrieb »mitgehen« ließ, eine neue Bleibe. Zwei Zimmer und Wohnküche. Im Herbst 1947 zogen sie ein. Nun gehörte jede freie Stunde dem Gemüse-, Kartoffel- und Tabakanbau.
Bald warf diese Arbeit noch einen ansehnlichen Nebenverdienst ab und schürte Unternehmergedanken. Die Frau räumte das Stubenbüfett in die Küche und stellte dafür einen zweiten Tisch samt Stühlen in eines der beiden Zimmer. Ihr Mann schaffte ein paar Kasten Bier und Brause heran - das Geschäft blühte auf. Als Frau Reichelt später noch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen anbot, blieb es nicht bei Gästen aus der Gartenanlage. Allmählich wurde diese unscheinbare, abseits der Stadt gelegene Lokalität zum Treffpunkt für Leute, die wenig Wert darauf legten, mit ihrer jeweiligen Begleitung gesehen zu werden.
Der besondere Vorzug für einige eingeweihte Nachtbummler lag darin, dass es die Reichelts mit der Polizeistunde nie so genau nahmen. Außerdem schrieben sie guten Kunden die Zeche bereitwillig bis zum nächsten Lohntag an und kassierten statt Bargeld auch mal eine Armbanduhr, einen goldenen Ring oder irgendeinen anderen Wertgegentand.
Wer auf den Namen »Distel-Bar« gekommen war, hätte niemand sagen können, jedenfalls wusste in den Bierkneipen und Friseurgeschäften der Stadt bald jeder, was damit gemeint war, und kannte den Weg. Es blieb nicht aus, dass die Gepflogenheiten der geschäftstüchtigen Reichelts manchen üblen Kunden anzogen. Die Kleingärtner beobachteten das mit zwiespältigen Gefühlen. Ganz ohne Zweifel brachte die »Distel-Bar« den guten Ruf des »Rosenhafens« in Misskredit.
Wenn der Vorstand dennoch nichts gegen die zwielichtigen Geschäfte unternahm, so war der Grund dafür allein Bequemlichkeit. Ohne »Distel-Bar« kein Flaschenbierverkauf in der Anlage, keine gemütliche Kaffeepause auf Reichelts Veranda und wegen jeder Schachtel Zigaretten ein langer Marsch bis in die Stadt. Es fand sich keiner, der die Arbeit der Reichelts übernehmen wollte, und so blieb eben alles, wie es war.
Fritz Lehnert wunderte sich nicht über die unverschlossene Gartentür. In der »Distel-Bar« gab es keine Öffnungszeiten. Durch ein Rosenspalier ging er auf das Häuschen zu. Unter seinen Sohlen knirschte der geharkte Kies. Er kam zum Eingang und fand es auch jetzt noch nicht verwunderlich, dass die Tür nur angelehnt war. Sie knarrte leise, als er sie aufschob.
Lehnert blieb auf der Schwelle stehen.
»Hallo, Wirtschaft!«, rief er. Ein paar Sekunden war es still, dann polterte es wie von einem umgeworfenen Stuhl. »Darf ich 'reinkommen? Lehnert Fritz!«
Keine Antwort. Kein Laut.
Unschlüssig rieb Fritz Lehnert seinen Nasenrücken, schaute dann auf die Uhr. Kurz vor fünf. Wäre das Gepolter nicht gewesen, hätte er angenommen, dass es für die Reichelts wieder einmal spät geworden war und sie noch schliefen. «Hallo, ist denn keiner da oder was?« Wieder nichts. Einen Augenblick schwankte er, ob er umkehren oder eintreten sollte, dann siegte seine Neugier.
III. Kapitel
In dem als Gästezimmer dienenden Raum waren die Stühle mit den Beinen nach oben auf die Tische gestellt. Auf dem Ausschank standen ein paar ungewaschene Gläser. In der Ecke glänzten volle Flaschen in aufgestapelten Kästen. Über allem hing der unangenehme Geruch von kaltem Tabakrauch und Asche. Fritz Lehnert sah die fingerbreit geöffnete Küchentür, trat aber zur anderen Seite und klopfte dort an, wo er das Schlafzimmer der Reichelts wusste. Entweder die pennen wie die Murmeltiere, oder sie sind gar nicht da, dachte er. Aber warum haben sie alles offen stehen lassen, wenn sie weggegangen sind? Komisch, sehr komisch.
Behutsam drückte er die Klinke herab. Er spähte durch den Türspalt und verlor seine Zurückhaltung. Im Schlafzimmer war niemand. Er sah die benutzten, nebeneinanderstehenden Ehebetten, einen umgeworfenen Stuhl vor dem Toilettentisch und ein weit geöffnetes Fenster. Der Teufel soll mich frikassieren, wenn hier alles in Ordnung ist, ging es ihm durch den Kopf. Plötzlich beschlich ihn das Gefühl, mit einem Wagen bergab zu fahren und feststellen zu müssen, dass die Bremsen nicht funktionierten.
»Hört denn niemand, verdammt noch mal?« Seine erregte Stimme kam ihm unnatürlich laut vor. Weg, dachte er. Auf schnellstem Wege! Was geht es mich eigentlich an, wenn die Reichelts ihre Bude zum Ausräumen anbieten. So was kann einem nur Scherereien bringen, nichts weiter!
Fritz Lehnert war schon am Ausgang, als sein Blick erneut auf die Küchentür fiel. Mit einem Male kam er sich feige und eigensüchtig vor. Er schämte sich ein bisschen für sein Verhalten. Schließlich waren die Reichelts nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht hatte der Anton Nachtschicht, oder er war ganz zeitig zum Betrieb gegangen. Holzabladen oder so was. Seine Frau lag jetzt möglicherweise hilflos in der Küche. Schlaganfall zum Beispiel, oder kann das etwa nicht vorkommen? Alle Tage ...!
Drei schnelle Schritte brachten Fritz Lehnert zur Küchentür. Er stieß sie auf und zuckte in der nächsten Sekunde entsetzt zurück. Ein paar Atemzüge lang stand er mit schreckgeweiteten Augen und starrte das grässliche Bild an, das sich ihm bot.
Kreidige Blässe kroch in sein Gesicht. Bilder, längst von den Jahren überwuchert, flackerten in ihm auf, Bilder aus der Kriegszeit. Langsam, wie unter einem Bann stehend, wich er zum Ausgang. Hätte ihn jemand in dieser Minute aus dem Häuschen der Reichelts kommen sehen, wäre er gewiss für einen Betrunkenen gehalten worden. Er kam bis zum Zaun, wo er seine kalte Stirn gegen das Holz stemmte und würgend erbrach.
IV. Kapitel
Im Zwanzigkilometertempo rollte ein dunkelgrüner Wartburg durch die Allee, die den Stadtpark von der gegenüberliegenden Häuserzeile abgrenzte. Die drei Männer im Wagen trugen Volkspolizeiuniformen. Ein Leutnant und zwei Oberwachtmeister. Ihre abgespannten Gesichter verrieten, dass sie einen langen Nachtdienst hinter sich hatten.
»So ist das jedes Mal«, brummte der Mann hinter dem Lenkrad und machte eine Kopfbewegung hinaus zu den Parkwiesen, deren sattes Grün von der Morgensonne mit Licht und Wärme übergossen wurde. »Vormittags Badewetter wie aus dem Bilderbuch, und wenn du dich dann ausgepennt hast, kommt ein Gewitterregen.«
»Heute bestimmt nicht«, meinte der Leutnant und lächelte müde. »Klar, doch«, widersprach der Oberwachtmeister, der hinter dem Fahrer saß. »Sie haben's auch im Wetterbericht gesagt.«
»Heute nicht«, beharrte der Leutnant. »Ihr werdet sehen, am Nachmittag scheint die Sonne ... Wir haben sechzehn Uhr Parteiversammlung!«
»Dann allerdings«, sagte der Fahrer. Das Gespräch schlief wieder ein. Noch fünfunddreißig Minuten, dann haben wir es für heute hinter uns, dachte jeder der drei Polizisten. Es war für sie eine Nacht ohne besondere Vorkommnisse gewesen. Sie hatten kurz vor Mitternacht ein paar Jugendliche zur Vernunft gebracht, die ausgerechnet auf dem Heimweg vom Tanzboden ihre Begeisterung für Volkslieder und Chorgesang entdeckten.
Dann musste ein Betrunkener mit einigem Nachdruck in die Ausnüchterungszelle des Kreisamtes gebracht werden, und auch der fünfjährige Junge war bald gefunden worden, der sich im Nachthemd und mit einem Dackel an der Leine heimlich auf eine nächtliche Wanderung zu seiner in Schweden lebenden Oma begeben hatte. - Alles in allem eine normale Nacht.
»Achtung, FSW!«, meldete sich plötzlich eine Stimme aus dem Lautsprecher. »Fahren Sie sofort zur Kleingartenanlage >Rosenhafen<. Leichenfund in der >Distel-Bar<! Sichern Sie Tatort gegen Spurenverwischung bis zum Eintreffen der Einsatzgruppe!«
»Verstanden!«, bestätigte der Leutnant. Der Sprecher in der Funkzentrale hatte seine Durchsage noch nicht beendet, da begann die Tachonadel bereits auf die Fünfzig zu klettern. Mit blinkendem Blaulicht und Polizeisignal kreuzte der Wagen in schneller Fahrt die Stadtmitte. Achtundzwanzig Minuten nach fünf. Für Sekunden geriet der gerade erwachende Verkehr ins Stocken. Fahrzeuge bremsten scharf, fuhren an die Bordsteinkante und gaben die Fahrbahn frei. Passanten mit schläfrigen Mienen schreckten auf und drehten verdutzt die Köpfe.
Aus den Gesichtern der drei Polizisten im Funkstreifenwagen war die Müdigkeit wie weggeblasen. Leichenfund? Ein Mord? Seit Jahren hat es so etwas hier in Weimar nicht gegeben.
»Schneller!«, befahl der Leutnant.
»Dort winkt einer!«, sagte der Fahrer.
Nahe dem Bahnübergang stand ein Mann mitten auf der Straße und schwenkte beide Arme. Der Fahrer trat auf das Bremspedal. Der Mann kam eilig heran.
Es war Fritz Lehnert. »Ich habe angerufen!«, sagte er.
Der Leutnant gab ihm einen Wink, und er stieg ein. »Das war kein Mensch! Ein wildes Tier war das, ein wildes Tier ... Und vor ein paar Tagen habe ich noch mit ihr gesprochen.« Sein Atem ging kurz, wie nach einer großen Anstrengung.
»Sie kennen die Tote?«, fragte der Leutnant. Der Wagen bog in den Hauptweg der Gartenanlage ein.
»Fast zwanzig Jahre. Wir kennen uns alle hier ... Dort an der offenen Tür ist es.« Fritz Lehnert verließ mit den drei Polizisten den Wagen. Er folgte ihnen bis zum Häuschen der Reichelts. »Wenn es nicht unbedingt sein muss ... Ich warte hier, ja?«
An der Schwelle der Küche verstanden die drei Männer den Mann, der diesen Anblick nicht ein zweites Mal erleben wollte. Auf dem Fußboden lag, inmitten einer großen Lache geronnenen Blutes, eine Frau. Über dem langen Nachthemd trug sie einen grünweißen, schon stark verblichenen Bademantel. Sie hatte kein Gesicht mehr. Auch Hals und Oberkörper waren, offenbar mit einem Messer, fürchterlich zugerichtet. Es gab nicht den geringsten Zweifel, dass die Frau tot war.
»Der Mann draußen hat nicht übertrieben«, murmelte der Leutnant. Sein Gesicht war jetzt hart und bleich. Er hielt den Oberwachtmeister zurück, der näher treten wollte.
»Nein! Sehen Sie sich hinter dem Haus um, aber so, dass wir nachher keinen Ärger mit den K-Leuten bekommen.«
»Raubmord, schätze ich«, sagte der andere Polizist. Auch er sprach unwillkürlich leise. Sein Blick zeigte zum Küchenbüfett. Dort stand eine Geldkassette. Ihr Deckel war mit großer Gewalt an einer Ecke hochgebogen worden. Man konnte die breiten Kratzer erkennen, die das Werkzeug auf der karminrot gestrichenen Innenseite hinterlassen hatte.
»Abwarten!«, sagte der Leutnant.
Wenig später tauchten an der Einfahrt zur Garenanlage zwei dunkle Wartburg-Limousinen auf: die Kriminalisten der Einsatzgruppe!
V. Kapitel
Der ohrenbetäubende Lärm einer reparaturbedürftigen Bohnermaschine füllte den langen Korridor des Volkspolizei-Kreisamtes. Morgensonne spiegelte sich im Linoleum. Bis zum Dienstbeginn waren es noch zwanzig Minuten, aber am Zimmer 208 hing die Schnur der Versiegelung schon lose an der Knetmasse.
Während Hauptmann Jochen Seibt, Leiter der Einsatzgruppe, in seinem Dienstraum mit zwei Polizisten eine erste Bilanz des neuen Falles zog, waren die Ermittlungen bereits in vollem Gange. Kriminaltechniker werteten im Labor wichtige Spuren aus, darunter eine ganze Anzahl von Fingerabdrücken. Zwei Polizisten hatten mit einem Polizeihund die Verfolgung einer Fährte aufgenommen, und Doktor John, der Gerichtsmediziner, arbeitete an dem genauen Untersuchungsbefund.
»Fassen wir zusammen«, sagte Hauptmann Seibt und drückte den Rest seiner Zigarette in den Aschenbecher. Er war Ende Dreißig, mittelgroß und trug das grau melierte Haar sehr kurz. Seine Frau hänselte ihn immer, dass er mit diesem sportlichen Haarschnitt nur seine bereits weiß gewordenen Schläfen verheimlichen wollte.
»Frau Hilde Reichelt, Mitbesitzerin der sogenannten >Distel-Bar<, wurde in der vergangenen Nacht vermutlich zwischen null Uhr dreißig und halb zwei in der Küche ihres Gartenhauses getötet. Zur Tat wurde wahrscheinlich der Hirschfänger benutzt, den Sie, Genosse Grabner, hinter dem Haus gefunden haben.
Von Doktor John wissen wir, dass der Täter mindestens ein Dutzend Mal zugestochen haben muss, wobei er Brustkorb und Gesicht der Frau stark verstümmelte. Außerdem hat er offenbar versucht, den Kopf seines Opfers vom Körper abzutrennen.«
Der Hauptmann hielt einen Augenblick inne. Er sah die beiden Polizisten an. Ihre Mienen verrieten Spannung und Ungeduld. Unterleutnant Grabner rauchte hastig eine Zigarette.
»Das sieht alles nach einem Geisteskranken aus«, meinte Leutnant Hendrich, der dritte Mann im Zimmer. Ein schwacher Duft von Kölnischwasser umgab ihn. Er trug einen tadellos sitzenden Anzug und zu dem cremefarbenen Hemd eine passende Krawatte, während die beiden anderen Polizisten die Kragen ihrer Sporthemden über die Sakkos geschlagen hatten. »Wir sollten sofort feststellen, ob irgendwo so ein Typ ausgebrochen ist.«
»Übernehmen Sie das mit.« Hauptmann Seibt nickte, aber er schien nicht viel von dieser Vermutung zu halten. »Noch wichtiger erscheint mir allerdings die Frage, wo eigentlich der Ehemann steckt.«
»Sie denken an die beiden benutzten Betten?«, meinte Unterleutnant Grabner, der die Schulter eines Gewichthebers besaß, zu seinem größten Leidwesen aber nur 1,64 Meter maß. »Furchendackel« wurde er von Witzbolden der Dienststelle heimlich genannt. In seiner Hörweite sagte das jedoch niemand. Grabner galt im Bezirk als der beste Judoka. Jetzt wiegte er zweifelnd der Kopf. Er rührte mit einem Strohhalm in seiner Milchflasche. »Der Mann kann das Haus vor der Tat verlassen haben. Bestimmt sogar. Außerdem ist da die ausgeraubte Geldkassette ...«
»... mit der ein ausgekochter Bursche offenbar gar nicht so erfolglos einen Raubmord vortäuschen kann, wie ich sehe.« Der spöttische Unterton in der Stimme Hendrichs war unüberhörbar. Grabner setzte zu einer Erwiderung an, doch der Hauptmann kam ihm zuvor.
»Was wir jetzt brauchen, sind nicht voreilige Schlussfolgerungen, sondern Fakten, hieb- und stichfeste Fakten«, sagte er und warf einen Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk. »In einer Viertelstunde ist Arbeitsbeginn im Sägewerk. Nehmen Sie dort die Suche nach Anton Reichelt auf, Genosse Grabner ... Moment!«
Hendrich hatte die Hand gehoben. Er wollte noch etwas sagen. Der Unterleutnant war bereits aufgestanden. Nun schickte er einen missbilligenden Blick zu dem Leutnant: Halt mich doch nicht auf, Mann!
»Nur ganz kurz!«, erklärte Hendrich. »Dieser Lehnert hat ein paar interessante Angaben gemacht. Das Protokoll wird gerade getippt. Er ist noch hier im Amt.«
»Na und?« Grabners Finger trommelten auf die Stuhllehne.
»Beim Betreten des Hauses will er ein Poltern gehört haben, wie von einem umgeworfenen Stuhl. Und im Schlafzimmer lag ein Stuhl am Boden!«
»Die Tatzeit war eine halbe bis anderthalb Stunde nach Mitternacht, Genosse!« Grabner betrachtete den Leutnant wie jemanden, der sich anschickt, eine meterdicke Eiche mit einer Laubsäge zu fällen. »Nicht mal ein total Verrückter legt sich nach so einer Tat ins Nebenzimmer und pennt. Außerdem waren keine Blutspuren an der Bettwäsche.«
Der Hauptmann, der unbewegt dem nervösen Fingerspiel Grabners zugesehen hatte, hob den Blick. Um seine Mundwinkel spielte ein kaum merkliches Lächeln. Die kleinen Reibereien zwischen den beiden hatten schon vor Monaten begonnen, nachdem Grabner von einem Kriminalistiklehrgang zurückgekommen war.
»Bringen Sie uns den Reichelt, dann klärt sich bestimmt manches auf ... Und lassen Sie uns nicht zu lange warten, Grabner!«
An der Tür nahm der Unterleutnant noch einmal Haltung an und verließ dann eilig das Zimmer. Seine Milchflasche blieb halb voll auf dem Tisch zurück. Hauptmann Seibt wandte sich wieder dem Leutnant zu.
»Klammern wir diese mysteriöse Stuhlsache erst einmal aus. Wusste Lehnert etwas über die Familienverhältnisse der Reichelts?«
»Wenig«, erwiderte Hendrich. »Man sagt in der Gartenanlage, dass die Frau, jedenfalls was die Geschäfte betraf, die Zügel ziemlich straff in der Hand hielt. Und prahlsüchtig ist sie gewesen. Lehnert hat selbst zweimal erlebt, wie sie den Inhalt der Kassette von ihren Gästen bestaunen ließ. Ein paar dicke Bündel Geldscheine und zwei oder drei Armbanduhren. Auch einige Schmuckstücke sollen dabei gewesen sein. Es lag ihr viel daran, als reiche Frau zu gelten, glaube ich.«
»Hm«, brummte Jochen Seibt. Er stand auf und ging zum Fenster. Unten an der Straßenecke standen drei junge Mädchen mit Schultaschen und Bademänteln. Sie unterhielten sich und lachten.
»Wir brauchen eine Liste der Leute, die in der >Distel-Bar< verkehrten. Schnell. Es werden ein paar Bekannte von uns darunter sein, wie ich den Laden einschätze. Deren Alibis überprüfen wir zuerst.«
»Auch die der Frauen?«, fragte Hendrich. »Ich halte es für ausgeschlossen, dass es eine Frau war.«
»Warum?«
»Na, diese ganze bestialische Art! Und der aufgebogene Kassettendeckel, da gehört eine Portion Kraft dazu.«
Der Hauptmann schwieg. Er steckte sich eine Zigarette an und blies nachdenklich eine Rauchwolke gegen die Fensterscheibe. Zu den drei Mädchen an der Straßenecke gesellten sich jetzt zwei etwa gleichaltrige Jungen, die ebenfalls Schultaschen trugen und wohl erwartet worden waren. Gemeinsam schlugen die fünf den Weg in Richtung Oberschule ein. Jochen Seibt kam zum Schreibtisch zurück.
»Trotzdem«, sagte er. »Überprüfen Sie auch die Frauen. Wir müssen herausfinden, wer sich gestern Abend in der >Distel-Bar< aufgehalten hat. Fangen Sie sofort damit an.«
Wenige Minuten, nachdem Leutnant Hendrich gegangen war, erhielt der Hauptmann von einer Kriminaltechnikerin in weißem Laborkittel eine Mappe mit den Tatortfotos. Ehe sie wieder ging, stand er auf, nahm vorsichtig mit zwei Fingern Grabners Milchflasche vom Tisch und hielt sie ihr wie eine hochexplosive Bombe hin.
»Ach bitte, nehmen Sie das doch mit hier 'raus, ja?«
Als Jochen Seibt wieder allein war, holte er eine Lupe aus der Schublade des Schreibtisches und betrachtete die Bilder genau.
Es dauerte geraume Zeit, bis er das Vergrößerungsglas sinken ließ und sich zurücklehnte. Seine Lippen waren schmal geworden. Sein Blick, ernst und grüblerisch, verlor sich vor den ockerfarbenen Zimmerwänden. Er musste an die jungen Leute denken, die vorhin an der Straßenecke gestanden hatten. Sie waren bedroht in dieser Stunde. Alle waren bedroht. Ein Mörder befand sich auf freiem Fuß, ein Mensch ohne Skrupel, bösartiger als ein wildes Tier. Niemand konnte wissen, ob er nicht in diesen Minuten schon nach einem neuen Opfer Ausschau hielt.
Der Mann, der in dieser Stunde zum unerbittlichen Jäger des » Distel-Bar«-Mörders wurde, hatte eigentlich nicht Polizist werden wollen. Die Träume seiner Jugend waren durchweht gewesen von den Stürmen am Kap Hoorn, vom Kreischen der Kräne im Hafen von Hongkong, von den Liedern der braunhäutigen Mädchen Waikikis. Dann aber kam der Hauer Martin Seibt aus der Kriegsgefangenschaft heim.
Geduldig hörte er sich die verwegenen Zukunftspläne seines Fünfzehnjährigen an, sah eine Weile versonnen zum Stubenfenster hinaus und bestimmte schließlich: Morgen nehme ich dich mit zu unserem Schacht! Und Jochen Seibt fuhr vier Jahre lang in die weißen Gebirge tief unter der Erde. Das Salz gerbte ihm den Flaum von der Haut, der Presslufthammer machte seine Hände hart, und jede Tonne Kali nahm ein kleines Stück von seinem Fernweh mit fort.