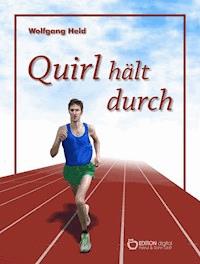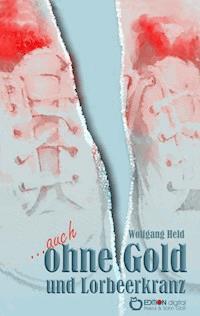6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Khai und Hua leben mit ihren Eltern in dem kleinen Dorf Gui im Süden Vietnams, mitten im Dschungel. Seit kurzer Zeit haben sie eine Schule und eine Lehrerin, die abends auch ihren Eltern das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringt. Die Lehrerin Nam weiß sogar noch mehr Geschichten als Onkel Quam. Doch da kommen amerikanische Flugzeuge und werfen Napalmbomben auf ihr Dorf. Hua und Khai können sich in einem Geheimgang verbergen und sind die einzigen Überlebenden des Dorfes. Beiden Kindern gelingt die Flucht in den Dschungel. Als sie einen hilflosen, schwerverletzten USA-Soldaten finden, bringen sie es nicht übers Herz, ihn allein zu lassen oder gar zu töten. Zum "Dank" werden sie gefangen genommen und gefoltert. Können sich die Kinder befreien? Spannend, kindgerecht und ergreifend schildert Wolfgang Held in dem Buch von 1969 den Vietnamkrieg aus der Sicht des vietnamesischen Volkes. Ein interessantes Buch, das angesichts der aktuellen Weltpolitik nicht nur die Kinder zum Nachdenken anregt. INHALT: DER ELEFANT HAM UND DAS UNBESIEGBARE GRAS FEUERVÖGEL ÜBER DEN HÜTTEN DER SPRUNG ÜBER DEN MÄCHTIGEN FLUSS SCHWARZE FRÜCHTE AUGE IN AUGE DIE BURG DER DONNERGÖTTER DIE NACHT DER SCHWARZGEKLEIDETEN DIE DREI SCHWERTER DES NGUYEN-HAN-CHUNG LESEPROBE: Khai schob Sprosse für Sprosse in die Löcher und kletterte aufwärts. Dicht unter dem Brunnenrand verharrte er und lauschte. Das erste, was ihm auffiel, war das Schweigen der Vögel. Er erinnerte sich nicht, jemals einen Tag erlebt zu haben, an dem die bunt gefiederten kleinen Sänger stumm geblieben waren. Dafür hörte er aus einiger Entfernung fremde, merkwürdige Geräusche. Es waren Stimmen in einer Sprache, die er nicht verstand, und eine für sein Ohr sehr seltsame, stotternde Musik. Neugierig spähte er über die Brunnenmauer. Der Anblick verschlug ihm den Atem. Die große Versammlungshütte war bis auf die Stützpfähle niedergebrannt. An manchen Stellen glomm das Holz noch, und aus den verkohlten Resten krochen hier und da dünne Qualmfäden. Einen Menschen entdeckte er nirgends. Auch die Feuervögel schwebten nicht mehr am Himmel. Vorsichtig stieg er aus dem Brunnenschacht und wandte sich in die Richtung, aus der die eigenartige Melodie kam. In jeder Sekunde zur Flucht bereit, pirschte er sich vorwärts, auch die geringste Deckung ausnutzend. Ein Dorf namens Gui gab es nicht mehr. Keine Hütten, keine Stallungen, keine Gärten mit Teesträuchern, mit Litschibäumen voller sauersüßer, saftiger und grüner Früchte, mit Bananenstauden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Feuervögel über Gui
ISBN 978-3-86394-945-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1969 beim Kinderbuchverlag Berlin.
.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.ddrautoren.de
DER ELEFANT HAM UND DAS UNBESIEGBARE GRAS
Das Mädchen und der Junge hatten die Reisfelder hinter sich gelassen. Sie waren nach Süden aufgebrochen, als der Tau noch silbern auf den Gräsern schimmerte und die Berge ihre Schatten bis hinab zu den Tümpeln schickten, in denen ein Heer von Fröschen quarrend und gurgelnd den neuen Tag begrüßte. Jetzt stand die Sonne schon gut zwei Fingerspannen hoch über den Bergbuckeln. „Schlafende Büffel", so hießen sie bei den Leuten des Dorfes Gui. Von dort kamen das Mädchen und der Junge.
Gui war ein sehr kleines Dorf. Nur knapp dreihundert Menschen wohnten in den auf Pfähle gebauten und mit Palmstroh gedeckten Hütten. Im Westen, Norden und Osten bildete der Dschungel eine grüne, undurchdringliche Mauer um die Ansiedlung und die Felder. Eine Straße hinaus ins Land gab es nicht. Die einzige Verbindung zu der viele Kilometer entfernten Distrikthauptstadt war ein beschwerlicher Pfad über die Schlafenden Büffel im Süden.
Das Mädchen Hua lief einige Schritte vor ihrem Bruder Khai. Sie hatte wie er die schwarze Kattunhose über den dünnen braunen Beinen bis zu den Knien hochgekrempelt und war barfüßig. Geschickt vermied sie die scharfkantigen Steine, die, geschliffenen Beilen gleich, aus dem rissigen Boden wuchsen. Ihr tiefschwarzes, bis auf die Schultern fallendes Haar glänzte matt in der Sonne. Wenn Hua einem dornigen Zweig auswich oder eine der vom Regenwasser in den Pfad gefressenen Rinnen übersprang, blieben ihre Bewegungen voll tänzerischer Anmut und Geschmeidigkeit. Das pralle Bündel, das sie trug, schien federleicht zu sein. Doch der Schein trog. Es wog mindestens fünf Kilo und war damit fast so schwer wie der geflochtene, randvolle Korb, den Khai auf dem Rücken schleppte.
Khais kastanienbraune Augen beobachteten hellwach die Umgebung. Ihm entging nichts. Er sah den braun-roten Falter, groß wie eine Männerhand, im taumelnden Flug über das dicht verfilzte Buschwerk segeln und entdeckte auch den rotschwänzigen Gecko, der blitzschnell zwischen Laub und Blüten verschwand. Doch nicht diese harmlosen Bewohner des wild wuchernden Dickichts waren es, die den Jungen vorsichtig und abwehrbereit machten. Er wusste, dass hier am Nordhang der Schlafenden Büffel noch nie ein Tiger gesehen worden war. Die Feinde, nach denen er Ausschau hielt, hatten Menschengesichter!
Die fünfzehnjährige Hua und ihr um ein Jahr jüngerer Bruder Khai erinnerten sich noch genau an die Zeit des großen Hungers. Zweimal im Jahr schnitten die Bauern aus Gui den reifen Reis: die „Ernte des fünften Monats" und die meist reichere „Ernte des zehnten Monats". Da sie, uralter Sitte folgend, nach Mondjahren rechneten und das Mondneujahr fast immer im Februar gefeiert wurde, war der fünfte Monat bei ihnen der Juni und der zehnte Monat der November. Ob nun aber die gebündelten, weißlich gelben Rispen der Reisernte an den Enden der biegsamen Traghölzer schwer oder leicht wogen, niemals blieben die Vorratslager der Bauern in Gui bis zur nächsten Ernte gefüllt. Reis allein genügt nicht zum Leben. Die Bauern brauchten Salz und Stoff für die Kleidung und Werkzeuge. All das besaßen nur die reichen Händler in der Distrikthauptstadt. Sie bestimmten, wie viel Reis die Dorfbewohner für eine neue Sichel oder ein Kilo des begehrten Salzes geben mussten. Wenn die Bauern nicht genug auf die Waagen der Händler legen konnten, wurde der fehlende Rest als Schuld angeschrieben. Lange Zahlenreihen wuchsen so in die Bücher der Händler, und etwas Seltsames geschah. Diese Zahlen wucherten auf den Buchseiten wie Unkraut im warmen Schlamm. Ganz Ähnliches passierte mit den Zahlen auf den Listen der Steuereintreiber. Bald waren die Schulden höher als die Ernte. Eines Tages kamen dann die Händler selbst über die Schlafenden Büffel nach Gui. Sie ließen sich in Sänften tragen und waren nicht allein. Soldaten der Regierung begleiteten sie und kräftige Männer, die Lasten schleppen konnten. Sie holten nicht nur den Reis aus den Hütten, sie nahmen den Familien auch die Büffel und die Schweine und das Federvieh. Zudem forderten sie, dass die Bauern ihre halbwüchsigen Töchter und Söhne zum Sklavendienst hergaben.
Hua und Khai hatten mit angesehen, wie es einem Mann ergangen war, der für die schwere Arbeit in den Reisfeldern nur einen Wasserbüffel besaß und ihn behalten wollte. Die Soldaten hatten diesen Mann und seine Frau an die Pfähle der Hütte gebunden und Feuer gelegt. Sie waren vor den Augen ihrer fünf Kinder und der übrigen Dorfbewohner lebendigen Leibes verbrannt. Die drohenden Mündungen von Maschinenpistolen hatten keine Hilfe zugelassen. Bis ans Ende ihres Lebens würden Hua und Khai den letzten Aufschrei des in den Flammen sterbenden Reisbauern im Gedächtnis behalten: Verflucht sollt ihr Teufel sein, bis die Berge zu Staub zerfallen und der Himmel einstürzt ... Verflucht und gejagt!
Seit drei Jahren war nun alles anders geworden in Gui. Begonnen hatte es an einem sehr heißen Maitag. Zwei fremde Männer und eine mädchenhaft junge Frau waren aus dem Dschungel ins Dorf gekommen. Sie trugen schwarze Hemdblusen und flatternde schwarze Hosen. Jeder von ihnen besaß ein Gewehr. Ihre Stimmen klangen freundlich, aber sie sprachen nicht die Mundart der Leute aus dem Dorf. Anfangs machte das die Bewohner misstrauisch. Konnte es nicht sein, dass diese Schwarzgekleideten von der Distriktverwaltung geschickt worden waren, von den Handlangern, die früher den französischen Kolonialisten gedient hatten und nun von den reichen Händlern und Großgrundbesitzern bezahlt wurden? Waren es Spitzel, die in Gui nach Reisverstecken suchten oder nach jungen, gesunden Männern für die Regierungstruppen? Niemand redete mit ihnen, niemand hörte ihnen zu. Trotzdem beobachteten viele dunkle Augenpaare unauffällig jeden ihrer Schritte.
Am Abend des ersten Tages bereiteten sich die drei Fremden ein Lager neben der Hütte des Dorfältesten. Ihre Mahlzeit bestand aus den fest zusammengepressten Reiskugeln, die sie in Stoff gewickelt an ihren Gürteln trugen. Es fiel auf, dass sie die Hühner der Dorfbewohner unangetastet ließen. Nie zuvor hatten fremde Bewaffnete das Eigentum der Leute von Gui so streng geachtet. Dennoch gingen die Erwachsenen am nächsten Morgen zur Arbeit auf die Felder, ohne den Schwarzgekleideten einen Funken Freundlichkeit zu schenken. Kein Gruß, kein Wort, kein Blick. Nur die Alten und die Kinder blieben bei den Hütten.
Hua und Khai, damals erst zwölf und elf Jahre alt, verrichteten an diesem Tag wie immer die morgendliche Hausarbeit. Sie fütterten die drei Schweine der Familie und das Federvieh, dann gingen sie mit den Krügen zum Brunnen, um Wasser zu holen. Auf dem Rückweg sahen sie die fremde junge Frau mit dem Gewehr. Sie hockte unweit des Teiches, in dem am Abend die Büffel badeten. Die kleineren Kinder des Dorfes umringten sie und waren merkwürdig still. Neugier erwachte in Hua und Khai. Eilig trugen sie die vollen Krüge zur Hütte und saßen bald darauf ebenfalls mit in dem großen Kreis. Sie heißt Nam! tuschelten ihnen die anderen zu, und: Sie weiß mehr Geschichten als Onkel Quang! Zuerst wollten Hua und Khai nicht so recht daran glauben. Schließlich war Onkel Quang bestimmt dreimal älter als diese zierliche Fremde, und außerdem hatte er sogar schon einmal Saigon, die große Hauptstadt mit den tausend Steinhäusern, gesehen. Zwei Stunden später jedoch wussten Hua und Khai, dass Nam es im Geschichtenerzählen tatsächlich mit Onkel Quang aufnehmen konnte.
Als die Bauern aus Gui am Nachmittag von der Feldarbeit nach Hause kamen, erlebten sie eine Überraschung. Die Kinder liefen ihnen entgegen und riefen schon von Weitem: Es sind gute Menschen! Nam hat uns viele Geschichten erzählt und uns auch gezeigt, dass man aus Bambusasche und Wurzeln so etwas wie Salz machen kann! Die beiden Onkel haben mit den Alten gemeinsam die Hütten gesäubert und uns Essen gekocht! Sogar die Babys haben sie gebadet! — Damit war der Bann gebrochen. Am Abend fand eine Dorfversammlung statt, bei der keiner der Erwachsenen fehlte. Hua und Khai waren nicht dabei gewesen, aber sie hatten schon am nächsten Tag erfahren, dass Gui nun nicht länger ein Dorf unter der Peitsche von Steuereintreibern und reichen Händlern sein sollte. Die Glut des Widerstandes, von den Abgesandten der Nationalen Befreiungsfront Südvietnams in das abgelegene Dorf getragen, wurde zu einem unauslöschbaren Feuer.
Eine der Geschichten Nams, die seitdem als Lehrerin in Gui geblieben war, erzählte von dem bösen Elefanten Ham. Ihm, dem der allmächtige Buddha die Kraft von dreißig Büffeln verliehen hatte, war seine Stärke zu Kopf gestiegen. Mit Verachtung schaute er auf die kleineren Tiere herab und wurde für sie ein Schrecken. Er zerstampfte die Hügel der Ameisen, bohrte seine langen Stoßzähne in den Leib des Tigers und riss mit seinem Rüssel die Nester der bunten Vögel aus den Zweigen. Kein Lebewesen blieb vor ihm sicher. Bald stiegen überall aus dem Dschungel und den Savannen die Klagen auf zum Ohr des großen Buddhas, und das Gesicht des Gottes verfinsterte sich. Er rief den Elefanten Ham vor den goldenen Thron und stellte den grauen Riesen zur Rede. Ham aber blieb uneinsichtig.
„Warum hast du mich so stark gemacht, wenn ich nicht Herrscher sein soll in den Wäldern und Steppen?", warf er dem Himmelskaiser vor. „Ich bin der Mächtigste dort, und es ist das Recht des Mächtigen, die Schwächeren niederzuhalten. Freundlich kann ich erst sein, wenn du mir zeigst, wer mir zu widerstehen vermag!"
Buddha blickte den Elefanten lange an. „Gut", sagte er dann und lächelte. „Du sollst der Höchste sein dort unten, wenn du es fertigbringst, das Gras zu besiegen." Und der Elefantenkoloss ging, um das Gras zu besiegen.
Ham glaubte zuerst, der Himmelskaiser wolle einen Witz machen, dann trompetete er vor Vergnügen. „Das Gras? Hundert Tiger und hundert Büffel, das wäre ein Kampf für mich gewesen, aber Gras ... Nicht einen Monat sollst du warten, und du wirst kein einziges kümmerliches Hälmchen mehr finden!"
Tag um Tag stampfte Ham mit seinen klobigen Beinsäulen jeden grünen Schimmer nieder, den er am Boden entdecken konnte. So verging ein Monat und noch ein Monat. Hams graue, dicke Haut wurde runzelig wie die eines Greises. Ohnmächtiger Zorn rötete das Weiße in seinen Augen. Seine Kräfte zerrannen, doch das Gras wurde nicht weniger. Immer wieder spross es neu aus dem Boden, grüner und saftiger als zuvor. Nach einem Jahr, einem Monat und einem Tag sank Ham erschöpft zur Erde. Er starb auf einer Lichtung, umgeben von wallendem, kniehohem Gras. Der große Buddha nickte zufrieden.
Und unsere Feinde, so beendete Nam diese Geschichte, sind stark wie der böse Elefant Ham. Wir aber, das Volk des Reislandes, wir tragen in unseren Herzen die Kraft des Grases, und wir sind unbesiegbar, wenn wir das erkennen.
Die Leute in Gui, auch Hua und Khai, sie alle verstanden den tiefen Sinn der Erzählung.
Bis hinauf zur schroffen Bergkuppe waren es für Hua und Khai nur noch ein paar Steinwurfweiten. Plötzlich blieb das Mädchen stehen. Sie hob warnend die Hand. Khai erstarrte mitten im Schritt. Die Mühe des steilen Anstieges hatte seinen Atem schnell und keuchend gemacht. Er schloss die Augen, um besser lauschen zu können. Da war es wieder, das fremde, feindliche Geräusch, das Hua erschreckt hatte. Hart und bissig übertönte es die friedlich zirpenden, geckernden und raschelnden Stimmen des Bergdickichts: Schüsse aus einer Maschinenpistole!
„Es ist drüben auf der anderen Seite", sagte Khai. Er sprach leise, als fürchtete er von dem unbekannten Schützen gehört zu werden. „Vielleicht ist Onkel Quang mit Sao hinuntergestiegen und auf Soldaten gestoßen."
Hua schaute zur Bergkuppe hin und schüttelte den Kopf. „Onkel Quang weiß, dass wir kommen ... Schnell, wir dürfen ihn nicht warten lassen!"
Sie hasteten weiter bergan.
Die Sonne stand jetzt fast senkrecht über dem Land. Wie eine Decke aus durchsichtig-flimmerndem Glas umhüllte Gluthitze die Höhen der Schlafenden Büffel. Die Last, die Hua und Khai schleppten, wog nun doppelt schwer. Noch zweimal vernahmen sie aus der Ferne das blecherne Tacken von Feuerstößen aus Maschinenpistolen. Sie ließen sich davon nicht aufhalten.
Die Bergkuppe war, wie von einem riesigen Messer kreuz und quer getroffen, in zahllose Felsen und Spalten zerklüftet. Nach der Südseite hin fiel der Hang kahl und ziemlich steil ab. Der Zickzackpfad, der hinunterführte und unten im Dschungel verschwand, war gut zu überschauen. Für einen hier oben postierten Beobachter konnte an dieser Stelle niemand unbemerkt die Bergkette überschreiten.
Hua legte ihr Bündel ab und setzte sich auf einen Steinbrocken. Sie streckte die Beine aus und schnurrte zufrieden. Obwohl sie die tropische Hitze gewohnt war, rann ihr der Schweiß in dicken Tropfen über das Gesicht. Nass und dunkel klebte ihr die blaue Bluse an der Haut. Auch auf Khais Kleidung zeichneten sich feuchte Flecken ab. Er hob die Hände trichterförmig an den Mund und ahmte täuschend echt den lauten, krächzenden Schrei eines Bergpapageis nach. Nur Sekunden verstrichen, dann kam zwischen den Felsen hervor die Antwort. „Hierher, Kinder! Beeilt euch!"
Es war die Stimme Onkel Quangs. Sein faltiges Gesicht mit den silbrigen Bartfäden am Kinn tauchte zwischen den Steinquadern auf. Er winkte dem Geschwisterpaar zu. Wenig später hockten Hua und Khai in der niedrigen Felsenhöhle, die den beiden Männern aus Gui als Unterschlupf diente. Ihre Aufgabe bestand darin, heranrückende Feinde möglichst lange aufzuhalten und die Leute im Dorf mit Rauchsignalen zu warnen.
„Wo ist Onkel Sao?", fragte Khai und schaute sich suchend um. „Wir haben das Schießen gehört. Hat er eine Maschinenpistole?"
„Morgen werden wir welche haben", sagte Onkel Quang, und das winzige Lächeln in seinen Mundwinkeln schob noch ein paar Falten mehr in sein Großvatergesicht. Bedächtig packte er die Sachen aus, die Hua und Khai gebracht hatten. Getrocknetes Fleisch war dabei, Klebreis, grüner Tee und dazu eine Rolle aus dunkelbraunen, würzig duftenden Tabakblättern. „Es sind Regierungssoldaten", erklärte Onkel Quang ruhig. „Eine Kompanie oder zwei. Sao behält sie im Auge. Sie kommen nur langsam vorwärts."
„Aber sie schießen auf ihn." Huas Miene verriet, dass sie sich Sorgen machte.
Onkel Quangs Lächeln wurde noch einen Zentimeter breiter. „Nicht auf ihn", sagte er. „Sie haben Mäuseherzen. Aus lauter Angst schicken sie ihre Kugeln blind nach allen Seiten in den Dschungel."
„Sind sie an den Spießen vorbeigekommen?", wollte Khai wissen.
Onkel Quang nickte. Sein Gesicht wurde wieder ernst. Überall im Dschungel gab es Pflanzen mit dolchartigen Stacheln. Bäume wuchsen dort, deren Dornen eisenhart und länger als zwanzig Zentimeter waren. Die Leute von Gui hatten schon vor zwei Jahren geeignete Gewächse dieser Art ausgewählt und sie entlang jedes Pfades gepflanzt, der zu ihrem Dorf führte. Diese Barrieren waren so geschickt angelegt, dass kein Fremder unverletzt daran vorbeikam. Achtete ein Söldner darauf, dass seine Füße und Waden verschont blieben, geriet er sofort in die Gefahr, mit der Brust oder dem Bauch gegen einen der Dornenpfeile zu rennen. War er jedoch auf den Schutz seines Oberkörpers bedacht, bohrte sich ihm mit Sicherheit ein harter Stachel in den Fuß oder in die Wade. Einige Monate zuvor hatte eine Söldnereinheit bei ihrem Marsch auf Gui in diesem Dornendickicht so viele Verletzte gehabt, dass sich die Soldaten schließlich weigerten, weiter vorzudringen.
„Diesmal haben ihnen die weißen Langnasen geholfen", erklärte Onkel Quang. Er meinte damit die Amerikaner. „Sie haben sich Metallhüllen ausgedacht, mit denen die Soldaten geschützt sind vom Gürtel bis zu den dicken Lederschuhen. Aber sie werden damit langsam wie Schnecken. Eine halbe Stunde brauchen sie noch bis zum Rand des Hanges. Und der Anblick unserer Schlafenden Büffel wird ihnen keine Freude machen, glaub ich."
Onkel Quang bestand darauf, dass sich Hua und Khai nach dem langen, kräftezehrenden Weg erst einmal stärkten. Aus einem Winkel der Höhle holte er zwei Kokosnüsse, die er mit einem breiten Haumesser spaltete. Die Kinder tranken die köstliche, eiskalte Fruchtmilch und leckten sich genüsslich die Lippen. Hua schlug vor, gemeinsam mit ihrem Bruder Khai sich um das Feuer für die Rauchsignale zu kümmern. Alle größeren Kinder aus Gui hatten längst gelernt, wie so etwas gemacht wurde. Sie kannten die Mischung von Zweigen und dürrem Gras, die, angezündet, einen dunklen, weithin sichtbaren Qualm erzeugte. Quang wollte jedoch nichts davon wissen. Er hielt den Zeitpunkt für verfrüht. Wenn die Bauern auf den Reisfeldern die warnenden Zeichen über den Kuppen der Schlafenden Büffel entdeckten, würden sie sofort ihre Arbeit unterbrechen und zum Kampf herbeieilen. Weniger Arbeit aber bedeutete weniger Reis, und von ihm, dem großen Ernährer, hing nicht zuletzt das Glück des Dorfes ab. „Wenn sie bis zum Hang kommen, ist noch Zeit genug", entschied Onkel Quang. „Ihr dürft mitgehen und sehen, wie wir die Teufel diesmal das Fürchten lehren. Fertig?"
Das Mädchen und der Junge folgten neugierig dem Grauhaarigen, der erstaunlich behänd vorauseilte. Er brachte sie ein Stück hangabwärts bis zu einem felsigen Vorsprung. Ein paar mannshohe Steinquader boten Schutz, und wer einen scharfen Blick besaß, konnte von hier aus sehr gut die Stelle beobachten, an welcher der Pfad die ersten Baumriesen des Dschungelrandes erreichte.
„Erkennt ihr die vier hellen Bündel dort unten in den Ästen des jungen Eisenholzbaumes? Ja, da dicht neben dem Pfad." Onkel Quang zeigte hinunter zu dem Baum, und die beiden Geschwister entdeckten, was er meinte.
„Sie sehen aus wie große gelbe Kürbisse", sagte Khai. Er hatte noch nie so etwas gesehen. Audi Hua fand die vier Bündel sehr merkwürdig.
„Ich kenne die Samenfrüchte des Eisenbaumes. Sie sind ganz anders. Viel, viel kleiner!"
Onkel Quang schmunzelte und rieb die silbernen Fäden seines dünnen Kinnbartes zwischen den Fingerspitzen. „Wenn die Soldaten da sind, werden sie reif sein, diese Früchte. Und bestimmt werden sie ihnen nicht wie Zuckerkürbisse schmecken!" Mehr verriet er vorläufig nicht.
Etwa eine Viertelstunde kauerten Onkel Quang, Hua und Khai hinter den Felsbrocken, als wie aus dem Boden gewachsen plötzlich Sao vor ihnen stand. Sogar der Grauhaarige hatte seinen Gefährten nicht eher bemerkt. Sao war ein heiterer Mann, den alle Leute in Gui gern hatten. Man sah ihm nicht an, dass er Mitte Dreißig und Vater von drei munteren Kindern war. Schlank und sehnig, mit einem goldbraunen, stets fröhlichen Gesicht, konnte ihn ein Uneingeweihter leicht für einen Jüngling um die Zwanzig herum halten. Im Dorf galt er als einer der besten Jäger. In seiner Hütte hingen an der Wand die buschigen Schwänze von drei Tigern, die er allein erlegt hatte.
„Sie kommen!", meldete er dem Grauhaarigen, dann fuhr er Hua und Khai mit der Hand freundlich zausend über die schwarzen Haarschöpfe. „Habt ihr auch Tabak mitgebracht, ja?" Die beiden wollten gleichzeitig antworten, doch es kam nicht so weit.
„Achtung!", stieß Quang leise hervor und spähte zum Pfad hinab.
Unten am Dschungelrand wurde es lebendig. Vier, fünf Gestalten bewegten sich beiderseits des Pfades zögernd vorwärts. Die Köpfe mit den kugelrunden braunen Stahlhelmen tief zwischen die Schultern gezogen, die Rücken gekrümmt wie unter einer Last, die Maschinenpistolen schussbereit in den Händen, so lösten sie sich ängstlich aus dem Schatten des dichten Waldes. Nahe beim jungen Eisenholzbaum blieben sie unschlüssig stehen und warteten. Ein paar Minuten vergingen, dann erschienen die anderen. Achtzig bis hundert Mann mochten es sein, darunter drei Offiziere. Sie suchten mit Ferngläsern den Hang ab. Offenbar trauten sie dem Frieden nicht. Schließlich wählten sie zehn der Soldaten aus und zeigten zu der Bergkuppe hinauf. Die Soldaten schnallten ihre Metallschienen ab, die sie beim Gehen sehr behinderten. Einer der Offiziere übernahm das Kommando über den Trupp. Langsam und wohl jeden Augenblick mit einem Angriff rechnend, setzten sich die Männer in Bewegung. Sie waren noch keine zwanzig Schritt von den anderen Soldaten entfernt, als es geschah. Drei der an der Spitze des Trupps laufenden Soldaten wurden plötzlich vom Erdboden verschluckt. Ihre gellenden Schreie drangen bis hinauf zu den Beobachtern auf dem Felsenvorsprung. Die drei Söldner waren in eine Bambusfalle gestürzt.
Die mehr als zwei Meter tiefe Grube war so gut getarnt, dass sie selbst einem geübten Jägerauge leicht verborgen blieb. Auf einem Netzwerk aus dünnen Zweigen lag eine nur fingerdicke Erdschicht. Laub und Graswuchs glichen das Quadrat täuschend echt der Umgebung an. Hüfthoch ragten auf dem Boden der Grube nadelspitze, stahlharte Bambusspieße empor. Auf diese Spieße waren die drei Söldner gestürzt.
Schrilles Jammern lockte die am Dschungelrand Wartenden herbei, doch noch ehe sie die Wunden der Verletzten behandeln konnten, traf sie der zweite Schlag. Wie von Zauberhand berührt, platzten genau in dieser Minute die seltsamen hellen Bündel in der Krone des jungen Eisenbaumes. Ein dunkler Schleier senkte sich aus den Ästen auf die Männer, die den Tod nach Gui bringen wollten.
Bienen! Hunderte, Tausende von Bienen, die zum Angriff übergingen!
Ein Hagel glühender Kohlen hätte die Söldner nicht schlimmer treffen können. Wie eine Herde wild gewordener Büffel stoben sie auseinander, rannten in panischer Flucht den Weg zurück in den Dschungel. Auch einer der von den Bambusspießen Verletzten konnte sich dorthin retten, aber vier uniformierte Gestalten blieben, reglos am Boden liegend, auf dem Kampfplatz.
Sao, der Bauer und Jäger aus Gui, hatte tagelang die besonders großen, wilden Bienen des Bergdschungels beobachtet. Sie waren so lang wie ein Kinderdaumen, sammelten aber keinen Honig. Ihre Gefährlichkeit erlebte Sao sehr eindrucksvoll. Es gehörte zu den Lebensgewohnheiten dieser Insekten, dass stets vier Bienen in der Nähe ihres Schwarmes Wachdienst verrichteten. Einmal, während Sao das Verhalten der wilden Bienen studierte, kam ein kräftiger und neugieriger Affenmann diesen Wächtern zu nahe. Gereizt umschwirrten sie ihn, und er versuchte, sie zu verjagen. Sie alarmierten den Schwarm. Der Kampf dauerte keine Viertelstunde, dann fiel der vorwitzige Affenmann, durch Dutzende schmerzhafter Stiche getötet, aus dem grünen Blätterdach des Dschungels. Nach diesem Erlebnis war es Sao gelungen, einige der Schwärme zu fangen. Als Behälter dienten ihm Beutel aus breiten, schmiegsamen Blättern wild wachsender Bananenstauden. Er hängte sie in die Krone des jungen Eisenbaumes nahe der Fallgrube, sperrte dort einige Wächter-Bienen ein und stellte mit dünnem Strick eine gut verborgene Verbindung zwischen den eingefangenen Schwärmen und der Falle her. Auf diese Weise wurden beim Einbrechen in die Falle die Blätterbündel zerrissen, und die Schwärme stürzten sich auf die von den wütenden Wächter-Bienen in der Fallgrube ausgemachten Ziele.
„Ich glaube nicht, dass sie noch einmal zurückkommen, aber es ist besser, wenn wir noch eine halbe Stunde warten", sagte Sao, dem es nun um die von den Geflüchteten in großer Zahl weggeworfenen Waffen ging. „Und die Bienen müssen auch erst ihren Zorn austoben."
Onkel Quang nickte, aber er schaute nicht wie Sao und Khai hinunter zu den toten Söldnern. Er betrachtete das Mädchen Hua, und seine Miene verriet, dass er mit sich selbst unzufrieden war. Es sind Kinder, dachte er. Ich hätte sie nicht hierher mitnehmen dürfen.
Hua kauerte, mit dem Rücken an dem Felsen lehnend, auf dem Boden und hielt den Kopf gesenkt. Als Quang ihr sanft die Hand auf die Schulter legte, hob sie das Kinn, und er sah, dass ihre Augen feucht waren.
„Die Männer dort unten", sagte sie leise. „Sie haben die gleichen Augen wie wir, und ihre Haut ist wie unsere Haut."
Sao und Khai wandten sich zu ihr um und blickten sie verwundert an. Khai warf einen schnellen, scheuen Blick auf Sao, als müsse er sich für die Worte seiner Schwester entschuldigen.