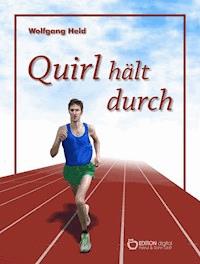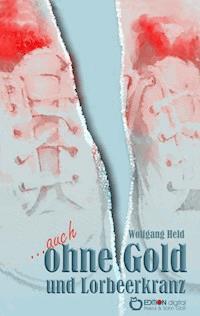7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erzählt von der ungewöhnlichen Begegnung zweier junger Menschen in der gerade ein Jahr alten DDR, zu unbedeutend für die historischen Annalen und doch eng verflochten mit dem Geschehen jener bewegten Jahre. Die bittere Einsicht von Schuld, der Mangel am Notwendigsten in dem zerschundenen Land, das alles löschte damals den Willen zum Leben nicht aus. Ein Volkspolizist und ein evangelischer Vikar müssen, todkrank und mit völlig verschiedener Weltanschauung, über mehrere Monate ein Zimmer in einem Tbc-Heim teilen. Humorvoll und mit großer Dramatik schildert Wolfgang Held, wie beide schließlich zu gegenseitiger Achtung und Toleranz finden. Als der später auf der Berlinale ausgezeichnete Film „Einer trage des anderen Last" Anfang 1988 in die Kinos kam, fand er in der DDR ein Millionenpublikum. Er wurde in Ost und West als ein „Plädoyer für Toleranz" verstanden. Nach seinem Drehbuch hat Wolfgang Held 1995 den gleichnamigen Roman geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Einer trage des anderen Last
Roman nach dem Film
ISBN 978-3-86394-951-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 2002 beim quartus-Verlag, Bucha.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Der blasse Mann, höchstens zwanzig, ist mit schwerem Koffer am Bahnhof der Kreisstadt in den klapperigen, mit Holzgas angetriebenen Omnibus eingestiegen. Die Schulterstücke auf seinem bis zu den Knöcheln reichenden Uniformmantel glänzen silbern wie die Kordel der Schirmmütze. Volkspolizist. Kommissar. Der Sitzplatz neben ihm bleibt unbesetzt. Hohenfels, hat der junge Mann dem Fahrer beim Bezahlen gesagt, kein Wort mehr. Nun schaut er hinaus in die Waldeinsamkeit, ernst und mit quälender Angst im Blick vor dem, was ihn erwartet.
Es ist vor fünf Wochen passiert, an einem Oktobertag, so heiß, als sei Hochsommer. Sie haben Trümmer weggeräumt. Schutt, der noch im Frühjahr 1945 eine Schule gewesen war, bis Fliegerbomben die halbe Stadt und einige Hundert ihrer Bewohner ausgelöscht hatten.
Aufbauwerk hieß die Aktion in den Zeitungen. Ein paar Arbeiter packten zu, mit ihnen Volkspolizisten wie er, Hausfrauen bis hin ins Greisenalter, Studentinnen und Studenten einer Arbeiter-und-Bauern-Fakultät. Freiwillige alle. Keiner, der nach Lohn fragte. Die Männer schufteten in der Hitze mit nackten Oberkörpern, mager und schweißig. Ein Bagger hob die Grube für ein neues Fundament aus und füllte den Abraum in Kipploren. Mit zwei älteren Arbeitern hatte er eine der schweren, eisernen Karren auf einem Schienenstrang vorwärts geschoben, angestrengt und keuchend. Plötzlich war ihm dabei schwindelig geworden. Ein Hustenanfall. Er hatte gefühlt, wie etwas heiß in seiner Kehle hochstieg, hatte das Taschentuch vor den Mund gepresst und war in eine schwarze Leere gestürzt. Das hellrote, ausgespiene Blut auf dem Tuch hatte er nicht mehr wahrgenommen.
Die stinkende Auspuffwolke des mit Holzgas angetriebenen Omnibusses vergiftet den feuchten Atem des Herbstwaldes. Meterweit spritzt Wasser aus Schlaglöchern. Die wenigen Fahrgäste werden geschüttelt und gerüttelt. Sie nehmen es hin, sind Ärgeres gewohnt.
Die schmale Waldstraße steigt an, krümmt sich in eine steile Kurve. Das Schaltgetriebe kreischt. Der Fahrer wendet den Kopf. Er nickt dem Uniformierten zu. Der Bus hält, wo von der Straße ein mit Spurrinnen gestriemter Weg in den Wald eindringt. Der junge Mann bugsiert seinen Koffer durch die Tür und steigt aus. Ein kurzes Verschnaufen noch, dann wandert er los. Erst, als ihn jemand einholt, wird ihm bewusst, dass er nicht der einzige Aussteiger gewesen ist ...
Eine sehr hagere, ziemlich finster blickende Frau in den Vierzigern bleibt bei ihm stehen. Ihre stocksteife Haltung, von dem im Nacken zur Würdeknolle hochgebundenen Haar bis hinab zu den schlichten Schnürstiefeln, lässt eine resolute Respektsperson ahnen. Er setzt den Koffer ab, schiebt die Schirmmütze in den Nacken und streicht Schweiß von der Stirn. Knapper Atem schwächt die Stimme.
„Guten Tag ...!"
Die Frau mustert ihn und seinen Koffer. Sie runzelt die Stirn. „Sie wollen zum Sanatorium?" Der Satz ist viel mehr Rüge als Frage und irritiert.
„Ja ... Hohenfels ... Noch weit?"
„Ich bin Oberschwester Walburga! ... Grüß Gott!"
„Heiliger ... Josef!" Knappes Nicken soll eine Verbeugung andeuten.
„Wie bitte?"
Für Sekunden fühlt sich die tief religiöse Oberschwester veralbert. Den junge Mann überraschen solche verblüfften Reaktionen auf seine Namensnennung längst nicht mehr. Er lächelt. „Josef Heiliger ... So heiße ich."
Die Oberschwester hat einige Mühe, die ungewöhnliche Verknüpfung zwischen dem Namen des Zimmermannes aus Nazareth und Nährvaters Jesus einerseits und dem Träger einer Uniform der Volkspolizei andererseits vom Gefühl her zu akzeptieren.
„Ich habe Sie für einen der Grenzer gehalten ... Wieso tragen Sie Uniform?"
Josef Heiliger hätte der Oberschwester erklären können, dass er beim Eintritt in die Volkspolizei seinen einzigen, noch einigermaßen tragbaren Anzug dem zwei Jahre jüngeren Bruder überlassen hatte und seitdem niemals auf den Gedanken gekommen war, Geld für Zivilkleidung auszugeben. Er hält das jedoch für eine unangemessene Vertraulichkeit und beschränkt sich auf eine kurze Gegenfrage. „Wieso nicht?"
„Ihre Sache." Oberschwester Walburga zuckt kaum merklich mit den Schultern. Sie schaut auf den Koffer. „Das Gepäck wird vom Bahnhof abgeholt. Haben Sie Ihre Einweisung nicht gelesen?"
„Doch, schon ..." Verlegen sieht Josef Heiliget zu, wie die Oberschwester nach dem Koffer greift. Sie prüft das Gewicht und sendet einen Blick zum Himmel.
„Mein Gott!"
Ehe er zu Wort oder einer abwehrenden Geste kommt, hat sie ihm ihr Einkaufsnetz in die Hand gedrückt. Er braucht einen Augenblick, bevor er begreift, dass sie die Absicht hat, seinen Koffer zu tragen.
„Aber ...! Das kommt doch überhaupt nicht infrage, Oberschwester!" Sein Protest bleibt wirkungslos. Auch der Versuch, den Koffer wieder in die Hand zu bekommen, scheitert. „Wollen Sie den Helden spielen? Bei uns werden Sie sich manches abgewöhnen müssen, mein Herr! Zuerst die dumme Einbildung, dass nur schwer krank ist, wer Schmerzen hat ..."
Oberschwester Walburga ist gewohnt, ihren Willen durchzusetzen. Sie schleppt das schwere Gepäck und verrät mit keiner Miene, wie sie von der Last gequält wird. Ein halber Zentner, schätzt sie. Mindestens! Entweder ein Haufen Bücher oder der Kerl bringt sein Maschinengewehr mit!
Sie überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, künftigen Patienten schon auf der Einweisung Stück für Stück exakt vorzuschreiben, was zur Kur auf Hohenfels als Mitbringsel erlaubt sei. Zweimal Wäsche und Nachthemden, Waschzeug, Trainingsanzug - Schluss! Keine weltlichen Bücher, keine Bronzebüsten und überhaupt nichts, was mehr als hundertfünfzig Gramm wiegt ...
Im Einkaufsnetz der strengen Frau sind nur, sorgfältig in Papier verborgen, drei Schachteln Nortag-Zigaretten, eine Flasche Alkolat und zwei Paar wollene Strümpfe aus der HO. Das Gewicht ist kaum spürbar. Trotzdem glänzt Schweiß auf Josef Heiligers Stirn. Die Situation ist ihm peinlich. Schmerzhaft unangenehm. Wenn jetzt einer kommt, was muss der von mir denken, geht es ihm durch den Sinn. Ein verlorener Arm, ein lahmes Bein, da weiß jeder sofort, was los ist, aber so ... Er geht an Oberschwester Walburgas Seite, hält den Kopf gesenkt und fühlt sich mit seiner Krankheit so elend wie selten zuvor.
Sie haben erst die Hälfte des Weges zurückgelegt, als hinter ihnen Geklapper und Gepolter näher kommt. Ein Fuhrwerk. Der Milchwagen des Sanatoriums Hohenfels, gezogen von einem Gaul, der aussieht, als sei er einst unter Friedrich dem Großen durch die Schlesischen Kriege getrabt. Das Alter des Kutschers bleibt hinter Vollbart und Löwenmähne ein reizvolles Rätsel für ehrgeizige Schätzer.
Peitschenknall vermag das Pferd nicht in schnelleren Schritt zu bringen. Oberschwester Walburga hat neben dem Alten auf dem Kutschbock Platz gefunden. Josef Heiliger hockt hinten bei den Milchkannen auf seinem Koffer. Er kann die Augen kaum noch offen halten. Müdigkeit, damit hatte es angefangen, Wochen vor dem Bluthusten. Auch der künstliche Pneumothorax, der ihm noch zu Hause vom Arzt in der Tbc-Fürsorgestelle angelegt worden war, hatte daran nichts geändert. Alles war nur noch bedrohlicher geworden.
In sein Dahindämmern knattert Motorengeräusch. Er richtet sich auf. Der Kutscher lenkt den Wagen zur Seite und strafft den Zügel. Ein Auto rollt ihnen entgegen. Eine schwarze, geschlossene Limousine. Josef Heiliger erkennt die gekreuzten, silbernen Lorbeerblätter an Seite und Hecktür. Ein Leichenwagen. Jemand, der es hinter sich hat, denkt er und ist im nächsten Augenblick wegen dieses Gedankens ärgerlich über sich selbst.
2. Kapitel
Das Sanatorium Hohenfels, umgeben von dichtem Nadelwald, ist eingebettet in Abgeschiedenheit und Stille. Ein zweistöckiger Fachwerkbau, errichtet um die Jahrhundertwende, mit Giebelzimmern im oberen Stockwerk und langen Balkons im Erdgeschoss. Liegehallen, in denen die in Decken gehüllten Patientinnen und Patienten die meisten Stunden des Tages ruhen, mit Harzgeruch und Tannenduft gewürzte, klare Luft atmen und auf Heilung hoffen.
In Sichtweite des Haupthauses gibt es ein schlichtes Nebengebäude. Hier sind der Chefarzt, die Schwestern, eine Laborantin und das weitere Personal des Sanatoriums untergebracht. Bis kurz nach dem Krieg hatte dort auch der Eigentümer seine Wohnung. Er war mit seiner Familie im Juni 1945 vor der anrückenden Roten Armee den abziehenden amerikanischen Truppen nach Hessen gefolgt.
Doktor Stülpmann kommt mit Schwester Elfriede aus dem Haus. Sie tragen weiße Kittel. Der Arzt, ein Mann in den Fünfzigern, das Silberhaar korrekt gescheitelt, stets umgeben vom Duft eines angenehm unaufdringlichen Rasierwassers, muss seinen Schritt dem langsameren Tempo der zierlichen Frau angleichen. Schwester Elfriede, trippelnd und leicht gebeugt, hat erst vor wenigen Tagen ihren sechsundsiebzigsten Geburtstag gefeiert. Sie gehört seit mehr als einem halben Jahrhundert zu Hohenfels und wird wieder einmal von der Sorge beunruhigt, dass man sie demnächst in den Ruhestand schicken könnte. Doktor Stülpmann hält solche Befürchtungen für ganz und gar unbegründet.
„Aber auf Sie können wir hier doch nie verzichten, Schwester Elfriede. Hohenfels ohne Sie - undenkbar!"
Die Greisin schmunzelt fein, aber sie schüttelt den Kopf. „Ja, wäre ich erst sechzig, siebzig, täte ich mir keine Sorgen machen, Herr Chefarzt ..."
„So lange Hohenfels noch den Burgbaums gehört, entscheide allein ich hier über Personalfragen ..."
„Wenn Sie das sagen, Herr Chefarzt ..." Sie schaut mit ihren blassblauen Augen dankbar zu ihm auf. Er legt im Gehen den Arm um ihre Schultern.
„Und Sie bestimmen ja schließlich auch mit, wenn's in unserem Haus um Personalangelegenheiten geht, Schwester."
„Ich?"
„Na, sind Sie nun unsere Gewerkschaft hier oder nicht?"
Es kommt selten vor, dass Schwester Elfriede an ihre Gewerkschaftsfunktion erinnert wird. Auf Zureden des Chefarztes hatte sie sich wählen lassen, weil kein anderer dazu bereit gewesen war und Hohenfels bei den Behörden nicht ins Gerede kommen sollte. Nun kichert sie leise und nickt.
„Wenn Sie es sagen, Herr Chefarzt ..."
Doktor Stülpmann und Schwester Elfriede sind gerade erst im Haupthaus verschwunden, da recken die in gemischter Reihe ruhenden Patientinnen und Patienten in den Liegehallen die Köpfe. Maßlos gelangweilt, ist für sie auch heute wieder die alltägliche Ankunft des Milchwagens ein beobachtenswertes Ereignis. Zumal, wenn ein Neuer mitgebracht wird. Der junge Mann in Uniform löst bei den neugierigen Patienten beiderlei Geschlechts die unterschiedlichsten Empfindungen aus. Seltsam berührt, verfolgt ein junges Mädchen den Offizier mit ihrem Blick. In ihre grauen Augen steigt dabei ein ganz eigenartiger Ausdruck. Gleichermaßen Wehmut, Freude, eine Spur von Hoffnung - hellwaches Interesse jedenfalls. Frau Grottenbast, eine verblühte Mittfünfzigerin auf der Pritsche neben dem Mädchen Sonja, bemerkt es mit sichtlichem Unbehagen.
Der Kutscher hält vor dem Portal. Er hebt den schweren Koffer vom Wagen. Josef Heiliger will zugreifen, doch die Oberschwester ist schneller. Unbeeindruckt von der ärgerlichen Geste des jungen Mannes schleppt sie die Last ins Haus. Er presst die Lippen zusammen und folgt ihr. Auf der Schwelle schaut er noch einmal, wie Abschied nehmend, hinüber zum Wald, dann zieht er die wuchtige Eichentür so heftig hinter sich zu, dass der Knall sogar den ewig schläfrigen Gaul vor dem Milchwagen zu zwei tänzelnden Schritten vorwärts aufschreckt.
3. Kapitel
Die fast einen halben Meter hohe Nachbildung der griechischen Statue des Dornausziehers wirkt allein merkwürdig zwischen Aktenschrank, Vitrinen mit ärztlichen Instrumenten, dem Sichtgerät für Röntgenbilder und einer Liege für körperliche Untersuchungen, doch auch der gerahmte Wandspruch neben der Tür des Behandlungsraumes verrät Doktor Stülpmanns Vorliebe für Kunst und Weisheit der Antike: TU NE CEDE MALIS, SED CONTRA AUDENTIORITO - WEICHE DEM UNHEIL NICHT, NOCH MUTIGER GEH IHM ENTGEGEN!
Josef Heiliger hat keinen Blick für den weltvergessenden, allein mit seinem Fuß beschäftigten, sitzenden Knaben aus Marmor. Nach gerade erfolgter Untersuchung kleidet er sich wieder an. Er beobachtet dabei den Chefarzt. Doktor Stülpmann steht vor dem Leuchtkasten, an dem die von dem Ankömmling mitgebrachten Röntgenbilder eingespannt sind. In respektvollem Abstand wartet auch Oberschwester Walburga. Aufrecht-steif trägt sie ihre blütenweiße Haube wie eine Krone. Josef Heiliger hält die Stille schließlich nicht länger aus.
„Wie lange, Herr Doktor? Bitte, was denken Sie, wie lange ich hier bleiben muss?"
Stumm bedeutet der Chefarzt seinem Patienten, näher zu treten. Er führt einen Bleistift über helle und dunkle Linien der Röntgenaufnahmen. Verschlüsselte Signale aus Licht und Schatten, nur für den Eingeweihten entzifferbar. Als er endlich spricht, ist seine Stimme leise und ernst.
„Das sind keine Mädchenaugen, junger Mann ... Sehen Sie, hier?" Die Spitze des Bleistiftes umkreist zwei schwach erkennbare, ringförmige Aufhellungen. „Kavernen! Dicht nebeneinander sehr dicht! Kirschkern- und kleinapfelgroß ... Er wendet sich an die Oberschwester. „Pneu schon versucht?" Sie kennt die Krankengeschichte bereits ohne einen Blick in die Mappe.
„Ambulant! Zu starke Verwachsungen. Fieber. Exudat ... Kaustik nach Ansicht von Doktor Ziehmer inakzeptabel."
Josef Heiliger sieht, wie der Chefarzt kaum merklich den Kopf wiegt, aber er will das nicht als Anzeichen wachsender Besorgnis gelten lassen. Vierzehn Tage, rechnet er. Vielleicht vier, fünf Wochen, nicht länger. Auf gar keinen Fall länger.
„Es muss doch Erfahrungswerte geben. Wie lange braucht man, um mit so was fertig zu werden?" Er sieht zu der Oberschwester hin, dann wieder zum Arzt. Beide bleiben stumm, betrachten ihn nachdenklich. Ihr Schweigen reizt ihn. Er wird heftig. „Ich werde gebraucht, Herr Doktor!" Ungestüm knöpft er seine Uniformjacke zu, geradeso, als wolle er das Sanatorium nun sofort wieder verlassen.
Gelassen setzt sich Doktor Stülpmann an seinen Schteibtisch. Er reagiert nicht auf den Unmut des jungen Patienten. Ruhig wendet er sich der Oberschwester zu.
„Zuerst muss dieser junge Mann bei uns zur Ruhe kommen. Viel liegen, schlafen, langsam gehen. Bringen Sie ihm das bei, Oberschwester." Sein Blick wandert wieder zu Josef Heiliger. Die Stimme wird freundlicher, beinahe väterlich. „Hier auf Hohenfels, Herr Heiliger, gehen die Uhren ganz, ganz anders als dort drüben hinter den Bergen ..."
„Aber dort warten sie auf mich!" Josef Heiliger braust auf. „Ich muss dabei sein. Ich hab' keinen Tag zu verlieren in so einer Zeit! Keine Stunde ... Ich kann nicht hier rumsitzen und Däumchen drehen, verstehen Sie, Doktor. Lieber will ich ..."
„Sterben?!"
Der knappe, sehr ernste Einwurf des Arztes lässt Josef Heiliger verstummen. Sterben, wieso sterben? Ich huste kein Blut mehr, ich habe kaum noch Fieber, ich bin auf meinen eigenen Beinen hierher gekommen und nicht auf einer Krankentrage, Herrgottnochmal, ich will nicht sterben ...
„Sie müssen innere Ruhe finden, das ist für Sie jetzt das Wichtigste. Denken Sie immer, es geht Sie nichts an. Was auch geschieht, es geht Sie nichts an, junger Mann ... Sie werden es lernen!"
4. Kapitel
Oberschwester Walburga begleitet den neuen Patienten zu seinem Zimmer. Er ist mit den Gedanken immer noch bei dem Ergebnis der Untersuchung. Im Korridor geht die Schwester ganz bewusst sehr langsam. Damit er sein hektisches Tempo bremst, muss sie ihn am Arm halten. Er hört der von ihr erteilten Belehrung kaum zu.
„Unser Herr Chefarzt legt größten Wert auf Einhaltung der Etikette, Herr Heiliger. Keine Nachlässigkeiten, bitte! Bei der relativ langen Dauer einer Behandlung ..."
Josef Heiliger horcht auf. Hastig hakt er ein: „Wie lange, Oberschwester? ... Ungefähr?"
Das Lächeln der Schwester ist mild und nachsichtig. Für einen Moment verlieren ihre Züge die Respekt fordernde Strenge, doch schon mit der Antwort zieht die gewohnte Strenge ein. „Wir rechnen hier nach Monaten, Herr Heiliger. Und wir sind dabei um eine niveauvolle Atmosphäre bemüht. Studieren Sie bitte die Hausordnung. Unser Herr Chefarzt hat sie vor siebzehn Jahren eingeführt ..."
Verdutzt bleibt Josef Heiliger stehen. Er schaut sich in dem bis zur Decke gediegen mit edlem Holz getäfelten Korridor um. Goldglänzende Türgriffe. Ein hohes Mosaikfenster. Ein Ölgemälde mit dem Matterhorn. Parkettboden.
„Das war hier schon vor dem Krieg Sanatorium?"
„Seit 1929!" Sie sagt es mit vernehmlichem Stolz. Josef Heiliger ist erstaunt.
„Hätt' ich nicht gedacht, ehrlich." Er geht langsam weiter. „Sieht aus wie 'n altes Schloss ... Enteignet."
„Vorläufig ist das alles gottlob noch in Privathand. Die Besitzer leben in der amerikanischen Zone. Übrigens entfernte Verwandte von Frau Grottenbast, Ihrer zukünftigen Tischdame."
Erneut hält er jäh inne. „Meiner ... was?"
Diesmal geht die Oberschwester die drei Schritte weiter bis zur Tür des Zimmers, in dem der junge Patient untergebracht ist. „Tischdame! Ich sagte Ihnen ja bereits, dass wir hier sehr auf Umgangsformen achten ... Machen Sie sich ein wenig mit Ihren neuen vier Wänden vertraut. Ich bringe Ihnen dann das Krankenblatt und alles Übrige."
Der davongehenden Oberschwester kommen drei Patienten entgegen. Im Vorübergehen grüßen sie beflissen. Das Mädchen Sonja ist dabei. Die Achtzehnjährige mustert den jungen Mann in Uniform neugierig, doch der nimmt dieses Interesse nicht wahr und verschwindet im Zimmer.
5. Kapitel
Die ruhige, mahnende Stimme des Chefarztes lässt Josef Heiliger nicht los. Sein Koffer liegt noch verschlossen auf dem Tisch. Angekleidet wirft er sich auf eines der beiden Betten und starrt gegen die weiße Decke. Was auch geschieht, es geht Sie nichts an - wie denkt sich das dieser Herr Doktor? Es geht mich nichts an - wie soll das gehen, Herr Doktor? Es geht mich nichts an - von wegen!
Der offene Fensterflügel knarrt leise. Josef Heiliger spürt die hereinwehende, nasskalte Luft nicht. Bilder steigen auf. Erinnerungen, gerade erst ein Jahr alt. Ein Bauer pflügt. Das von zwei trägen Ochsen gezogene Scharmesser bricht eine Schälfurche in den Stoppelacker. Nahe des Feldraines ist ein meterhoher Pfahl in den Boden getrieben. Schwarzrotgold gestreift. Staatsgrenze seit ein paar Tagen. Zwei Grenzer patrouillieren entlang der unsichtbaren Barriere, die bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland im 49er Mai Zonengrenze oder Demarkationslinie hieß und seit Oktober dieses Jahres zwei deutsche Staaten trennt. Einer der beiden jungen Männer in den dunkelblauen Uniformen der Volkspolizei ist Josef Heiliger. Sie winken dem Mann hinter dem Pflug einen Gruß zu. Über ihren Auftrag denken sie nicht nach. Unerlaubtes Überschreiten der Grenze verhindern, ob von Osten nach Westen oder umgekehrt. Nicht anders als Grenzwächter zwischen Frankreich und Spanien, Mexiko und den USA oder anderswo an der Trennlinie von Staaten. Jetzt beschäftigt die beiden Streifenposten vielmehr der Film, den sie am Abend zuvor gesehen haben. „Wiener Mädel" mit Willi Forst, Lizzi Holzschuh und Hans Moser. Darf ein Schauspieler nuscheln oder darf er nicht...
Ein Schuss kracht!
Sie werfen sich zu Boden. So etwas passiert in diesem Abschnitt nicht zum ersten Mal. Vermutlich ein Fanatiker, der voller Zorn ist. Vielleicht einer, dem man hier im Osten ein Unternehmen enteignet hat, der seinen Gutsbesitz für die Bodenreform hergeben musste, dem ein Angehöriger eingesperrt oder nach Sibirien transportiert worden ist. Die zwei jungen Männer im Gras wissen, dass es eine Menge Hass gibt in dieser Zeit und zu beiden Seiten dieser Grenze. Josef Heiliger denkt dabei an die Villa des Besitzers einer großen Brauerei. Seine Mutter hatte dort als Putzfrau ein paar Groschen verdient. Manchmal hat sie ihn dorthin mitgenommen. Es gab da einen Korridor, größer als die Mansardenwohnung der Heiligers. Er durfte da seine Schularbeiten machen. Hin und wieder, wenn der gleichaltrige Unternehmersohn seine Eisenbahn aufgebaut hatte, ließ er den Armeleutejungen mitspielen. Reinhold hieß der Junge. Sie hatten sich gut verstanden und wären vielleicht sogar richtige Freunde geworden, wenn Reinholds Eltern nicht dagegen gewesen wären. Die Brauerei war jetzt ein volkseigener Betrieb und die Villa ein Internat für Studenten. Womöglich ist das Reinhold dort drüben mit einer Knarre, geht es Josef Heiliger für einen Moment durch den Kopf. Ich würde es bestimmt auch nicht wie einen verlorenen Pfennig hinnehmen, wenn mir meine Brauerei und das Zuhause weggenommen würden ...
Ein zweiter Schuss!
Der Schütze steckt jenseits im Dickicht. Josef Heiliger bringt seinen Karabiner in Anschlag, obwohl er genau weiß, dass er selbst in Notwehr nicht hinüberschießen darf. Drüben bleibt es still. Er wendet den Blick, will seinem Gefährten etwas sagen und erschrickt. Das Blut weicht aus seinem Gesicht. Leblose Augen starren an ihm vorbei ins Leere ... Und immer denken, es geht mich nichts an? Josef Heiliger richtet sich auf. Er reibt die fieberwarme, schmerzende Stirn. Sein Blick wandert durch das Zimmer. Die Einrichtung stammt wahrscheinlich aus den Tagen der Eröffnung dieses Hauses. Zwei weiß lackierte Stahlrohrbetten, zwei einander gegenüberliegende Waschtoiletten samt Spiegeln, ein großer, wohl für beide Zimmerbewohner hingestellter Kleiderschrank, zwei Nachttische, ein großer Tisch mit zwei Stühlen. Blümchentapete und Plüschvorhang. Sehr, sehr hübsch das alles hier, würde Oma sagen. Zum ersten Mal seit seinem Aufenthalt hier in Hohenfels bringt Josef Heiliger ein Schmunzeln auf die Lippen.
Nach kurzem Überlegen wählt Josef Heiliger das linke Bett. Er öffnet den Koffer und beginnt mit dem Auspacken. Als erstes hängt er ein Bild an die Wand über dem Nachttisch, wo es schon einen kleinen Nagel für diesen Zweck gibt. Das Foto zeigt den Generalissimus Stalin beim Anzünden seiner Krummpfeife. Nun baut er Lektüre auf den Nachttisch. Lenins „Staat und Revolution", das „Kommunistische Manifest", „Wie der Stahl gehärtet wurde" von Nikolai Ostrowski. Wie immer beim Umgang mit Büchern, so kann er auch jetzt nicht umhin, wenigstens in eines hineinzuschauen. Er ist dabei, sich festzulesen, als ihn ein kurzes, energisches Klopfen an der Tür in die Gegenwart holt.
Oberschwester Walburga wartet keine Aufforderung ab und tritt sofort ein. Sie bringt ein Fieberthermometer mit, ein Krankenblatt und eine braune, faustgroße Flasche. Kontrollierend schaut sie sich im Zimmer um.
„Fiebermessen morgens und abends unter der Zunge, bitte. Das Krankenblatt führen Sie selbst ..." Der Blick verharrt etwas länger bei dem Stalinbild. Ihre Reaktion bleibt auf ein kaum wahrnehmbares Naserümpfen beschränkt. Sie achtet nicht darauf, dass der Patient mit einer schnellen, anscheinend flüchtigen Bewegung den Kofferdeckel schließt. Kühl reicht sie ihm das Fläschchen. „Diese Sputumflasche tragen Sie bitte immer bei sich, ja?!"
Josef Heiliger betrachtet das kleine Gefäß neugierig, aber zugleich auch mit einigem Missbehagen.
„Wozu?"
Die Oberschwester ist an den Tisch getreten. Sie legt ihre Hände auf den Kofferdeckel, wohl in der Absicht, beim Auspacken behilflich zu sein. In ihrer Stimme schwingt rügender Unterton mit.
„Ihr Auswurf! Sie sind ansteckend ... Aber bitte dezent, ja?"
„Dezent? Was?"
„Man benutzt es unauffällig, Herr Heiliger ..." Sie öffnet dabei den Koffer, hebt Wäsche heraus und - stutzt. Für ein paar Sekunden verschlägt es ihr die Sprache, was höchst selten passiert. Josef Heiliger, der weiterhin das ihm höchst unsympathische Fläschchen betrachtet, merkt nichts von diesem Verhalten. „Ich muss nie spucken, Oberschwester. Ehrlich! ... Oder ist das hier Pflicht?"
Die Oberschwester starrt immer noch in den Koffer. Sie kann nicht fassen, was sie da mühselig durch den Wald geschleppt hat.
„Herr Heiliger!!!"
Sie legt die Wäsche zur Seite und stellt sechs volle Bierflaschen auf den Tisch.
„Ich wollte ihn ja selbst tragen, Schwester ... Die Bücher, das Bier ..."
„Gegen Bücher haben wir hier, weiß Gott, gewiss nichts, Herr Heiliger."
Traurig schaut er zu, wie Oberschwester Walburga die Flaschen mit beiden Armen aufnimmt, damit zur Tür geht und dort verharrt. Sie hat kerne Hand für die Klinke frei. Es dauert einen Augenblick, bis ihm klar wird, was die Höflichkeit gebietet. Mit zwei schnellen Schritten ist er bei ihr und öffnet. Auf der Schwelle wendet sie sich noch einmal zu ihm um. Ihr Blick ist eisig wie ihre Stimme. „Wenn ich zurückkomme, liegen Sie im Bett!"
„Jetzt? Vor dem Mittagessen?"
„Zuerst drei Tage Bettruhe, das ist hier bei uns so üblich!"
Josef Heiliger glaubt, in ihren Augen einen Funken Boshaftigkeit blitzen zu sehen.
„Drei Tage?"
In ihrem feinen Schmunzeln wird die Schadenfreude jetzt deutlich.