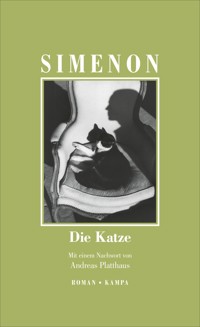
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georges Simenon. Die grossen Romane
- Sprache: Deutsch
Émile und Marguerite Bouin haben seit Jahren kein Wort miteinander gesprochen. Beide verwitwet, heirateten sie spät, um der Einsamkeit zu entgehen. Ein fataler Fehler, wie sie bald feststellten. Inzwischen sind sie einander verhasst. Er wirft ihr vor, seinen Kater vergiftet zu haben, den er schon geliebt hat, ehe er sie überhaupt kannte. Um es ihr heimzuzahlen, misshandelte er ihren Papa gei. Seither belauern auch sie sich wie Tiere, jede Geste, jeder Blick eine Waffe, die auf den anderen zielt. Die Atmosphäre in der Wohnung ist zum Schneiden. Manchmal schreiben sie sich grausame Nachrichten, die sie zu Kügelchen knüllen und einander zuschnipsen. Die meiste Zeit aber warten sie darauf, dass einer von ihnen stirbt. Bis Émile eines Tages genug hat und eine Entscheidung trifft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 108
Certes, ils préfèrent que je ne voie pas
certaines choses. Mais ce qu’il ne faut surtout pas,
c’est que je leur en raconte d’autres.
– Vous direz tout?
– Et vous?
– J’essaierai. Si je n’y parviens pas,
je m’en voudrais toute ma vie
Peuples qui ont faim, 1934
Georges Simenon
Die Katze
Roman
Mit einem Nachwort von Andreas Platthaus
Hansjürgen Wille | Barbara Klau | Cornelia Künne
Aus dem Französischen von Hansjürgen Wille, Barbara Klau und Cornelia Künne
Band 108
Certes, ils préfèrent que je ne voie pas
certaines choses. Mais ce qu’il ne faut surtout pas,
c’est que je leur en raconte d’autres.
– Vous direz tout?
– Et vous?
– J’essaierai. Si je n’y parviens pas,
je m’en voudrais toute ma vie
Peuples qui ont faim, 1934
Kampa
1
Die Zeitung war ihm aus den Händen geglitten, hattesich auf seinen Knien entfaltet und war dann auf den gebohnerten Fußboden gesegelt. Man hätte glauben können, er sei eingeschlafen, hätten sich seine Lider nicht immer wieder ein wenig geöffnet.
Ließ seine Frau sich täuschen? Sie saß strickend in ihrem niedrigen Sessel auf der anderen Seite des Kamins. Nie ließ sie sich anmerken, dass sie ihn beobachtete; aber er wusste schon lange, dass ihr nichts entging, nicht das leiseste Zucken seiner Muskeln.
Krachend fiel der Greifkorb mit dem stählernen Gebiss neben dem Betonmischer zu Boden. Jedes Mal erzitterte dabei das Haus, und jedes Mal fuhr die Frau zusammen und legte die Hand an die Brust, als träfe sie das längst vertraute Geräusch bis ins Mark.
Sie belauerten einander. Sie brauchten sich nicht anzusehen. Seit Jahren belauerten sie sich und erfanden immer neue Tricks bei ihrem Spiel.
Er lächelte. Die schwarze Marmoruhr mit den Bronzeverzierungen zeigte fünf Minuten vor fünf. Er bewegte die Lippen, als zählte er die Sekunden, die Minuten. Und er zählte wirklich. Auch er wartete darauf, dass der große Zeiger senkrecht stand. Der Lärm der Mischmaschine und des Krans würde schlagartig verstummen. Die Männer in ihrem Ölzeug, denen der Regen vom Gesicht und von den Händen tropfte, würden einen Augenblick innehalten und dann zur Baracke am Rand der Baustelle gehen.
Es war November. Ab vier Uhr arbeiteten sie im Licht von Scheinwerfern. Gleich würde es ausgehen, und mit einem Mal würde es dunkel und still sein, nur eine Gaslaterne würde noch die Sackgasse beleuchten.
Als Émile Bouin, dem in der Wärme die Beine eingeschlafen waren, die Augen halb öffnete, sah er die gelben und bläulichen Flammen, die von den Holzscheiten aufstiegen. Wie die Uhr und die vierarmigen Kerzenleuchter zu ihren beiden Seiten war auch der Kamin aus schwarzem Marmor.
Im Haus rührte sich nichts. Wie auf einem Foto oder auf einem Gemälde, dachte er. Nur Marguerites Hände bewegten sich, und man hörte das leise Klappern der Stricknadeln.
Drei Minuten vor fünf. Zwei Minuten. Einige Arbeiter gingen schon mit langsamen schweren Schritten zu der Baracke, um sich umzuziehen, aber der Kran war noch in Betrieb, und der Greifkorb schwebte ein letztes Mal mit einer Betonladung hinauf zum künftigen ersten Stock des Gebäudes.
Eine Minute vor fünf. Fünf Uhr. Der Zeiger zitterte zögernd auf dem bleichen Zifferblatt; in großen Abständen folgten fünf Schläge, als müsste alles langsam vonstattengehen in diesem Haus.
Marguerite seufzte und horchte gespannt in die plötzliche Stille draußen, die bis zum nächsten Morgen anhalten würde.
Émile Bouin dachte nach, lächelte vage vor sich hin und betrachtete durch die halb geschlossenen Lider die Flammen. Das unterste Holzscheit war nur noch ein geschwärztes Skelett, von dem Rauchfäden aufstiegen. Die beiden anderen glühten noch, aber ihr Knistern verkündete schon, dass auch sie bald in sich zusammenfallen würden.
Marguerite fragte sich, ob er aufstehen, neue Scheite aus dem Korb nehmen und sie ins Feuer legen würde.
Sie hatten sich beide an die Hitze des Kamins gewöhnt und genossen sie so lange, bis ihre Gesichter brannten und sie ihre Sessel etwas abrücken mussten.
Er lächelte weiter. Sein Lächeln galt nicht ihr, galt nicht dem Feuer, sondern einem Gedanken, der ihm gerade durch den Kopf gegangen war.
Er hatte es nicht eilig, ihn in die Tat umzusetzen. Sie hatten Zeit, beide, bis zu dem Moment, da einer von ihnen sterben würde. Wer würde der Erste sein? Bestimmt dachte auch Marguerite darüber nach. Sie dachten seit einigen Jahren mehrmals am Tag daran. Es war ihr wichtigstes Problem geworden.
Schließlich seufzte er ebenfalls. Er nahm die rechte Hand von der Lehne des Ledersessels, tastete nach der Tasche seiner Hausjacke und zog ein kleines Notizbuch heraus, das eine bedeutende Rolle in diesem Haus spielte. Die schmalen Seiten waren perforiert, sodass man drei Zentimeter breite Papierstreifen säuberlich herausreißen konnte.
Der Einband war rot. Ein winziger Bleistift steckte in einer Lederschlaufe.
War Marguerite zusammengezuckt? Fragte sie sich, was er ihr diesmal mitteilen würde?
Sie war daran gewöhnt, aber sie konnte nie wissen, was er schreiben würde.
Er blieb, den Bleistift in der Hand, absichtlich lange reglos sitzen, als würde er nachdenken.
Er hatte ihr nichts Besonderes mitzuteilen. Er wollte sie nur in Unruhe versetzen, in Atem halten, gerade dann, wenn der Lärm auf der Baustelle verstummte und Marguerite Erleichterung verspürte. Er hatte einige Einfälle, aber er verwarf sie einen nach dem anderen.
Der Rhythmus der Stricknadeln hatte sich verändert. Es war ihm gelungen, sie zu verunsichern oder jedenfalls ihre Neugier zu wecken.
Er kostete sein Vergnügen noch fünf Minuten aus, bis die Schritte eines Arbeiters zu hören waren, der sich dem Ende der Sackgasse näherte. Dann schrieb er in Druckbuchstaben:
Die Katze
Eine ganze Weile saß er reglos da, ehe er das Notizbuch, aus dem er den Papierstreifen herausgerissen hatte, wieder in die Tasche steckte.
Den Streifen faltete er so zusammen, wie es Kinder mit einem Blatt Papier tun, das sie mit einem Gummiband wegschnipsen wollen. Er brauchte kein Gummiband. Er hatte bei diesem Spiel eine erstaunliche, gleichsam machiavellistische Geschicklichkeit entwickelt.
Er nahm das Papier zwischen Daumen und Zeigefinger, krümmte den Daumen zu einem Abzughahn und beförderte die Botschaft in Marguerites Schoß.
Er verfehlte nie sein Ziel und triumphierte jedes Mal innerlich.
Marguerite würde sich nicht rühren, das wusste er. Sie würde so tun, als hätte sie nichts bemerkt, würde weiterstricken und dabei die Lippen wie zu einem Gebet bewegen, während sie lautlos die Maschen zählte.
Manchmal wartete sie, bis er das Zimmer verließ oder ihr den Rücken kehrte, um Holz nachzulegen.
Dann wieder ließ sie nach einigen Minuten scheinbarer Gleichgültigkeit die rechte Hand über ihre Schürze gleiten und ergriff das zusammengefaltete Papier.
Es gab immer wieder Variationen. Heute zum Beispiel wartete sie, bis alle Geräusche von der Baustelle verstummt waren und in die Sackgasse, an deren Ende sie wohnten, völlige Stille eingekehrt war.
Als hätte sie ihre Arbeit beendet, legte sie ihr Strickzeug auf einen Hocker und schloss halb die Augen, als wäre auch sie von der Wärme des Feuers ganz schläfrig geworden.
Erst sehr viel später tat sie so, als bemerkte sie plötzlich das gefaltete Papier auf ihrer Schürze, und nahm es zwischen ihre mit feinen Falten überzogenen Finger.
Man mochte glauben, sie würde es gleich ins Feuer werfen. Aber er wusste, das gehörte zur täglichen Komödie. Er ließ sich nicht täuschen.
In einem bestimmten Alter spielen Kinder Tag für Tag zur gleichen Zeit dasselbe Spiel, als wäre es ganz neu. Sie tun »als ob«.
Allerdings war Émile Bouin dreiundsiebzig Jahre alt und Marguerite einundsiebzig. Ihr Spiel dauerte schon vier Jahre, und sie wurden seiner offenbar nicht müde.
In dem stickigen und stillen Zimmer entfaltete die Frau schließlich das Papier und las, ohne die Brille aufzusetzen, die beiden Wörter, die der Mann darauf geschrieben hatte:
Die Katze
Sie rührte sich nicht, zuckte nicht mit der Wimper. Es hatte längere, überraschendere, dramatischere Botschaften gegeben, auch solche, die ein echtes Rätsel darstellten.
Diese war die banalste und kam am häufigsten vor, dann nämlich, wenn Émile Bouin keine andere Bosheit einfiel.
Sie warf das Papier in den Kamin, eine schmale Flamme loderte auf und erlosch gleich wieder. Die Hände auf dem Bauch, blieb sie still sitzen, und nichts regte sich mehr im Zimmer, außer den Flammen im Kamin.
Die Uhr zitterte und schlug ein Mal. Marguerite, klein und dünn, stand auf, als wäre das ein Zeichen.
Ihr Wollkleid war blassrosa wie ihre Wangen, die karierte Schürze hellblau. Ein paar blonde Strähnen durchzogen ihr weißes Haar.
Ihre Züge waren mit den Jahren spitz geworden. Für jene, die sie nicht kannten, spiegelten sich Sanftheit, Melancholie und Resignation in ihrem Gesicht.
»Eine so gute Frau!«
Émile Bouin grinste nicht. Sie waren nicht mehr in dem Alter, in dem man seine Gefühle deutlich zeigt. Ein Zucken, ein Verziehen der Mundwinkel, ein flüchtiges Aufleuchten der Augen genügten.
Sie blickte um sich, als überlegte sie, was zu tun sei. Er ahnte es, so wie man im Damespiel voraussieht, welchen Zug das Gegenüber machen wird.
Er hatte sich nicht getäuscht. Sie ging zum Käfig, einem großen blau-weißen Käfig mit goldenen Stäben. Ein buntgefiederter Papagei hockte wie erstarrt auf der Stange. Es dauerte eine Weile, ehe man entdeckte, dass er Glasaugen hatte und ausgestopft war.
Sie betrachtete ihn liebevoll, als ob er noch leben würde, und steckte einen Finger zwischen die Stäbe. Ihre Lippen bewegten sich wie vorhin, als sie die Maschen gezählt hatte.
Sie sprach mit dem Vogel. Man war fast darauf gefasst, dass sie ihn gleich füttern würde.
Er hatte geschrieben:
Die Katze
Sie antwortete ohne Worte:
Der Papagei
Die übliche Antwort.
Er beschuldigte sie, seinen Kater vergiftet zu haben, den er schon geliebt hatte, ehe er seine Frau kannte.
Jedes Mal, wenn er vor dem Fenster saß, eingehüllt in die Wärme, die von den brennenden Scheiten aufstieg, war er versucht, die Hand auszustrecken, um das weiche schwarzgestreifte Fell des Tiers zu streicheln, das früher, sobald er sich hingesetzt hatte, auf seinen Schoß gesprungen war.
»Eine ganz gewöhnliche Hauskatze«, hatte sie behauptet.
Damals, als sie noch miteinander sprachen. Meist nur, um einen Streit vom Zaun zu brechen.
Die Katze war zwar nicht reinrassig gewesen, aber auch keine gewöhnliche Hauskatze. Mit ihrem langen, geschmeidigen Körper strich sie an Wänden und Möbeln entlang, wie ein Tiger.
Sie hatte einen kleineren, dreieckigeren Kopf als eine Hauskatze, und ihr Blick war ruhig und geheimnisvoll.
Émile Bouin behauptete, sie sei eine Wildkatze, die sich nach Paris verirrt habe.
Er hatte das noch ganz junge Tier auf einer Baustelle gefunden, als er noch beim Pariser Straßenbauamt gearbeitet hatte. Damals war er Witwer und lebte allein. Das Tier war sein Gefährte geworden. Zu jener Zeit standen noch Häuser auf der anderen Seite der Sackgasse, dort, wo jetzt ein riesiges Mietshaus errichtet wurde.
Als er die Straßenseite gewechselt hatte, um Marguerite zu heiraten, war die Katze mitgekommen.
Die Katze
Eines Morgens hatte er sie im dunkelsten Winkel des Kellers gefunden.
Sie war vergiftet worden, mit dem Futter, das Marguerite ihr zubereitet hatte.
Das Tier hatte sich nie an Marguerite gewöhnt. Während der vier Jahre im Haus gegenüber hatte es sein Futter nur von Bouin genommen.
Zwei-, dreimal täglich folgte es seinem Herrn auf ein einfaches Schnalzen hin wie ein dressierter Hund durch die Sackgasse.
Bis zu dem Tag, an dem sie in ein neues Haus mit unbekannten Gerüchen gezogen waren, hatte nur Bouin seinen Kater gestreichelt.
»Er ist ein bisschen wild, aber er wird sich an dich gewöhnen.«
Das Tier hatte sich nicht an sie gewöhnt. Es blieb misstrauisch und ging nie zu Marguerite und auch nicht zu dem Käfig mit dem Papagei, einem großen bunten Ara, der nicht sprach, aber, wenn er in Wut geriet, schreckliche Schreie ausstieß.
Deine Katze …
Dein Papagei …
Marguerite war sanft, ja fast zuckrig gewesen. Man konnte sich vorstellen, wie schlank und rank sie in ihrer Jugend gewesen war, dass sie schon damals Pastellfarben trug und einen großen Strohhut auf dem Kopf, wenn sie verträumt, einen Sonnenschirm in der Hand, am Ufer eines Flusses spazieren ging.
Im Esszimmer gab es eine Fotografie, die sie so zeigte.
Sie war immer noch schlank, nur ihre Beine waren ein wenig angeschwollen. Und sie hatte immer noch dieses allzu sanfte Lächeln wie auf dem Foto.
Die Katze und der Papagei, die eine so misstrauisch wie der andere, beobachteten sich nur von fern und nicht ohne einen gewissen Respekt. Wenn die Katze auf dem Schoß ihres Herrn zu schnurren begann, erstarrte der Papagei und blickte sie mit großen runden Augen an, als würde ihn das regelmäßige monotone Geräusch ver-blüffen.
Wusste die Katze, welche Macht sie über den Papagei hatte? Spähte sie nicht unter halb geschlossenen Lidern befriedigt zu ihm hin?
Sie saß nicht in einem Käfig. Sie teilte die wohlige Wärme mit ihrem Herrn, und er beschützte sie.
Stets kam der Augenblick, da der Papagei es satthatte, ein unlösbares Problem zu wälzen, da er die Nerven verlor und in Wut geriet. Sein Gefieder sträubte sich, sein Hals reckte sich, als gäbe es keine Stäbe um ihn her, als würde er sich gleich auf seinen Feind stürzen, und seine schrillen Schreie hallten durchs Haus.
Dann sagte Marguerite:
»Es wäre besser, du würdest uns einen Augenblick allein lassen.«
Uns, das waren sie und ihr Tier.
Die Katze zitterte, da sie wusste, dass man sie in das kalte Esszimmer tragen würde, wo Bouin sich in einen anderen Sessel setzte.
Marguerite öffnete den Käfig und sprach zärtlich mit ihrem Papagei, wie mit einem Liebhaber oder einem Sohn, ehe sie sich wieder in ihren Sessel setzte.
Der Papagei blickte zur geschlossenen Tür und lauschte, um sicher zu sein, dass keine Gefahr drohte, dass die beiden Fremden, der Mann und sein Tier, ihn nicht mehr bedrohen, sich nicht mehr über ihn lustig machen konnten.
Schließlich sprang er mit einem großen Satz auf die Lehne eines Stuhls; fliegen konnte er nicht. Nach zwei, drei weiteren Sprüngen hatte er endlich seine Herrin erreicht und setzte sich auf ihre Schulter.
Sie strickte. Das Spiel der blitzenden Nadeln faszinierte ihn. Wenn er davon genug hatte, rieb er seinen riesigen Schnabel an der Wange der Frau und dann an der zarten Haut hinter dem Ohr.
Deine Katze
Dein Papagei
Die Minuten zogen dahin. Émile war im Esszimmer und Marguerite im Wohnzimmer, bis die Marmoruhr ihr sagte, dass es Zeit war, das Essen vorzubereiten.
Damals kochte sie noch für sie beide.
Émile bestand darauf, das Futter für die Katze selbst zuzubereiten. Als er einmal die Grippe hatte und drei Tage das Bett hüten musste, hatte sie die Gelegenheit genutzt und Innereien beim Metzger gekauft, sie in Stücke geschnitten, gekocht und mit Reis und Gemüse vermischt.
»Hat sie gefressen?«
Marguerite hatte gezögert.
»Nicht gleich.«
»Aber dann doch?«
»Ja.«
Er war fast sicher, dass sie log. Am nächsten Tag hatte er 39 Grad Fieber, und sie hatte ihm das Gleiche gesagt. Während sie am folgenden Tag in der Rue Saint-Jacques Besorgungen machte, ging er im Morgenrock hinunter. Unter dem Spülstein fand er das Futter vom Vortag, unangerührt.
Die Katze, die ihm gefolgt war, sah ihn vorwurfsvoll an. Émile mischte das Futter neu und stellte ihr den Napf hin. Sie fraß nicht sofort.
Als Marguerite zurückkam, war der Napf leer und die Katze nicht mehr im Erdgeschoss, sondern im Schlafzimmer im ersten Stock, wo sie zu Füßen ihres Herrn lag.
Dort schlief sie jede Nacht.
»Das ist unhygienisch«, hatte Marguerite an den ersten Abenden gesagt.
»Die Katze schläft seit Jahren bei mir, und ich bin davon nicht krank geworden.«
»Sie schnarcht so laut, dass ich nicht schlafen kann.«
»Sie schnarcht nicht, sie schnurrt. Man gewöhnt sich daran. Ich habe mich auch daran gewöhnt.«
Teilweise hatte sie recht. Die Katze schnurrte nicht so wie andere Katzen. Es war mehr ein Schnarchen, wie das eines Mannes, der zu viel getrunken hat.
Jetzt stand sie vor dem Käfig, betrachtete den ausgestopften Papagei und bewegte dabei die Lippen, als würde sie ihm liebevolle Worte sagen.
Émile, der ihr halb den Rücken zuwandte, brauchte nicht hinzusehen.
Er kannte diese Komödie so gut wie alle ihre Komödien. Er lächelte vor sich hin und blickte weiter auf die verglimmenden Scheite. Schließlich stand er auf, um zwei neue zu holen. Er legte sie in die Glut und schob sie mit dem Schürhaken zurecht.
Von draußen war nichts mehr zu hören, außer dem Rauschen des Regens und dem dünnen Wasserstrahl im Marmorbecken des Brunnens.
In der Sackgasse standen sieben gleiche Häuser nebeneinander. Jedes hatte eine Tür in der Mitte, rechts davon waren die Fenster des Wohnzimmers und links die des Esszimmers, hinter dem die Küche lag. Die Schlafzimmer befanden sich im ersten Stock.
Genau solche Häuser hatten bis vor zwei Jahren auch auf der anderen Straßenseite gestanden. Es waren die mit den geraden Nummern gewesen. Die riesige Abrissbirne hatte sie zur Strecke gebracht wie Kartenhäuser, und jetzt sah man dort nur noch eine Baustelle mit Kränen, Eisenträgern, Balken, Brettern und Karren.
Drei Anwohner besaßen ein Auto. Selbst bei geschlossenen Läden hörte man abends, ob jemand ausging, und von außen konnte man sehen, in welchem Zimmer die Leute sich aufhielten.
Nur wenige Mieter zogen ihre Vorhänge zu. Man sah die Ehepaare und die Familien bei Tisch, einen Mann mit Stirnglatze, der in seinem Sessel unter einem Bild mit fleckigem Goldrahmen las, ein Kind, das über ein Heft gebeugt an seinem Bleistift lutschte, eine Frau, die das Gemüse für den nächsten Tag putzte.
Alles wirkte weich, milde, gedämpft. Und den Brunnen hörte man eigentlich nur, wenn man im Bett lag und das Licht aus war.
Das Haus der Bouins, das immer noch das Haus der Doises genannt wurde, war das letzte in der Reihe und grenzte an die hohe Mauer, die die Sackgasse abschloss. Am Fuß dieser Mauer stand eine Bronzestatue, eine Putte mit einem Fisch in der Hand. Ein dünner Wasserstrahl, der aus dem Maul des Fisches floss, fiel in eine Marmormuschel.
Marguerite hatte sich wieder ans Fenster gesetzt. Sie strickte nicht mehr. Die silberne Brille auf der Nase, blätterte sie in der Zeitung, die sie neben dem Sessel ihres Mannes vom Boden aufgehoben hatte.
Die schwarzen Zeiger der Uhr rückten langsam vor. Zu jeder vollen und jeder halben Stunde vernahm man ihr zögerndes Zittern.
Émile las nicht, betrachtete nichts, hatte die Augen geschlossen, dachte vielleicht nach oder schlummerte. Manchmal bewegte er die von der Hitze steifen Beine. Erst als die Uhr sieben schlug, erhob er sich langsam und ging zur Tür, ohne den ausgestopften Papagei in seinem Käfig oder seine Frau anzusehen.
Im Flur war es dunkel. Links war die Haustür mit dem leeren Briefkasten in der Mitte, rechts die Treppe nach oben.
Er machte Licht, schloss die Tür hinter sich und öffnete die Tür zum Esszimmer, in dem es eiskalt war.
Das Haus hatte Zentralheizung, aber sie wurde nur an sehr kalten Tagen angestellt. Außerdem wurde das Esszimmer nicht mehr benutzt. Das Ehepaar aß in der Küche, wo der Gasherd ausreichend Wärme verbreitete.
Sorgfältig und planmäßig schaltete Bouin das Licht im Flur aus, schloss die Esszimmertür hinter sich, ging in die Küche, machte dort Licht und schaltete dann die Lampe im Esszimmer aus.
Er hatte sich die Sparsamkeit seiner Frau zu eigen gemacht, aber es gab noch einen anderen Grund für sein Verhalten.
Er wusste, dass in dem Augenblick, da er von seinem Sessel aufgestanden war, Marguerite sich in ihrem zu rühren begann. Sie wollte ihm nicht gleich nachgehen; sie wartete ein Weilchen. Wenn sie ihrerseits mit einem Seufzer aufstand, würde sie, nachdem sie die Lampe im Wohnzimmer gelöscht hatte, im Flur das Licht erst anmachen müssen, es dann wieder ausmachen und jede Tür hinter sich schließen.
Das alles war zu einem Ritual geworden und hatte einen mehr oder weniger geheimen Sinn.
In der Küche zog Émile Bouin einen Schlüssel aus der Tasche, um den Schrank rechts zu öffnen, denn es gab zwei Küchenschränke. Der links, der ältere aus Pitchpine, hatte dort schon gestanden, als Marguerites Vater noch lebte.
Der weißgestrichene rechts gehörte Bouin. Er hatte ihn am Boulevard Barbès gekauft.
Er nahm ein Kotelett, etwas gekochten Chicorée und eine Zwiebel heraus, die mittags übrig geblieben waren und die er in eine Schale gelegt hatte, ferner eine halb volle Flasche Rotwein, aus der er sich ein Glas einschenkte, und schließlich seine Butter, sein Öl und seinen Essig.
Nachdem er das Gas angezündet hatte, ließ er ein Stückchen Butter schmelzen, schnitt die Zwiebel klein, briet sie goldbraun und legte dann das Kotelett in die Pfanne.
Marguerite, die in der Tür erschienen war, tat so, als sähe sie ihn gar nicht, als würde sie nur den beißenden Zwiebelgeruch wahrnehmen, der ihr in die Nase stieg. Auch sie nahm einen Schlüssel heraus – er steckte in ihrem Gürtel – und öffnete dann ihren Küchenschrank.
Die Küche war nicht groß, und der Tisch nahm viel Platz ein. Sie mussten sich vorsichtig bewegen, um sich aus dem Weg zu gehen. Aber sie waren so geübt darin, dass sie sich fast nie berührten.
Sie benutzten keine Tischdecke mehr, begnügten sich mit einem karierten Wachstuch.
Auch Marguerite hatte ihre Flasche. Sie trank keinen Wein, sondern ein Stärkungsmittel, das zu Anfang des Jahrhunderts in Mode gewesen war und das ihr Vater ihr mittags und abends gegeben hatte, als sie noch ein blutarmes junges Mädchen gewesen war.
Auf dem altmodischen Etikett sah man schwer zu identifizierende Blätter und in verschnörkelten Buchstaben die Aufschrift Alpentrunk.
Sie füllte ein kleines Likörglas und tauchte genießerisch die Lippen hinein.
Als das Kotelett gebraten war und der Chicorée aufgewärmt, tat er alles auf einen Teller und setzte sich an das eine Ende des Tischs vor seine Flasche, sein Brot, seinen Salat, seinen Käse und seine Butter.
Marguerite, scheinbar gleichgültig seinem Essen gegenüber, platzierte ihr eigenes Essen auf der anderen Seite des Tischs: eine Scheibe Schinken, zwei kalte Kartoffeln, die sie in Aluminiumfolie im Kühlschrank aufbewahrt hatte, und zwei dünne Scheiben Brot.
Ihr Mann war ihr mit dem Essen voraus. Manchmal setzte der eine sich zu Tisch, wenn der andere schon fertig war. Aber das war unwichtig, da sie ohnehin keine Notiz voneinander nahmen.
Sie aßen schweigend, wie sie alles schweigend taten.
Bouin war sicher, dass seine Frau dachte:
›Jetzt isst er schon wieder zweimal am Tag Fleisch, und er brät absichtlich Zwiebeln.‹
Das stimmte nur zum Teil. Er aß gern Zwiebeln, aber er hatte nicht unbedingt jeden Tag Appetit darauf.
Um sie zu ärgern, nahm er sich manchmal komplizierte Gerichte vor, deren Zubereitung eine Stunde oder länger dauerte. Für ihn hatte das einen Sinn. So zeigte er, dass er nichts von seinem Appetit verloren hatte, dass er immer noch gern und viel aß, dass es ihm nichts ausmachte, sich um sein Essen selbst zu kümmern.
Dann wieder brachte er Kutteln mit, deren Anblick allein seiner Frau Übelkeit bereitete.
Sie dagegen aß abends, als wollte sie so ihre Genügsamkeit betonen, nur eine Scheibe Schinken oder etwas kalten Kalbsbraten, ein Stück Käse oder manchmal eine oder zwei Kartoffeln, die vom Mittagessen übrig geblieben waren.
Auch das hatte einen Sinn. Erstens wollte sie damit zeigen, dass er für sein Essen mehr Geld ausgab als sie für ihres; zweitens wollte sie die Pfanne nicht nach ihm benutzen. Wenn es gar nicht anders ging, wartete sie, bis er sie abgewaschen hatte, auch wenn sie dann erst viel später essen konnte.
Sie kauten langsam. Sie wie eine Maus, mit kaum wahrnehmbaren Bewegungen des Kiefers; er dagegen schmatzte befriedigt.
›Siehst du, deine Anwesenheit stört mich nicht im Geringsten … Du hast wohl gedacht, du könntest mich bestrafen, mich fertigmachen, aber es geht mir ausgezeichnet. Und meinen Appetit habe ich auch nicht verloren.‹
Ihr Dialog war natürlich stumm, aber sie kannten sich zu gut, um nicht jedes Wort, jede Absicht zu erraten.
›Du bist ordinär. Du isst unmanierlich und stopfst dich mit Zwiebeln voll wie ein Prolet … Ich habe immer den Appetit eines Vogels gehabt. Darum nannte mich mein Vater Vögelchen. Und mein erster Mann, der ja nicht nur Musiker, sondern auch Dichter war, nannte mich seine zarte Taube.‹
Sie lachte, nicht äußerlich, innerlich. Er merkte es trotzdem.
›Aber er ist gestorben, der Arme. Von uns beiden war er der Zarte …‹
Kaum streifte ihr Blick ihren zweiten Mann, da verhärtete sich ihre Miene auch schon.
›Und du, der du dich für so stark hältst, wirst auch vor mir sterben.‹
›Ich wäre schon längst tot, wenn ich mich hätte unterkriegen lassen. Erinnerst du dich an die Dose im Keller?‹
Er lachte ebenfalls innerlich. Auch wenn sie sich gegenseitig zur Stummheit verurteilt hatten, tauschten sie doch unentwegt bissige Bemerkungen aus.
›Wart nur, ich werde dir dein Essen schon noch madig machen!‹
Er zog sein Notizbuch aus der Tasche, schrieb vier Wörter auf, riss den Papierstreifen heraus und ließ ihn auf den Teller seiner Frau segeln.
Gleichmütig faltete sie den Zettel auseinander.
Vorsicht mit der Butter
Gegen ihren Willen erstarrte sie. Sie hatte sich nie an diesen Scherz gewöhnen können. Sie wusste, die Butter war nicht vergiftet, denn sie schloss sie in ihrem Küchenschrank ein, obwohl sie dort weich wurde, manchmal fast flüssig.
Trotzdem kostete es sie Überwindung, weiter davon zu essen.
Sie würde sich später rächen. Sie wusste noch nicht, wie. Sie hatte Zeit, darüber nachzudenken. Keiner von ihnen hatte irgendetwas zu tun.
›Du vergisst, ich bin eine Frau, und eine Frau hat immer das letzte Wort. Außerdem leben Frauen drei bis fünf Jahre länger als Männer. Man braucht nur die Witwen zu zählen. Es gibt viel mehr Witwen als Witwer.‹
Er war schon Witwer gewesen, aber wegen eines Unfalls. Das zählte nicht. Seine Frau war auf dem Boulevard Saint-Michel von einem Bus überfahren worden. Sie war nicht sofort tot gewesen, sondern zwei Jahre lang dahingesiecht. Damals arbeitete er noch. Wenn er abends nach Hause kam, musste er sich um sie kümmern und um den Haushalt.
›Sie hat sich prächtig gerächt, was?‹
Pause. Stille. Regen im Hof.





























