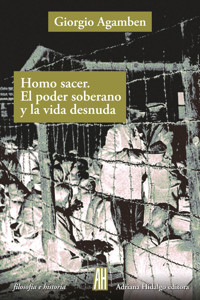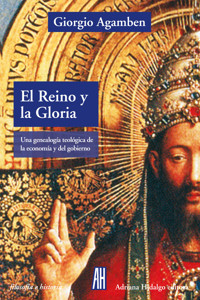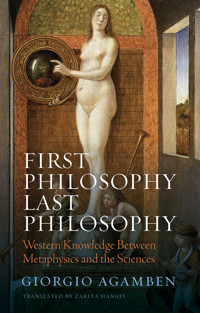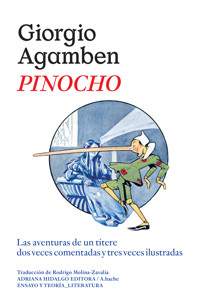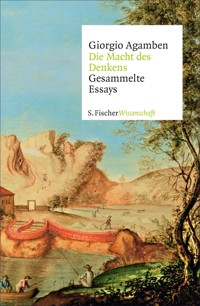
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Neben seinen großen Büchern hat der international bekannte Philosoph Giorgio Agamben kleinere Texte und Essays verfasst, die ebenso nachhaltig die jeweiligen Diskussionen beflügelt haben. Die wichtigsten aus den letzten 20 Jahren hat er in einem Buch versammelt, das nun zum ersten Mail vollständig auf Deutsch vorliegt. Darin begegnen uns alle Motive seines Denkens in überraschender, neuer Form: Ob es sich um die Auseinandersetzung mit Walter Benjamin, Aby Warburg, Max Kommerell oder Martin Heidegger handelt oder um Themen wie Ursprung und Vergessen, Bildlichkeit, Immanenz und Faktizität, immer gelingt es Agamben, seinem Gegenstand ungewöhnliche und überraschende Einsichten abzugewinnen – ein Meister auch der kleinen Form.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Giorgio Agamben
Die Macht des Denkens
Gesammelte Essays
Übersetzt von Francesca Raimondi
Fischer e-books
Inhalt
I.Sprache
Die Sache selbst
Für Jacques Derrida im Andenken an Giorgio Pasquali
Der Ausdruck »die Sache selbst«, to pragma auto, taucht am Anfang der sogenannten philosophischen Digression im Siebten platonischen Brief auf, ein Text, dessen Bedeutung für die Geschichte der abendländischen Philosophie bei weitem noch nicht vollständig erfasst wurde. Nachdem Bentley einen Fälschungsverdacht über die gesamte antike Epistolographie geäußert hatte und zuerst Meiners 1783, dann auch Karsten und Ast die platonischen Briefe für unecht erklärten, wurden diese – die stets als ein wesentlicher Bestandteil des Werkes galten – allmählich aus der philosophischen Geschichtsschreibung verbannt, und zwar gerade zu einer Zeit, als sich in der Historiographie besonders viel bewegte. Als sich in unserem Jahrhundert die Tendenz umzukehren begann und immer zahlreichere und angesehenere Kritiker die Echtheit der Briefe verbürgten (die inzwischen, zumindest für den uns hier interessierenden Brief, allgemein anerkannt ist), mussten die Philosophen und Forscher, die sich nun wieder mit ihnen befassten, für die mehr als ein Jahrhundert andauernde Isolierung der Briefe büßen. Was verlorenging, war die lebendige Verbindung zwischen dem Text und der nachfolgenden philosophischen Tradition. Daher erschien beispielsweise der Siebte Brief mit seinem dichten philosophischen excursus wie ein schweres, isoliertes Massiv, das jedem Versuch einer Durchdringung standhielt. Aber es stimmt natürlich auch, dass die lange Isolierung – wie das Meer den Körper von Alonso in Ariels Lied – die Briefe in etwas Reiches und Sonderbares verwandelt hatte, dem deshalb, wie keinem der anderen großen platonischen Texte, unvoreingenommen begegnet werden konnte.
Das Szenario des Briefes ist bekannt: Platon, nunmehr alt – er ist fünfundsiebzig –, erinnert sich für Dions Freunde an seine Begegnungen mit Dionysios und an das abenteuerliche Scheitern seiner politischen Bemühungen in Sizilien. An der Stelle, die uns hier interessiert, erzählt er gerade den Anhängern Dions von seinem dritten Aufenthalt in Sizilien. Vom inständigen Drängen des Tyrannen gelockt, trifft er erneut in Syrakus ein und beschließt dort als Erstes, Dionysios auf die Probe zu stellen, ob er es denn in seinem Wunsch, Philosoph zu werden, ernst meine:
Es gibt eine Art, dies auf die Probe zu stellen, die nicht niederträchtig ist – eine Weise, die sich sogar wunderbar für Tyrannen eignet, besonders, wenn sie voll mit Wissen aus zweiter Hand sind; und gleich bei meiner Ankunft merkte ich, dass dies eben Dionysios’ Zustand war. (340 b 3–7)
Menschen wie diesen, so fährt er fort, müsse man sofort zeigen, was die ganze Sache ist (hoti esti pan to pragma), wie viele und welche Anstrengungen sie erfordert. Hört ein wahrer Philosoph zu und ist er der Sache gewachsen, dann wird er denken, von einem wunderbaren Weg gehört zu haben, den man unverzüglich einschlagen sollte, und nicht anders leben zu können. Jene dagegen, die keine wahren Philosophen sind und nur einen oberflächlichen Anstrich von Philosophie besitzen, so wie jemand, dessen Körper von der Sonne gebräunt ist, denken beim Einsatz, den die Sache verlangt, dass er viel zu schwer, sogar unmöglich sei, und geben sich der Überzeugung hin, bereits genug zu wissen und nichts weiter zu benötigen.
Auf diese Weise sagte ich Dionysios damals, was ich ihm sagte, erklärte ihm aber nicht alles, noch bat mich Dionysios auch darum. Er nahm an, viele Sachen und gerade die bedeutendsten schon zu wissen und sie hinreichend zu beherrschen auf Grund der beiläufigen Erzählungen anderer. Später, so habe ich gehört, verfasste er auch eine Schrift über das, was er von mir gehört hatte, die er als sein Werk vorstellte und nicht als eine von mir gehörte Rede. Darüber weiß ich jedoch nichts. Ich weiß aber, dass auch andere diese Sachen geschrieben haben, doch dass jene, die dies getan haben, nicht einmal sich selbst kennen. Das zumindest kann ich wahrlich über alle sagen, die darüber geschrieben haben und noch in Zukunft schreiben werden: jene, die zu kennen behaupten, worüber ich mir Gedanken mache [peri hōn egō spoudazō], ob sie es nun von mir gehört oder von anderen oder ob sie es allein herausgefunden haben: Nun, es ist unmöglich, meiner Auffassung nach, dass sie von der Sache irgendwas verstanden haben. (341 a 7–c 4)
An dieser Stelle taucht nun der Ausdruck to pragma auto auf, die Sache selbst – eine so prägnante Formulierung für die Sache des Denkens und für die eigentliche Aufgabe der Philosophie, dass wir ihr mehr als zweitausend Jahre später wie einer Losung wieder begegnen, die von Kant zu Hegel und von Husserl zu Heidegger weitergereicht wird:
Über diese Sache gibt es keine Schrift von mir und kann es auch niemals eine geben. Sie lässt sich nämlich keineswegs in Worte fassen wie andere Lerngegenstände [mathēmata], sondern nur nachdem man viel gemeinsamen Umgang mit der Sache selbst [peri to pragma auto] gepflegt hat und aus vielem gemeinsamen Leben entsteht sie plötzlich in der Seele, wie ein Licht, das einem Feuer entsprungen ist, und nährt sich dann schon aus sich heraus weiter [auto heauto ēdē trephei]. (341 c 4–d 2)
Dieser Passus ist unzählige Male als Beweis für die esoterischen Interpretationen Platons und für die Existenz einer ungeschriebenen Lehre zitiert worden. Dieser Interpretation zufolge enthielten die Dialoge, die sich unsere Kultur über Jahrhunderte als ehrwürdiges Erbe überliefert hat, nicht das, was Platon ernsthaft beschäftigte, denn dies sei einzig der mündlichen Tradierung vorbehalten gewesen! Wir möchten uns hier aber nicht so sehr zu diesem sicherlich wichtigen Problem positionieren, sondern vielmehr fragen, was jene »Sache selbst« ist, über die sich Platon Gedanken machte und von der Dionysios zu Unrecht annahm, sie verstanden zu haben. Was genau ist die Sache des Denkens?
Eine Antwort auf diese Frage kann nur durch eine aufmerksame Lektüre des darauffolgenden Passus erfolgen, den Platon als »eine Erzählung und ein Umherschweifen« [mythos kai planos] (344 d 3) kennzeichnet und zugleich als »eine wahre Rede, [die ich] auch früher schon oft dargestellt habe, aber die ich wohl jetzt noch einmal aussprechen muss« (342 a 3–7). Erst in der Interpretation dieses »sonderbaren Mythos« kann sich das Denken auf die Probe stellen und sich über seine »Sache« klarwerden. Versuchen wir also, den Mythos zu lesen:
Für jedes Seiende gibt es drei, über die sich das Wissen einstellen muss, das Vierte ist das Wissen selbst, als Fünftes muss man das ansetzen, was erkennbar und das wahrhaft Seiende ist. Das Erste ist der Name, das Zweite die definitorische Rede [logos], das Dritte ist das Abbild, das Vierte ist das Wissen. Wenn Du das Gesagte verstehen willst, nimm Dir ein Beispiel und denk Dir, es verhalte sich bei allem so. Es gibt etwas, was wir Kreis nennen [kyklos estin ti legomenon], dessen Namen eben jener ist, den wir gerade aussprachen. Das Zweite ist sein logos, das aus Namen und Verben zusammengesetzt ist: »Das, was von seinen äußersten Punkten zur Mitte überall gleich entfernt ist«, das wäre der logos dessen, was den Namen Rund, Ring oder Kreis trägt. Das Dritte ist das, was gemalt und wieder ausgewischt, gedrechselt und wieder zerstört wird, aber von all dem erleidet der Kreis selbst [autos ho kyklos, hier Beispiel für die Sache selbst], um den es hier geht, nichts, denn er ist etwas anderes als das. Das Vierte ist das Wissen und der nous und die wahre Meinung über diese Sachen; und alles dies muss als eine einzige Sache gedacht werden, da es nicht in den Lauten [en phōnais] und nicht in den körperlichen Gestalten [en sōmatōn schēmasin], sondern in den Seelen [en psychais] ist; dadurch ist klar, dass es etwas anderes ist als die Natur des Kreises an sich und als die drei, von denen die Rede war. Von diesen kommt der nous aufgrund seiner Verwandtschaft und Ähnlichkeit dem Fünften am nächsten, die anderen bleiben weiter von ihm entfernt. Dasselbe gilt von der geraden wie der gebogenen Gestalt und von der Farbe, dem Guten und Schönen und Gerechten und von jedem angefertigten oder natürlich entstandenen Körper, vom Feuer, vom Wasser und allen derartigen Sachen, von jeglichem Lebewesen und vom ēthos in der Seele und von allen Erzeugnissen [poiēmata] und Leidenschaften [pathēmata]. Wenn man für jede Sache diese vier nicht erfasst hat, wird man niemals vollkommen am Wissen des Fünften teilhaben können. Außerdem verdeutlichen die ersten vier aufgrund der Schwäche der Sprache [dia to tōn logōn asthenes] sowohl die Eigenschaft [to poion ti] eines Gegenstandes als auch dessen Sein. Aus diesem Grund wird niemand, der Verstand hat, seine Gedanken der Sprache anvertrauen, umso mehr, wenn es sich um eine unbewegliche Rede wie jene in Buchstaben geschriebene handelt. (342 a 8–343 a 3)
Halten wir hier einen Augenblick an, um Luft zu holen. Angesichts dieses außerordentlichen excursus, der die letzte und deutlichste Darstellung der Ideenlehre enthält, können wir den Schaden ermessen, den der Fälschungsverdacht, der im letzten Jahrhundert über den platonischen Briefen lastete, in der philosophischen Geschichtsschreibung angerichtet hat. Es ist nicht meine Absicht, dieses unwegsame Massiv zu erklimmen. Gleichwohl lohnt sich der Versuch, ein erstes Lager an dessen Hang aufzuschlagen, um die Schwierigkeiten des Aufstiegs aufzuzeigen und um es innerhalb des ihn umgebenden Gebirges zu verorten.
Eine erste Beobachtung, die wir anstellen können (wie u.a. Pasquali es auch bereits getan hat), betrifft den Status der Unsagbarkeit, welchen die esoterische Lesart der Sache selbst zuschreibt. Bereits aus dem Kontext ergibt sich eine Abschwächung jenes Status in dem Sinne, als dass es sich bei der Sache selbst um nichts handelt, was die Sprache absolut transzendiert und von ihr vollkommen losgelöst ist. Platon behauptet vielmehr ausdrücklich, dass, »wenn man diese vier nicht aufnimmt« (die, wir erinnern uns, u.a. Name und logos umfassen), man niemals in der Lage sein wird, das Fünfte vollkommen zu erkennen. In einer anderen wichtigen Passage des Briefes schreibt er, dass sich die Erkenntnis der Sache selbst plötzlich entzündet, wenn »Namen, logoi, Bilder und Wahrnehmungen aneinander gerieben werden, und wenn sie in wohlwollenden Widerlegungen und in Diskussionen, die ohne Missgunst geführt werden, auf die Probe gestellt werden« (344 b 4–7).
Diese eindeutigen Aussagen entsprechen im Übrigen dem sehr engen Verhältnis zwischen Ideen und Sprache, wie es durch die platonischen Dialoge nahegelegt wird. Als Sokrates im Phaidon die Genese der Ideenlehre darlegt, sagt er: »Es schien mir demnach notwendig, zu den logoi meine Zuflucht zu nehmen, um in ihnen die Wahrheit des Seienden zu finden« (99 e 4–6); andernorts stellt er die Verachtung der logoi, die Misologie, als das schlimmste aller Übel (89 d 2) und den Verlust der Sprache als den Verlust der Philosophie (Soph., 260 a 6–7) dar, während er im Parmenides die Ideen als das, »was man am ehesten mit logos erfaßt« (135 e 3), definiert. Und behauptet nicht auch Aristoteles in seiner historischen Rekonstruktion des platonischen Denkens am Anfang der Metaphysik, dass die Ideenlehre aus einer skepsis en tois logois, aus einer Untersuchung im Bereich der Sprache hervorgegangen sei (987 b 33)?
Die Sache selbst hat daher in der Sprache ihren eminenten Ort, obgleich die Sprache ihr, wie Platon sagt, aufgrund ihrer Schwäche auch nicht ohne weiteres angemessen ist. Man könnte, offensichtlich paradox, sagen, dass die Sache selbst, obwohl sie die Sprache in gewisser Weise transzendiert, nur in Sprache und durch Sprache möglich ist, dass also die Sache selbst eine Sache der Sprache ist. Wenn Platon sagt, dass das, was sein Denken umtreibt, nicht sagbar sei wie die anderen mathēmata, sollte man die Betonung auf Letzteres legen: Es ist nicht sagbar wie die anderen Lerngegenstände und deshalb auch nicht einfach nur unsagbar. Es sind eben ethische und nicht bloß logische Gründe, wie Platon unermüdlich wiederholt (Ep.VII, 341 e 1–5), die davon abhalten, die Sache selbst dem geschriebenen Wort anzuvertrauen. Die platonische Mystik – wenn es sie denn überhaupt gibt – ist, wie jede authentische Mystik, tief in die logoi verstrickt.
Nach dieser einleitenden Anmerkung können wir nun die Aufzählung näher betrachten, die in der Digression enthalten ist. Die Identifizierung der ersten vier Bestimmungen bereitet keine besonderen Schwierigkeiten: der Name, die Definition, das Abbild (das hier den sinnlichen Gegenstand bezeichnet) und schließlich das Wissen, dass sich durch jene einstellt. Onoma, der Name, ist in modernen Begriffen ausgedrückt – die übrigens auf die stoische Logik zurückführbar sind – der Signifikant; der logos ist das Signifikat bzw. die virtuelle Referenz; das Abbild ist das Denotat bzw. die aktuelle Referenz.
Die einzelnen Bestimmungen sind uns vertraut, auch wenn man nicht vergessen darf, dass erst in der Sophistik und bei Platon jene Reflexion über die Sprache ansetzt, die später zu den präzisen logisch-grammatischen Konstruktionen der Stoa und der hellenistischen Schulen führen wird. Wie im Buch X der Nomoi oder im letzten Teil des Sophistes stellt Platon auch hier eine Theorie der sprachlichen Bedeutung in ihrer Beziehung zur Erkenntnis dar. Die Schwierigkeit beginnt natürlich mit der fünften Bestimmung, durch die ein neues Element in die uns geläufigen Bedeutungstheorien eingeführt wird. Lesen wir die Passage daher noch einmal: »Für jedes Seiende gibt es drei, über die sich das Wissen einstellen muss, das Vierte ist das Wissen selbst, als Fünftes muss man das ansetzen, was erkennbar und das wahrhaft Seiende ist.« Mit dem »Fünften« scheint hier genau jenes Seiende gemeint zu sein, mit dem die Rede beginnt und von dem ausgesagt wird: »Für jedes Seiende gibt es drei …«. Die Sache selbst wäre demnach einfach der Gegenstand der Erkenntnis, was jene Interpretation des Platonismus (die schon bei Aristoteles am Werk ist) bestätigen würde, welche die Idee lediglich für ein überflüssiges Duplikat der Sache hält. Des Weiteren erwiese sich die Aufzählung als zirkulär, weil das, was hier an letzter Stelle genannt wird, in Wahrheit das Erstgenannte und somit die Voraussetzung ist, von der die gesamte Rede ihren Ausgang nimmt.
Vielleicht kann uns die philologische Achtsamkeit für die Details hier behilflich sein, in denen, wie jemand einmal gesagt hat, der liebe Gott steckt. In den modernen Ausgaben des griechischen Textes (in jener von Burnet, die exemplarisch für alle späteren ist, aber auch in jener neueren von Souilhé) lesen wir an dieser Stelle: pempton d’auto tithenai dei ho dē gnōston te kai alethōs estin on, »als Fünftes muss man das ansetzen, was erkennbar und das wahrhaft Seiende ist« (342 a–b). Aber die zwei wichtigsten Kodizes, auf die beide Gelehrten ihre Ausgaben stützen – der Parisinus graecus 1807 und der Vaticanus graecus 1 – enthalten einen anderen Text, in dem anstelle von dei ho (»muss man … was«) dio (»weshalb«) steht. Wenn wir die Lesart der Kodizes wiedergeben, oder besser: indem wir di’ho schreiben, dann lautet die Übersetzung: »Fünftens [ist] dasselbe [notwendig zu] setzen, weshalb [durch welches hindurch] es [jedes Seiende] erkennbar und wahr ist.«[1]
Am Rande dieses Textes hatte eine Hand aus dem 12. Jahrhundert als Verbesserung oder Lesart jenes dei ho notiert, an das sich die modernen Herausgeber gehalten haben. Aber der Kodex, den noch Marsilio Ficino für seine lateinische Übersetzung der platonischen Werke vor Augen hatte, enthielt die Lesart dio. Ficinos Übersetzung lautet wie folgt: »Quintum vero oportet ipsum ponere quo quid est cognoscibile, id est quod agnosci potest, atque vere existit.«[2]
Was also ändert sich, welche neuen Einsichten bringt uns die Wiedergabe des ursprünglichen Texts der Kodizes? Im Wesentlichen die folgende: Die Sache selbst ist nicht einfach mehr nur das Seiende in seiner Dunkelheit, der Gegenstand, der der Sprache und dem Erkenntnisprozess vorausgesetzt ist, sondern auto di’ho gnōston estin, das, wodurch es selbst erkennbar ist, seine eigene Erkennbarkeit und Wahrheit. Auch wenn sie irreführend sein kann, ist die Lesart am Rand, an die sich die modernen Herausgeber gehalten haben, nichtsdestotrotz nicht falsch: Die Hand, die sie notiert hat (und wir haben Grund zur Annahme, dass es sich dabei um keine unerfahrene Hand handelte), sah wahrscheinlich die Gefahr, dass die Erkennbarkeit selbst – die Idee – ihrerseits vorausgesetzt und wie ein Duplikat der Sache hinter oder jenseits der Sache als eine andere Sache substantiviert würde. Die Sache selbst – daher auch der Terminus auto als die technische Bezeichnung der Idee – ist keine andere Sache, sondern die Sache selbst; als solche ist sie jedoch nicht mehr dem Namen und dem logos unterstellt [supposta], als wäre sie eine reale dunkle Voraussetzung [presupposto] (ein hypokeimenon), sondern steht im Medium ihrer eigenen Erkennbarkeit, im reinen Licht ihrer Offenbarung und Verkündigung an die Erkenntnis.
Die »Schwäche« des logos liegt also genau in seiner Unfähigkeit, diese Erkennbarkeit und Selbigkeit zum Ausdruck zu bringen, und in dem Umstand, dass er die Sache selbst, um die es ihm geht, zu einer Voraussetzung (zu einer Hypo-these im etymologischen Sinn des Wortes, als das, was zu Grunde gelegt ist) zurückstuft.
Das ist der Sinn der Unterscheidung zwischen on und poion, zwischen dem wirklichen Sein und seiner Beschaffenheit, auf die Platon im Brief mehrmals beharrt (342 e 3; 343 b 8–c 1). Die Sprache – unsere Sprache – ist notwendigerweise voraussetzend [presupponente] und vergegenständlichend, und zwar in dem Sinne, dass sie in ihrem Vollzug die Sache selbst, die sich in ihr und nur in ihr ankündigt, in ein Sein, über das gesprochen wird, und in ein poion, eine Eigenschaft und Bestimmung, die vom ihm gesagt wird, zerlegt. Die Sprache unter-stellt [sup-pone] und verbirgt das, was sie ans Licht bringt, im selben Akt, in dem sie es ans Licht bringt. Die Sprache ist mithin immer, gemäß der von Aristoteles aufgegriffenen Definition (die auch Platon in Soph., 262 e 6–7 schon geäußert hatte und die in der modernen Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung noch implizit enthalten ist), legein ti kata tinos, etwas-über-etwas Sagen; sie ist daher immer vor-aus-setzend und unter-stellend [pre-sup-ponente] sowie vergegenständlichend. Die Voraussetzung ist die Form des sprachlichen Bedeutens als solchem: kath’ hypokeimenou, etwas über ein Subjekt sagen.
Die Warnung, die Platon der Idee mitgibt, ist also, dass die Sagbarkeit selbst in dem, was von und über etwas gesagt wird, ungesagt bleibt und dass die Erkennbarkeit selbst in dem, was von und über etwas erkannt wird, verlorengeht.
Das spezifische Problem, um das es im Brief geht – welches notwendigerweise das Problem jeder menschlichen Rede ist, die das »Fünfte« ausdrücken möchte, die mithin das zum Thema macht, was nicht Thema sein kann –, ist daher: Wie ist es möglich zu sprechen, ohne dasjenige, wovon man spricht, zu unterstellen, zu hypo-thetisieren und zu unterwerfen [soggettivare]? Wie ist also möglich, legein kath’ hauto, nicht über etwas Vorausgesetztes, sondern durch es selbst zu sprechen? Und da die Ebene der Namen für die Griechen wesentlich jene ist, die kath’ hauto gesagt wird: Kann die Sprache das, was sie benennt, ergründen (logon didonai), kann sie aussagen, was der Name genannt hat?
Dass in diesem Problem so etwas wie ein Widerspruch enthalten war, haben bereits die ältesten Kommentatoren gesehen. Wir sind im Besitz der Glosse eines späten platonischen Scholiasten, die ungefähr Folgendes sagt: »Wie kommt es, dass der Meister im Phaidros die Schrift abwertet und dennoch, da er doch geschrieben hat, sein schriftliches Werk in gewisser Weise für wertvoll gehalten haben muss? Auch hierin«, antwortet der Scholiast, »ist er der Wahrheit gefolgt: So wie die Gottheit sowohl die unsichtbaren Dinge als auch jene geschaffen hat, die erblickt werden können, hat auch er einige Dinge ungeschrieben belassen, andere geschrieben.« Dieselbe Frage stellt sich sicherlich auch für den Siebten Brief. Indem er über das schreibt, worüber er sich Gedanken macht und dieses aber nicht geschrieben werden soll, scheint Platon die Schwäche des logos herauszufordern und seine eigenen Überlegungen zu widerrufen. Und es ist sicherlich kein eitler Scherz, wenn er in einem anderen Brief die Urheberschaft der Dialoge abstreitet, die unter seinem Namen zirkulierten, und behauptet, dass sie »von einem Sokrates stammen, der schöner und jünger geworden ist« (Ep. II, 314 c 3–4). Hier springt die Paradoxie des geschriebenen platonischen Werkes sofort ins Auge: In einem Brief – den die Modernen oft für apokryph gehalten haben – erklärt er seine Dialoge für nicht authentisch, um sie einem unmöglichen Autor zuzuschreiben: dem Protagonisten der Dialoge selbst, Sokrates, der schon seit vielen Jahren tot und begraben liegt. Die Figur, über die im Text gesprochen wird, nimmt hier die Stelle des Autors der Dialoge an, in denen sie selbst vorkommt. Bereits die antiken Kritiker, und gerade die scharfsinnigsten wie Demetrios und Dionysius, hatten bemerkt, wie der Stil Platons, der in den ersten Dialogen sehr klar ist, dunkel (zophos), geschwollen und parataktisch wird, wenn er Themen in Angriff nimmt, die ihm besonders am Herzen liegen (epirriptei allēlois ta kōla aph’ heterou heteron, »die Sätze werfen sich eins über das andere«, schreibt Demetrios).
Es ist eine kuriose Fügung, dass die Schwäche der Sprache, die der Vater der abendländischen Metaphysik vor zwei Jahrtausenden in diesem Brief festgestellt hat, jene in der metaphysischen Anlage unserer Sprache implizite Schwierigkeit prophetisch vorwegzunehmen scheint, die zäh über den Schriften des späten Heidegger liegt und zu ihrem inneren Stolperstein wird. Doch bei Platon verleiht die Schwäche des logos der Idee keinerlei mystischen Charakter, im Gegenteil ermöglicht sie jene Rede, die dem (geschriebenen) Wort zu Hilfe kommt (logō boēthein), was im Phaidros (278 c 6) zum Merkmal der authentischen philosophischen Darstellung erhoben wird. Hierbei besteht die Gefahr, dass die Nicht-Thematisierbarkeit der Sache ihrerseits thematisiert und vorausgesetzt wird, und zwar weiterhin in der Form eines legein ti kata tinos, also in Form eines Redens über das, was sich nicht sagen lässt. Die Sache selbst ist keine einfache Hypostase des Namens, etwas Unaussprechliches, das ungesagt bleiben soll und nur so, als Name, in der Sprache der Menschen aufbewahrt wird. Eine solche Konzeption, die im Theaitetos implizit widerlegt wird, nimmt die Sache selbst weiterhin als »Hypothese« an und unter-stellt sie. Diese – die Sache der Sprache – ist kein quid, das wie eine extreme Hypothese jenseits aller Hypothesen zu suchen wäre, ein letztes und absolutes Subjekt jenseits aller anderen Subjekte, das qualvoll oder selig in der Finsternis versenkt bleibt. Eine solche Sache, die ohne Bezug zur Sprache wäre, ein solches Nichtsprachliches können wir in Wahrheit nur in der Sprache denken, und zwar durch die Idee einer Sprache, die keinen Bezug zu den Sachen hat. Sie ist mithin eine Chimäre im spinozistischen Sinne des Wortes: ein rein sprachliches Sein. Die Sache selbst ist keine Sache – sie ist die Sagbarkeit, die Offenheit selbst, um die es in der Sprache geht, die die Sprache selbst ist und die wir in der Sprache ständig unterstellen und vergessen, vielleicht weil sie selbst in ihrem Innersten ihre eigene Vergessenheit und Selbstaufgabe ist. In den Worten des Phaidon (76 d 8) ist sie das, was wir immer im Munde führen, wenn wir sprechen, was wir also ununterbrochen aussprechen und mitteilen und allerdings auch immer aus dem Blick verlieren. Die voraussetzende Struktur der Sprache ist als solche die Struktur der Überlieferung: Die Sache wird in der Sprache vorausgesetzt, tradiert und zugleich verraten, damit diese über etwas (kata tinos) sein kann. Das Zugrundegehen der Sache ist selbst der Grund, auf dem allein sich so etwas wie eine Überlieferung konstituieren kann.
Die Aufgabe der philosophischen Darstellung ist es, sprechend dem Sprechen beizukommen, damit im Sprechen das Sprechen selbst nicht unterstellt bleibt, sondern als Sprechen zur Sprache kommt. An dieser Stelle berührt die voraussetzende Macht der Sprache ihre Grenze und ihr Ende: Die Sprache sagt die Voraussetzungen als Voraussetzungen und gelangt auf diese Weise zu jenem nicht-voraussetzbaren und nicht-vorausgesetzten Prinzip (archē anhypothetos), das nur als solches eine authentische menschliche Gemeinschaft und Mitteilung konstituiert. Wie Platon in einem entscheidenden Passus eines Dialogs schreibt, der den »sonderbaren Mythos« des Siebten Briefes an mehr als einer Stelle berührt:
Nun erfahre auch, was ich mit dem zweiten Abschnitt des Erkennbaren meine, den die Sprache selbst [autos ho logos] mit dem Vermögen der Auseinandersetzung berührt, indem sie die Hypothesen nicht für Anfänge [archai], sondern wirklich nur als Hypothesen, als Stützpunkte und Antriebe nimmt, um bis zum Nicht-Hypothetischen, zum Anfang von Allem vorzudringen, ihn zu berühren und dann wieder, sich an das haltend, was mit ihm verbunden ist, zum Ende zurückzukehren, ohne sich dabei irgendwie mit dem Sinnlichen zu beschäftigen, sondern mit Hilfe der Ideen, durch die Ideen, zu den Ideen, auch bei den Ideen endet. (Resp., 511 b 3–c 2)
Ich sehe ein, dass ich womöglich etwas über das Ziel hinausgeschossen bin, das ich mir gesetzt hatte, und mich in gewisser Weise für jene nicht göttliche, sondern menschliche Torheit (Ep., VII, 344 d 1–2) verantwortlich gemacht habe, vor der der Mythos des Siebten Briefes eben warnen wollte: der Torheit, unachtsam die eigenen Gedanken über die Sache selbst einem geschriebenen Text anvertrauen zu wollen. Es ist daher angebracht, an dieser Stelle innezuhalten und mit größerer Achtsamkeit zu jener vorbereitenden historiographischen Aufgabe zurückzukehren, die ich mir gestellt hatte.
Die Digression des Siebten Briefes behandelt, so hatten wir gesehen, die Idee in ihrem Verhältnis zur Sprache. Die Sache selbst wird nämlich in enger Verbindung mit einer Theorie der sprachlichen Bedeutung bestimmt, die vielleicht die erste, wenn auch äußerst verdichtete, organische Darstellung dieses Gegenstandes ist. Sollte dies wahr sein, müssten wir ihre Spuren in der unmittelbar darauffolgenden griechischen Reflexion über die Sprache auffinden können. Man denkt hierbei sofort an den Text, der für Jahrhunderte die Reflexionen über Sprache in der antiken Welt geprägt hat, nämlich an Aristoteles’ De interpretatione. Hier erörtert Aristoteles den Prozess des sprachlichen Bedeutens auf eine Weise, die dem ersten Anschein nach in keinerlei Beziehung zur platonischen Digression steht:
Was in der Stimme ist [ta en tē phōnē], ist Zeichen für das, was unserer Seele [en tē psychē] widerfährt, und das Geschriebene ist wiederum Zeichen für das, was in unserer Stimme ist. Und wie die Buchstaben nicht für alle Menschen gleich sind, so sind es auch die Stimmen nicht; wovon sie aber in erster Linie Zeichen sind, die seelischen Widerfahrnisse, diese sind für alle gleich; und auch die Sachen [pragmata], von denen die seelischen Widerfahrnisse Abbildungen sind, sind für alle dieselben. (De Int., 16 a 3–7)
Bei aufmerksamer Prüfung zeigt sich jedoch eine genaue Entsprechung mit dem Text des excursus. Gerade die Dreiteilung, durch die Aristoteles die Bewegung der Bedeutung gliedert (en tē phōnē, en tē psychē, pragmata), zeichnet wortwörtlich die platonische Unterscheidung zwischen dem nach, was en phōnais (Name und logos), was en psychais (Wissen und Meinung) und was en sōmatōn schēmasin (der sinnliche Gegenstand) (342 c 6) ist. Umso bemerkenswerter erscheint dann aber das Verschwinden der Sache selbst. Mit Aristoteles wird die Sache selbst durch die hermēneia, durch den sprachlichen Prozess des Bedeutens getilgt; auch wenn sie flüchtig wieder auftauchen wird (etwa in der stoischen Logik), tut sie das nunmehr in einer von der ursprünglichen platonischen Absicht beinahe bis zur Unkenntlichkeit entfremdeten Gestalt.
Die aristotelische Bestimmung der hērmeneia entfaltet sich daher wie ein Kontrapunkt gegenüber der platonischen Aufzählung, die sie aufgreift und zugleich widerlegt. Der entscheidende Beweis dieses polemischen Kontrapunktes ist gerade die Einführung der grammata, der Buchstaben, im aristotelischen Text. Bereits die antiken Kommentatoren fragten sich, wo die auf den ersten Blick inkongruente Einführung dieses vierten Interpreten neben den anderen drei (Lauten, Begriffen, Sachen) herrührt. Bedenkt man, dass der platonische excursus ja gerade darauf ausgerichtet war, die Unmöglichkeit der Verschriftlichung der Sache selbst und im Allgemeinen die Unzuverlässigkeit jeder schriftlichen Rede für das Denken zu beweisen, wird der grundlegende Kontrapunkt beider Texte noch offensichtlicher.
Indem er die Sache selbst aus der Theorie der Bedeutung tilgt, spricht Aristoteles die Schrift von ihrer Schwäche frei. Anstelle der Sache selbst tritt in den Kategorien die prōtē ousia, die erste Substanz, die Aristoteles als das definiert, was nicht über ein Subjekt ausgesagt wird (kath’hypokeimenou »über ein Vorausgesetztes«) und auch nicht im Subjekt liegt. Was bedeutet diese Definition? Die erste Substanz wird nicht über ein Vorausgesetztes gesagt und hat keine Voraussetzungen, weil sie selbst die absolute Voraussetzung ist, auf die sich jede Rede und jede Erkenntnis gründet. Sie allein wird – als Name – kath’ hauto, über sich selbst gesagt; sie allein – die in keinem Subjekt ist – zeigt sich mit Evidenz. In sich selbst allerdings, als ein individuum, ist sie unaussprechlich (individuum ineffabile, nach der mittelalterlichen aristotelischen Formulierung) und kann nicht in den Bereich des sprachlichen Bedeutens eintreten, dessen Grund sie ist – es sei denn, sie verlässt ihre deiktische Aktualität und wird universelle Prädikation. Das ti des Namens wird in der Rede als das kata tinos aufgenommen, als das Worüber der Rede. Sie – das Was und das Über-was – sind daher dieselbe Sache, die als to ti ēn einai, das Sein-was-etwas-war, erfasst werden kann. In diesem logisch-zeitlichen Prozess wird die platonische Sache selbst entzogen und erhalten oder vielmehr als Entzogene erhalten: e-liminiert.
Aus diesem Grund taucht in De interpretatione das gramma, der Buchstabe, auf. Eine genaue Prüfung zeigt nämlich, dass im hermeneutischen Zirkel von De interpretatione der Buchstabe als Interpret des Lautes selbst keines weiteren Interpreten bedarf. Er ist der letzte Interpret, jenseits dessen keine weitere hērmeneia möglich ist: ihr Limit. Daher sagten die antiken Grammatiker, die De interpretatione analysierten, dass der Buchstabe als Zeichen des Lautes zugleich auch dessen Element stoicheion tēs phōnēs ist. Als Element dessen, wovon er ein Zeichen ist, hat er den privilegierten Status eines index sui, einer Selbstanzeige: wie die prōtē ousia, deren sprachliche Chiffre er darstellt, zeigt er sich selbst, aber nur sofern er im Laut war, demnach immer schon als Vergangenheit.
Das gramma ist also die Form der Voraussetzung selbst und nichts anderes als das. Als solche nimmt es in jeder Mystik einen zentralen Platz ein, und als solche hat es auch eine entscheidende Bedeutung im Denken unserer Zeit, das weitaus aristotelischer und mystischer ist, als man gemeinhin glaubt. In diesem Sinne – und nur in diesem – ist Aristoteles und nicht Platon der Begründer der abendländischen Mystik, und es ist auf diesem Wege, dass der Neuplatonismus zu jener Eintracht zwischen Platon und Aristoteles gelangen konnte, welche die Grundlage der Lehre dieser Schule bildete.
Auf dieser Grundlage, sofern der Sprache selbst die ontologische Struktur der Voraussetzung eingeschrieben ist, kann das Denken unmittelbar Schrift werden, ohne sich mit der Sache selbst messen und ohne die eigene Voraussetzung verraten zu müssen. Der Philosoph ist sogar der Schreiber sowohl des Denkens als auch – vermittelt durch das Denken – der Sache und des Seins. Das spätbyzantinische Lexikon, das den Namen Suda trägt, vermerkt unter dem Stichwort Aristoteles: Aristotelēs tēs physeōs grammateus ēn, ton kalamon apobrechōn eis noun, »Aristoteles war der Schreiber der Natur, der das Schreibrohr in das Denken eintauchte«.
Viele Jahrhunderte später zitiert Hölderlin unerwartet diesen Satz der Suda an einer entscheidenden Stelle seiner Anmerkungen* zur Übersetzung des Oedipus Tyrannus von Sophokles, und zwar während seiner Erläuterung des Sinns und der Natur der tragischen Darstellung*. Das Zitat enthält allerdings eine Abweichung, die auch die äußerst gewissenhafte Hölderlinphilologie nicht erklären konnte. Hölderlin schreibt: Tēs physeōs grammateus ēn ton kalamon apobrechōn eunoun (statt eis noun): »Er war der Schreiber der Natur, der das wohlgesinnte Schreibrohr eintauchte«. Es gibt kein Eintauchen des Schreibrohrs ins Denken: Das Schreibrohr – dieses einfache materielle Instrument der menschlichen Schrift – steht allein vor seiner Aufgabe, bewaffnet nur mit Wohlwollen. Der Sache selbst ihren Ort in der Sprache wiedergeben und zugleich die Schrift auf ihre Herausforderung zurückführen, ihrem poetischen Auftrag der Niederschrift – das ist die Aufgabe der kommenden Philosophie.
Die Idee der Sprache
Wer in einem christlichen oder jüdischen Umfeld erzogen wurde oder auch einfach nur gelebt hat, wird eine gewisse Vertrautheit mit dem Wort »Offenbarung« besitzen. Diese Vertrautheit impliziert aber noch lange nicht, dass der Betreffende dessen Bedeutung auch zu definieren vermag. Ich möchte meine Überlegungen mit dem Versuch einer solchen Definition beginnen. Ich bin der Überzeugung, dass eine angemessene Definition dieses Wortes nicht unwichtig für einen philosophischen Diskurs ist, der, wie bemerkt wurde, über alles sprechen kann, vorausgesetzt, er spricht zunächst über die Tatsache, dass er darüber spricht. Sämtliche Vorstellungen von der Offenbarung gehen von deren Heterogenität gegenüber der Vernunft aus. Damit ist, auch wenn die Kirchenväter auf diesem Punkt so sehr beharrt haben, nicht bloß gemeint, dass der Inhalt der Offenbarung der Vernunft notwendig absurd erscheinen muss. Der Unterschied, der hier angesprochen ist, ist weitaus radikaler, denn er betrifft die Ebene, auf der die Offenbarung angesiedelt ist und d.h. ihre eigene Struktur.
Wenn der Inhalt einer Offenbarung – mag dieser noch so absurd sein, wie etwa dass rosarote Esel im Venushimmel singen – von der menschlichen Vernunft und Sprache aus eigener Kraft erkannt und gesagt werden könnte, dann würde jene aus ebendiesem Grund aufhören, Offenbarung zu sein. Was uns die Offenbarung zu erkennen gibt, muss nicht nur etwas sein, das ohne sie nicht erkennbar gewesen wäre, sondern muss von solcher Art sein, dass es die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt betrifft.
Es ist diese radikale Differenz der Ebene der Offenbarung, welche christliche Theologen zum Ausdruck bringen, wenn sie sagen, dass der einzige Inhalt der Offenbarung Christus selbst, also das Wort Gottes, ist; eine Differenz, die auch von jüdischen Theologen bestätigt wird, wenn sie behaupten, dass sich die Offenbarung Gottes im Namen manifestiert. Wenn Paulus den Kolossern den ökonomischen Sinn der göttlichen Offenbarung erklären will, schreibt er: »Damit das Wort Gottes vollendet sei, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern verborgen war« (Kol1,25–26). In diesem Satz ist »Geheimnis« [to mystērion] eine Apposition von »das Wort Gottes« [ton logon tou theu]. Das Geheimnis, das ehedem verborgen war und nunmehr offenbart wurde, betrifft nicht dieses oder jenes irdische oder überirdische Ereignis, sondern einfach nur das Wort Gottes.
Wenn die Offenbarung in der theologischen Tradition also immer als etwas verstanden wurde, das die menschliche Vernunft nicht aus sich heraus erkennen kann, dann kann dies nur eines heißen: Der Inhalt der Offenbarung ist keine Wahrheit, die kraft sprachlicher Aussagen über das Seiende (und sei dieses auch das höchste Seiende) ausgedrückt werden könnte, sondern vielmehr eine Wahrheit, die die Sprache selbst betrifft, die Tatsache als solche, dass es Sprache (und mithin Erkenntnis) gibt. Der Sinn der Offenbarung ist, dass der Mensch zwar das Seiende durch die Sprache offenbaren kann, nicht aber die Sprache selbst. Mit anderen Worten: Der Mensch sieht die Welt durch die Sprache, aber er sieht nicht die Sprache. Diese Unsichtbarkeit des Offenbarenden im Offenbarten ist Gottes Wort, ist die Offenbarung.
Daher sagen die Theologen, dass die Offenbarung Gottes zugleich auch seine Verborgenheit ist, oder auch, dass Gott sich im Wort unverständlich offenbart. Dabei handelt es sich nicht einfach nur um eine negative Bestimmung oder einen Mangel der Erkenntnis, sondern um eine wesentliche Bestimmung der göttlichen Offenbarung, die ein Theologe als von »höchst reinen Lichte [das] durch die dichtesten Finsternisse strahle«[3] und als eine »Offenbarung eines Unerkennbaren« beschrieb. Das kann nur heißen: Was hier offenbart wird, ist kein Gegenstand, über den es viel zu wissen gäbe, der jedoch aufgrund des Fehlens angemessener Erkenntnismittel nicht erkannt werden kann. Vielmehr ist es die Offenbarung selbst, die hier offenbart wird, das Faktum, dass es Weltoffenheit und Erkenntnis gibt.
In diesem Horizont erscheint die Konstruktion der trinitären Theologie als der rigoroseste und kohärenteste Versuch, jene paradoxe primordiale Verfasstheit des Wortes zu denken, den der Prolog des Johannesevangeliums durch folgende Formel zum Ausdruck bringt: en archē ēn ho logos »im Anfang war das Wort«. Die Dreieinigkeit Gottes, die uns durch das Nicäische Bekenntnis (»Credo in unum deum …«, »Ich glaube an einen Gott …«) vertraut ist, sagt nichts über die innerweltliche Wirklichkeit, sie hat keinerlei ontischen Inhalt, sondern bezeugt die neuartige Erfahrung des Wortes, die das Christentum in die Welt gebracht hat. Sie sagt, um Wittgensteins Terminologie zu verwenden, nichts darüber, wie die Welt ist; sie offenbart vielmehr, dass die Welt ist, dass Sprache ist. Das Wort, das absolut im Anfang ist, das also die absolute Voraussetzung ist, setzt nichts voraus außer sich selbst, hat nichts vor sich, das es erklären oder seinerseits enthüllen könnte (für das Wort gibt es keine Worte) und seine dreifaltige Struktur ist nichts anderes als die Bewegung seiner Selbstoffenbarung. Und diese Offenbarung des Wortes, dieses Nichts-Voraussetzen, das die einzige Voraussetzung ist, ist Gott: »Und das Wort war Gott« (Joh 1,1).
Der eigentliche Sinn der Offenbarung ist mithin zu zeigen, dass jedes Wort und jede Erkenntnis ihre Wurzeln und ihren Grund in einer Offenheit haben, die sie unendlich übersteigt; zugleich betrifft diese Offenheit aber nichts anderes als die Sprache selbst, ihre Möglichkeit und ihre Existenz. Wie der große jüdische Theologe und Hauptvertreter der neukantianischen Schule Hermann Cohen sagte: Der Sinn der Offenbarung Gottes ist nicht, dass er sich in etwas, sondern an etwas offenbart, und dass seine Offenbarung also nichts anderes als »die Schöpfung der Vernunft«*[4] ist. Offenbarung meint weder diese oder jene Aussage über die Welt noch das, was durch Sprache gesagt werden kann, sondern dass das Wort, dass die Sprache ist.
Was aber bedeutet solch eine Aussage wie: Die Sprache ist?
Ausgehend von dieser Perspektive, müssen wir uns dem locus classicus zuwenden, an dem sich das Problem des Verhältnisses zwischen Offenbarung und Vernunft gestellt hat, nämlich Anselm von Canterburys ontologischem Beweis. Wie Anselm unmittelbar entgegnet wurde, ist es nicht wahr, dass das bloße Aussprechen des Namens Gott, [aliquid] quo maius cogitari nequit – »über dem nichts Größeres gedacht werden kann« –, notwendig die Existenz Gottes impliziert. Ein Seiendes, dessen einfache sprachliche Benennung bereits seine Existenz impliziert, gibt es aber in der Tat, und dieses Seiende ist die Sprache. Die Tatsache, dass ich rede und jemand zuhört, impliziert die Existenz von nichts anderem außer der Sprache selbst. Die Sprache ist das, was sich notwendig selbst voraussetzen muss. Der ontologische Beweis zeigt demnach, dass, solange Menschen sprechen und es vernunftbegabte Tiere gibt, es auch ein göttliches Wort gibt, und zwar in dem Sinne, dass die Präexistenz der Bedeutungsfunktion und die Offenheit der Offenbarung immer schon vorausgesetzt sind (nur in diesem Sinne – also nur, wenn Gott der Name für die Präexistenz der Sprache ist, für ihr Verweilen in der archē – weist der ontologische Beweis die Existenz Gottes nach). Aber diese Offenheit gehört im Gegensatz zu dem, was Anselm dachte, nicht der Sphäre der bedeutenden Rede zu, sie ist keine sinnvolle Aussage, sondern das reine Ereignis der Sprache diesseits oder jenseits jeder besonderen Bedeutung. Man tut gut daran, den Einwand, den ein großer verkannten Logiker, Gaunilo, gegen Anselms Beweis vorgebracht hat, vor diesem Hintergrund neu zu lesen. Gegen Anselms Behauptung, dass die Äußerung des Wortes Gott für jene, die es hören, notwendig die Existenz Gottes impliziere, stellt Gaunilo die Erfahrung eines Idioten oder eines Barbaren, der in Anbetracht einer bedeutenden Rede sicherlich versteht, dass da ein sprachlicher Vollzug statthat, dass es sich – so Gaunilo – um eine vox, um ein menschliches Wort handelt, obwohl er den Sinn der Äußerung gar nicht begreift. Ein solcher Idiot oder Barbar, so schreibt Gaunilo, denkt nicht
die Stimme selbst, also den Klang der Silben und Buchstaben, der eine durchaus wirkliche Sache ist, […] als vielmehr die Bedeutung der vernommenen Stimme; nicht jedoch so, wie sie von einem gedacht wird, der die gewöhnliche Bedeutung des Lautes kennt (und der sie also der Sache gemäß [secundum rem] denkt, auch wenn diese nur in Gedanken wirklich ist), sondern so, wie sie von jemandem gedacht wird, der sie nicht kennt und nur einem seelischen Widerfahrnis nach denkt, das sich die Wirkung und die Bedeutung des erfassten Lautes vorzustellen versucht.[5]
Nicht mehr bloßer Laut und noch nicht Bedeutung, dieses »Denken allein nach der Stimme« (»cogitatio […] secundum vocem solam«, wie Gaunilo es nennt) erschließt dem Denken eine gleichsam originäre logische Dimension, in der sich die Sprache bar jedes determinierenden Bedeutungsereignisses ereignet und die damit auf die Möglichkeit eines Denkens jenseits der bedeutungsvollen Aussagen hinweist. Die ursprünglichste logische Dimension, um die es bei der Offenbarung geht, ist daher nicht jene des bedeutungsvollen Wortes, sondern die eines Wortes, das, ohne irgendetwas zu bedeuten, die Bedeutsamkeit selbst bedeutet. (In diesem Sinne müssen die Theorien jener Denker wie Roscelin verstanden werden, von denen gesagt wurde, sie hätten »die Bedeutung der Stimme« entdeckt, und die behaupteten, dass die Universalien nur flautus vocis seien. Flautus vocis ist hier nicht der bloße Laut, sondern, im eben dargelegten Sinn, die Stimme als reine Anzeige eines Sprachereignisses. Und diese Stimme fällt mit der universellsten Dimension der Bedeutung, mit dem Sein, zusammen.) Diese Gabe, eine Stimme für die Sprache zu sein, ist Gott, ist Gottes Wort. Der Name Gottes ist der Name, der die Sprache benennt, er ist daher (wie die mystische Tradition unermüdlich wiederholt hat) ein Wort ohne Bedeutung.
In Begriffen zeitgenössischer Logik ließe sich nun sagen, dass, sollte es eine Metasprache geben, der Sinn der Offenbarung keine bedeutungsvolle Rede, sondern reine bedeutungslose Stimme ist. Dass es Sprache gibt, ist ebenso gewiss wie unverständlich, und diese Unverständlichkeit und diese Gewissheit machen Glaube und Offenbarung aus.
Die größte Schwierigkeit, die einer philosophischen Darstellung inhärent ist, betrifft genau dieses Problemregister. Die Philosophie handelt nämlich nicht nur von dem, was uns durch die Sprache offenbart wird, sondern auch von der Offenbarung der Sprache selbst. Philosophisch ist mithin jene Darstellung, die, wovon auch immer sie sprechen mag, stets berücksichtigen muss, dass sie darüber spricht; es handelt sich demnach um eine Rede, die in jedem Gesagten vor allem die Sprache selbst sagt. (Daher die wesentliche Nähe – aber auch Distanz – zwischen Philosophie und Theologie, die mindestens genauso alt wie die aristotelische Definition der ersten Philosophie als theologikē ist.)
Man könnte dies auch durch die Behauptung ausdrücken, dass die Philosophie keine Weltanschauung ist, sondern eine Anschauung der Sprache, und in der Tat ist das zeitgenössische Denken diesem Weg allzu eifrig gefolgt. Denn die Schwierigkeit entsteht hierbei, weil es – wie Gaunilos Definition der Stimme impliziert – bei einer philosophischen Darstellung nicht einfach nur um eine Rede geht, die die Sprache zum Gegenstand hat, um eine Metasprache, die von der Sprache spricht. Die Stimme sagt nichts, sondern zeigt sich genauso wie die logische Form für Wittgenstein; sie kann daher nicht Thema einer Rede werden. Die Philosophie vermag das Denken bloß an die Grenze der Stimme zu führen; sie kann die Stimme selbst nicht sagen (so scheint es zumindest).
Das gegenwärtige Denken ist sich kurzerhand darüber bewusst geworden, dass es eine letzte und absolute Metasprache nicht gibt und dass jede Konstruktion einer Metasprache sich in einen infiniten Regress verstrickt. Die Paradoxie des reinen philosophischen Unterfangens liegt in einer Rede, die von der Sprache sprechen und ihre Grenzen darstellen muss, ohne über eine Metasprache zu verfügen. Auf diese Weise stößt sie genau auf das, was der wesentliche Inhalt der Offenbarung war: logos en archē, das Wort als absoluter Anfang, als absolute Voraussetzung (oder, wie Mallarmé einmal schrieb, das Wort als ein Prinzip, das sich durch die Negation jedes Prinzips entfaltet[6]). Und genau mit diesem Verweilen des Wortes im Anfang müssen sich Logik und Philosophie immer wieder auseinandersetzen, wenn sie sich ihrer Aufgabe bewusst sind.
Wenn es einen Moment der Übereinstimmung in den gegenwärtigen Philosophien gibt, dann liegt dieser in der Anerkennung ebenjener Voraussetzung. So nimmt die Hermeneutik die absolute Vorgängigkeit der Bedeutungsfunktion an, indem sie – gemäß dem Schleiermacher’schen Motto, das den dritten Teil von Wahrheit und Methode eröffnet – behauptet: »Alles Vorauszusetzende in der Hermeneutik ist nur Sprache.«[7] Oder indem sie, wie Apel, Wittgensteins Begriff des »Sprachspiels« im Sinne einer transzendentalen Bedingung jeder Erkenntnis interpretiert. Dieses Apriori ist für die Hermeneutik die absolute Voraussetzung, die rekonstruiert und zu Bewusstsein gebracht, nicht aber überschritten werden kann. Übereinstimmend mit diesen Prämissen, kann sich die Hermeneutik nur als Horizont einer unendlichen Überlieferung und Auslegung verstehen, deren letzter Sinn und Grund notwendigerweise ungesagt bleiben müssen. Sie kann sich fragen, wie sich Verstehen ereignet, aber dass es Verstehen gibt, ist das, was selbst ungedacht jedes Verstehen erst möglich macht. »Ein jedes Wort«, schreibt Gadamer, »läßt daher auch, als das Geschehen seines Augenblicks, das Ungesagte mit da sein, auf das es sich antwortend und winkend bezieht.«[8] (Es wird also deutlich, warum die Hermeneutik, die sich ja auf Hegel und Heidegger beruft, gerade jene Aspekte ihres Denkens im Schatten belässt, die jeweils das absolute Wissen und das Ende der Geschichte sowie das Ereignis* und das Ende der Seinsgeschichte, verkünden.)
In diesem Sinne stellt sich die Hermeneutik gegen jene Diskurse wie die Wissenschaft und die Ideologie – wenngleich nicht so radikal, wie es zunächst einmal erscheint –, die zwar mehr oder weniger bewusst von der Präexistenz der Bedeutungsbeziehung ausgehen, sie dann aber als Voraussetzung auch verdrängen, um deren Produktivität und auslöschende Macht hemmungslos arbeiten zu lassen. Es ist jedoch nicht wirklich zu sehen, in welcher Weise die Hermeneutik diese Diskurse überzeugen könnte, ihre Haltung, oder zumindest das nihilistische Bewusstsein der eigenen Unbegründetheit, aufzugeben. Wenn der Grund abermals unsagbar und irreduzibel bleibt, wenn er dem sprechenden Menschen immer schon vorausgegangen ist und ihn in eine epochale Geschichte und in ein epochales Schicksal wirft, dann ist ein Denken, das dieser Voraussetzung eingedenk Sorge um sie trägt, unter ethischen Gesichtspunkten jenem Denken ganz und gar gleichwertig, das sich seinem Schicksal überlässt und dessen Gewalt und Unbegründetheit bis zum Ende erfährt (wobei es ein Ende hier in Wirklichkeit gar nicht gibt).
Es ist daher kein Zufall, wenn eine einflussreiche Strömung des gegenwärtigen französischen Denkens die Sprache an den Anfang setzt, ihrem Verweilen in der archē allerdings die negative Struktur der Schrift und des gramma verleiht. Es gibt keine Stimme für die Sprache, sondern die Sprache ist vielmehr von Anfang an unendliche Spur und Selbsttranszendenz. Mit anderen Worten: Die Sprache, die im Anfang ist, ist ihre eigene Annullierung und der Aufschub ihrer selbst, und der Signifikant ist nichts anderes als die Chiffre dieser Grundlosigkeit.
Es ist sicherlich legitim zu fragen, ob sich die Aufgabe der Philosophie wirklich in der das gegenwärtige Denken charakterisierenden Anerkennung erschöpft, dass die Sprache als Voraussetzung zu betrachten sei. Das Denken, so könnte man sagen, scheint hier seine Aufgabe mit der Anerkennung dessen für beendet zu halten, was der ureigene Inhalt des Glaubens und der Offenbarung war: die Situiertheit des logos in der archē. Was die Theologie als für die Vernunft unverständlich erklärte, ist nun von der Vernunft als ihre eigene Voraussetzung anerkannt. Jedes Verstehen gründet auf dem Unverständlichen.
Bleibt auf diese Weise aber nicht genau das im Schatten, was die Aufgabe der Philosophie par excellence sein sollte, nämlich die Eliminierung und die »Absolution« der Voraussetzung? War nicht die Philosophie jener Diskurs, der sich von jeder Voraussetzung, selbst jener universellsten, die sich in der Formel »Es gibt Sprache« ausdrückt, frei wissen wollte? Geht es ihr nicht darum, das Unverständliche zu verstehen? Vielleicht sind die Schwierigkeiten der gegenwärtigen Philosophie darauf zurückzuführen, diese Aufgabe preisgegeben zu haben, welche die Magd zu einer Heirat mit ihrer theologischen Herrin verdammt – genauso wie das Problem des Glaubens mit dessen Akzeptanz durch die Vernunft zusammenfällt. Die Aufhebung der Grenzen zwischen Glauben und Vernunft kennzeichnet zugleich ihre Krise, d.h. ihr wechselseitiges Urteil.
Das gegenwärtige Denken hat sich jener Grenze genähert, jenseits deren eine neue religiös-epochale Enthüllung des Wortes nicht mehr möglich zu sein scheint. Dass der logos den Charakter einer archē hat, ist nunmehr gänzlich offenbart; keine neue Figur des Göttlichen, kein neues geschichtliches Schicksal kann nunmehr von der Sprache ausgehen. Wo sich die Sprache absolut in der archē situiert, enthüllt sie auch ihre absolute Anonymie. Es gibt keinen Namen für den Namen, keine Metasprache, nicht einmal in der Form einer bedeutungslosen Stimme. Wenn Gott der Name der Sprache war, kann »Gott ist tot« nur bedeuten, dass es keinen Namen für die Sprache gibt. Die vollendete Offenbarung der Sprache ist ein vollständig von Gott verlassenes Wort. Und der Mensch ist in die Sprache geworfen, ohne eine göttliche Stimme oder ein göttliches Wort zu haben, das ihm die Möglichkeit eines Fluchtwegs aus dem endlosen Spiel der bedeutungsvollen Sätze sicherstellt. Endlich sind wir also allein mit unseren Worten, zum ersten Mal allein mit der Sprache, von jeglichem Grund verlassen. Dies ist die kopernikanische Revolution, durch die unser Denken den Nihilismus beerbt: Wir sind die ersten Menschen, die sich der Sprache vollkommen bewusst geworden sind. Was die vergangenen Generationen als Gott, Sein, Geist, Unbewusstes gedacht haben, sehen wir zum ersten Mal klar als das, was sie sind: Namen für die Sprache. Deswegen gehören für uns jede Philosophie, jede Religion und jedes Wissen, die von dieser Wende keine Kenntnis genommen haben, unausweichlich der Vergangenheit an. Die Schleier, die Theologie, Ontologie und Psychologie über den Menschen aufgespannt haben, sind nunmehr gelüftet, und wir bringen sie Stück für Stück an ihren jeweiligen Ort in der Sprache zurück. Unverhüllt schauen wir jetzt die Sprache an, die alles Göttliche, alles Unsagbare ausgeatmet hat: vollkommen offenbart, absolut im Anfang. Wie ein Dichter, der endlich das Gesicht seiner Muse erblickt, so schaut die Philosophie der Sprache ins Gesicht (weil die Muse die ursprünglichste Erfahrung der Sprache benennt, kann Platon sagen, dass die Philosophie »die höchste Musik« ist).
Der Nihilismus macht dieselbe Erfahrung eines von Gott verlassenen Wortes; aber er deutet die äußerste Offenbarung der Sprache so, dass es nichts zu offenbaren gibt, dass die Wahrheit der Sprache darin liegt, das Nichts aller Sachen zu enthüllen. Die Abwesenheit einer Metasprache wird so zur negativen Form der Voraussetzung und das Nichts zum letzten Schleier, zum letzten Namen der Sprache.
Wenn wir nun auf Wittgensteins Bild einer im Fliegenglas gefangenen Fliege zurückgreifen, könnten wir sagen, dass das gegenwärtige Denken schließlich die Unabdingbarkeit des Glases, das die Fliege gefangen hält, anerkannt hat. Die Präexistenz und Anonymie der Bedeutungsfunktion bilden die Voraussetzung, die dem sprechenden Menschen immer schon vorausgegangen ist und aus der es offenbar keinerlei Ausgang gibt. Die Menschen sind dazu verdammt, sich durch Sprache zu verständigen. Aber noch einmal: Was damit aufgegeben wird, ist das ursprüngliche Anliegen, das in jenes Bild eingelassen war, nämlich die Möglichkeit eines Auswegs aus dem Fliegenglas.
Die Aufgabe der Philosophie muss daher genau dort wiederaufgenommen werden, wo sich das gegenwärtige Denken von ihr abzuwenden scheint. Wenn es auch stimmt, dass die Fliege erst einmal anfangen muss, das Glas zu sehen, das sie einschließt, was kann eine solche Einsicht dann aber weiter bedeuten? (Das Fliegenglas ist für die Fliege nämlich keine Sache, sondern das, wodurch sie die Sachen sieht.) Ist ein Diskurs möglich, der keine Metasprache ist, aber auch nicht ins Unsagbare versinkt, sondern die Sprache selbst zum Ausdruck bringt und ihre Grenzen darstellt?
Eine antike Denktradition artikuliert diese Möglichkeit in Form einer Theorie der Ideen. Entgegen jener Deutung, die darin den unaussprechlichen Grund einer Metasprache erblickt, impliziert die Ideenlehre eine vorbehaltlose Akzeptanz der Anonymie der Sprache ebenso wie der Homonymie, die ihr Feld regiert (in diese Richtung müssen Platons Beharren auf der Homonymie von Idee und Sache sowie die sokratische Ablehnung jeglicher Misologie gedeutet werden). Diese Endlichkeit und Doppelsinnigkeit der menschlichen Sprache ebnen zugleich die Wege für die »dialektische Reise« des Denkens. Würde jedes menschliche Wort stets ein anderes Wort voraussetzen und nähme die voraussetzende Macht der Sprache kein Ende, dann könnte es tatsächlich auch keine Erfahrung der Grenzen der Sprache geben. Und wäre die Sprache perfekt, bar jeder Homonymie und in allen Zeichen eindeutig, dann wäre sie wiederum eine absolut ideenlose Sprache.
Die Idee ist im Spiel von Anonymie und Homonymie der Sprache vollständig enthalten. Weder ist das Eine und hat einen Namen, noch ist es nicht und hat keinen Namen. Die Idee ist kein Wort (keine Metasprache) und auch nicht die Anschauung eines Objekts jenseits der Sprache (ein solches Objekt, ein solches Unsagbares gibt es nicht), sondern die Anschauung der Sprache selbst. Denn die Sprache, die für den Menschen jede Sache und Erkenntnis vermittelt, ist selbst unmittelbar. Nichts Unmittelbares kann vom sprechenden Menschen erreicht werden – nichts außer der Sprache selbst, außer der Vermittlung als solche. Diese unmittelbare Vermittlung stellt für den Menschen die einzige Möglichkeit dar, einen von jeder – auch der eigenen – Voraussetzung befreiten Anfang zu erreichen. Es ist die einzige Möglichkeit, an jene archē anhypothetos zu gelangen, die Platon im Staat als das telos, als die Vollendung und das Ziel von autos ho logos, der Sprache selbst, darstellt und die er zugleich als »die Sache selbst« bzw. die Angelegenheit des Menschen versteht.
Keine wahre menschliche Gemeinschaft kann sich auf einer Voraussetzung errichten – sei diese die Nation oder die Sprache oder auch das Apriori der Kommunikation, von dem die Hermeneutik spricht. Was die Menschen untereinander vereint, ist weder eine Natur noch eine göttliche Stimme und auch nicht die gemeinsame Gefangenschaft in der bedeutungshaften Sprache, sondern die Anschauung der Sprache und daher die Erfahrung ihrer Grenzen, ihres Endes. Wahre Gemeinschaft ist nur eine nicht vorausgesetzte Gemeinschaft. Die reine philosophische Darstellung kann daher nicht die Darstellung der eigenen Ideen über die Sprache oder die Welt sein; sie ist vielmehr die Darlegung der Idee der Sprache.
Sprache und Geschichte
Sprachliche und geschichtliche Kategorien im Denken Benjamins
In den Notizen und Vorarbeiten zu den Thesen Über den Begriff der Geschichte findet man in verschiedenen Variationen den folgenden Passus:
Die messianische Welt ist die Welt allseitiger und integraler Aktualität. Erst in ihr gibt es eine Universalgeschichte. Was sich heute so bezeichnet, kann immer nur eine Sorte von Esperanto sein. Es kann ihr nichts entsprechen, eh die Verwirrung, die vom Turmbau zu Babel herrührt, geschlichtet ist. Sie setzt die Sprache voraus, in die jeder Text einer lebenden oder toten ungeschmälert zu übersetzen ist. Oder besser, sie ist diese Sprache selbst. Aber nicht als geschriebene, sondern vielmehr als festlich begangene. Dieses Fest ist gereinigt von aller Feier und es kennt keine Festgesänge. Seine Sprache ist die Idee der Prosa selbst, die von allen Menschen verstanden wird wie die Sprache der Vögel von Sonntagskindern. (GS I.3, 1239)[9]
Die Annäherung, die diese Passage in ihrer messianischen Perspektive zwischen Sprache und Geschichte, zwischen sprachlichen und geschichtlichen Kategorien vornimmt, kann auf den ersten Blick verwundern. Die Geschichte der erlösten Menschheit, sagt Benjamin, ist die einzige Universalgeschichte: diese fällt jedoch in eins mit ihrer Sprache. Als Universalgeschichte setzt sie eine Universalsprache nicht nur voraus, sondern sie ist eigentlich diese Sprache, die der babylonischen Verwirrung ein Ende setzt. Die Sprache der erlösten Menschheit hat jedoch weniger die Gestalt einer geschriebenen als die einer festlich begangenen Sprache. Sie ist die Idee der Prosa, »die befreite Prosa«, so lesen wir in einer anderen Variante, »die die Fesseln der Schrift gesprengt hat« (GS I.3, 1235). Sie wird daher von allen Menschen verstanden, genauso wie die Sonntagskinder*, die einer christlichen Volkslegende zufolge über übernatürliche Kräfte verfügen, die Sprache der Vögel verstehen.
Auf den folgenden Seiten schlagen wir eine Lesart dieses Textes vor, in dem Benjamin einem seiner dringendsten Anliegen eine erhellende Form gegeben hat.
Die Annäherung zwischen geschichtlichen und sprachlichen Kategorien, um die es hier geht, war nicht immer so ungewöhnlich, wie sie uns heute erscheinen mag. Dem mittelalterlichen Denken war sie durchaus vertraut, und so liest man in den Etymologiae1, 41 von Isidor von Sevilla eine vielleicht noch extremere Formulierung: »Für die Geschichte ist die Grammatik zuständig« (»haec disciplina [scil. historia] ad grammaticam pertinet«). In Augustinus’ Werk, der maßgeblichen Quelle für das Diktum des Isidor, wird diese Zuständigkeit durch das notwendige Angewiesensein jeder geschichtlichen Überlieferung auf die Sphäre des »Buchstabens« erklärt. Nachdem er, in seinen Worten, »die Kindheit der Grammatik [quaedam grammaticae infantia]« von der Erfindung der alphabetischen Zeichen bis hin zur Bestimmung der Elemente der Rede zurückverfolgt hat, fährt Augustinus fort:
Damit konnte die Grammatik eigentlich erschöpft sein, aber weil sie mit ihrem Namen ihre Beschäftigung mit den Buchstaben verkündet, weshalb sie im Lateinischen »litteratura« genannt wird, kam es, dass alles Erinnerungswürdige, was den Buchstaben anvertraut [litteris mandaretur] wurde, notwendig in ihre Zuständigkeit fiel. So wurde dieser Disziplin die Geschichte zugeordnet, die dem Namen nach eine ist, der Materie nach aber unendlich, vielgestaltig, an Sorgen reicher als an Annehmlichkeit und Wahrheit, und für den Grammatiker eine weitaus beschwerlichere Angelegenheit als für den Geschichtsschreiber. (De ordine, 2, 12, 37)
Die Geschichte wird hier in dem uns vertrauten trüben Licht als »für den Grammatiker weitaus beschwerlichere Angelegenheit als für den Geschichtsschreiber« vorgeführt, und dies, weil Augustinus – die Natur der Sprache scharfsinnig durchdringend – zur Wissenschaft der Sprache nicht nur die Grammatik im engeren Sinne (also die synchrone Analyse ihrer Strukturen), sondern auch die »unendliche« Dimension der historischen Überlieferung (»litteris mandaretur«) zählt. Der Buchstabe, das gramma, ist für Augustinus also in erster Linie ein geschichtliches Element. Aber in welchem Sinne?
Augustinus’ Auffassung hatte ihre Wurzeln in der stoischen Sprachreflexion, die z.B. noch in der großen Abhandlung des Varro über die lateinische Sprache zum Ausdruck kommt. Dessen Reflexion unterscheidet deutlich zwischen zwei Ebenen der Sprache: jene der Namen (oder der reinen Benennung, »impositio«, »quemadmodum vocabula rebus essent imposita«) und jene der Rede, die aus ersterer »wie ein Fluss aus der Quelle« hervorgeht (De lingua latina, 8, 1–6).
Da der Mensch die Namen, die ihm stets vorausgehen, nur durch Überlieferung empfangen kann, ist sein Zugang zu dieser grundlegenden Sphäre der Sprache durch die Geschichte vermittelt und bedingt. Der sprechende Mensch erfindet keine Namen, noch gehen sie aus ihm hervor wie eine tierische Stimme: Sie erreichen ihn discendo, sagt Varro, also durch die geschichtliche Überlieferung. Die Namen können nur gegeben und weitergegeben werden; die Rede dagegen ist Gegenstand einer ars und unterliegt einem technisch-rationalen Wissen. Es ist hier nicht wichtig, ob die Namen als göttliche Gabe oder als menschliche Erfindung verstanden werden: wichtig ist, dass sich ihr Ursprung dem Sprecher selbst entzieht.
Die Zerlegung der Ebene der Sprache in zwei hierarchisch distinkte Stufen ist eine so langlebige und wichtige Intuition, dass wir sie in einer vollkommen analogen Fassung noch im Tractatus von Wittgenstein wiederfinden können. Hier werden die Namen als Urzeichen* definiert, deren Bedeutung uns erst erklärt werden muss, damit wir sie verstehen (Satz 4.026). Mit den Sätzen dagegen, sagt Wittgenstein, verständigen wir uns, ohne weiterer Erläuterung zu bedürfen. (Man sollte über diesen Charakter des menschlichen Zugangs zur Sprache nachdenken, nach dem jeder Sprechakt stets die Ebene der Namen voraussetzt, die ihrerseits nur geschichtlich durch ein »so sagt man« betreten werden kann, das aber in Wirklichkeit ein »so sagte man« ist.)
Es ist dieser ursprüngliche geschichtliche Grund der Sprache, der sich jeder bloß technisch-rationalen Durchdringung widersetzt und den uns Dante in einer Passage des Gastmahls mit einem astronomischen Bild als den »Schatten« der Grammatik präsentiert. Dante vergleicht die Grammatik mit dem Mondhimmel, ob »des Schattens, der in ihm ist, der nichts anderes ist als die Porosität seines Körpers, wo die Strahlen der Sonne nicht so an ein Ende gelangen und abprallen können, wie in den anderen Teilen«. Von der Grammatik sagt Dante gleichermaßen: »denn wegen ihrer Unendlichkeit können die Strahlen der Vernunft in ihr an kein Ende gelangen, vor allem bezüglich der Vokabeln«[10].
Die Vernunft kann den Grund der Namen (»der Vokabeln«) nicht erreichen, sie kann sie nicht ergreifen, weil sie ihr, wie wir gesehen haben, geschichtlich zustoßen: discendendo. Dieses unendliche »Herabsteigen« [discesa] der Namen ist die Geschichte. Die Sprache nimmt den sprechenden Menschen hinsichtlich seines ursprünglichen Orts immer schon vorweg, übersteigt ihn unendlich in die Vergangenheit und zugleich in die Zukunft einer unendlichen Herkunft [discendenza