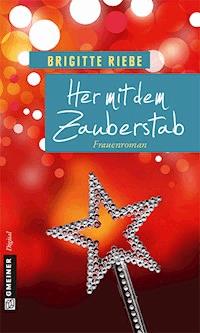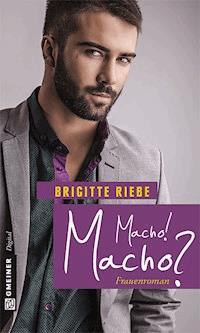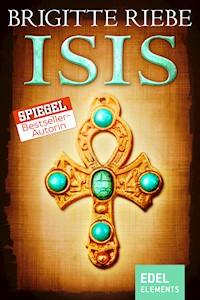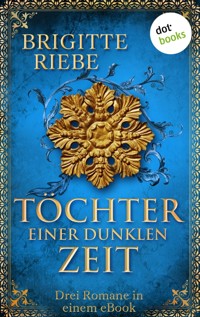Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die berühmteste Heilerin der westlichen Welt: Der Historienroman »Die Prophetin vom Rhein« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe als eBook bei dotbooks. Mitte des 12. Jahrhunderts: Die einen verehren sie, für die anderen ist sie eine Gesandte des Teufels – doch unbeirrt folgt Hildegard von Bingen der Stimme ihres Herzens. Sie will nicht länger von Männern abhängig sein und sich deren Allmachtsanspruch unterwerfen. In ihrem Kloster auf dem Rupertsberg bietet sie darum vielen Frauen Schutz, so auch der jungen Theresa: Durch den plötzlichen Tod ihres Vaters und die Machtgier ihres Onkels hat Theresa alles verloren, was ihr als Tochter des Reichsgrafen zustand – nun bleibt ihr keine andere Wahl, als den Schleier zu nehmen. Doch dann verliebt sich Theresa in den Händlersohn Willem, der gefährliche Verbindungen zu den Katharern hat – eine Ketzersekte, die Hildegard und ihren jungen Schützling vor die härteste Probe ihres Lebens stellt … »Ein hervorragender Roman, der Hildegard von Bingen nicht nur als strahlende Visionärin zeigt.« Frankfurter Stadtkurier Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der große Mittelalterroman »Die Prophetin vom Rhein« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Mitte des 12. Jahrhunderts: Die einen verehren sie, für die anderen ist sie eine Gesandte des Teufels – doch unbeirrt folgt Hildegard von Bingen der Stimme ihres Herzens. Sie will nicht länger von Männern abhängig sein und sich deren Allmachtsanspruch unterwerfen. In ihrem Kloster auf dem Rupertsberg bietet sie darum vielen Frauen Schutz, so auch der jungen Theresa: Durch den plötzlichen Tod ihres Vaters und die Machtgier ihres Onkels hat Theresa alles verloren, was ihr als Tochter des Reichsgrafen zustand – nun bleibt ihr keine andere Wahl, als den Schleier zu nehmen. Doch dann verliebt sich Theresa in den Händlersohn Willem, der gefährliche Verbindungen zu den Katharern hat – eine Ketzersekte, die Hildegard und ihren jungen Schützling vor die härteste Probe ihres Lebens stellt …
»Ein hervorragender Roman, der Hildegard von Bingen nicht nur als strahlende Visionärin zeigt.« Frankfurter Stadtkurier
Über die Autorin:
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sich schließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem mehr als 50 historische Romane und Krimis, mit denen sie regelmäßig auf den Bestsellerlisten vertreten ist. Heute lebt Brigitte Riebe mit ihrem Mann in München.
Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.com
Bei dotbooks veröffentlichte Brigitte Riebe ihre historischen Romane: »Der Kuss des Anubis«, »Die Töchter von Granada«, »Schwarze Frau vom Nil«, »Pforten der Nacht«, »Liebe ist ein Kleid aus Feuer«, »Die Hexe und der Herzog«, »Die schöne Philippine Welserin« und »Die Braut von Assisi«.
Auch bei dotbooks erscheint ihr Roman »Der Wahnsinn, den man Liebe nennt«.
***
eBook-Neuausgabe März 2022
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Lightboxx / digiselector / javarman / Oksanan Alekseeva
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-771-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Prophetin vom Rhein« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Riebe
Die Prophetin vom Rhein
Roman
dotbooks.
Meiner Großmutter Therese in Liebe und Dankbarkeit
Der Himmel auf Erden ist überall, wo ein Mensch von Liebe zu Gott, zu seinen Mitmenschen und zu sich selbst erfüllt ist.
Hildegard von Bingen (1098 bis 1179)
Prolog
Doryläum, Herbst 1147
Warum durfte er nicht endlich sterben?
Der Ritter spürte die kalte Umarmung bereits, und er roch den brandigen Atem, der ihn streifte. Doch der Tod schien entschlossen, ihn zu verhöhnen, denn er kam und ging, wie es ihm gefiel, presste sich nah an ihn und zog sich plötzlich wieder zurück, ganz und gar nicht die mächtige Welle, wie der Ritter es sich stets vorgestellt hatte, etwas Dunkles, Großes, das ihn gnädig einhüllen und weit forttragen würde, bis alle Pein verflogen und jegliche Erinnerung ausgelöscht wäre.
Was er seit Stunden durchlitt, war grell und hart, schmerzvoll und erniedrigend zugleich. Blut, überall Blut, dazu Heerscharen von Fliegen, die sich auf den Wunden niedergelassen hatten – seinen und denen der toten und halb toten Krieger, die neben ihm oder unter ihm lagen, grotesk entstellt durch klaffendes Fleisch oder Gase, die ihre Körper widerlich aufgetrieben hatten. Ab und zu noch ein kraftloses Ächzen oder Stöhnen, sonst war nichts zu hören als das heisere Krächzen der Geier über ihnen, die immer engere Kreise zogen.
Keiner würde seinen Leichnam waschen oder später einmal an seinem Grab weinen. Niemand seinetwegen eine Totenmesse stiften noch für den Leichenschmaus aufkommen. Sein Name sollte einfach verwehen wie lose Spreu im Wind – was für ein schmähliches Ende!
Für einen Augenblick wurde sein Blick klarer, umfasste die trostlose Steppe mit dem staubigen Gestrüpp, in der sie hier gestrandet waren, die blutverschmierten Schwerter ringsumher, weggeworfen wie nutzlos gewordenes Kinderspielzeug. Ein bitteres Lachen stieg auf in seiner Kehle, die so ausgedörrt war, als hätte er humpenweise Staub geschluckt. Was hatte der zornige Prediger ihnen nicht für aufregende Abenteuer in Aussicht gestellt, wie überzeugend all den versammelten Rittern himmlische Vergebung und kostbare Beute in einem ausgemalt!
Stattdessen war er nun am Verrecken, armseliger als jeder Straßenköter, Seite an Seite mit einem blutjungen Franzosen von der Küste, dem der Hieb eines Sarazenenschwertes das vorher hübsche Lärvchen vom Scheitel bis zum Kiefer gespalten hatte. Die Gedanken des Ritters flogen davon, und für den Bruchteil eines Augenblicks tauchten die starken Mauern der heimatlichen Burg vor ihm auf. Dann das Gesicht seiner Frau, bleich und ängstlich, als spüre sie am eigenen Leib, was er soeben durchlitt. Gefolgt vom aufmüpfigen Profil des kleinen Sohns, eines Pferdenarren wie er selbst, der am liebsten schon als Ritter im Sattel gesessen hätte, kaum hatten seine dicken Beinchen das Laufen gelernt. Schließlich schien das Haar seiner Tochter auf einmal zum Greifen nah, dunkel wie Rauch, knisternd vor Jugend und Kraft.
Doch vor all diese sehnsuchtsvollen Bilder schob sich breit und triumphierend das Blecken seines nachgeborenen Bruders, der nun endlich am Ziel seiner kühnsten Träume angelangt war, da der Reichsgraf nie mehr zurückkehren würde.
Verzeiht mir, wollte er den anderen zurufen, dass ich euch ihm ausgeliefert habe! Er wird nicht lange zögern, die Schmach des Zweitgeborenen endlich zu tilgen. Niemals hätte ich euch verlassen dürfen, schon gar nicht wegen dieses sinnlosen Heerzuges gegen die Heiden, der uns nur Hunger und Leid, nichts als Verrat, Tod und Verwüstung gebracht hat.
Doch seine Gedanken trieben ihr eigenes Spiel, ballten sich zusammen, verknoteten sich, um sich schließlich wie klebrige Fäden im unsichtbaren Nichts zu verlieren. War das nun das Ende, um das er seit Stunden so verzweifelt rang?
Es musste fast so weit sein, denn plötzlich ertönten Hufschläge auf harter Erde. Danach eilige Schritte; schließlich beugte sich jemand tief über ihn.
Eine fremde Kraft trieb ihn dazu, die Lider zu öffnen.
Helle Augen schauten auf ihn hinunter, klar und hart wie Gebirgsgletscher. Ein Blick, den man nicht mehr vergaß, wenn er einen nur ein einziges Mal gestreift hatte: der ehrgeizige junge Königsneffe mit dem roten Bart, der selbst von der Krone träumte, wie der Ritter wusste.
Der Sterbende versuchte, einen Arm zu rühren, um anzuzeigen, dass er noch lebte. Verzweifelt strengte er sich an, wenigstens einen Laut hervorzustoßen, doch aus seinen halb geöffneten Lippen floss lediglich ein Schwall dunklen Blutes.
Friedrich von Schwaben betrachtete ihn, zog angewidert die Nase hoch, schüttelte den Kopf und wandte sich ab. In seinem behäbigen Tonfall hörte der Ritter ihn etwas zu seinem Begleiter sagen, dann gingen die beiden Männer weg, saßen auf und ritten davon.
Eine kleine Ewigkeit verstrich.
Irgendwann musste der Tod ihm auf die Brust gekrochen sein, drückte und würgte ihn, als sei er entschlossen, dem unwürdigen Zustand nun doch ein Ende zu bereiten. Beine und Arme spürte der Ritter längst nicht mehr, eben so wenig wie den präparierten Pfeil, der ihm tief zwischen die Rippen gedrungen war und dort unerbittlich sein Werk verrichtete. Alle Qualen der letzten Stunden hatten sich zu einem einzigen Schmerz vereinigt, der wie mit Feuerzungen sein ganzes Sein erfüllte – beziehungsweise das wenige, was davon noch übrig geblieben war.
Er musste wissen, wie der aussehen mochte, der ihm derart mitleidlos zusetzte, doch nicht einmal seinen Lidern konnte er mehr befehlen. Als er schon längst nicht mehr damit rechnete, gingen sie plötzlich auf.
Der Tod hatte ein hageres bräunliches Gesicht. Seine Nase war gekrümmt. Schwarze Sichelaugen, in denen der Ritter eine Spur von Neugierde zu lesen glaubte. Er hielt den Mund gespitzt und gab fremdartige Töne von sich, die sich zu einer seltsamen Melodie verbanden. Doch wieso hörte er nicht auf, derart an ihm zu zerren und zu ziehen, wo er ihm doch ohnehin wehrlos ausgeliefert war?
Der Ritter spürte, wie sein Kopf leicht angehoben wurde, dann floss etwas unendlich Köstliches durch seine Kehle: Wasser!
Er hatte das Schlucken bereits verlernt, würgte, spuckte. Hustend sank er auf den Boden zurück. Dabei stieß sein Schädel hart gegen einen Stein.
Jetzt, endlich, erlöste ihn das ersehnte Dunkel, tief und grenzenlos.
Erstes BuchSäen
1152 bis 1155
Kapitel 1
Bingen, Spätwinter 1152
Ein kalter Wind pfiff auf dem Fährschiff, das soeben vom rechten Rheinufer abgelegt hatte. Noch gegen Mittag hatte die Februarsonne ein Weilchen zwischen den Wolken hervorgeblitzt, inzwischen aber war der Nachmittag vorangeschritten, und der Himmel zeigte sich wieder verhangen. Schon drohte der nächste Graupelschauer, der die ständig klammen Umhänge erneut durchnässen würde.
Wie satt Theresa das alles hatte!
Beim Aufspringen auf die rutschigen Planken war Feuchtigkeit durch die löchrigen Sohlen gedrungen, und ihre Füße waren inzwischen zu Eis erstarrt. So durchfroren fühlte sie sich, so hungrig und verloren, dass sie am liebsten geweint hätte. Doch Weinen war strengstens verboten, ebenso wie über einen knurrenden Magen zu klagen oder über Schneeregen, Bettwanzen und schimmelig gewordenes Brot, das sich kaum noch hinunterwürgen ließ. Sie waren auf der Flucht und bettelarm, das hatte die Mutter ihnen eingetrichtert, bis jemand den Oheim zwingen würde, ihnen zurückzugeben, was er ihnen so dreist geraubt hatte.
Allerdings gab es da sehr wohl etwas, auf das Götz von Ortenburg sich in seinem Zorn berufen konnte, etwas Schwerwiegendes, Unaussprechliches, das spürte sogar Gero, ihr kleiner Bruder, der so angestrengt auf das Wasser starrte, als erhoffe er sich Erlösung aus den blaugrünen Fluten. Die Mutter selbst hatte ihrem Schwager den Anlass für sein Handeln geliefert. Und es hätte sogar noch schlimmer ausfallen können, da Götz sehr jähzornig werden konnte, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Deshalb hatten sie sich auch im Schoß der Nacht aus der Burg geschlichen, zwei Pferde aus dem Stall geholt und sich nach Westen durchgeschlagen, um dort Schutz und Hilfe zu erbitten.
Eine endlose Reise allerdings, die ihnen bislang nichts als Enttäuschungen und neuen Kummer gebracht hatte. Theresa hatte von Anfang an nicht recht daran glauben können, dass dieser schwache Herrscher, von vielen im Reich als »Pfaffenkönig« verunglimpft, ihnen helfen würde, und ihr Misstrauen sollte sich schließlich auch bewahrheiten. Zu König Konrad, der ihren Vater in den Tod geschickt hatte, war trotz Bitten und Flehen kein Vordringen gewesen. Er litt, wie man ihnen flüsternd zutrug, an einem südlichen Fieber, mit dem er sich während des gescheiterten Kreuzzuges angesteckt hatte, und war dem Tod näher als dem Leben.
Auch in seiner Umgebung schien keiner daran interessiert, sich ausgerechnet jetzt mit der wirren Geschichte der Witwe eines Reichsgrafen und ihrer unmündigen Kinder zu beschäftigen, die in Not geraten waren. Zu Bamberg jedenfalls, wo die Großen des Landes sich für eine Italienfahrt versammelt hatten, die nun nicht mehr stattfinden konnte, hatte man sie abgefertigt wie lästiges Bettlerpack. Hätte es nicht jenen Ritter gegeben, der mit ihrem Vater gegen die Heiden gekämpft und ihnen einen Beutel mit ein paar Silbermünzen zugesteckt hatte, sie hätten sich unterwegs schon bald nicht einmal mehr die schäbigste Unterkunft leisten können.
Sah man ihnen das Elend inzwischen schon von Weitem an?
Gerade in diesem Moment wünschte sich Theresa aus ganzem Herzen, dass es anders wäre. Ein Blick auf ihre lehmbespritzten Kleider und das rissig gewordene Schuhwerk belehrte sie jedoch eines Besseren. Warum musste sie ausgerechnet in einem so erbärmlichen Zustand auf diesen jungen Mann treffen, der sie wie magisch anzog, seitdem er ihren Weg gekreuzt hatte?
Er war groß und hielt sich gerade, hatte stattliche Schultern und eine dichte, rotbraune Mähne, die der Wind ihm zerzauste. Ein wenig erinnerte er sie an Richard, den Bastard von Onkel Götz, aber vielleicht auch nur, weil beide sich ähnlich geschmeidig bewegten, und Richard der ansehnlichste junge Mann war, der ihr bisher begegnet war. Das Gesicht des Fremden war flächig und hell, mit einem Nest von Sommersprossen auf der Nase und einem Grübchen im Kinn, das man nur bemerkte, wenn man ganz genau hinsah. Sein dicker, brauner Walkumhang sah so wärmend aus, dass Theresa ihn darum beneidete. Was sie aber am meisten faszinierte, waren seine Augen, das rechte so blau wie der Himmel an einem strahlenden Junitag, das linke ein gutes Stück dunkler, fast ins Bräunliche changierend.
Natürlich schaute er nicht zu ihr herüber, und wenn doch, dann lediglich gleichgültig, als nehme er sie bestenfalls zufällig wahr. Was bekam er denn auch schon zu sehen? Nichts als ein armselig gekleidetes Mädchen, das inzwischen viel zu lange von zu Hause fort war, um mit dem Kostbarsten prunken zu können, was die Natur ihm geschenkt hatte. Das dunkle Haar, sonst Theresas größter Stolz, war notgedrungen straff geflochten und unter einer verbeulten Filzkappe verborgen, anstatt wie sonst lockig und knisternd bis zu den Hüften zu fallen.
Jetzt musste ihre Nase noch spitzer wirken, und die Wangen sahen vermutlich so eingefallen aus wie die eines halb verhungerten Kindes. Theresa, die noch vor wenigen Monaten auf ihren vierzehnten Geburtstag hingefiebert hatte, um endlich zu den Erwachsenen zu zählen, schätzte das anziehende männliche Gegenüber auf zwanzig. Eigentlich genau das zu ihr passende Alter. Doch seit sie Ortenburg verlassen hatten, war so viel geschehen, dass sie beide sehr viel mehr trennte als diese paar lächerlichen Jahre.
»Ist Euch nicht gut?«, wandte sich der ältere Mann, der neben dem jungen stand, an die Witwe, und sein singender Tonfall ließ erkennen, dass er wohl nicht in seiner Muttersprache redete. »Ihr seid doch nicht etwa krank?«
Ada von Ortenburg wischte sich mit der Hand über das Gesicht. Dabei verschob sich der Umhang und entblößte ihren gewölbten Bauch.
»Es geht schon wieder.« Schnell zupfte sie den Stoff zurecht. »Wir sind nur schon so lange unterwegs. Und haben leider bislang nicht gerade Glück gehabt.«
Der Blick ihres Gegenübers schien an Schärfe zu gewinnen. Der Mann war mittelgroß und sehnig, hatte grau meliertes Haar und ein markantes Gesicht. Unter einem wild wuchernden, pechschwarzen Brauengestrüpp stachen Augen hervor, blank wie geschliffener Obsidian.
»Frauen ohne männlichen Schutz meiden für gewöhnlich Straßen und Flüsse.« Plötzlich klang er offen missbilligend. »Zumal zu dieser unwirtlichen Jahreszeit. Und dazu haben sie auch jeden Grund. Was sagt denn Euer Gemahl dazu? An ihm wäre es doch zuallererst gewesen, Euch vor solch gefährlichen Abenteuern abzuhalten!«
Geros magerer Rücken schien auf einmal noch steifer geworden zu sein. »Ich kann sie doch beschützen!«, rief er, ohne sich umzudrehen. »Mama und meine Schwester. Auch wenn ich leider noch kein Ritter bin. Doch zu ihrem Schutz fühle ich mich längst groß genug!«
Theresa sah, wie die Mutter den Umhang unwillkürlich enger um sich zog. Lass es bleiben!, hätte sie ihr am liebsten zugerufen. Du kannst es ohnehin nicht mehr verbergen, so viel Mühe du dir auch gibst. Aber natürlich kam nicht ein Laut über ihre Lippen.
»Mein Mann ist tot, und es gibt nur noch eine einzige Zuflucht, die uns geblieben ist. Wir müssen sie unter allen Umständen erreichen, sonst weiß ich nicht, was aus uns werden soll.«
Das Brauengestrüpp schnellte fragend nach oben.
»Wir kommen gerade vom Kloster Eberbach«, fuhr Ada fort, »aber auch dort konnte man uns nicht weiterhelfen.«
Wieso erteilte die Mutter einem Fremden diese Auskünfte, wo sie den Kindern doch eingeschärft hatte, so wenig wie möglich von sich preiszugeben, bis sie ihr Ziel erreicht hätten?
»Der Erzbischof von Mainz ...« Adas Stimme war nur noch ein Flüstern. »Ich hatte so sehr gehofft, ihn in Kloster Eberbach anzutreffen, aber ...«
Sie taumelte, suchte nach einem Halt und lehnte sich in Ermangelung von etwas Besserem an den Weißen, Theresas kreuzbraven Wallach mit der Blesse, die ihm den Namen eingetragen hatte. Das Tier ließ es sich schnaubend gefallen. Es war jetzt ihr einziges Pferd, nachdem das andere vor ein paar Tagen alle viere von sich gestreckt hatte. Was hieß, dass sie nun noch langsamer vorankommen würden.
»Der Erzbischof hat Eberbach verlassen und ist nach Bamberg geritten«, sagte der Mann. »Es scheint ungewiss, wann er wieder an den Rhein zurückkehren wird, so wie die Dinge gerade liegen.« Er sah Ada an und schüttelte missbilligend den Kopf. »Ich beginne mir ernsthaft Sorgen um Euch zu machen. Ihr schwankt ja noch immer und seid kreidebleich! Wollt Ihr Euch nicht ein wenig ausruhen? Willem, den Hocker und unseren Proviantkorb – und beeil dich gefälligst!«
Der Jüngere lief zu dem Packpferd, das sie mit sich führten. Schon nach wenigen Augenblicken kam er mit einem aufklappbaren Sitzmöbel zurück, auf das Ada sich mit einem Seufzer der Erleichterung sinken ließ.
Gerade noch rechtzeitig, denn das Boot, das bislang ruhig und gleichmäßig unter den Stößen der Fährleute vorangekommen war, geriet in der Strommitte auf einmal ins Trudeln und begann bedenklich zu schwanken. Waren das jene gefährlichen Untiefen im Rhein, vor denen andere Reisende sie so eindringlich gewarnt hatten?
Plötzlich war auch Gero wieder an ihrer Seite. Obwohl er grünlich im Gesicht war, griff er ebenso gierig wie Theresa nach dem weißen Brot. Der geräucherte Fisch dagegen verschwand zögerlicher in seinem Mund.
»Habt ihr denn kein Fleisch?«, sagte er, mit vollen Backen kauend. »Oder wenigstens ein ordentliches Stück Käse? Ich mach mir eigentlich nicht besonders viel aus Wassergetier, müsst ihr wissen.«
»Damit können wir leider nicht dienen.« Die Stimme des Alteren klang plötzlich belegt.
»Verhungern wirst du schon nicht, Kleiner!« Willems breites Lachen entblößte einen abgeschlagenen Schneidezahn, der ihm etwas Jungenhaftes verlieh.
Ada ließ den Kindern den Vortritt und begnügte sich mit ein paar Schlucken Most aus einer bauchigen Lederflasche.
Inzwischen glitt die Fähre wieder einigermaßen ruhig dahin. Waren die beiden Fremden Vater und Sohn? Theresa konnte in den so unterschiedlichen Männergesichtern beim besten Willen keinerlei Ähnlichkeit entdecken.
»Ihr seid sehr gütig«, hörte sie die Mutter nach einer Weile sagen. »Und zudem offenbar bemerkenswert gut unterrichtet.«
Die Spur eines Lächelns auf dem strengen Gesicht des Alteren.
»Gebietet uns der Glaube nicht, mildtätig und barmherzig zu sein, auch und gerade Fremden gegenüber?« Er deutete eine Verneigung an. »Adrian van Gent, verzeiht mein Versäumnis! Der junge Mann neben mir ist mein geliebter Neffe Willem. Wir sind flandrische Kaufleute, die viel herumkommen.«
»Und die soeben das Glück hatten, einige ihrer Waren am erzbischöflichen Hof anbieten zu dürfen.« In Willems Stimme schwang unüberhörbarer Stolz mit. »Dabei erfuhren wir überaus freundliche Aufnahme. Seitdem ...«
»Das gehört doch nicht hierher, Willem!«, unterbrach Adrian ihn schroff.
Der Neffe wirkte brüskiert, ließ sich aber nicht lange einschüchtern. »Und wer seid Ihr?«, fragte er.
Schaute er dabei nicht einen Augenblick länger zu Theresa, als es eigentlich nötig gewesen wäre? Ihr Herz jedenfalls machte einen freudigen Satz.
»Die Reichsgräfin zu Ortenburg«, erwiderte Ada und sah plötzlich größer aus. »Und diese beiden sind meine Kinder Theresa und Gero.« Plötzlich schien sie es aufgegeben zu haben, sich weiterhin zu verstecken.
Adrian van Gent gelang es, seine Überraschung zu verbergen, trotzdem war ihm anzusehen, dass er mit solch einer Eröffnung niemals gerechnet hatte.
Geros Augen waren bei Willems Worten blank vor Neugierde geworden. »Verkaufst du dem Erzbischof auch Schwerter und Ringelpanzer?«, stieß er aufgeregt hervor. »Damit er wie mein Herr Vater die Heiden zu Jerusalem niederschlagen kann?«
»Wo denkst du hin!« Willem schüttelte den Kopf. »Wir handeln ganz friedlich mit edlen Tuchen, mit Barchant und Seide. Unsere Fuhrwerke mit der jüngsten Lieferung müssten Bingen bereits binnen weniger Tage erreichen.«
»Bingen!«, stieß Ada hervor. »Genau das ist auch unser Ziel. Das neue Kloster auf dem Rupertsberg ...« Sie verstummte abermals, als fehle ihr die Kraft weiterzureden.
»Wir könnten Euch dorthin bringen, wenn Ihr wollt«, bot Adrian an. »Am Ufer nehme ich die Kleine auf mein Pferd, und Willem soll den Jungen bei sich aufsitzen lassen.«
»Ich danke für Euer freundliches Angebot!«, sagte Ada, auf einmal wieder Gräfin von Kopf bis Fuß. »Aber warum wollt Ihr das alles für uns tun?« Ihr Tonfall verriet erneut aufflackerndes Misstrauen.
»Wir sind gute Christen«, lautete van Gents Antwort, »die dem Vorbild Jesu nacheifern. Wieso esst Ihr nicht auch ein paar Bissen? Es ist doch mehr als genug für alle da!«
***
Höre, Tochter, mich, deine Mutter, die ›im Geiste‹ zu dir spricht: Schmerz steigt in mir auf. Der Schmerz tötet das große Vertrauen und die Tröstung, die ich in einem Menschen besaß. Von nun ab möchte ich sagen: Besser ist es, auf den Herrn zu hoffen, als auf Fürsten seine Hoffnung zu setzen. Der Mensch, der so auf Gott schaut, richtet wie ein Adler sein Auge auf die Sonne. Und darum soll man nicht sein Augenmerk auf einen hochgestellten Menschen richten, der wie die Blume verwelkt. Hierin habe ich gefehlt aus Liebe zu einem edlen Menschen ...
Hatte sie nicht soeben ein Klopfen gehört?
Hildegard schaute zur Tür, doch draußen blieb alles still. Erneut nahm sie ihre Lektüre wieder auf, die noch heute in ihren Händen zu brennen schien.
Nun sage ich wiederum: Weh mir, Mutter, weh mir, Tochter! Warum hast du mich wie eine Waise zurückgelassen? Ich habe den Adel deiner Sitten geliebt, deine Weisheit und deine Keuschheit, deine Seele und dein ganzes Leben, sodass viele sagten: Was tust du? Jetzt können alle mit mir klagen, die ein Leid tragen, wie ich es trage, die in der Liebe zu Gott dieselbe Liebe in ihrem Herzen und Geist für einen Menschen fühlten, wie ich sie für dich fühlte – für einen Menschen, der ihnen ganz plötzlich entrissen wurde, so wie du mir entrissen wurdest ...
Tränen füllten ihre Augen. Sie ließ die Abschrift ihres Briefes sinken, konnte sie nicht vollständig zu Ende lesen. Die Worte brannten ohnehin in ihrem Herzen, waren dort eingeätzt bis zum letzten Atemzug.
Was hatte sie nicht alles in Bewegung gesetzt!
Die Markgräfin und zwei Erzbischöfe zur Unterstützung angerufen, sogar den Heiligen Vater in Rom beschworen, die über alles geliebte Freundin auf den Rupertsberg zurückkehren zu lassen. Ganz zum Schluss dann eben diese Zeilen, in denen sie ihre Seele nach außen gekehrt und den letzten Stolz abgestreift hatte – leider ebenso vergeblich wie all ihre anderen Bemühungen.
Richardis war fort. Nichts und niemand auf der Welt würde sie ihr jemals zurückgeben.
Ihr Bildnis freilich würde Hildegard bis zum Ende aller Tage in sich tragen. Schmale, überraschend energische Hände. Ein Lächeln wie ein Sonnenstrahl, das die Anmut des ernsten Gesichts erst zur Geltung brachte. Dunkles Haar, so widerspenstig, dass es sich kaum unter den Schleier zwingen ließ. Gewitterblaue Augen. Entschlossene Schritte, die Hildegard oft wie ein Tanz erschienen waren. Ein unbestechlicher Kopf, der auch vor riskanten Themen nicht zurückscheute. Und diese nahezu traumwandlerische Sicherheit in Grammatik, Rhetorik, vor allem aber in Latein, die sie immer wieder aufs Neue begeistert hatte! Ohne Richardis’ Beistand hätte Hildegard ihr großes Werk »Scivias – Wisse die Wege« niemals so rasch vollenden können.
Alles, alles an Richardis hatte sie geliebt!
Der Schmerz, sie verloren zu haben, wucherte wie ein Krebsgeschwür in ihr, stach und wütete, obwohl die junge Nonne den Rupertsberg bereits vor Monaten verlassen hatte. Und wenn auch die anderen frommen Schwestern sich eifersüchtig die Mäuler über sie zerrissen, weil ihre Liebe zu der viel Jüngeren das übliche Maß an Zuneigung unter den Ordensfrauen bei Weitem überstiegen hatte, bis heute donnerte der Hufschlag der Pferde, die Richardis nach Norden getragen hatten, als höllisches Getöse in Hildegard. Noch immer meinte sie, das hilflose Winken zu sehen, mit dem die andere sich im Sattel ein letztes Mal zu ihr umgedreht hatte.
Jetzt war das Klopfen nicht länger zu überhören.
Hildegard wischte sich die Augen trocken, straffte sich. Alle Schwestern auf dem Rupertsberg wussten, wie heilig ihr die knappe Zeit zwischen Non und Vesper war, die sie am liebsten allein in ihrem erst jüngst fertiggestellten Haus verbrachte. Es musste schon etwas Wichtiges sein, was diese Störung rechtfertigte.
»Herein!«, sagte sie und war froh, dass ihre Stimme so gefasst klang.
Hedwigs schmaler Kopf schob sich vorsichtig durch den Spalt. »Josch wäre jetzt da, hochwürdige Mutter«, sagte sie. »Die Entscheidungen wegen der Wingerte lassen sich nicht länger aufschieben. Willst du ihn empfangen?«
Hedwigs prüfendem Blick entging nichts. Weder die verquollenen Augen noch das fleckig gewordene Pergament, das unter einer anderen Abschrift hervorlugte, die Hildegard im letzten Moment darübergeschoben hatte. Eigentlich zur Leiterin des Scriptoriums bestimmt, war sie Hildegard in den zurückliegenden schwierigen Anfangsjahren wegen ihrer ebenso fröhlichen wie zupackenden Art in vielerlei Hinsicht unentbehrlich geworden. Trotzdem würde sie Richardis niemals ersetzen können, in keiner Hinsicht, was beide Frauen wussten, auch wenn keine von ihnen je ein Wort darüber verlor.
Hedwig betrat den kleinen Raum, das Studierzimmer der Magistra, wohin diese sich in ihrem Schmerz am liebsten verkroch.
»Bei Donata hat heute Nacht wieder das Gliederreißen eingesetzt«, fuhr Hedwig schnell fort, als könne sie Hildegards Gedanken lesen. »Sie kann sich kaum aufrichten und humpelt einher, als sei ihr ein böser Wind in den Rücken gefahren. Deshalb hab ich heute Nachmittag auch ihren Dienst an der Pforte übernommen, damit sie in der Krankenstube schnell wieder zu Kräften kommt.«
»Das heißt, sie bleibt vorerst im Bett und bekommt endlich das Geflügel vorgesetzt, nach dem es sie so sehr gelüstet?«
»Nicht allen ist es vergönnt, auf alles stets mit leichtem Herzen zu verzichten. Wir mühen uns redlich darum, mal mit besserem, gelegentlich aber leider auch mit schlechterem Ergebnis.«
Hildegard schenkte ihr einen raschen Blick. Niemals würde Hedwig eine Mitschwester verpetzen, schon gar nicht die Ärmste, die sich nun quälen und tagelang mit Benignas ätzend riechender Stinkwacholdersalbe einreiben musste, bis sie halbwegs schmerzfrei sein würde. Und doch besaß Hedwig durchaus ein gewisses Geschick, die eigenen Leistungen ins rechte Licht zu rücken.
»Dann bring Josch endlich herein und setzt euch alle beide!« Sie wies auf die Stühle neben sich.
Hedwig zögerte keinen Augenblick. Der hagere Mann dagegen, der sichtlich respektvoll den Raum betreten hatte, sehr wohl.
»Ich weiß, ich störe, domina«, sagte er und senkte ehrerbietig den kantigen Kopf. »Doch der Wingert ...«
»... gehorcht den Gesetzen der Natur und kann nicht warten«, fiel Hildegard ihm ins Wort. »Was brauchst du von mir, Josch, damit du deine Arbeit fortsetzen kannst?«
Er schluckte, schien nach Worten zu ringen. »Vor allem wünschte ich, Ihr kämt endlich wieder einmal mit mir«, sagte er schließlich. »Um Euch mit eigenen Augen von unseren enormen Fortschritten zu überzeugen.« Ein Räuspern, als strenge er sich an, endlich zur Sache zu kommen. »Die Rodung für den neuen Wingert ist abgeschlossen, das gesamte Gelände mithilfe der fleißigen Männer urbar geworden. Die edle Frau Gepa würde im Himmel lächeln, könnte sie sehen, was wir aus ihrer großzügigen Schenkung gemacht haben.«
»Das meiste davon ist im vergangenen Jahr geschehen.« Hildegards Stimme klang müde. »Und du hattest mir bereits ausführlich darüber berichtet. Sonst noch etwas?«
Der Tadel, den er aus ihren Worten herauszuhören glaubte, schien ihn zu treffen.
»Kein Wein ist richtig trinkbar nach den ersten Ernten«, sagte er. »Es dauert Jahre, bis die veredelten Stöcke schmackhafte Trauben tragen, das wisst Ihr ebenso gut wie ich. Und deshalb bin ich hier. Damit wir keine Zeit vergeuden.«
Sie zog die hellen Brauen nach oben. Jetzt hatte ihr Gesicht den melancholischen Ausdruck von vorhin verloren, wirkte wacher, um einiges jünger.
»Wir sollten baldmöglichst mit dem Rebschnitt im älteren Wingert beginnen.« Josch war nun ganz in seinem Element. »Um die milde Witterung zu nutzen, die ich schon in allen Knochen spüre.«
»Meinst du damit vielleicht den Graupelschauer, der draußen gerade niedergeht?«
»Das Wetter wird umschlagen, vielleicht schon heute Nacht, vielleicht auch erst morgen, das verrät mir mein alter Bruch, der zu jucken begonnen hat, und darauf kann ich mich verlassen. Doch wer kann schon sagen, wie lange das anhalten wird? Es gibt Jahre, wo der Winter nach solch einer kurzen Warmperiode noch einmal mit aller Macht zurückkommt und das Erdreich erneut gefrieren lässt. Daher müssen die abgeschnittenen Triebe so schnell wie möglich klein gehackt und in den Boden eingearbeitet werden, um den Humus anzureichern ...« Er hielt inne, starrte auf seine Schuhe.
»Was du sagst, hat Hand und Fuß. Wer oder was könnte dich also davon abhalten?«, schaltete Hedwig sich ein.
»Der Mangel, ehrwürdige Schwester, einzig und allein der Mangel! Denn leider fehlen mir die dazu notwendigen Männer.« Seine Schultern sanken nach unten. »Bischof Heinrichs Kämmerer hat die Bauern ganz kurzfristig zu Arbeiten in den bischöflichen Weinbergen abgezogen. Und das kann dauern. Ihr wisst selbst, wie viele Tagwerk er zu bewirtschaften hat.«
Hildegards Gesicht war unbewegt geblieben. »Erst dann sind sie wirklich Mönche, wenn sie von der Arbeit ihrer Hände leben. Dieser Satz stammt vom heiligen Benedikt, dem Gründer unseres Ordens. Und gilt nicht für uns Schwestern das Gleiche, was er den Brüdern abverlangt?« Ein feines Lächeln. »Wir werden dir tatkräftige Hände schicken. Kämst du denn mit acht Schwestern ein Stück weiter?«
Josch schien nach den richtigen Worten zu kramen.
»Die Zeit zwischen den Horen ist nicht gerade üppig«, entgegnete er schließlich. »Im Kloster mag das keine so erhebliche Rolle spielen. Dort können die Schwestern ihre Arbeit genau da wieder aufnehmen, wo sie sie zuvor unterbrochen haben. Wenn wir aber im Wingert halbwegs rasch vorankommen wollen ...«
»... könnte man die Psalmen ausnahmsweise unter freiem Himmel singen«, vollendete Hildegard seinen Satz. »Dann wäre ein Arbeitstag im Freien ein paar ordentliche Stunden lang. Ist dir damit geholfen, Josch?«
»Wahrhaft ein guter Anfang, domina.« Seine Züge hatten sich entspannt. »Soll ich sie dann gleich morgen früh vor der Pforte mit dem Pferdewagen abholen kommen – oder wollt Ihr Euch erst mit Bruder Volmar besprechen?«
»Volmar ist erst gestern in meinem Auftrag zum Disibodenberg geritten«, sagte sie knapp. »Ich denke, die Schwestern haben alle gesunde Beine und können laufen. Sei übermorgen an Ort und Stelle. Dann kann die Arbeit beginnen – vorausgesetzt natürlich, deine überaus optimistische Wetterprognose erweist sich wieder einmal als richtig.« Für sie schien das Gespräch beendet.
»Ich denke, Joschs Idee mit dem Pferdewagen ist gut, hochwürdige Mutter.« Auf Hedwigs hellen Wangen brannten rote Flecken, ihre Stimme aber war fest. »Dann kommen unsere Schwestern ausgeruht am Weinberg an und können abends schon ein wenig rasten, bevor sie mit uns zusammen die Vesper singen.«
Hildegard warf ihr einen unergründlichen Blick zu und erhob sich. Der Mann war ebenfalls aufgesprungen.
»Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, Herrin«, sagte er und verbeugte sich tief. »Ihr könnt Euch auf mich verlassen – in allem.«
»Gott segne dich, Josch, und auch deine Frau!«, erwiderte sie. »Ich habe von Benigna gehört, ihr erwartet wieder ein Kind?«
Er begann zu strahlen. »Ja, bald, ganz bald. Und wie froh wir beide darüber sind, wo das Letztgeborene doch nicht einmal ein Jahr alt geworden ist. Eva behauptet zwar, sie sei inzwischen zu alt zum Gebären, aber das hab ich ihr zum Glück wieder ausreden können. Eine Wehmutter muss schließlich mehr von diesem Geschäft verstehen als alle anderen zusammen, oder etwa nicht?«
Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, wandte sich Hedwig mit bittender Geste an die Magistra: »Verzeih meine Einmischung, Mutter! Aber ich dachte, es sei vielleicht besser, den verbliebenen Schwestern nicht allzu viel abzufordern. Einige murren noch immer über die ungewohnten Zumutungen unseres Umzugs vom Disibodenberg, die sich mit ihrem adeligen Stand nicht vertrügen. Sollten uns noch mehr von ihnen verlassen, so könnte es schwierig werden, unser neues Kloster zu halten.«
Hildegards Gesicht hatte sich verschlossen.
»Wer sein Leben Christus weiht, muss wissen, worauf er sich einlässt. Ehrliche Feldarbeit hat noch niemandem geschadet, schon gar nicht einer Dienerin Gottes. Übermorgen kann Josch mit dem Karren kommen, die folgenden Tage werden sie sehr wohl zu Fuß zum Weinberg gehen.« Jetzt spielte ein winziges Lächeln um ihre Lippen. »Abends mag er sie dann von mir aus mit dem Gefährt zurück ins Kloster bringen. Ich möchte nicht riskieren, dass sie mir in der Vesper aus Erschöpfung einschlafen und womöglich laut zu schnarchen beginnen. Morgen werde ich im Kapitelsaal meine Entscheidung verkünden – auch wenn ich dann nicht nur strahlende Mienen ernte.«
»Sie werden dir gehorchen, Mutter, da kannst du ganz gewiss sein. Selbst wenn es nicht allen gefällt und einige sich wieder heimlich beklagen werden.«
Hildegard strich sich mit der Hand über die Stirn.
»Ich schätze deine Offenheit, Hedwig, von jeher, und das weißt du. Allerdings wünsche ich künftig in Gegenwart von Dritten keine Widerworte mehr. Der erste Grad der Demut ist der Gehorsam. Auch das ist in den Regeln des heiligen Benedikt nachzulesen und gilt ausnahmslos für jede Schwester, für die ich als geistige Mutter zu sorgen habe.«
Hedwig neigte rasch den Kopf, um zu verbergen, wie bitter ihr Mund geworden war. Das dumpfe Geräusch des Schlagbretts erlöste sie, das alle Nonnen zur abendlichen Vesper rief.
Schweigend begaben sich beide Frauen auf den Weg zur Kapelle.
***
Warum hatte die Frau mit dem silbernen Kreuz auf der Brust sie so finster angeschaut?
Sie war die Magistra, die Erste und Oberste des Klosters, die alles zu entscheiden hatte. Ihr hatte die Mutter in fiebrigen Sätzen das ganze Elend entgegengeschleudert, bevor Hildegard die Kinder fast schon barsch aus dem Raum geschickt hatte, um mit der Mutter allein weiterzureden. Dass sie auf der Flucht waren, weil der Oheim sie um das Erbe betrogen hatte. Dass weder König noch Erzbischof ihnen hatten helfen können. Und dass das Kloster auf dem Rupertsberg, wo Base Richardis lebte, für sie die allerletzte Zuflucht war.
Ob die Mutter ihr mehr sagen, alles verraten würde, jetzt, wo die beiden Frauen allein und ungestört waren? Theresa bezweifelte es. Und selbst wenn Ada bereit war, dieses Risiko einzugehen, so stand ihre Sache doch denkbar schlecht. Die hochwürdige Mutter wird uns nicht helfen, dachte das Mädchen. Sie mag mich nicht. Das spüre ich ganz genau. Dabei kennt sie mich doch gar nicht!
Theresa ließ den Löffel sinken. Die eingedickte Buchweizensuppe, die sie gerade noch heißhungrig verschlungen hatte, schmeckte plötzlich fade.
»Hast du etwa schon genug?« Gero schielte gierig auf ihren Napf. »Dann könnte ich doch ...«
Theresa schob den Napf zu ihm. »Nimm schon«, sagte sie und hoffte, der Stein in ihrem Magen würde sich auflösen.
»Kann ich dein Brot auch haben?«, bohrte er weiter. »Ich meine nur, bevor die Schweine es bekommen?«
»Der arme Kleine muss ja regelrecht am Verhungern sein!« Clementia, die Küchenschwester, riss ihre kugelrunden Augen noch weiter auf und legte kurz die schwielige Hand auf Geros warmen Kopf. »Warte, mein Junge, du kriegst gleich noch einen ordentlichen Nachschlag. Und deine Schwester natürlich auch, wenn sie möchte.«
Eine ganze Anzahl von Nonnen hatte sich um die Kinder geschart, die am Eichentisch in der Klosterküche verköstigt wurden. Allerdings schienen die Sympathien unterschiedlich verteilt. Drei von ihnen umstanden Theresa, während der Rest sich mit teils begeisterter, teils skeptischer Miene um Geros Stuhl gruppiert hatte.
»Habt ihr denn gar kein Fleisch?«, erkundigte Gero sich unbefangen, noch bevor Theresa auch nur einen Mucks machen konnte. »Ich werde nämlich bald ein Ritter sein – und Ritter müssen doch Fleisch essen, weil sie viel Kraft brauchen.«
Einige Schwestern lachten, als habe er einen köstlichen Witz gerissen. Es war zu spüren, wie sehr sie diesen ungewohnten männlichen Besuch in ihrer klösterlichen Abgeschiedenheit genossen, selbst wenn es sich nur um einen Naseweis von gerade mal elf Jahren handelte.
»Weißt du was, Gero? Ich hätte da vielleicht noch ein paar knusprige Hühnerschenkelchen«, sagte Schwester Clementia eifrig. »Eigentlich waren sie ja ...«
»... für Donata bestimmt«, fiel Benigna ihr ins Wort. »Und die wird sie morgen auch bekommen. Gib diesem Nimmersatt stattdessen lieber ein Schälchen von deinem weißen Käse. Der macht auch ordentlich satt.« Während der Junge angesichts dieses Vorschlags wenig begeistert das Gesicht verzog, wandte die Nonne sich dem Mädchen zu. »Lässt du dir eigentlich immer von ihm die Haare vom Kopf fressen?«, fragte sie. »So etwas hätte ich meinen kleinen Brüdern niemals erlaubt.«
Theresa schaute sie sorgenvoll an. »Mutter ist immer noch bei der Magistra«, sagte sie. »Ist das ein gutes oder eher ein schlechtes Zeichen?«
Schwester Benigna zog die breite Nase hoch. »Das kann man bei der ehrwürdigen Mutter niemals so genau sagen«, antwortete sie. »Denn sie spricht direkt mit dem göttlichen Licht und hat in allem ihren ganz eigenen Kopf. Seid ihr denn wirklich Verwandte von Richardis? Das würde es vielleicht ein wenig leichter machen.«
»Richardis ist zu uns so eine Art Base«, murmelte Theresa. »Getroffen hab ich sie allerdings noch nie. Sie war schon im Kloster, als ich zur Welt kam, aber ich weiß, dass Mutter und sie sich ab und zu geschrieben haben.«
»Eure werte Base ist aber nicht mehr hier.« Das klang fast triumphierend und kam von Magota, die für die Kleiderkammer zuständig war und alle anderen Schwestern ein gutes Stück überragte. Ihr knochiges Gesicht glich einem Totenschädel, in dem nur die grünlichen Augen lebendig wirkten. »Schon vor Monaten hat sie uns verlassen. Richardis ist jetzt nämlich selber Äbtissin geworden. In Bassum, hoch im Norden. Durch ihren Bruder, Erzbischof Hartwig von Bremen. Seitdem geht es endlich wieder gerechter zu auf unserem schönen Rupertsberg. Sollte sie etwa vergessen haben, euch das zu schreiben?«
Benigna trat ihr unauffällig auf den Fuß, und Magota verstummte, funkelte allerdings erbost zurück. Irritiert schaute Theresa von einer zur anderen. Bislang hatte sie Nonnen stets für entrückte, mehr oder minder körperlose Wesen gehalten, die den ganzen Tag beteten und sangen. Zwischen diesen Frauen jedoch schwelte ein Zwist, der ihr äußerst irdisch vorkam.
Sie schloss die Augen, um sich davor zu schützen, und spürte plötzlich wieder Willems Wärme. Noch immer war er ihr gegenwärtig, und sie hörte seine Stimme in ihrem Kopf.
»Ich möchte lieber mit Euch reiten. Bitte!« Hatte sie das wirklich gesagt?
»Wenn du unbedingt willst.« Sein Lachen, das ihr noch immer das Herz wärmte, wenn sie daran dachte!
Er hatte zu Theresas Überraschung trotz der wütenden Blicke seines Onkels und dem entsetzten Gesichtsausdruck der Mutter ihrem Wunsch sofort entsprochen. Sie saß dann vor ihm, den Rücken an seiner Brust, beiderseits von seinen Armen gehalten, die die Zügel sicher führten. Ob es ihm gefallen hatte, vermochte Theresa nicht zu sagen. Sie aber hätte trotz des erneut einsetzenden Regens stundenlang so weiterreiten können – sogar bis in alle Ewigkeit, wie sie sehnsüchtig dachte. Warum konnte sie jetzt nicht bei Willem sein, in einem schönen Haus, das sicherlich sein Heim war, vor einem prasselnden Feuer, anstatt sich bei diesen zänkischen Weibern in ihren schwarzen Kutten lieb Kind machen zu müssen?
»Du schläfst ja schon halb im Sitzen«, hörte sie die rundliche Benigna sagen. »Komm, ich bring euch zu eurem Lager ...«
»Nicht nötig.« Das war die Nonne mit dem schmalen Kopf, die sich in alles einmischte, wie Theresa bereits herausgefunden hatte. Vor Ungeduld wippend, stand Schwester Hedwig in der Tür. »Clementia, wir brauchen sofort einen großen Krug heißen Salbeitee, damit sie uns nicht alle noch krank werden. Und Gunta soll nachsehen, ob wir noch etwas von den Dinkelkeksen übrig haben. Ihr zwei kommt mit mir. Eure Mutter erwartet euch schon.«
Theresa konnte den Fluss hören, als sie wenig später hinter Hedwig ins Freie trat. Sie war auf Böen und Regengüsse gefasst gewesen, aber es war draußen zu ihrer Überraschung trocken, und es schien sogar wärmer geworden zu sein. Hinter schnell ziehenden Wolken zeigte sich ab und zu ein milchiger Vollmond. Schweigend gingen sie den Kreuzgang entlang, und die strenge, schlichte Schönheit der Säulenreihe tat dem Mädchen gut. Das Kirchenschiff an der Längsseite dagegen steckte offenbar noch im Rohbau. Überall Karren, Bretter, Sandhaufen und mehr oder minder sorgfältig aufgeschichtete Steine.
»Ihr lebt wohl noch nicht besonders lang hier«, sagte Theresa, während sie sich bemühte, auf nichts zu treten, was sie hätte zu Fall bringen können. »Das wirkt alles noch so ... unfertig. Oder ist euch vielleicht mittendrin das Geld ausgegangen?«
Hedwig blieb stehen. »Kluges, kleines Ding«, sagte sie. »Und scharfe Augen hat sie auch. Wie kommst du darauf, Theresa?«
»Weil es so aussieht, als hätten die Bauleute einfach alles stehen und liegen lassen. Genau wie auf unserer Burg, als mein Vater nach zwei kümmerlichen Ernten nichts mehr besessen hat, um den neuen Turm zu bezahlen, und die Männer sich geweigert haben, auch nur noch einen einzigen Handstreich zu verrichten.«
»Dabei haben wir schon so vieles erreicht! Den Berghang mit einer Mauer zur Nahe hin abgestützt, Küche und Dormitorium fertiggestellt und vor Kurzem nun auch noch das Haus der Magistra. Und wenn erst einmal unsere Kirche fertig sein wird!« Hedwig war so in Fahrt geraten, dass ihre Worte sich fast überschlugen. »Was bedeuten schon ein paar Jahre für ein Haus Gottes?«, fuhr sie fort, während Gero, unversehens der heimeligen Wärme der Küche beraubt, weiterhin verstockt schwieg. »Der Rupertsberg ist ein gewaltiger Neuanfang. Wer so eine Herausforderung bekommt, muss sich bei Gott herzlich bedanken.«
Vor einem niedrigen Gebäude aus Bruchsteinen machte sie halt.
»Unser Gästehaus ist leider auch noch nicht ganz fertig«, sagte Hedwig. »Aber ein Dach hat es schon mal. Und für Decken und Stroh ist ebenfalls gesorgt. Ich denke, so kommt ihr durch die Nacht.«
Mit diesen Worten ließ sie die beiden allein.
Theresa sank das Herz, als die Mutter öffnete und im nächsten Augenblick den Krug so begierig an sich riss, dass sie den Tee fast verschüttet hätte. Adas Gesicht war sogar im Schein der Ölfunzel kalkweiß, als hätte sie gerade einen Hieb erhalten. Das Mädchen brauchte nicht zu fragen, um zu wissen, dass es Schwierigkeiten gegeben haben musste. Gero dagegen schien das nicht weiter zu kümmern. Im Nu hatte er das mitgebrachte Dinkelgebäck verputzt. Er griff sich eine Decke, raffte Stroh zusammen und baute sich ein provisorisches Nest. Ein paar Augenblicke später war er bereits eingeschlafen.
Ada hatte sich in eine Ecke zurückgezogen und dort offenbar etwas in den mitgebrachten Tee gestreut, was schon bald einen unangenehm stechenden Geruch verbreitete. Danach kam sie mit einem vollen Becher zurück und ließ sich auf dem Boden nieder, den Rücken an die Wand gelehnt.
Theresa setzte sich zu ihr.
»Wir müssen bald wieder weg«, murmelte die Mutter. »Spätestens übermorgen. Base Richardis lebt schon lange nicht mehr hier, und die Magistra will uns nicht länger hier haben. Wir gehören nicht in ihr Kloster, hat sie gesagt, weder ein halbwüchsiges Mädchen noch ein wilder Junge und erst recht keine Ehe ...« Sie verstummte.
»Sie hat dich nach Vater gefragt?«, wollte Theresa wissen.
Ein Nicken.
»Und was hast du ihr geantwortet?«
»Die Wahrheit, was sonst? Dass Robert vom Kreuzzug nicht mehr nach Hause gekommen ist. Und dass von da an unsere Schwierigkeiten begonnen haben.«
Das ist nicht die ganze Wahrheit, dachte Theresa, doch sie verzichtete darauf, die Mutter zu verbessern. »Und dann hat sie sich nach dem Kind erkundigt«, mutmaßte sie. »Wie es angehen kann, dass du schwanger bist, wo dein Mann doch seit Jahren tot ...«
Ada fuhr ihr rasch mit der Hand über den Mund, als könne sie die Tochter damit zum Verstummen bringen.
»Was spielt das jetzt noch für eine Rolle?«, sagte sie müde. »Am besten wäre es doch, wir beide wären auch nicht mehr am Leben, das Kind in meinem Bauch und ich.«
»So etwas darfst du nicht sagen!« Theresa versuchte, die Mutter zu umarmen, um sie zu trösten, Ada aber machte sich steif und schob sie weg.
»Ich hätte dich niemals mit meinen Albträumen belasten sollen«, murmelte sie, »aber du bist schon so groß, da vergesse ich manchmal, dass du eigentlich noch ein halbes Kind bist. Ich weiß einfach nicht mehr weiter, Theresa – jetzt, wo wir auch hier nicht bleiben können.«
»Es wird eine Lösung geben!«, stieß das Mädchen hervor. »Ganz bestimmt. Morgen werden wir ...« Sie wollte nach dem Becher greifen, den die Mutter sich vollgeschenkt hatte, Ada jedoch drängte sie fast grob zur Seite.
»Lass das!«, sagte sie, und es hörte sich an wie ein Befehl. »Du rührst es mir nicht an, verstanden? Leg dich lieber schlafen!«
Theresa gehorchte, streckte sich aus und schlang die Decke um sich. Schlafen sollte sie? Das war leichter gesagt als getan. Das notdürftig ausgestreute Stroh vertrieb weder die Kälte, noch machte es den harten Boden gemütlicher. Ihre Waden waren steif, zwischen den Rippen stach es, und hungrig war sie plötzlich auch wieder. Jetzt bereute sie, dass sie vorhin alles Gero überlassen hatte, der ein Stück entfernt satt und wohlig vor sich hin schnarchte. Irgendwann fielen ihr doch die Lider zu.
In wirren Träumen hetzte sie durch einen Wald, in den kaum Licht fiel, so eng standen die Bäume. Zweige verhakten sich in ihrem Haar, Insektenschwärme umschwirrten sie, unter den nackten Sohlen spürte sie Moos und altes Laub. Immer undurchdringlicher wurde das Dickicht, schwarz wie dick geronnenes Blut, doch sie konnte und durfte nicht rasten, rannte weiter, so schnell, dass ihre Füße den Boden kaum noch berührten. Da kam unversehens eine kleine Lichtung in Sicht ...
Theresa fuhr hoch, mit klopfendem Herzen.
Da war ein hohes, durchdringendes Wimmern dicht neben ihr – die Mutter, die sich krümmte und wand, als wäre ihr Beelzebub höchstpersönlich in den Leib gekrochen.
»Was hast du?«, rief das Mädchen angstvoll und sah im trüben Schein der Ölfunzel das Erbrochene, mit dem Ada ihr Mieder beschmutzt hatte. Etwas Grünliches war darin zu erkennen, beinahe wie die jungen Spitzen eines Nadelbaumes, die sie wieder ausgespien haben musste. Der Geruch war so widerlich, dass Theresa schnell zurückfuhr.
Ihre Gedanken überschlugen sich. Wie hatte die Mutter nur in diesen jämmerlichen Zustand geraten können? Gegessen hatte die Schwangere nichts, jedenfalls nicht in ihrer Gegenwart, aber getrunken. Etwas krampfte ihr Herz zusammen. Der Tonbecher war leer getrunken und die Kanne zerbrochen, aber der Fleck, der den Boden dunkel gefärbt hatte, stank abscheulich.
»Kommt das vielleicht von diesem Tee, den du dir heimlich zusammengebraut hast?«
Ada verdrehte die Augen, bis nur noch das Weißliche zu sehen war, und gab ein undefinierbares Gurgeln von sich. Mit dem Rockzipfel wischte Theresa ihr die Mundwinkel sauber. Dann erst bemerkte sie, dass auch der Rock besudelt war. Zuerst dachte sie, die Mutter habe sich vor Schmerzen womöglich eingenässt, doch beim näheren Hinsehen entpuppte es sich als etwas anderes: Vorn entlang zog sich wie eine hässliche Borte eine breite rötliche Spur – Blut!
In Theresas Ohren war auf einmal ein seltsames Rauschen, das immer stärker anschwoll. Keine Schwangere durfte bluten. Sie war längst alt genug, um das zu wissen. Und für eine Geburt war es Monate zu früh. Was sollte sie tun? Die Leidende hier allein zurücklassen oder Gero aufwecken, damit er zu den Schwestern laufen konnte?
Sie lief zu ihm, rüttelte ihn sanft. »Wach auf!«, sagte sie, als er halb die Lider öffnete. »Du musst jetzt ganz tapfer sein. Mama ist sehr krank. Wir brauchen Hilfe.«
»Was ist los?«, murmelte er schlaftrunken. »Bekommt sie das Kind?«
Er wusste besser Bescheid, als sie gedacht hatten! Wer konnte schon sagen, was der Kleine sonst noch alles mitbekommen hatte, das nicht für seine Ohren bestimmt gewesen war?
Nein, ihn schickte sie besser nicht zu den Nonnen!
»Steh auf, setz dich zu ihr und nimm ihre Hand! Das tut ihr bestimmt gut.« Theresa bemühte sich, ruhig zu sprechen, obwohl alles in ihr flatterte. »Und falls ihr wieder übel wird, dann stützt du sie, so gut es geht, und wischst ihr den Mund sauber. Hast du mich verstanden, Gero?«
Er nickte mit großen, erschrockenen Augen.
»Muss sie jetzt auch sterben so wie unser Vater im Morgenland?«, flüsterte er und hielt sich Schutz suchend an seiner Schwester fest. »Dann sind wir beide ja ganz allein!« Plötzlich sah er so hilflos und verschreckt aus wie damals, als er mit sechs Jahren vom Kirschbaum gefallen war und sich das Bein angebrochen hatte. Einen ganzen Sommer lang hatte er nur humpeln können, und noch heute merkte man manchmal die alte Verletzung, wenn er rennen wollte, und sein linkes Bein nicht ganz so mitmachte.
Rührung wallte in Theresa hoch, doch dazu war jetzt keine Zeit. »Red keinen Unsinn!«, entgegnete sie schnell und resolut, obwohl ihr bang zumute war. »Wir sind nicht umsonst in einem Kloster, wo sie sich mit Kranken gut auskennen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin gleich wieder zurück.«
Sie lief hinaus, verlor jedoch im Dunkeln zunächst die Orientierung. Zum Glück verzogen sich die Wolken, und das Mondlicht reichte aus, um sich schließlich zurechtzufinden. Hier waren sie zuvor entlanggegangen – der Kirchenrohbau, die Säulen des Kreuzgangs, sie erkannte alles wieder. Plötzlich fühlte sie sich sicherer. Dort drüben befand sich auch der Eingang zur Küche, aber natürlich war zu dieser späten Stunde weit und breit niemand mehr zu sehen.
Theresa blieb stehen, schaute sich um. Wo nur mochten die frommen Schwestern schlafen?
Ihr Blick glitt nach oben. Die mit Schweinsblasen gegen die letzte Winterkälte geschützten Fensteröffnungen im oberen Geschoss waren alle dunkel. Sie durfte nicht zaudern, so schlecht, wie es der Mutter offenbar ging. Sie bückte sich nach einem Stein, hob ihn auf und zielte. Die jahrelange Übung im Ballspiel mit Gero, der dafür allerdings lieber einen Bruder gehabt hätte, zeigte jetzt Wirkung.
Ihr Wurf war kraftvoll und präzise. Die zweite Schweinsblase von rechts hatte auf einmal einen hässlichen Riss.
Von drinnen hörte man einen erschrockenen Aufschrei, dann Gepolter, als wäre etwas Schweres umgefallen.
»Helft mir!«, rief Theresa, als sich nach einer Weile ein Kopf mit langen dunklen Zöpfen zeigte. »Und macht bitte schnell! Meine Mutter – ich hab solche Angst, dass sie uns gleich stirbt!«
***
Eigentlich wäre es ja Magotas Aufgabe gewesen, über die Steinbrücke nach Bingen zu laufen, wie sie es sonst gerne tat, Magota mit ihren langen, dürren Beinen, mit denen sie viel schneller vorankam, als Clementia es mit ihren strammen Schenkeln, die unter der rauen Kutte bei jedem Schritt aneinanderrieben, je vermochte. Allerdings hatte ein Blick der Magistra genügt, um jede Widerrede im Keim zu ersticken, und so war Clementia eben losgerannt. Sie war Hildegards leibliche Schwester, und dennoch genoss sie keinerlei Vorteile, so wollten es nun mal die Regeln des heiligen Benedikt. Doch jetzt wuchs ihr innerer Unwille bei jedem Schritt, während das Öllämpchen in ihrer Hand bereits gefährlich flackerte. Wenn es erlosch, wovor die allerheiligste Mutter Maria sie bewahren möge, würde sie sich im Finstern weiter durchschlagen müssen.
Natürlich waren die Stadttore nachts geschlossen. Wie sonst hätten sie den Bürgern Schutz und Sicherheit bieten sollen? Wer hinein- oder herauswollte, musste also notgedrungen den Morgen abwarten. So viel Zeit aber blieb den frommen Schwestern nicht, wollten sie das Leben der Fremden retten, das in größter Gefahr schwebte.
Vor einiger Zeit hatte Josch ihnen von einer Nebentür in der Stadtmauer erzählt, durch die Fischer schon vor der Dämmerung das ummauerte Bingen verlassen konnten, um mit ihren Netzen und Reusen ihr Tagwerk zu beginnen. Clementia stieß ein erneutes Stoßgebet zur himmlischen Jungfrau aus. Hoffentlich war Joschs Beschreibung auch präzise genug gewesen!
Keuchend und schwitzend kam die Nonne nach längerem Umherirren an der richtigen Stelle an. Alles war so, wie Josch es geschildert hatte. In die Tür aus rohen Holzbrettern war ein Stein gelegt worden, um das Zufallen zu verhindern.
Clementia zwängte sich durch und lief weiter, vorbei an den Reihen von Holzhäusern, die das Stadtbild prägten, weil nur wenige Wohlhabende sich kostspielige Steinbauten leisten konnten. Sie senkte den Kopf, als versuche sie, sich unsichtbar zu machen, und die breite Liebfrauengass, auf der auch Markt gehalten wurde, erschien ihr unendlich lang. Hoffentlich sah sie keiner. Wie hätte sie auch jemandem erklären können, weshalb zu nachtschlafender Zeit eine der Nonnen vom Rupertsberg ausgerechnet das Haus der Hebamme aufsuchte?
Zu ihrer Überraschung sah sie schon beim Einbiegen in die Salzgasse, in der Josch mit seiner Familie wohnte, im oberen Geschoss seines Hauses Licht, und auch zur ebenen Erde, in der Küche, schienen mehrere Kerzen zu brennen.
Sie atmete tief aus und klopfte an die Tür.
»Schwester Clementia?« Josch hielt einen brennenden Holzspan in der Hand und starrte sie verblüfft an. Er wusste natürlich, wer sie war, und behandelte sie deshalb besonders ehrerbietig. »Ist etwas auf dem Rupertsberg passiert? Aber kommt doch erst einmal herein!«
Er trat zur Seite, ließ sie eintreten. Auf dem Herd brodelte ein großer Topf mit Wasser. Eine junge Frau war damit beschäftigt, ein altes Leintuch in Stücke zu schneiden, eine andere zerstieß etwas in einem Mörser, während die beiden kleinen Söhne mit betretener Miene am Tisch hockten.
»Nachbarinnen, die zum Helfen gekommen sind«, erklärte Josch. »Und meine zwei Rabauken hier sind einfach nicht ins Bett zu kriegen. Jetzt, wo wir bald wieder zu fünft sein werden.«
Von oben hörte man energische Schritte, dann einen lauten, schmerzerfüllten Schrei. Josch nickte den beiden Blondschöpfen beruhigend zu. »Genauso seid ihr auch zur Welt gekommen, erst du, Karl, und dann du, Florin, gute drei Jahre danach.«
»Aber sie kann doch nicht ausgerechnet jetzt kreißen«, stieß Schwester Clementia hervor, die erst in diesem Augenblick verstand, was da vor sich ging.
»Und ob sie kann!«, sagte Josch lächelnd. »Das Wasser ist schon vor einiger Zeit abgegangen, und mühen muss sie sich dieses Mal ganz besonders, denn das Kleine liegt offenbar verkehrt herum mit dem Hinterteil nach unten. Jetzt könnte meine Eva selber eine geschickte Wehmutter gebrauchen, aber sie ist ja die einzige weit und breit.«
Clementias Augen weiteten sich. »Wo ist sie?«, rief sie. »Ich muss sofort zu ihr.«
Sie lief die Treppe hinauf, Josch ihr hinterher. Eva, nur mit einem Hemd bekleidet, das ihr riesiger Bauch fast zu sprengen drohte, lehnte mit der Stirn erschöpft am Pfosten der Bettstatt, während eine ältere Frau ihr sanft den Rücken massierte.
»Es sitzt leider falsch herum«, sagte sie mit einem schiefen Lächeln, als sie die Schwester erkannt hatte, »und muss ungewöhnlich groß sein. Nicht einmal ich hätte es vermutlich von außen wenden können. Aber wieso seid Ihr ...« Die nächste Wehe hatte sie erfasst, sie beugte sich nach vorn, biss sich auf die Lippen, schließlich aber schrie sie doch.
»Weshalb gebiert deine Frau nicht im Bett wie jedes anständige Christenweib?«, wandte die Nonne sich empört an Josch.
»Weil es in anderen Stellungen meist sehr viel einfacher ist«, japste Eva, die inzwischen wieder etwas mehr Luft bekam. »Seht Ihr den dicken Kälberstrick, der von der Decke baumelt? Den hat Josch eigens für mich festgemacht, damit ich mich später dranhängen kann, wenn es noch schlimmer kommt.« Sie wischte sich das schweißnasse Haar aus der Stirn. »Was wollt Ihr überhaupt hier, mitten in der Nacht, Schwester? Ist bei Euch auf dem Berg ein Unglück geschehen?«
»Und wenn schon! Du kannst uns ja ohnehin nicht helfen«, sagte Clementia. »Obwohl wir deine Hilfe gerade heute dringend gebraucht hätten.« Sie klang so verzagt, dass Eva trotz ihrer Erschöpfung aufhorchte.
»Lass uns kurz allein!«, sagte sie zu Josch, der sich nur zögernd entfernte und die ebenfalls nur widerwillig weichende Nachbarin mit sich zog. Sie nickte Clementia zu, als die beiden draußen waren. »Also? Und kommt schnell zum Wesentlichen! Ich spür die nächste Wehe nämlich schon.«
Clementia suchte nach Worten. Ihre Züge wirkten verzerrt, so sehr strengte sie sich an.
»Doch nicht eine von Euch Nonnen?«, fragte Eva, als Clementia weiterhin stumm blieb. »Eine heimliche Geburt im Kloster ...«
»Nein, nein! Eine Fremde hat bei uns Zuflucht gesucht. Eine schwangere Fremde von weit her. Sie hat ...« Die Schwester schien es kaum über die Lippen zu bekommen. Dann nahm sie einen erneuten Anlauf: »Sie hat offenbar heimlich Sadebaumspitzen gegessen.«
»Aih!« Der neuerliche Schmerz trieb Eva das Wasser in die Augen. »Das tun nur die Verzweifeltsten. In welchem Monat ist sie?«, sagte sie keuchend.
»Man sieht noch nicht besonders viel, aber bewegt haben soll sich das Kind schon.«
»Das wird es jetzt sicherlich nicht mehr können, das arme, unschuldige Ding! Der Sündenbaum tötet die Frucht im Mutterleib. Von diesem Teufelszeug ist jedes bisschen zu viel.« Sie legte die Hände auf ihren Bauch, als wolle sie ihn instinktiv schützen. »Sie muss das Kind gebären, habt Ihr mich verstanden, Schwester Clementia? Um jeden Preis, sonst stirbt auch sie, denn wenn es drinbleibt, beginnt es in ihrem Leib zu verwesen. Aber so eine Geburt kann schwierig werden, wenn das Kind nicht mehr lebt.« Der Atem wurde ihr erneut knapp.
»Kann man ihr dabei nicht helfen?«
»Mein Kreuz fühlt sich schon jetzt an, als würde es im nächsten Augenblick zerbrechen«, sagte Eva stöhnend. »Dabei geht es vielleicht noch Stunden so weiter, wenn ich Pech habe. Ja, das kann man. Aber die Priester sehen es nicht sonderlich gern.«
»Wenn du etwas weißt, dann musst du es uns sagen!«, bat Clementia. »Die Lage ist auch so schon verworren genug. Und sollte über diese unselige Angelegenheit etwas nach außen dringen, sind wir verloren.«
»Von mir erfährt niemand ein Wort. Den Nachbarinnen werde ich eine gute Ausrede auftischen. Und dass Josch den Mund halten kann, wisst Ihr. Dort drüben – die niedrige Truhe. Öffnet sie und nehmt die erste Lage mit den Kräutern heraus, aber bitte vorsichtig!«
Die Nonne gehorchte, legte das Leinen mit den getrockneten Büscheln des Frauenmantels beiseite. Dann schien sie plötzlich zu stutzen.
»Das ist ja eine Alraune!«, rief sie. »Woher in aller Welt ...«
»Vergesst auf der Stelle, was Ihr gesehen habt, sonst vergesse ich augenblicklich alles, was ich jemals gewusst habe!«
Clementia nickte klamm.
»Dann weiter unten, das kleine rote Kästchen«, kommandierte Eva mühsam. »Mein kostbarster Schatz. Habt Ihr es gefunden?«
»Ja. Hier ist es.«
»Gut. Darin liegt die Kornmutter. Nehmt eines von den schwarzen Hörnchen und ein zweites als Reserve – und nur als Reserve, habt Ihr gehört? Wickelt sie in ein dünnes Tuch und übergebt sie Schwester Benigna! Sie soll ein halbes in heißem Wein auflösen und der Gebärenden schluckweise davon zu trinken geben. Das müsste die Geburt zügig vorantreiben. Aber sagt ihr unbedingt, dass sie aufpassen muss! Nur ein wenig zu viel – und man bringt die Schwangere um, anstatt sie beim Kreißen zu unterstützen.«
»Ist das alles?«
»Noch nicht ganz. Den Blutstein, den ich um meinen Schenkel gebunden habe – nehmt den auch mit! Ich komme schon ohne ihn zurecht.«
»Bist du sicher?« Die Nonne zögerte, dann schob sie das Hemd nach oben und löste mit spitzen Fingern das Lederband von der verschwitzten Haut.
Eva stieß einen markerschütternden Schrei aus. Josch stürmte mit wildem Blick in die Stube.
»Genug, Schwester, genug!«, rief er. »Ich schaue nicht länger tatenlos zu. Was immer es auch sein mag, das Ihr von Eva begehrt – geht bitte! Jetzt ist erst einmal mein Weib an der Reihe.«
***
Das Kind war so klein, dass es ohne Schwierigkeit in eine kräftige Männerhand gepasst hätte, ein Häuflein Mensch, vollständig ausgebildet – aber leblos. Theresa hatte kaum noch zu atmen gewagt, als sie davorstand, dann jedoch hatte sie das Tuch beiseitegeschoben, mit dem Schwester Benigna es bedeckt hatte.
»Ein Junge«, sagte sie und biss sich auf die Lippen, um die Tränen zurückzuhalten. »Ein kleiner, makelloser Bub. Seht doch nur, er hat schon Wimpern! Und winzige Nägel! Aber was ist das seltsame Weiße auf seiner Haut?«
»Die Wehmütter nennen es Käseschmiere. So hast du auch einmal ausgesehen. Jedes Kind wird so geboren.«
»Warum ist die Wehmutter nicht gekommen?«, fragte Theresa weiter. »Sie hätte ihm doch helfen müssen!«
»Weil Eva gerade selber in den Wehen liegt. Und auch wenn sie rechtzeitig hier gewesen wäre, gegen die teuflische Macht des Sündenbaumes hätte auch sie keine Macht. Er hat dem Kind den Tod gebracht. Da konnte keiner mehr helfen.«
Theresa beugte sich tiefer über das Kind. »Wie schön er ist!«, sagte sie mit einem traurigen Lächeln. »Und er sieht mir sogar ein bisschen ähnlich, findet Ihr nicht? Wann werdet Ihr ihn taufen lassen? Wir müssen noch einen Namen für ihn aussuchen.«
Benigna bedeckte den kleinen Leichnam erneut mit dem weißen Leintuch.
»Taufen? Wie denkst du dir das?«, fragte sie seufzend. »Ein Kind der Sünde. Geatmet hat es auch nicht. Da ist eine christliche Taufe leider ganz und gar unmöglich.«
»Ihr wollt ihn ungetauft begraben lassen? Aber das dürft Ihr nicht! Denn dann wäre ja die Erbsünde nicht von ihm genommen, und er käme geradewegs in die Hölle«, rief Theresa. »Der Kleine kann doch nichts dafür, er am allerwenigsten! Und einen Namen braucht er auch. Wie soll der liebe Gott ihn sonst zu sich rufen?«
»Benigna?« Das war die gebieterische Stimme der Magistra, die alle sofort verstummen ließ. »Bring das Mädchen ins Äbtissinnenhaus! Und dann komm zu mir! Die Reichsgräfin fiebert stark. Wir müssen uns um sie kümmern.«
»Was soll ich denn in Eurem Haus?«, protestierte Theresa. »Hier ist doch mein Platz, bei Mutter und diesem kleinen Bruder!«