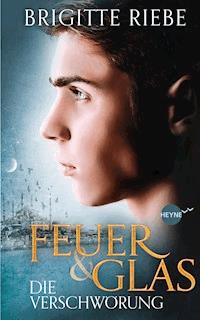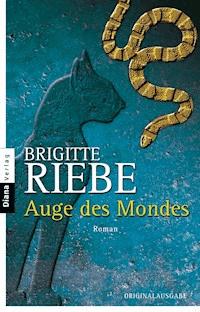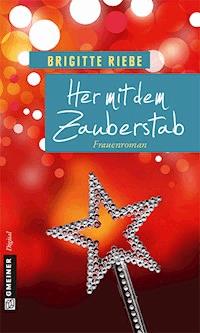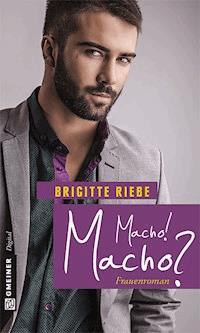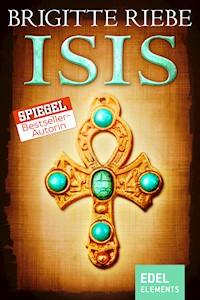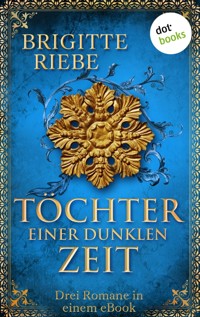Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Frauenromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Claus ist ein verdammt attraktiver Dozent, und so schwebt Studentin Susanna im siebten Himmel, als die beiden ein Paar werden. Doch hinter der Fassade des romantischen Ritters steckt etwas ganz anderes, und so landet Susanna äußerst unsanft auf dem Boden der Tatsachen. Nun wird Gleiches mit Gleichem vergolten und auf die heiße Liebe folgt eiskalte Rache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Riebe
Mann im Fleisch
Frauenroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: © yuriyzhuravov - Fotolia.com
Umschlaggestaltung: Matthias Schatz
ISBN 978-3-7349-9208-7
Widmung
Für C.
Die Augen sehen anders als das Herz.
I.
1
An dem Tag, als seine Frau durch meinen Briefschlitz schoss, beschloss ich endgültig, die Sache zu beenden. Vorausgegangen war totaler, ununterbrochener Telefonterror. Erst er. Für lange, sehnsuchtsvolle Monate. Dann sie für kurze, schreckliche Stunden.
Niemals hätte ich mir zu Anfang auch nur einen Bruchteil dessen vorstellen können, was schließlich geschah. Ich war ahnungslos wie ein kleines Schaf. Mein dreiundzwanzigster Geburtstag war gerade vorüber, und ich interessierte mich vor allem für Bob Dylan und Roxy Music, Paul Klee, Dichtung der zwanziger Jahre und meine täglich wechselnden Diäten.
Ich lebte in einer Käseglockenwelt, in der es bei rechtem Licht besehen niemand Vernünftigen über dreißig gab, tausend Euro eine astronomisch hohe Summe waren und tiefgefrorene Bihun-Suppen fast täglich auf dem Programm standen.
Natürlich war ich nicht solo. Natürlich hatte ich eine feste Beziehung.
Schon seit fünf Jahren schlief ich – allerdings zunehmend unwilliger – mit meinem Jugendfreund Willi. An meiner Seite durchpflügte er tapfer und anstellig die lustfeindlichen Jahre von Karin Struck, Verena Stefan und Anja Meulenbelt. Je »frauenbewegter« er sich allerdings verhielt, desto langweiliger und unerträglicher wurde der Sex mit ihm.
Längst vorbei die kurzen, heißen Vormittage, an denen ich ihn zum Schuleschwänzen verführt hatte und wir im düsteren Mief seiner elterlichen Erdgeschosswohnung unter dem grellbunten Jimi-Hendrix-Plakat zitternd vor Lust und Unsicherheit zusammen geschlafen hatten.
Immer öfter ersann ich Ausreden, warum wir gerade wieder einmal nicht miteinander ins Bett gehen sollten.
Nur wenn mir weder Kopf- noch Bauchschmerzen einfielen, wenn ich nicht vergessen hatte, den Herd auszuschalten, oder unbedingt noch den Rest des langen Strukturalismuskapitels lesen musste, kam es zum »Letzten«. Nach wenigen pumpenden Versuchen, gemeinerweise von mir durch gezieltes Schenkeldrücken angeheizt, fiel er zuckend über mir zusammen.
Dabei mochte ich Willi. Sehr sogar.
Als ich ihn mit siebzehn auf einem Schulball getroffen hatte, glaubte ich, niemals zuvor einem besser aussehenden Mann begegnet zu sein. Er war groß und kräftig, mit breiten, muskulösen Schultern, einem schmalen Becken, den langen Schenkeln des ausdauernden Läufers. Und er hatte einen wunderhübschen, festen kleinen Bubenpo.
Braune Locken fielen ihm bis auf die Schultern, und wenn er lachte, kerbten Grübchen unwiderstehlich seine Wangen. Er war intelligent und belesen, und man hätte ihn jederzeit ohne Kompass in der Wildnis aussetzen können. Willi hätte immer nach Hause gefunden.
Was war geschehen? Wo waren die ersten glühenden Nächte im Zelt, in denen wir mit Hingabe und Leidenschaft unsere Körper erkundet hatten, als seien sie unbekannte Landschaften, in denen wir heimisch werden wollten? Die kühlen Morgen, als wir uns am Strand geliebt hatten?
Ich hatte ihn systematisch weichgekocht. Domestiziert. Neutralisiert. Er machte mir weniger Spaß als ein Goldhamster, aber ich war viel zu feige, um die Konsequenzen zu ziehen. In einer komischen Mischung aus scheinbarem Mitleid und unbewusster Angst klebte ich an ihm und verhinderte stets im Ansatz jeden seiner wenigen Versuche, mir zu entkommen.
Ich übte den Ausbruch aus der Beziehung selbstverständlich um einiges öfter. Aber ebenfalls mit kaum sichtbarem Erfolg. Drohte es einmal, ernster zu werden, zog ich rasch die Bremse und machte mir vor, ich würde mir letztlich nur das gleiche in etwas anderer Gestalt wieder einhandeln.
Systematisch redete ich mir ein, Männer würden mich nicht besonders interessieren. Schließlich war ich fest davon überzeugt: Ich war die »Naturfeministin« schlechthin. Mein Leben schien mir recht zu geben.
Frauen waren es, mit denen ich alles besprach. Mit ihnen feierte und weinte ich. Männer waren für mich wie ein fremder Stamm. Merkwürdig, unverständlich. Unpraktisch. Wenn man nicht einmal ordentlich Vergnügen mit ihnen haben konnte – wozu in aller Welt waren sie dann nütze?
Das änderte sich schlagartig an dem Tag, an dem Claus mich zum ersten Mal küsste. Er küsste mich lang, fast romantisch. Ich glaube, spätestens in dem Augenblick passierte es.
Dabei sah er fast aus wie Spiderman mit seinen langen, dünnen Beinen, einer fortgeschrittenen Halbglatze und einer lächerlichen zitronengelben Weste aus den zwanziger Jahren, die er offensichtlich heiß liebte und bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu seinen schlecht sitzenden Jeans trug.
Er küsste mich, und unsere Körper wuchsen auf geheimnisvolle Weise zusammen. Wurden eins. Alchemistische Hochzeit könnte man es nennen. Mehr als das Zusammengießen zweier Metalle. Ich fühlte seine weichen, saugenden Lippen auf den meinen, roch seinen Lavendelatem, und mein Fleisch schmolz erwartungsvoll. Meine Möse klopfte vor Begehren, meine Knie wurden schwach.
Allerdings war der Ort des Geschehens alles andere als passend. Wir standen, hinter eine Säule geklemmt, im belebten Lichthof der Uni. Gerade hatten wir laut lästernd Seite an Seite eine Vorlesung verlassen. Claus hielt ein dickes Manuskript unter dem linken Arm, das ich mir dringend ausleihen wollte.
Dazu ist es nie gekommen.
Als er mich wieder losließ, drehte ich mich um, wie von der Tarantel gebissen, und stürzte den langen Gang entlang durch den Hintereingang des Gebäudes ins Freie.
Verwirrt und reichlich aufgelöst, betrat ich das Café an der Ecke und bestellte mir eine heiße Schokolade. Ich hatte gerade die Sahne abgeleckt und für heute meine längst fällige Diät auf den nächsten Tag verschoben, als die Türe aufging und Claus hereinkam.
Ohne mich zu sehen, steuerte er auf einen freien Tisch im vorderen Teil zu und versank in seiner Zeitung.
Mir blieb vor Schreck, vor Entzücken fast die Luft weg. Während ich schlückchenweise die heiße, klebrigsüße Brühe durch meine Kehle rinnen ließ, überlegte ich fieberhaft, was ich nun unternehmen sollte.
Dann ging die quietschende Türe erneut auf und brachte mit dem nächsten kalten Windstoß eine Frau herein, die zielgerichtet auf seinen Tisch zusteuerte. Sie war klein, schmal wie ein Kind und trug ihr Haar sehr glatt, sehr blond. Ein ovales, ein wenig lebloses Gesicht. Die Augen grau unter dunklen, geschwungenen Brauen.
Natürlich ungeschminkt. Natürlich in Faltenrock und kamelhaarfarbenem Twinset. Perlenkette. Siegelring. Nicht einmal ein Pferdetuch, das ich scheußlich finden konnte. Sondern ein kleines, weiches seidenes Etwas, türkis und lässig um ihren schlanken Hals gewunden.
Eine jener zeitlos klassischen Schönheiten eben, bei deren Anblick man notgedrungen im gleichen Augenblick an veredelte Rosensträucher, hauchdünne, chinesische Teekannen und Familiensilber für mindestens achtzehn Personen denken muss.
Sie küsste Claus leicht abwesend auf die Backe und zupfte beim Hinsetzen besitzergreifend ein imaginäres Staubkorn von seiner graubraunen, leicht ausgebeulten Tweedjacke. Dann nahm sie Platz. Anmutig. Selbstverständlich. Studierte lange die Karte.
Durch die Bogenöffnung sandte sie mir einen gelangweilten, abschätzigen Blick. Fast unfreundlich.
Sie konnte keine Ahnung haben, wer ich war. Aber ich wusste sofort, wen ich vor mir hatte.
Seine Frau. Beate.
Zwei Tage später kam sein erster Brief.
Liebe S.,
vor ein paar Monaten wusste ich noch nichts von Dir, und doch hatte das leise Pochen der Sehnsucht, die Deinen Namen trägt, schon angefangen. Jetzt ist das neue Jahr Dein Jahr geworden, und bei allem, was geschieht, bist Du für mich dabei: Manchmal als eine, die an einem warmen Sommertag durchs weitgeöffnete Fenster in mein Leben hereinschaut. Manchmal als Vogelzug, der aus der Ferne heruntergrüßt. Und ganz oft als ein versunkenes Götterbild, das von Atlantis drunten durch das tiefe Wasser zu mir heraufblinkt und golden flimmert. Mich herunterzustürzen habe ich mich – bislang? – nicht getraut. Aber wer weiß, ob Göttinnen das überhaupt wollen?
Immer Dein Freund Claus
Ich kam gerade vom Penny um die Ecke, wo ich Käse, Eier und Caro-Kaffee gekauft hatte, und las die in elegantem Sepia hingeworfenen Zeilen gleich unten im Hausflur. Augenblicklich stieg sein großes Gesicht mit der hellen Haut vor mir auf, bläulich unter den Augen und an den Schläfen.
So hatte noch niemand mit mir gesprochen. Beziehungsweise über mich. In meiner Welt der schnellen, immer unverbindlichen dates redete man nicht viel über Liebe. Man machte erst gar nicht so lange rum, wenn man auf jemanden stand; man kam gleich zur Sache. Und man legte sich vor allem keinesfalls schriftlich fest. Allenfalls ein, zwei Anrufe konnte man noch riskieren. Dann hatte die Sache zu laufen. Oder eben nicht.
Vollkommen unerwartet begannen meine Knie zu zittern. Aufgeregt hielt ich das Blatt an die Nase. Ein feiner, fast unmerklicher Geruch nach Sandelholz. Plötzlich hätte ich losheulen können. Wie ertappt, knüllte ich das Papier zusammen und stopfte es in die große, aufgenähte Tasche meines lavendelfarbenen Regenmantels.
Second hand. Selbstredend. Damals verachtete ich all jene, die neue Klamotten trugen.
An jenem Morgen hatte ich nicht die leiseste Idee, dass diese Zeilen nur der Anfang einer langen Kette weiterer Briefe waren, die ich zunehmend hektischer stets auf der Stelle aufreißen würde. Dass ich schon bald den Hausflur nicht mehr betreten könnte, ohne halb sehnsuchtsvoll, halb ängstlich zum Briefkasten zu luren.
Weiter als zum ersten Treppenabsatz bin ich tatsächlich nie gekommen. Spätestens dann hatte ich den Umschlag zerfetzt, seinen Brief begierig in mich aufgesogen. Auch in unseren schlimmsten Zeiten.
Gesten, Gewohnheiten, die sich einprägen. Noch Jahre danach musste ich jedes mal den Impuls unterdrücken, innezuhalten und doch wieder einmal nachzusehen. Aber der Briefkasten blieb tot. Und als ich dann in ein anderes Viertel zog, war die fixe Idee fast verschwunden.
Nur mit Mühe schaffte ich an jenem ersten Tag unseres einseitigen Postverkehrs die Stufen hinauf in den vierten Stock. In unserer Wohnung schloss ich mich in der blau bemalten Toilette ein, die seit dem letzten Sommerfest mit Monden und Sternen aus Glanzpapier garniert war wie das Spielzimmer eines fortschrittlichen Kindergartens.
Ich las die wenigen Zeilen von neuem mit brennender Neugierde, als enthielten sie hinter dem Geschriebenen eine weitere, geheime Botschaft. Für mich allein bestimmt.
Las sie zweimal. Fünfmal.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten alle Alarmklingeln in mir rasseln sollen. Aber ich war wohl zu unerfahren, betrunken von der Ahnung eines unbekannten, niemals zuvor erlebten Rauschs, dass ich hartnäckig meine Sinne verschloss. Damals konnte ich noch nicht wissen, was mir bevorstand. Damals war mein Herz noch ganz und erwartungsvoll wie ein neuer, glänzender Morgen.
Vielleicht sollte ich diese seltsame Geschichte lieber ganz anders erzählen. Schön der Reihe nach. Von Anfang an.
Andererseits: Gab es ihn überhaupt, den richtigen Anfang?
Als ich Claus jedenfalls zum ersten Mal sah, fand ich ihn auf eine rührende Weise altmodisch. Er hatte nicht das geringste zu tun mit jener abgekapselten Welt studentischer Jugendlichkeit, in der ich mich nahezu ausschließlich bewegte.
Ich konnte mir kaum vorstellen, dass man sich nicht duzte oder nicht in Wohngemeinschaften zusammenleben wollte. Jene, die das verabscheuten, waren schreckliche, bornierte, unbelehrbare Spießer, Ignoranten, die nicht »dazugehörten«, die nichts von dem verstanden hatten, was wir in unserem gnadenlosen Jugendkult so eifrig praktizierten.
Eltern nahm ich prinzipiell von dieser Kategorisierung aus. Eltern waren eine Last, die man hatte und von der man sich in endlosen gruppendynamischen Prozessen zu befreien hatte. Möglichst schnell – obwohl es in der Regel bei den meisten von uns doch nur zögerlich zu einem rechten Ende kommen wollte.
Eltern konnten nicht dazugehören. Eltern hatte man. Eltern waren eine Art Karma. Obwohl dieser Begriff noch nicht in unserem Sprachinventar von damals vorhanden war.
Nein, Claus gehörte nicht zu meiner Welt. Aber auch nicht zu der der Spießer und Ignoranten.
Claus war ganz anders. Er kam mir vor wie der Abkömmling eines unbekannten, lockenden Kontinents. Ein wundersames, leicht angestaubtes Relikt einer Zeit, die längst vorbei war.
An einem sonnigen Herbstmorgen stürmte ich sein Büro. Völlig unabsichtlich.
Eigentlich hatte ich eine lange Weile sehr brav auf der Bank des Instituts gewartet, um als nächste seine Sprechstunde aufzusuchen. Als Assistent eines Wiener Professors, der jüngst an unsere Uni gewechselt hatte, war er neu bei den Germanisten. Man wusste nichts über ihn. Nicht eine meiner Freundinnen kannte ihn.
Ausgerüstet mit einem Traktat über Georg Büchner, vertrieb ich mir die Zeit, indem ich die hässlichen, verblassten Stiche an der Wand anstarrte und meinen Gedanken nachhing.
Es war einer jener gläsernen Septembertage, die blank und strahlend sind und dennoch schon nach Herbst riechen. Man konnte sich nichts vormachen. Der Sommer war endgültig vorbei. Bald würden die Tage kürzer werden, und in den Hörsälen und Seminarräumen würde man schon nachmittags die fahle Deckenbeleuchtung einschalten müssen.
Als die Türe auch nach einer guten halben Stunde verschlossen blieb, stand ich entschlossen auf, packte mein Buch in die afghanische Hirtentasche, die mir als das Nonplusultra modischer Entwicklung schien, und klopfte höflich.
Nichts geschah.
Ich klopfte heftiger. Immer noch nichts. Vorsichtig probierte ich, die Türe zu öffnen. Sie klemmte.
Von innen hörte ich ein leises Hüsteln. Eine Stimme, der ich so etwas wie »Herein« zu entnehmen glaubte.
Energisch drückte ich auf die Klinke. Die Türe sprang auf, und ich stolperte mit einem gewaltigen Satz ins Zimmer.
Der Mann am Schreibtisch nahm langsam die Brille ab und blickte mir aufmerksam entgegen. Ohne die randlosen Gläser sah er wacher und lebendiger aus. Ich schätzte ihn auf Ende Dreißig und vertat mich dabei nur um fünf Jahre.
»Hallo«, sagte er mit seiner hellen, belegten Stimme, die immer ein wenig atemlos klang. »Wollen Sie vielleicht zu mir?«
In diesem Moment begann mein neues Leben. Oder jedenfalls das, was ich damals dafür hielt.
2
Die nächsten Tage und Wochen verstrichen. Schließlich lag nur noch ein guter Monat vor dem Beginn des Wintersemesters. Ausnahmsweise schuftete ich in keinem der üblichen nervtötenden Ferienjobs, wo man Post austragen, Peperonis im Akkord einpacken oder Durchschläge nach fünfstelligen Nummern sortieren musste.
Diesen Herbst hatte ich mir selbst freigegeben. Ich wollte in aller Ruhe lesen und studieren, vor allem aber meine Magisterarbeit gründlich vorbereiten.
Aber ich tat nichts davon. Ganze Nachmittage verbrachte ich im Bett, las zum x-ten Mal die Krimis von Patricia Highsmith, futterte ganze Packungen von schlankmachendem Knäcke und fühlte mich matt und elegisch. Mein Hirn war wie ausgebrannt, und an manchem der klaren, kühlen Morgen überkam mich die Angst, ich würde langsam verblöden.
Jetzt, kurz bevor es wirklich ernst wurde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!