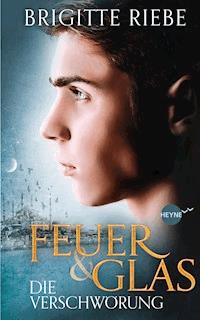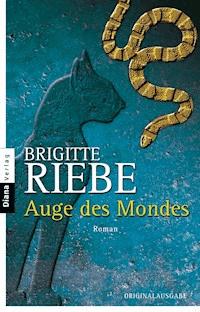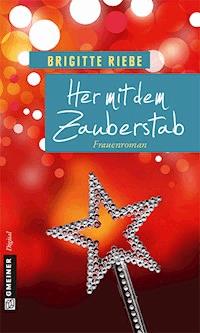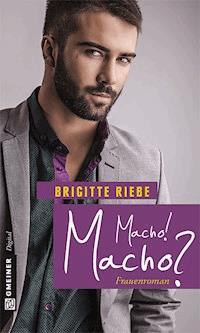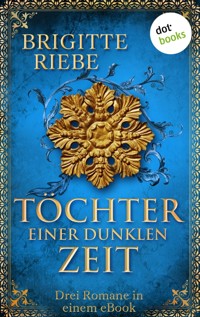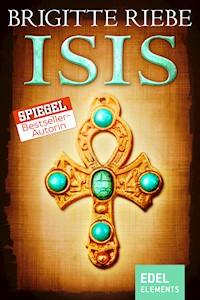
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Theben im 7. Jahrhundert vor Christus. Liebe und Eifersucht bestimmen die Beziehung der ungleichen Brüder Anu und Khay zu der schönen Bildhauertochter Isis. Als diese sich für den schüchternen Anu entscheidet, will sich der aufbrausende Khay nicht in die Rolle des Verlierers fügen. Isis sucht Rat bei der Seherin Meret, die eine furchtbare Vision hat: Brudermord! Wird es den Frauen gelingen, durch die Kraft der Liebe das vermeintlich unentrinnbare Schicksal aufzuhalten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Riebe
Isis
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2012 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. Copyright der Originalausgabe © 2002 by Brigitte Riebe
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-002-9
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Es gibt keinen Gott,
der tat, was ich getan habe,
noch eine Göttin:
Ich machte mich zum Mann,
obwohl ich eine Frau war.
Papyrus Louvre 3079
Inhalt
1. ATUM
2. SCHU
3. TEFNUT
4. GEB
5. NUT
6. NEPHTHYS
7. SETH
8. OSIRIS
9. ISIS
Vergehen
Nachwort
Namensverzeichnisse
Weiterführende Literatur
W E R D E N
Ich kenne das Gestern und habe das Morgen gesehen. »Die Augen des Nil«, so nannten sie mich, als ich noch die Gabe besaß, wenngleich ich nur das verborgene Schicksal anderer sehen konnte, jedoch blind war bei allem, was mich selbst betraf. Aus Liebe habe ich diese Gabe schließlich aufs Spiel gesetzt – und verloren. Seitdem gibt es für mich nur noch die Leere und darin, eingebettet wie in einen Kokon, die Vergangenheit, vorsichtig atmend, damit kein Unbefugter sie aufspüren kann.
Bei den Tränen der Isis: Nichts ist so schmerzlich wie die Liebe, die im Herzen aller Geschöpfe wohnt. Ich habe für diese Erfahrung einen hohen Preis bezahlt. Erst nach und nach lernte ich zu begreifen, dass Vergessen und Erinnern keine Gegensätze sind. Man muss sich erinnern können, um zu vergeben – und zu vergeben bedeutet auf seine Art zu vergessen.
Dabei wäre es mir noch immer am liebsten, es gäbe gar keine Geschichte zu erzählen. Lange Zeit habe ich daher eifersüchtig über sie gewacht, um sie wenigstens zu beschützen, wenn ich sie schon nicht ungeschehen machen konnte. Nun jedoch hat sich etwas ereignet, was niemand vorhersehen konnte, und ich werde nicht länger schweigen. Denn das Wort allein, das der Schöpfergott Ptah uns geschenkt hat, ist stärker als jede Waffe, mächtiger sogar als der Tod: das Einzige, was uns Menschen helfen kann, den Schmerz unserer Existenz im Angesicht der Endlichkeit zu begreifen.
Der Morgen, der alles für mich verändern sollte, begann wie gewohnt. Das Jahr ging zur Neige und die Tage zwischen den Zeiten waren angebrochen, die Isis und ihren göttlichen Geschwistern geweiht sind. Längst hatten die Bauern ihre Arbeiten an den Bewässerungsanlagen beendet. Auch ihre Tiere waren bereits vor der Flut evakuiert. Überall sah man gereinigte Kanäle mit ihren aufgeschütteten Dämmen, die sich wie ein exaktes Muster durch die rissige Erde zogen. Sie würden das Nilwasser zunächst aufstauen, um es später nach dem Durchstich auf die Felder zu leiten.
Natürlich hatte die allgemeine Unruhe vor dem Neujahrsfest, das mit dem Einsetzen der Flut gefeiert wird, auch mich ergriffen. Wir alle auf der Insel Philae fieberten dem Tag entgegen, an dem die Tränen der Isis den großen Fluss endlich über die Ufer treten lassen würden. Ein paar Gänse schnatterten im Schilf; ein Reiher stieß seine heiseren Schreie aus. Noch schliefen die anderen Bewohner der Tempelanlage, die große Hitze würde sich erst später auf das Flussufer legen. Eine kurze Nacht lag hinter mir, die ich auf dem Flachdach verbracht hatte, um der Schwüle drinnen zu entfliehen.
Vor Tagesanbruch stieg ich hinunter. Meine Knöchel waren geschwollen, als hätte ich im Traum eine weite Strecke zurückgelegt; mein Zehenstumpf pochte. Ich dehnte und streckte mich, um die Steifheit aus meinen Gliedern zu vertreiben. Die Morgentoilette verrichtete ich ohne den Kupferspiegel, der irgendwo herumlag. Mein Gesicht mit dem Leberfleck interessierte mich schon lange nicht mehr. Nicht einmal meinen Körper hasste ich noch, einst in seiner Besonderheit ebenso verstörend wie verlockend für mich und andere. Ich war schon zufrieden, wenn das Feuer in meinem Magen schwieg. Dass der ungleiche Gang, zu dem die Behinderung mich zwang, die linke Hüfte stärker belastete, war mir zur lästigen Gewohnheit geworden.
Ich knüpfte das Lederband auf, das die Holzprothese hielt, und massierte meinen Stumpf, bevor ich sie erneut anlegte und fester verschnürte. Inzwischen bewegte ich mich damit so behände, dass Fremde meine Beeinträchtigung oft nicht einmal bemerkten. Wie gewöhnlich zog ich eines der frischgescheuerten weißen Leinengewänder an und trank etwas Wasser, weil meine Eingeweide in letzter Zeit sogar gegen stark verdünnten Wein rebellierten. Dann wandte ich mich der Nische zu, die das Kostbarste meines bescheidenen Zuhauses barg: eine kleine Statue der Herrin der zehntausend Namen, der Mutter aller Mütter.
Die Göttin kniete auf einem Sockel, den Kopf nach links gewandt. Ein Pektoral lag um Ihren Hals, Reifen schmückten die erhobenen Arme, die in gefiederten Schwingen ausliefen. Das Kleid, das nach der herrschenden Mode die Brüste freigab, erinnerte an einen Schuppenpanzer, Huldigung an die allmächtige Herrin der Schlangen. Je nach Lichteinfall ließ der Schiefer, aus dem die Statue gefertigt war, Sie einmal grau, dann wieder eher grünlich erscheinen, ein schweres Material, aber so perfekt bearbeitet, dass es bei der Berührung wie seidiger Stoff wirkte.
Unzählige Male hatte ich vor diesem Isis-Bild schon mein Ritual verrichtet, hastig und dann wieder gelassen, voller Zweifel, den Tränen nah oder erfüllt mit Freude. Ich war sicher, die Göttin kannte meine Stimme, die sich manchmal schlaftrunken zu Ihr erhob, während die Sonnenscheibe sich im Leib der Nut vom Greis in ein Neugeborenes zurückverwandelte. Am liebsten waren mir jedoch jene intimen Momente der Dämmerung, wenn der Himmel in durchsichtigem Dunkelblau über der Wüste stand und den Morgen ankündigte. Dann hatte ich das Gefühl, Sie ganz direkt zu erreichen.
Ich räusperte mich und wollte mit dem ersten Satz meiner Anrufung beginnen. Doch zu meinem Erstaunen konnte ich nicht sprechen. Meine Zunge lag rau im Mund, der Hals war wie zugeschnürt.
Göttliche Mutter, was haben wir getan?
Auf einmal war alles wieder gegenwärtig, als wäre es erst gestern gewesen. Wir hatten uns angemaßt, Schicksal zu spielen. Und waren dafür bestraft worden – meine Brüder mit dem Tod, ich mit Verbannung, was mir, je länger ich lebte, als das härtere Los erschien. Denn die Lebenden mögen ihre Toten vergessen, die Toten aber lassen die Lebenden niemals ruhen, solange alte Schuld noch offen ist. Ich hatte schon zu hoffen gewagt, der Schmerz würde nach und nach an Schärfe verlieren. Jetzt aber war die Wunde plötzlich wieder offen.
Gebrauche nicht den Kopf, gebrauche dein Herz …
Kam diese Aufforderung von Ihr, der Beschützerin aller Frauen, die den Sternen ihre Wege weist und die Bahnen von Sonne und Mond ordnet? Aber durfte ich mich überhaupt zu den von Ihr Beschirmten zählen? Und wusste Isis nicht besser als jede andere Gottheit, dass es gerade das Herz gewesen war, das mich vom Weg abgebracht und in Verzweiflung geführt hatte?
Hilf mir, Isis!, bat ich stumm. Was soll ich tun, um Frieden zu finden?
Die Statue blieb regungslos, und doch glaubte ich plötzlich einen Lufthauch zu spüren, als hätten die steinernen Schwingen sich leicht bewegt. Und ich begann zu weinen, endlich. Die Feuchtigkeit verlor sich in meinen Haaren, die noch immer lang und lockig waren, wenngleich seit jener unvergessenen Nacht von silbernen Fäden durchzogen. Ich hatte nicht einmal geahnt, dass ich so viele Tränen in mir barg, denn meine Augen waren all die Jahre trocken geblieben: als Ruza starb, meine Mutter, die mich niemals geboren hatte, als wir Anu im Wüstensand betrauerten; sogar als Bewaffnete Khay in Fesseln abgeführt hatten. Tränen wie die ewigen Fluten des Nil, die das verdörrte Land aus seiner Erstarrung erlösen.
Auf einmal konnte ich den niedrigen Raum nicht mehr ertragen. Fast blind vom Weinen stolperte ich nach draußen.
Ich wusste nicht, wie viel Zeit verstrichen war, der warme Wind jedoch, der von Süden kam, hatte mein Herz gereinigt.
»Da bist du ja endlich!«
Es war Maram, die mich rief, anmutig und geheimnisvoll wie alle ihres Volkes. Als sie vor drei Sommern zu uns gekommen war, damals eher noch Kind als junge Frau, bedeckten lange Tuchröcke ihre Hüften und Beine, braun gefärbt mit dem Extrakt der Mimosenrinde, wie sie erklärte, nachdem sie sich einigermaßen in unserer Sprache ausdrücken konnte. Ihre Heimat war Punt, das Land Gottes, wie wir in Kernet es nennen, wo eine der zahlreichen königlichen Goldexpeditionen sie aufgegriffen und nach Sunu verschleppt hatte. Dunkelhäutige Schönheiten wie sie erfreuen sich auf dem hiesigen Sklavenmarkt so großer Beliebtheit, dass sie in Silber aufgewogen werden; kaum einer gelingt jemals die Flucht. Maram jedoch hatte entkommen können und war, halb verhungert und erschöpft, schließlich bei uns im Tempel aufgetaucht. Niemals hatte sie sich über Einzelheiten ausgelassen. Aber trotz der Qualen und Gefahren, die sie gewiss hatte überstehen müssen, war sie fröhlich geblieben. Außerdem war sie so jung, dass sie meine Tochter hätte sein können – wäre ich jemals in der Lage gewesen, ein Kind zu gebären.
Tatsächlich schien sie töchterliche Gefühle für mich zu empfinden und leistete mir freiwillig kleine Dienste, die ich dankbar annahm. Auch jetzt glättete sie mir mit ihren geschickten Fingern die Haare und drückte mir einen Kranz aus blauen Lotosblüten auf den Kopf, wie sie ebenfalls einen trug. Außerdem hatte sie an mein Instrument gedacht, das ich in meiner Verwirrung vergessen hatte.
»Wir müssen uns beeilen«, sagte sie beiläufig, obwohl ihr Blick verriet, dass ihr die Tränenspuren auf meinem Gesicht nicht entgangen waren. »Die anderen sind alle längst bei der Anlegestelle.«
Ich erhob mich und folgte ihr.
Die silberne Barke der Isis erreichte gerade den kleinen Quai im Südwesten der Insel. Tared, der Oberste Priester, stand frisch geschoren und mit einem gefältelten Schurz bekleidet ein Stück entfernt vor der Schar der anderen Gottesdiener. Einige der Musikantinnen schüttelten ihre Sistren. Maram, die sich niemals anstrengen musste, um den Takt zu halten, fiel mit ein. Andere schlugen Rahmentrommeln oder bliesen auf Rohrflöten. Darüber erhob sich die reine Mädchenstimme unserer jüngsten Priesterin:
Leih mir Deine Worte der KraftDein Lied zu singen vor aller Welt.In den Tiefen der Ozeane weilst Du, Herrin der Meere,in den Höhen der Berge weilst Du, Gebieterin der Berge.Dein Leib umfasst uns mit liebenden Armen,in Dir, mit Dir und durch Dich leben wir …
Eine stattliche schwarze Kuh, zwischen den Hörnern eine Mondscheibe aus poliertem Silber, wurde von Tared ans Ufer geführt. Freudenschreie erklangen. Überall wurden Fackeln entzündet. Isis, die ferne Göttin, war endlich nach Ihrem Zuhause zurückgekehrt!
Mir jedoch stockte der Atem. Befand ich mich bereits im Land der Schatten? Hatte ich all die Jahre in einem Traum gelebt, der soeben jäh endete?
Denn vom Tempel her näherte sich auf der Prozessionsstraße eine junge Frau, mit Knochen, die für den Rest des Körpers zu groß erschienen. Sie war hoch gewachsen, mit mageren Beinen, die eher zum Weglaufen taugten als zum Anlocken. Ein unverwechselbarer Gang, den ich nicht vergessen werde, solange ich atme: Schritte, ungleichmäßig, mal schnell, dann wieder langsamer, als drohe sie hinzufallen, was natürlich nicht geschah.
Sie blieb stehen und schaute sich um, als wolle sie alles in sich aufnehmen. Dann fiel ihr Blick auf mich.
Unaufhaltsam kam sie näher.
Für einen Moment empfand ich Abneigung, ja geradezu Hass. Wer gab ihr das Recht, so auszusehen wie jenes Mädchen namens Isis, das wir alle geliebt hatten – Khay mit verzehrender Leidenschaft, Anu hingebungsvoll und ich voller Entzücken? Selbst wenn unsere Isis noch am Leben war, konnte sie kein Mädchen mehr sein. Seit jenen Tagen hatte der große Fluss viele Male die Ufer überspült. Aber wer war sie dann, diese rätselhafte Doppelgängerin, diese Wandlerin zwischen den Zeiten?
Inzwischen war sie nah genug, dass ich Einzelheiten erkennen konnte: staubiges Haar, volle Lippen, leicht angespannt verzogen, eine schmalrückige Nase. Augen, nicht hell wie das große Grün jenes Mädchens, das uns alle in seinen Bann geschlagen hatte, sondern dunkel wie Schwarzdornbeeren. Furchtlos bohrten sie sich in meine, als wollten sie ihnen alle Geheimnisse entreißen. Und dann sah ich das Muttermal, exakt an der gleichen Stelle wie in meinem Gesicht.
Eine schreckliche Gewissheit stieg in mir empor. Was, wenn unser Versuch, in das Schicksal einzugreifen, doch geglückt war?
Inzwischen waren offenbar auch die anderen auf unseren wortlosen Dialog aufmerksam geworden. Die Sängerin verstummte, einige der Musikantinnen hatten die Instrumente bereits sinken lassen. Auf einmal klang dünn, ja fast schon jämmerlich, was eben noch als heiteres Loblied zum Himmel gestiegen war. Schließlich schwiegen alle. Und starrten uns neugierig an.
Tared ließ das rote Seil sinken und sah mit gerunzelter Stirn zu mir herüber. Was, wie ich wusste, Konsequenzen haben konnte. Denn ich war im Tempel nur geduldet.
»Ich suche Meret«, sagte die junge Frau.
Was sahen ihre Augen? Konnten sie hinter den Spiegel schauen, wie ich es einst vermocht hatte?
Ich versuchte, Ruhe zu bewahren. Die Gabe war ein göttliches Geschenk. Es gab keinerlei Anspruch auf sie, das hatte ich am eigenen Leib erfahren müssen. Oder täuschte ich mich auch darin, wie ich mich in so vielem getäuscht hatte?
Ihr Ton wurde fordernd. »Bist du Meret?« Ich senkte meinen Kopf, was ihr offenbar als Antwort genügte. »Dann ist meine Reise zu Ende.«
Hör auf!, flehte ich stumm. Bitte sprich nicht weiter, sonst stürzt du uns beide ins Unglück! Aber sie schien mich nicht zu verstehen. Und plötzlich traf es mich wie ein Schlag: Es gab kein Zurück – weder für sie noch für mich.
»Was ist mit meinem Vater?«, sagte die junge Frau, und ich entdeckte in ihrem eben noch so forschen Blick einen alten Schmerz, der mich erst recht befangen machte. »Ich muss wissen, wer er war. Du bist meine letzte Hoffnung, Meret.«
Sogar die Stimme war zum Verwechseln ähnlich!
Jetzt zitterte sie leicht, was sie plötzlich verletzbar aussehen ließ. Ich spürte fast körperlich, wie sehr sie sich anstrengen musste, um die Fassung nicht zu verlieren, und empfand einen Anflug von Mitgefühl.
»Wirst du mir helfen? Du musst!«
Ein Befehl, keine Bitte. So hatte auch Isis geklungen, als sie von mir den größten Liebesbeweis forderte. Wie damals schnürte mir Entsetzen die Kehle zu, als ich die gefürchteten Worte vernahm, und mir war, als würde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Eine jähe Welle schoss durch meinen Körper, als sei der glühende Ball in meinem Inneren explodiert. Ich schwankte, tastete vergeblich nach einem Halt und sah gerade noch, wie Maram die Arme ausstreckte, um mich zu stützen.
Dann fiel ich ihr bewusstlos zu Füßen.
Lehnte sich mein Körper gegen meine Seele auf, oder war es umgekehrt? Was ich hörte, bevor fiebriges Dämmern mich erneut umfing, waren Stimmen aus der Vergangenheit, die sich zögernd im Dunkel des Zimmers verloren. Die Krankheit bewegte sich wie ein gefangenes Tier in mir, verursachte Schweißausbrüche, Übelkeit, Schüttelfrost. Das Feuer in meinem Magen brannte. Manchmal glaubte ich förmlich zu sehen, wie es mich von innen unaufhaltsam zerfraß.
Unfähig aufzustehen, wurde ich zunächst von Maram versorgt, die mir Wasser einflößte und dünnen Tee, aus der Wurzel des Granatapfelbaumes, mit einer Prise Natronsalz versetzt. Als ich nach drei Tagen noch immer keine feste Nahrung zu mir nehmen konnte, holte sie trotz meines Protestes den Vorlesepriester an mein Krankenlager.
Djedi stellte ein Figürchen der löwenköpfigen Sachmet neben mich, um die Schlange in meinem Bauch zu töten, die er nicht zum ersten Mal als Ursache der Erkrankung vermutete. Nachdem er mich eine Weile eingehend betrachtet hatte, wiegte er bedenklich den Kopf. Ich ahnte trotz meiner Schwäche, dass er als Nächstes Maram hinausschicken würde, und tatsächlich befahl er ihr, uns allein zu lassen.
»Sie bleibt.« Ich versuchte mühsam, mich aufzurichten.
»Und keinerlei Untersuchungen!«
»Wie soll ich dir dann helfen?« Nicht einen Moment ließ er mich aus den Augen. »Du musst dich schon fügen, wenn du wieder gesund werden willst!«
Aber an diesem Tag hatte ich offenbar gewonnen, denn er entschied sich für keine seiner widerlich schmeckenden Arzneien, sondern begnügte sich damit, einen Zauberspruch zu murmeln und heiße Hühnerbrühe zu verordnen.
»Ich spüre die Anwesenheit eines Dämons«, sagte er, als er am nächsten Tag wiederkam und mich ein wenig lebhafter vorfand. »Als hätte man verbotenerweise eine Grabkammer geöffnet.« Ich erstarrte, versuchte aber, es nicht zu zeigen. »Gibt es jemanden aus jener anderen Welt, den du fürchtest?«
»Ich habe noch niemals erlebt, dass Tote sich rächen«, erwiderte ich schnell. »Komm lieber zur Sache! Ich habe das Gefühl, dass mein Magen sich gleich nach außen stülpt.«
»Wer weiß?«, erwiderte er. Seine dünnen Brauen zogen sich zusammen. »Manchmal reicht das Silber der Haare nicht aus, um das Herzensfeuer zu löschen. Gibt es etwas, was du loswerden möchtest, Meret? Mein Ohr ist allzeit für dich bereit. Aber das weißt du ja längst.«
Ja, ich wusste, worauf er lauerte, ebenso wie er wusste, dass ich niemals etwas freiwillig preisgeben würde. Oder hoffte er, meine Schwäche ausnützen zu können? Dazu würde er keine Gelegenheit erhalten! Er widerte mich an mit seinem wabbeligen Bauch und dem feisten, neugierigen Gesicht, das mir viel zu nah kam. Ein schwerer Duft stieg mir in die Nase, Djedi musste förmlich in Moschusöl gebadet haben. Außerdem hasste ich seine ölige Ausdrucksweise – und das war nicht alles, was ich hasste.
Trotz meines Verbots griff er nach meinem Arm, um den Puls zu fühlen. Die Berührung war mehr, als ich ertragen konnte. Jetzt besaß ich keine Macht mehr über das Fieber, das jäh anstieg, mich eine heiße Woge wegspülte und mir Bilder zutrug, Fetzen von Gesichtern und Stimmen, Gerüche, die ich längst schon vergessen geglaubt hatte …
Es ist wieder Sommer, und es ist sehr heiß. Ich bin ein zu schnell gewachsenes Kind, das nachts nicht mehr schlafen kann und tausend Fragen hat, auf die es keine Antworten gibt.
Wer bin ich? Woher komme ich?
Mein Grübeln findet kein Ende.
Langsam gehe ich hinunter zum Fluss, wie immer allein, weil Ruza mir eingeschärft hat, mich niemals nackt vor anderen zu zeigen. Ich weiß längst, weshalb. Auch wenn weder sie noch ich den Mut aufbringen, darüber zu reden.
Das Wasser ist erfrischend, winzige Sonnenflecke tanzen auf der grünlichen Oberfläche. Ich liege flach auf dem Rücken; kurze Wellen laufen über meinen Bauch. Mit geschlossenen Augen lasse ich mich treiben. Stirn und Augen sinken immer tiefer ins Wasser, bis nur noch Mund und Nase zum Atmen frei sind. Auf einmal klingt das Quaken der Ochsenfrösche und das Rauschen des warmen Windes wie eine ferne Melodie. Alles ist köstlich: die heiße Sonne auf meinem Körper und die Kühle darunter. Ein Fisch berührt meine Schulter, ich erschrecke kurz, aber entspanne mich wieder.
Plötzlich Rennen, Schreien, Spritzen – da sind sie, eine Schar Halbwüchsiger, die mir schon seit langem nachstellen. Älter als ich, grob und wild. Djedi ist darunter, und ein paar andere, vor denen ich mich fürchte, weil sie noch gemeiner sind als er. Sie zerfetzen mein Gewand, das am Ufer liegt, und lauern darauf, dass ich nackt aus dem Fluss kommen muss.
Ich aber schwimme flussabwärts, so weit ich kann, angstvoll, außer Atem. Schließlich verstecke ich mich im Gebüsch, bis sie endlich die Lust verlieren und verschwinden. Mücken zerstechen meine Haut, mein Schädel brummt vor Durst und Hitze, aber sie dürfen mich nicht kriegen, niemals, weil sie sonst …
»Sind wir nicht alle Grabräuber, sobald wir uns anschicken, Türen zu öffnen, die andere aus gutem Grund geschlossen haben?« Ich zog meinen Arm zurück, befriedigt darüber, dass jetzt Djedi jäh nach Luft schnappen musste. »Außerdem bin ich müde«, fuhr ich fort. »Ich möchte schlafen.«
Er ließ mich allein.
Ich wusste, er würde seine Vermutungen weiterplaudern. Es gab im ganzen Tempelbezirk keinen schwatzhafteren Mann als ihn. Und so war es nach wenigen Tagen ausgerechnet er, der meine Ahnungen bestätigte: Die Fremde, die sich noch immer auf der Insel aufhielt, hieß tatsächlich Isis.
Ich fühlte mich zu mutlos, um die Göttin anzurufen. Ich hatte Maram sogar gebeten, die Isis-Statue zu verhüllen, weil Ihr Anblick mir zum ersten Mal keinen Trost spendete.
Aber Mauern allein können das Leben nicht aussperren. Und draußen hatte die Flut bereits eingesetzt. Der große Fluss sang von Veränderungen, vom ewigen Wechsel, den kein Sterblicher jemals aufzuhalten vermag.
Ich spürte ihre Anwesenheit, noch bevor ich sie sah. Plötzlich schämte ich mich, dass der Raum nach Krankheit und Schlaf roch.
»Wieso bist du gekommen?«, fragte ich leise. Ein schneller Blick, dann Erleichterung. Das Laken verhüllte meinen verschwitzten Körper.
»Ich tue, was ich tun muss.« Sie schwieg eine Weile. »Kann ich auf dich zählen?« Ohne zu fragen, hatte sie sich neben mein Bett gesetzt. Sie war dünn, von einer noch jugendlichen Schlaksigkeit, die ihr eine eigenwillige, fast jungenhafte Anmut verlieh. »Du warst sehr krank«, fuhr sie fort.
»Meinetwegen?«
»Heute ist kein guter Tag für Antworten. Außerdem erfordern manche Fragen zu komplizierte Erklärungen. Bitte geh!«
Sie starrte gedankenverloren auf ihre Zehen: schmal, lang, makellos. Meine Prothese lag neben dem Bett, Seite an Seite mit dem scharfen Steinmesser, das ich immer in meiner Nähe hatte, und plötzlich schämte ich mich. Nichts an mir war vollkommen – nicht einmal die Füße. Ich spürte, wie mein Widerwille wuchs. Niemand konnte mich zwingen etwas preiszugeben. Selbst Isis nicht.
»Aber ist das wirklich vorzuziehen?« Ein einschmeichelndes Flüstern. Vom wem hatte sie ihre Klugheit geerbt? »Ein Leben lang mit einem Wissen herumzulaufen, das nichts als Schmerzen bereitet? Wo doch Worte trösten und heilen können!«
»Worte können aber auch gefährlicher als Steine sein«, entgegnete ich absichtlich barsch. »Hat man sie erst einmal geschleudert, verletzen sie. Oder töten sogar. Denn nichts von dem, was einmal gesagt wird, lässt sich jemals wieder rückgängig machen.«
»Ach, es gibt nichts, was sich nicht rückgängig machen ließe«, entgegnete sie altklug.
»Außer Zeugung und Tod.«
Jetzt hatte ich sie getroffen. Ich sah, wie das Licht in ihren Augen erlosch, und hasste mich im gleichen Atemzug dafür.
Schweigend starrten wir uns an.
Schließlich drehte ich mein Gesicht zur Wand, als sei die Unterhaltung für mich beendet. Vielleicht hatte ich Glück und sie gab auf.
»›Die Augen des Nil‹«, begann sie erneut, »so hat man dich genannt …«
»Das ist vorbei – lange schon! Meine Augen sind blind, verstehst du, vollkommen nutzlos. Wenn du deshalb gekommen bist, muss ich dich enttäuschen.«
»Dann ihretwegen«, beharrte sie. »Tu es für meine Mutter. Du hast sie doch geliebt.«
Der glühende Ball in meinem Inneren ließ Feuerfunken fliegen. »Was weißt du von Liebe? Nichts, gar nichts! Oder hast du schon am eigenen Leib erfahren, dass sie schnell und scharf ist? Brennend und verzehrend? Dass Liebe sogar vernichten kann?«
»Und sie, sie muss dich auch geliebt haben«, fuhr sie fort, als habe sie meinen Ausbruch nicht gehört.
»Woher weißt du das?«, flüsterte ich. »Hat sie es dir gesagt?«
»Nicht, solange sie lebte. Aber …«
»Isis ist tot?«
Wir alle sind Tiere, hatte Khay gesagt, als er die Gefahr schon spüren konnte, die uns schließlich alle vernichten sollte. Wir alle müssen sterben. Jeden Tag werden die Schatten länger. Ich fürchte mich, Meret, ich fürchte mich so sehr …
Er hatte Recht gehabt, mein Bruder Khay, der so leidenschaftlich gern gelebt hatte und so lange schon tot war. Ebenso wie Anu und wie ich soeben gehört hatte, auch Isis. Alle waren sie vor mir gegangen.
»… drei Tage nach ihrem Begräbnis habe ich von ihr geträumt.« Die Stimme des Mädchens rief mich in die Gegenwart zurück. »Sie sagte deinen Namen, so warm und herzlich, und dass ich dich auf Philae finden könne. Seltsamerweise jedoch war Mutter in meinem Traum kein Mensch. Und was noch seltsamer war: Ich konnte sie genau verstehen, obwohl sie ein flatterndes Sperberweibchen …«
»Schweig!«, verlangte ich heiser.
»Nur wer sich schuldig fühlt, windet sich vor der Wahrheit.« Jetzt klang sie unerbittlich. »Du hast meine Mutter gekannt. Aber wer ist mein Vater, Meret? Was weißt du von ihm?«
Anu, lag mir bereits auf der Zunge, mein Bruder Anu, der Mann deiner Mutter – wer sonst? Wieso sollte ich sie unnötig verwirren? Wo die Lüge doch die schnellste und einfachste Lösung war. Vielleicht würde ich sie damit endlich zum Schweigen bringen. Ich war schon beinahe so weit. Dann jedoch entdeckte ich die kleine bläuliche Ader, die aufgeregt an ihrem Hals pochte, genauso wie einst bei Isis.
»Du willst es wirklich wissen?«, fragte ich leise.
»Ich kann nicht anders.«
»Dann komm morgen Abend wieder! Aber sieh dich vor, denn du wirst einiges ertragen müssen. Und du brauchst Ausdauer und Offenheit. Denn was du zu hören bekommst, wird dir unfassbar erscheinen. Ich warne dich: Danach ist nichts mehr wie bisher, Isis.«
»Alles nehme ich auf mich«, sagte sie schnell, »wenn ich nur …«
»Geh!«, erwiderte ich.
Was konnte sie dafür, dass unsere Herzen damals vor Hunger brannten? Dass wir blindlings verstrickt waren und uns trotzdem unbesiegbar fühlten? Tod und Zeugung lassen sich nicht rückgängig machen, das hatte ich selbst gesagt. Vielleicht galt das auch für die Liebe, die alles fordert und nicht danach fragt, ob sie auch erwidert wird.
Wie ich es auch drehte und wendete – ich besaß kein Recht, ihr die Wahrheit über den Vater zu verweigern. Die Seele der Himmelsgöttin besteht aus Tausenden von Sternen, so wird in unseren schönsten Hymnen das Lob der Isis besungen. Eine Isis aus Fleisch und Blut hatte ich vor Jahren verloren. Nun war wie durch ein Wunder ihre Tochter in mein Leben getreten.
Waren das die Gesetze der Liebe?
Ich war bereit, mich ihnen noch einmal zu unterwerfen.
Ordnung würde mir helfen, klare Gedanken zu fassen. Deshalb war der Raum gefegt, die Decken auf dem Bett lagen sorgfältig gefaltet. Auf dem Tisch standen Brot und Früchte sowie Wasser- und Weinkrug. Maram, die keine überflüssige Frage stellte und meine Unruhe taktvoll überspielte, hatte sich mit dem Räuchern viel Mühe gegeben.
Ich war gebadet, mein Haar geflochten. Ich legte sogar die silberne Kette mit dem Flügelamulett an, die ich Jahre nicht mehr getragen hatte. Noch immer fühlte ich mich zittrig, gerade diese körperliche Schwäche jedoch verlieh mir besondere geistige Klarheit.
Als der Mond aufging, steigerte sich meine Unruhe, ähnlich wie einst, wenn die Visionen sich angekündigt hatten. Plötzlich wusste ich, was ich zu tun hatte.
Ich zog das Tuch von der Statue und kniete einen Augenblick vor der Göttin nieder. Danach griff ich nach dem Steinmesser und schnitt meinen Zopf ab. Wie eine schwarzsilbrige Schlange ringelte er sich auf dem Lehmboden. Mein Kopf fühlte sich plötzlich ganz leicht an, befreit von einer Last; der Nacken war angenehm kühl.
Mit einem Tuch bedeckte ich Kopf und Schultern, wie es die vornehmen Frauen Assurs tun, um sich von Sklavinnen und Huren zu unterscheiden. Ohne die Truppen Aschurbanaplis, des Königs der Assyrer, die in meinem ersten Lebensjahr Waset gebrandschatzt hatten, hätte ich vermutlich nicht überlebt. Außerdem erschien mir dieser Tribut an die Sitten Assurs nützlich, um meine Aufregung zu verbergen. Ein zusätzlicher Schleier verhüllte mein Gesicht. Nur die Augen blieben frei.
Wenn sie mein Anblick überraschte, so ließ sie es sich nicht anmerken. Ohne Zögern trat sie ein. Von nahem erschien sie mir so vertraut, dass ich sie am liebsten in die Arme genommen hätte. Aber zuerst hatte ich zu Ende zu bringen, was ich ihr schuldig war. Was danach geschehen würde, daran wagte ich nicht einmal zu denken. Der Feuerball in meinem Magen war zu neuem Leben erwacht. Ich musste an mich halten, um mich nicht vor Schmerzen zu krümmen. Trotzdem gelang es mir, mich zu beherrschen. Isis war die Tochter einer besonderen Frau und blutsverwandt. Wem also, wenn nicht ihr, gebührten Ehre und Höflichkeit?
Fast schon formell bat ich sie, auf einem Kissen Platz zu nehmen, und ließ mich ihr gegenüber nieder. Isis saß gerade wie eine Statue, die Beine gekreuzt. Ihr Atem ging unhörbar. Nur die Lider bewegten sich leicht.
»Ich bin bereit«, sagte sie, als die Stille im Raum unerträglich zu werden drohte.
Die Flut der Bilder wurde so stark, dass ich abermals zu zittern begann. Alles schien auf einmal zu einem mächtigen Strom zusammenzufließen, der mich ergriff und davontrug – was ich erlebt und jemals gehört hatte, Ruzas Erinnerungen, was ich in den Herzen von Khay und Anu gelesen hatte, Isis’ Ängste und schönste Hoffnungen. Geheimnisse, die meine Gabe einst entschleiert hatte.
Es war eine Geschichte der Liebe, gewebt aus unseren Schicksalssträngen, die sich auf einmal zu einem verschlungenen Muster verwoben und alle mit einschlossen: Sarit und Basa, Nezem und Selene, Ruza, meine beiden Brüder, mich selbst, vor allem aber Isis – ihre Mutter.
»Willst du nicht endlich beginnen?« Jetzt hörte sie sich an wie ein Kind.
Ich warf einen Blick auf die allmächtige Göttin, deren Schwingen uns alle beschützen, tat einen tiefen Atemzug und fing an zu erzählen.
1 A T U M
Als die Sonnenbarke am östlichen Horizont aufstieg, schlief keiner mehr im Anwesen des Basa. Die Schreie seiner Frau Sarit, die alle aus dem Schlaf gerissen hatten, waren inzwischen verstummt. Aber trotzdem wagte niemand, den Tag wie gewohnt zu beginnen. Dienerschaft und Mägde schlichen im Haus herum. Sogar die alte Neshet, sonst immer die Erste an der Feuerstelle im Hof und lärmend dazu, gab sich Mühe leise zu sein, während sie die Brote aus dem Ofen holte.
»Das waren noch keine Wehen«, sagte die Hebamme, als sie sich vom Bett abwandte, und ihrer Stimme war nicht anzuhören, ob sie besorgt oder erleichtert war. »Erste Warnzeichen, nichts weiter.« Sie furzte unbekümmert. »Wie es bei feinen Damen eben vorkommt, wenn sie ihre Blagen zu schnell hintereinander kriegen.« Als sei damit alles gesagt, nahm sie ihren Korb, in dem ein paar Bierkrüge schepperten, und strebte in Richtung Tür.
Basa packte sie fest so am Arm, dass seine Finger helle Male auf ihrer Haut hinterließen. »Du willst meine Frau doch nicht etwa allein lassen – in diesem Zustand?«
Sarits Haar glänzte schweißverklebt, die Lippen waren aufgesprungen. Erschöpfung und Angst ließen ihre Züge wie erloschen wirken.
Mit einem Schnauben machte die Hebamme sich los.
»Die Götter bestimmen, wann es an der Zeit ist für neues Leben, nicht wir. Schätze, wir werden uns noch gedulden müssen.« Sie zeigte ein aufsässiges Lächeln. »Eigentlich müsste sie ja bereits wissen, wie es geht – beim dritten Mal.«
»Und wofür werfe ich dir mein gutes Silber hinterher?«, fragte Basa scharf.
Sarit, die auf dem zerwühlten Bett vergeblich nach einer bequemeren Lage suchte, kannte den Grund. Die Alte mochte nach Fusel stinken, grobe Hände und einen kaum minder derben Wortschatz haben, aber wenn Basa nicht sie gerufen hätte, dann eben ein anderes billiges Weib. Irgendeine, die für ein paar Deben Silber zu allem bereit war – sogar dazu, ein Neugeborenes zu beseitigen, wenn es der Vater so schnell wie möglich loswerden wollte.
»Lass sie gehen!«, sagte sie leise, »die Amme kann mir doch beistehen. Schließlich kennt sie sich mit dem Kinderkriegen aus.«
Ein Vorschlag, der ihr alles andere als leicht gefallen war.
Aber die Amme genoss Basas Gunst, und es wäre unklug gewesen, den Namen ihrer Freundin zu erwähnen, die sie jetzt viel lieber an ihrer Seite gehabt hätte. Selene war ihm nicht nur deswegen suspekt, weil sie sagte, was sie dachte, und sich von keinem einschüchtern ließ. Er beschimpfte sie wegen ihrer grünen Augen als »Fischdämonin« und hasste sie mittlerweile so, wie er sie früher begehrt hatte.
Der Grund dafür lag auf der Hand: Sein Werben hatte Selene, die aus Keftiu stammte, nicht mehr als ein Lächeln entlockt. Sie liebte ihren Nezem, den Steinmetz, der am Hof der »Gottesgemahlin des Amun«, wie die höchste Priesterin hieß, gut bezahlte Arbeit gefunden hatte und mit seinen Händen Steine zum Leben erwecken konnte. Selene dachte nicht daran, sich mit einem anderen einzulassen, geschweige denn mit dem Ehemann ihrer Freundin. Wutentbrannt darüber, dass eine Frau und eine Fremde dazu es gewagt hatte, sich ihm zu verweigern, hatte Basa Sarit den Umgang mit Selene kurzerhand untersagt.
Nicht einen Augenblick hatte Sarit sich an dieses Verbot gehalten. Allerdings wollte sie vermeiden, Basas Zorn unnötig zu reizen, der aus dem Nichts aufsteigen konnte, um dann schwarz und stark wie eine Gewitterwolke loszustürmen, die alles unter sich hinwegfegte. Daher trafen sich die beiden Freundinnen nur noch heimlich. Wegen der fortgeschrittenen Schwangerschaft war Sarit mehr und mehr auf die Hilfe der Amme angewiesen, was ihr nicht gefiel, denn eigentlich erschien ihr die Amme des Kleinen kaum weniger suspekt als Basas Hafendirnen.
Aber blieb ihr eine andere Wahl?
Die Amme Ruza war die Einzige, die das schier Unmögliche tun konnte – und hoffentlich auch tun würde. Sie war Sarits letzter Ausweg, was der Hochschwangeren schlaflose Nächte bereitete. Sie liebt das Kleine wie ihr eigen Fleisch und Blut, versuchte sie sich Mut zuzusprechen. Niemals würde sie zulassen, dass ihm hinter ihrem Rücken ein Leid geschieht. Aber es fiel ihr noch immer schwer, wirklich daran zu glauben.
Basa runzelte die Stirn, und die helle Narbe an seiner Braue begann zu zucken. Normalerweise verließ er sich auf sein Siegerlächeln, das auf Frauen wie Männer wirkte. Jetzt aber, im frühen Licht des Morgens, erinnerte er sie mit der gebogenen Nase und seinem kräftigen Körper mehr denn je an einen Raubvogel.
Plötzliche Angst zog ihr das Herz zusammen.
Für ihn war sie nichts als ein fruchtbarer Schoß, der Söhne hervorbringen sollte – makellose Söhne. Versagte sie abermals, wie sie es in seinen Augen schon einmal so kläglich getan hatte, würde er keine Gnade kennen.
»Bitte!«, fügte sie in dem unterwürfigen Ton hinzu, der ihn manchmal umstimmen konnte. »Tu es für Khay!«
Bei der Erwähnung seines Erstgeborenen schien er tatsächlich unschlüssig geworden zu sein, denn plötzlich schrie er die Hebamme an: »Hast du nicht gehört, was sie gesagt hat? Verschwinde! Und lass dich hier nicht wieder blicken!«
Die alte Frau ließ sich dies nicht zweimal sagen. Vorsichtshalber hatte sie den Löwenanteil des vereinbarten Silbers im Voraus kassiert, denn der Erste Baumeister des Stadtfürsten Montemhet war für seine Launen bekannt. Sich mit Basa anzulegen konnte gefährlich sein. Es gab viele in Waset, die das bereits zu spüren bekommen hatten, zumal in diesen unruhigen Zeiten, da täglich neue Schreckensmeldungen über den Vormarsch der Assyrer stromaufwärts die Runde machten. Bereits vor drei Jahren hatten sie die Stadt belagert, wegen einer tödlichen Seuche im Heerlager jedoch unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen. Es gehörte nicht viel Phantasie dazu sich auszumalen, was geschehen würde, wenn sie nun abermals anrückten – und dieses Mal Erfolg hätten.
Die Hebamme war so schnell draußen, dass sie beinahe das Kind vor der Tür umgerannt hätte. Der kleine Junge in seinem fleckigen Leinenhemd rieb sich erschrocken die Stirn: ein hübscher Dreijähriger, kahl geschoren bis auf die übliche Jugendlocke, der gewöhnlich äußerst selbstbewusst auf seinen pummligen Beinchen umherstolzierte. Jetzt jedoch hatte ihn der ungewohnte Lärm ängstlich gemacht.
»Mama«, rief er und begann loszuschluchzen. »Meine Mama!«
Ruza gelang es gerade noch, ihn an der Schwelle einzufangen.
»Du kannst jetzt nicht zu deiner Mama, Khay.« Sie hob ihn hoch und drückte ihn gegen ihre Brust, die schwer und weich geblieben war, weil sie noch immer stillte, wenngleich ihre Milch schon lange nicht mehr ausreichte. Der süßliche Geruch, auch Khay nicht unvertraut, weil er manchmal eifersüchtig darauf bestand, dass sie nicht nur das Kleine, sondern auch ihn koste, schien ihn halbwegs zu beruhigen, denn sein Weinen wurde leiser.
»Komm her zu mir, mein Sohn!« Basa riss ihn aus Ruzas Armen, und Khay begann erneut loszuschreien. »Das da drinnen ist Weibersache, da haben Männer nichts verloren. Verstehe ohnehin einer, weshalb sie partout nicht das prachtvolle Geburtshaus benutzen will, das ich eigens für sie habe errichten lassen. Andere würden sich auf Knien dafür bedanken, aber ihr, der Verwöhnten, ist ja nie etwas gut genug!« Sichtlich angewidert schnupperte er an seinem Sohn. »Du stinkst ja wie eine ganze Affenherde! Gibt es in diesem Haushalt denn niemanden, der dich sauber halten kann?« Er streckte Khay weit von sich, als fürchte er sich zu besudeln. Wie jeden Morgen hatte er sich nach dem Bad mit Mandelöl massieren lassen und anschließend ausgiebig parfümiert. Keiner im Haus hätte es gewagt, ihn dabei zu stören. »Neshet, kümmere dich um ihn, aber schnell! Ich muss zum Stadtfürsten. Und mein Großer wird brav sein und tun, was ihm gesagt wird!«
Scherzhaft zog er an Khays Ohr, was wohl als unbeholfene Zärtlichkeit gedacht war, den Jungen aber noch mehr zu ängstigen schien. Das Schreien steigerte sich zu ohrenbetäubendem Gebrüll. Mit seinen Beinchen hämmerte er gegen den Leib der Alten, die ihn kaum noch halten konnte. Ruza, die erneut tröstend nach dem Jungen greifen wollte, wurde von Basa daran gehindert.
»Siehst du nicht, dass du hier gebraucht wirst?« Er wies nach drinnen. »Oder willst du lieber zurück in die Gosse? Ich hasse es, enttäuscht zu werden!«
»Aber das Kleine«, wandte sie ein und versuchte sich gegen die jäh aufsteigende Furcht zu wehren, die sie ganz schwindelig werden ließ. »Ich sollte vielleicht lieber …«
»Bist du taub?«
Wenn Ruza eines in Basas Haus gelernt hatte, dann, zur rechten Zeit den Mund zu halten. Sie zog den Kopf ein, starrte scheinbar demütig zu Boden und betrat das ebenerdige Wöchnerinnenzimmer, dessen Fenster sich zum Garten hin öffneten.
Drinnen schien die Luft plötzlich schwerer geworden zu sein. Keine der beiden Frauen sagte etwas, weder die Hochschwangere, die mit halb geschlossenen Augen vor sich hindämmerte, noch Ruza, die zunächst eine Weile unbehaglich herumstand. Schließlich zog sie die blauen Leinenstreifen vor die Fenster, um die zu dieser Jahreszeit schnell aufsteigende Hitze auszusperren, und stellte das benützte Geschirr zusammen. Dabei musste sie aufpassen, weder die Tawaret-Figuren umzuwerfen, die Bildnisse der hochschwangeren Nilpferdgöttin, die in verschwenderischer Anzahl herumstanden, noch auf die Kupfer- und Silberamulette zu treten, die alle dem gleichen Zweck dienen sollten: einer glücklichen, harmonischen Geburt.
Als sie Sarit Mandelmilch anbot, um das Einsetzen der Wehen anzuregen, verzog diese angeekelt den Mund. Einen Becher Wasser jedoch leerte sie durstig und verlangte nach einem zweiten, den sie ebenso schnell austrank.
»Willst du nicht aufstehen«, fragte Ruza schließlich, »und dich ein bisschen bewegen? Viele Frauen schwören darauf, und mir hat es auch geholfen.«
Sie hätte ebenso gut mit einer Wand reden können.
»Oder soll ich dich kämmen?« Ruza griff nach dem verzierten Elfenbeinkamm. »Dein schönes Haar ist ganz verfilzt.« Sarit blickte nicht einmal auf.
»Ich könnte dich feucht abreiben«, schlug die Amme vor, langsam mutlos, weil ihr bald nichts mehr einfiel. »Das würde dir bestimmt gut tun.«
Bei jedem Wort war ihr bewusst, dass die Herrin ihr von Anfang an misstraut hatte. An deren Stelle wäre es ihr wohl nicht anders ergangen, bestand doch ein wichtiger Unterschied zwischen ihnen: Sarit konnte sich Launen leisten. Sie dagegen war nur ein nicht mehr ganz junges Tanzmädchen gewesen, das ungewollt schwanger geworden war. Der Liebste hatte sie vor der Geburt verlassen. Dann war ihr Töchterchen nach wenigen Tagen an der gefürchteten Baa-Krankheit gestorben, die so viele Neugeborene dahinraffte. Betäubt vor Kummer, hatte sie in einer Schenke Arbeit gefunden. Dort hatte Basa sie aufgelesen und als Amme verpflichtet. Und plötzlich schien das Schicksal, mit dem sie so gehadert hatte, sich zu wenden. Wenn das Kleine an ihrer Brust lag und sie seinen warmen Duft einatmete, war in ihrer Vorstellung alles, wie sie es sich immer erträumt hatte: Sie war in Sicherheit, wohnte in einem schönen Haus – und ihr kleines Mädchen lebte.
Freilich war sie schlau genug, solche Phantasien niemandem anzuvertrauen, nicht einmal Neshet, die von allen Mägden am freundlichsten war und ihr manchmal sogar eine Extraration frisch gebrautes Dattelbier zukommen ließ. Ruza blieb dennoch auf der Hut. Sie wusste, sie konnte nicht vorsichtig genug sein. Denn wenn Basa erfahren sollte, was sie sich heimlich zusammenspann, würde er nicht zögern, sie auf der Stelle hinauszuwerfen.
»Ich werde auch ganz vorsichtig sein«, schickte sie in einem Anflug von schlechtem Gewissen hinterher.
Ein schwaches Nicken. Erstaunlicherweise schien ihr Vorschlag der Herrin zu gefallen.
Ruza zog die Decke beiseite und bemühte sich, ihr Erschrecken nicht zu zeigen, als sie Sarits Hemd nach oben schob. Die Haut hatte einen fahlen Olivton, der sich an manchen Stellen vertiefte, an den Schlüsselbeinen, feinknochig wie bei einem Mädchen, und den Rippen, die ihr geradezu zerbrechlich vorkamen. Sarits Arme und Beine waren während der Schwangerschaft dünn wie Holzstäbe geworden, während der Leib zum Platzen reif wirkte. Mit einem feuchten Lappen fuhr Ruza vorsichtig über den Körper. Das Gemisch aus Natron und Sand, das sie als Seife angerührt hatte, verströmte einen erdigen Geruch, der die Schwangere zu beruhigen schien. Jetzt war es still im Haus geworden, und die wenigen Laute, die zu hören waren, klangen gedämpft wie durch dicke Tücher zu ihnen herein.
»Ich weiß, dass ich entsetzlich aussehe«, sagte Sarit, die sich unter den Händen der Amme allmählich entspannte, unvermittelt. »Aber was macht das schon? Seit Monden hat er mich nicht mehr angerührt. Der große Basa hat offenbar Zerstreuungen gefunden, die ihn mehr befriedigen.« Sie verzog den Mund. »Wer ins Herz der Finsternis reist, muss mit allem rechnen.«
»Du brauchst dich nicht zu fürchten!« Ruza gab sich Mühe, zuversichtlich zu klingen. Früher hatte Sarit stets so kühl und elegant gewirkt. Sie war das schönste Mädchen Wasets gewesen, ausgestattet mit einer sagenhaften Mitgift, das Basa als Hartnäckigster unter vielen Bewerbern schließlich heimgeführt hatte. Jetzt schien ihre Jugend schon nach wenigen Jahren ebenso verflogen wie ihre Schönheit. Ruza deckte sie wieder zu. »Für jede Frau kommt irgendwann der Punkt, wo der Mut sie verlassen will. Aber Isis beschützt alle Gebärenden. Sie wird auch dir beistehen.«
Die Amme unterdrückte einen Schrei, denn Sarits spitze Fingernägel hatten sich plötzlich in ihr Fleisch gebohrt.
»Und du?« Mit erstaunlicher Kraft hielt sie Ruzas Gelenk umklammert. »Womit hat er dich geködert? Silbertropfen? Brünstige Umarmungen? Komm schon, verrat es mir! Was ist ihm sein Verbrechen wert?«
»Was meinst du damit?« Allein die Erinnerung an seinen Atem auf ihrer Haut ließ Ruza frösteln. Sie verabscheute Basa. Aber sie fürchtete ihn nicht minder. Wenn er in Zorn geriet, weil man verweigerte, was er begehrte, konnte der Baumeister unberechenbar werden wie ein wütender Elefantenbulle. Sie riss sich los.
»Du tust mir weh!« »Du sollst das Neugeborene ersticken, falls es wie das Kleine ist. Das verlangt er doch von dir! Und anschließend auch das Kleine töten.« Mit einem Seufzer sank Sarit zurück. »Ich bin weder taub noch blind. Mir könnt ihr nichts vormachen!«
»Niemals!« Ruza erschrak, wie dünn ihre Stimme klang.
»Du weißt ja nicht, was du da sagst!« Ihr Herz hämmerte gegen die Rippen. Musste sie jetzt darum bangen, ihr sicheres, bequemes Leben aufzugeben – und das Kleine, das ihr so ans Herz gewachsen war?
Sarit schien sie gar nicht zu hören. »Aber wenn du das tust«, sagte sie, »ist auch dein Leben in Gefahr. Hast du daran schon mal gedacht?«
Ruza starrte sie misstrauisch an.
»Basa kann sich keine Mitwisser leisten. Und er geht immer konsequent vor – bis zum bitteren Ende. Kein Mensch hat jemals mehr von der Hebamme gehört, die das Kleine zur Welt gebracht hat. Verschwunden ist sie, spurlos, als habe sie niemals gelebt. Willst du auch so enden?«
»Soll das heißen, er hat sie …«
»Dummköpfe, nichts anderes sind wir doch alle in seinen Augen! Nur er ist so klug, so stark, so unbesiegbar. Aber ich weiß, wie wir ihn schlagen können. Wirst du mir helfen, Ruza?«
Die Amme gab sich nicht einmal Mühe, ihre Skepsis zu verbergen. Ausgerechnet diese hilflose Schwangere und sie sollten sich einem Basa entgegenstellen? Die Vorstellung erschien ihr so absurd, dass sie lieber auf eine Antwort verzichtete.
»Rette das Kleine! Sein Leben ist keinen einzigen Deben Kupfer mehr wert, sobald das neue Kind den ersten Schrei getan hat.« Sarit berührte ihren Bauch mit einer hilflosen Geste. »Vorausgesetzt, es ist männlich und ohne Makel wie Khay. Für seinen Erstgeborenen würde Basa alles tun. Aber das Kleine? Niemand weiß besser als ich, wozu Basa fähig ist.«
»Unsinn!«, fiel Ruza ihr ins Wort. Sie wollte nichts mehr davon hören, gerade weil eine innere Stimme ihr sagte, dass es die Wahrheit war. Für das ungeborene Kind konnte sie noch keine Gefühle aufbringen. Aber dem Kleinen, ihrem Kleinen, durfte nichts geschehen! Erst neulich hatte es sich im Schlaf erbrochen und wäre, hätte sie nicht rechtzeitig nach ihm gesehen, womöglich an seinem eigenen Auswurf erstickt. Am glücklichsten fühlte sie sich, wenn es beim Einschlafen sein Köpfchen auf ihre Brust sinken ließ. »Das Kleine ist eine heilige Gabe der Götter …«
»Ich weiß«, fiel Sarit ihr ins Wort. »Ich kenne deinen Schmerz. Ein Meer von Tränen, als deine Tochter zu Osiris gegangen ist. Aber das ist vorbei. Du brauchst nicht mehr zu weinen. Das Kleine ist jetzt dein Kind. Und du bist seine Mutter – für immer. Willst du, Ruza? Du musst dich nur entscheiden.«
Die Amme spürte, wie ihr Mund trocken wurde. Das Kleine niemals wieder hergeben zu müssen? Eine jähe Sehnsucht ließ ihren Körper ganz schwer werden. Dann jedoch gewann die Vernunft wieder Oberhand. Sarit war offenbar dabei, den Verstand zu verlieren. Oder sie trieb ein grausames Spiel mit ihr. Und trotzdem – da war dieser wahnwitzige Hoffnungsfunke, der auf einmal ihr ganzes Sein erfüllte.
»Aber das geht doch nicht«, sagte sie matt. »Das dürfen wir nicht tun.«
Sarits schmale Hand glitt zu ihrem Schoß. Dann konnte Ruza hören, wie sie schwer ausatmete. Das Tuch unter ihr war bereits vom Fruchtwasser durchtränkt. »Uns läuft die Zeit davon. Ihr müsst fort, aus dem Haus, aus Waset. Weit genug, dass er euch nicht finden kann.«
»Aber wohin?«
»Stromaufwärts. Zum großen Isis-Tempel. Gegenüber diesen Mauern ist sogar Basa machtlos.«
»Unmöglich! Weißt du denn nicht, was in der Stadt los ist?« Ruzas Lippen waren vor Aufregung blass geworden. »Alle sagen, die fremden Soldaten sind nicht mehr aufzuhalten. Wer fliehen kann, ist längst mit Hab und Gut verschwunden. Außerdem nehmen die letzten Schiffe schon seit Tagen keine Passagiere mehr auf.«
Statt einer Antwort heulte Sarit auf.
Ruza fuhr zusammen. Inzwischen war es so stickig im Zimmer, dass sie kaum noch atmen konnte. »Wir werden doch die Alte holen müssen«, sagte sie und rieb sich den Nacken mit einem Tuch trocken. Das dünne Kleid klebte an ihrem Körper wie eine zweite Haut. Eine fiebrige Unruhe hatte sie ergriffen. Die Vorstellung, mit dem Kleinen für immer zusammen zu sein, wurde schier übermächtig.
»Nein, das werden wir nicht!« Plötzlich klang Sarit wieder ganz energisch. Sie tastete unter die Unterlage und zog ein halbes Dutzend Goldreifen hervor. »Ein lächerlicher Bruchteil meines einstigen Vermögens. Alles andere hat Basa sich einverleibt. Ich wette, selbst für den Fall einer Scheidung ist bereits alles zu seinen Gunsten geregelt.« Ihr Tonfall veränderte sich. »Ich bin deine Geliebte, deine Beute / ich gehöre dir wie das Grundstück, / das ich mit Blumen bepflanzt habe … Wenn er mich eines Tages verstößt, bin ich kein bisschen reicher als du.« Trotz der Schmerzen war ihr Lachen spöttisch. »Aber hiermit wird sich jeder Kapitän überzeugen lassen. Nach Philae, hörst du, Ruza? Zur Mutter aller Mütter. Warte, bis es dunkel wird! Im Schutz der Nacht habt ihr die besten Aussichten, durchzukommen. Schwöre mir bei deinem Leben, dass du alles dafür tun wirst!«
»Ich schwöre. Aber wozu so lange warten?« Das Kleine und sie für immer vereint – jetzt überfiel sie plötzlich die Furcht, es würde doch ein Traum bleiben.
»Basa wird sich mit eigenen Augen vergewissern, ob seine Handpuppen parieren. Versprich ihm alles! Er muss glauben, dass du Wachs in seinen Händen bist.« Sarit krümmte sich erneut. »Erst danach verschwindest du mit dem Kleinen, anstatt es zu töten.«
»Und du?«
»Es gibt jetzt wahrhaft Wichtigeres zu tun.«
»Aber du brauchst jemanden, der dir beisteht«, beharrte Ruza.
»Selene«, flüsterte Sarit, bevor sie einen schrillen Schrei ausstieß. Jetzt, während die Angst unaufhaltsam wuchs, besaß sie nicht länger die Kraft, den Namen der Freundin zurückzuhalten. »Hol Selene!«
»Ganz ruhig!« Der fremde Akzent war nur noch zu erkennen, wenn man genau hinhörte. Eine schlanke, große Frau stand im Raum, deren Haar wie ein Feuerkranz um das längliche Gesicht leuchtete. Ihr Blick flog über Sarits Lager, dann zu Ruza, die ihr reserviert entgegenstarrte. »Und bereits mitten in der Arbeit, wie ich sehe. Weshalb habt ihr mich nicht schon längst gerufen?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, löste Selene das Brusttuch, in das sie ihre Tochter gewickelt hatte, und legte diese kurzerhand in die Binsenwiege. Dem etwa halbjährigen Mädchen mit dem dunklen Schopf schien dieser Wechsel ganz und gar nicht zu behagen, denn augenblicklich ertönte empörtes Schreien.
»Offensichtlich hat Isis nicht nur mein Temperament geerbt, sondern auch die Sturheit ihres Vaters«, sagte Selene und lächelte, während sie ihr zur Beruhigung einen Honigzipfel in den Mund schob, den die Kleine immer wieder ausspuckte, bis sie endlich doch zu nuckeln begann. Anschließend schickte Selene die Amme mit knappen Worten zum Wasserholen. Sichtlich unwillig gehorchte Ruza.
»Hast du auch alles mitgebracht?«, flüsterte Sarit, kaum dass die Tür sich hinter der Amme geschlossen hatte. »Ich will es ihr erst geben, wenn sie das Haus mit dem Kind endgültig verlässt. Die Versuchung ist sonst zu groß.«
»Aber ja!« Selene nahm ihren gewebten Gürtel ab, der sich beim näheren Hinsehen als raffiniert geschneiderte Beuteltasche mit mehreren versteckten Fächern erwies. Sie bewegte ihn leicht hin und her und ließ dabei die unsichtbaren Schmuckstücke klappernd aneinander stoßen. »Und du hast Recht, vorsichtig zu sein. Ich bin froh, dass nicht einmal Nezem etwas davon zu Gesicht bekommen hat. So viel Gold kann sich ungünstig auf jeden Charakter auswirken.« Lachend legte sie den Gürtel wieder um. »Du hast also endlich mit Ruza gesprochen? Sie hilft dir?«
»Sie muss!« Sarits Ausdruck verriet ihre Anspannung.
»Warum bei allen Göttern kannst du nicht an ihrer Stelle sein? Es gibt niemanden, dem ich das Kleine lieber anvertrauen würde.«
»Als ob ich meinen Mondstrahl jemals verlassen könnte!« Ein inniger Blick zur Wiege, in der das kleine Mädchen schlief. Dann wandte sie sich wieder Sarit zu. »Klüger wäre es natürlich gewesen, nicht so schnell wieder schwanger zu werden, auch wenn dein Mann noch so sehr darauf gedrängt hat. Männer, was wissen sie schon? Söhne verlangt er von dir. Dabei sind doch Töchter das Kostbarste, was Isis einer Frau schenken kann.«
Die Gebärende stöhnte schmerzerfüllt.
Selenes Gesichtszüge wurden weich. »Aber was rede ich da? Mächtigere als wir lenken die Geschicke. Und überhaupt ist es höchste Zeit, nur noch an dich zu denken – und an dieses neue Leben, das es plötzlich so eilig hat. Jetzt wollen wir erst mal Platz schaffen!«
Sie räumte die Tawaret-Figuren so energisch zur Seite, dass eine davon umfiel und zerbrach. Abergläubisch sog Sarit die Luft zwischen die Zähne, Selene aber kümmerte sich nicht darum, sondern kehrte die Scherben zusammen, wechselte die Tücher und rieb ihre Freundin behutsam trocken. Danach wusch sie ihr Hände und Arme. Aus einem kleinen Tiegel salbte sie Sarits Scheitel.
»Herab zur Erde. Breite Deine Arme aus! Große Mutter, die alles Lebende hervorbringt, schütze und bewahre diese Mutter!« Mit einem Räuchergefäß fuhr sie dicht an Sarits Leib entlang.
»Was ist das? Mir wird ganz schwindelig«, flüsterte Sarit.
»Minze, Weihrauch und eine Prise Mandragora. Das nimmt dir die Angst.« Anschließend vollführte Selene mit einer Scherbe symbolische Schneidebewegungen. »Löse dich aus dem Bauch deiner Mutter und lebe glücklich und in Frieden!«
Sarit wirkte endlich ruhiger. Auf ihrer etwas zu kurzen Oberlippe glitzerten Schweißperlen, die den zuvor so angespannten Mund weich, fast mädchenhaft wirken ließen. Das Henna auf ihren Nägeln leuchtete wie frisches Blut.
»Ich mag ihn nicht«, sagte sie unvermittelt. »Und inzwischen verabscheue ich ihn manchmal sogar. Aber mein Körper sehnt sich trotzdem noch immer nach ihm. Kannst du dir das vorstellen? Dabei traue ich Basa zu, dass er mich mit bloßen Händen erwürgt, wenn er endgültig genug von mir hat.«
Selene strich ihr das feuchte Haar aus der Stirn.
»Schluss jetzt mit diesen düsteren Gedanken! Willst du Safrantee? Oder nicht doch lieber von den Weihrauchzäpfchen, die ich dir mitgebracht habe? Das Kind hat sich bis zuletzt nicht gedreht. Ich fürchte, du wirst einiges aushalten müssen, wenn es mit den Füßen oder seinem Hinterteil zuerst kommt.«
»Nein, lass nur, ich werde es auch so durchstehen.« Sarit versuchte, sich mit Selenes Hilfe etwas aufzusetzen. »Obwohl es sich anders anfühlt als bei den beiden ersten Malen. Beinahe, als ob ich von innen aufgerissen würde.« Keuchend redete sie weiter. »Aber es sind ja gar nicht die Schmerzen, die mir solche Angst machen, Selene. Was, wenn das Kind wieder wie das Kleine …«
»Hapis Segen wäre ihm auf jeden Fall gewiss. Und jetzt streng dich gefälligst an, meine Schöne! Was meiner Isis noch fehlt, ist eine lustige, kleine Freundin.«
Er liebte es, in den frühen Morgenstunden durch die Straßen zu laufen, wenn das Leben in den Innenhöfen erst allmählich begann. Sich in diesen geschenkten Stunden in einer Sänfte herumtragen zu lassen war etwas für Protzer oder Faulpelze, nichts jedoch für einen Mann wie Basa, der sich schon immer auf die Kraft seiner Muskeln und Sehnen verlassen hatte. Der Duft nach frischem Fladenbrot, der von unzähligen Feuerstellen aufstieg, ließ seine Schritte schneller und gleichmäßiger werden. Genauso hatte es in dem armseligen Haus in Mennefer gerochen, das er mit seiner Mutter bewohnt hatte, und manchmal waren die hauchdünn ausgerollten Fladen tagelang das Einzige gewesen, was die Witwe und ihr Sohn zu essen gehabt hatten.
Damals hatte er sich die meiste Zeit verzweifelt und niedergeschlagen gefühlt, selbst wenn sein Rücken ausnahmsweise nicht von ihren Stockhieben brannte. Damals hatte er sich geschworen, der Welt zu beweisen, was in ihm steckte, vor allem jedoch dieser unbarmherzigen Rächerin, die ihm zwar das Leben geschenkt hatte, ihn jedoch Tag für Tag härter dafür büßen ließ. Die Flecken und Blutergüsse auf seiner Haut mochten verblasst sein, aber es tat noch immer in den Knochen weh, dort, wo nur er wahrnehmen konnte, was sie ihm angetan hatte.
Unwillkürlich straffte er sich.
Inzwischen trug er seine verblichenen Narben wie Kampfspuren, und die Albträume behielt er für sich. Keiner würde in dem allseits geachteten Ersten Baumeister mehr den mageren, geduckten Jungen erkennen können, der vergeblich darauf gebrannt hatte, unbeschwert wie andere zu spielen – bis zu jenem Tag, an dem er durch einen älteren Freund zum ersten Mal von Imhotep erfahren hatte. Hoherpriester von Heliopolis war er gewesen, Ratgeber des Königs Djoser und Erbauer seiner großartigen Pyramide in Sakkara. Ganz Kernet verehrte ihn als Gott.
Die Vision, jenem Sagenumwobenen nachzueifern, hatte Jahre harter Entbehrungen erträglicher gemacht. Inzwischen hatte Basa trotz mancher Widerstände und Rückschläge erreicht, wovon andere nur träumten. Natürlich gehörte ganz Kernet dem Einzig-Einen; der allmächtige Pharao gebot über das Land und seine Erträge, er ließ Bauwerke errichten zum Lob der Götter. Aber er brauchte Menschen dazu, um Grund und Boden, Materialien und Tiere zu nutzen: Stadtfürsten, Priester, Verwalter – Männer wie ihn, die dabei Ehre und Reichtum erwerben konnten, wenn sie es geschickt anstellten. Basa war beides gelungen: Vom Taglöhner, der unter der Last der Steine schier zusammenbrach und auch die niedrigsten Dienste annehmen musste, um zu überleben, hatte er sich durch Fleiß, Klugheit und schließlich die Einheirat in eine der besten Familien zum Ersten Baumeister des Stadtfürsten Montemhet emporgearbeitet.
Und an einem blanken Morgen wie diesem kam es ihm vor, als sei Waset seine Stadt.
Viele der bunt bemalten Häuser trugen seine Handschrift. Seine Arbeiter standen im Ruf, solide Arbeit zu leisten, und errichteten das verzahnte Fachwerk so gekonnt, dass es die getrockneten Lehmziegel für mehr als eine Generation halten würde. Es hatte gedauert, bis er die überlieferten Techniken so weit verbessert hatte, dass sie seinen Ansprüchen genügten. Seine Spezialität waren Fußböden und Decken aus Balkenlagen, die mit Pech und Stroh versiegelt und erst anschließend mit Lehm geglättet wurden. Entwicklungen, die seine wohlhabende Kundschaft zu schätzen wusste. Niemals hatte es so großen Reichtum in Waset gegeben, nie zuvor war so viel Silber und Gold in Umlauf gewesen. Unter der inzwischen mehr als achtzigjährigen Herrschaft der schwarzen Pharaonen war die Stadt immer größer und prächtiger geworden, obwohl das nördlich gelegene Mennefer stets Residenz der Kuschiten blieb.
Eine Mauer schützte die »Siegreiche«, so der offizielle Name Wasets, vor Feinden, ausgedehnte Kanal- und Gartenanlagen verschönerten sie. Immer noch prachtvollere Bauwerke erhoben sich östlich des großen Flusses, der seit jeher das Ufer der Lebenden vom westlichen Totenreich trennte. Aber was waren schon die Lehmziegelbauten, was war selbst der mehrflügelige Palast des jüngst verstorbenen Pharaos Taharka gegenüber dem Haus für die Ewigkeit?
Was einzig und allein zählte, war die Tempelstadt von Ipetswt, erbaut zum Ruhm und zur Ehre des Gottes Amun-Re, dem wahren Herrscher Wasets. Als der gewaltige Säulenkiosk in Taharkas glücklichsten Regierungsjahren entstand, blieb Basa nichts anderes übrig, als ihr unaufhörliches Wachstum in den Himmel voller Sehnsucht und Neid zu verfolgen. Jahre später entschloss sich der Stadtfürst Montemhet, eine Osiris-Kapelle im Heiligtum errichten zu lassen, und beauftragte Basa damit. Nächtelang fand der Baumeister vor Aufregung keinen Schlaf mehr. Ein Teil seines früheren Lebens steckte noch immer wie ein Knochen in seiner Kehle, und kein noch so prall gefüllter Goldsack, kein noch so demütiges Wimmern einer Frau konnte etwas daran ändern. Aber er wusste nun, dass er die Schatten der Vergangenheit besiegen konnte – endgültig. Und nicht einmal der böse Geist seiner Mutter konnte ihn daran hindern.
Montemhet hatte ihn bei Baubeginn gemustert, als sei er durchsichtig wie helles Glas. »Eigentlich bist du ein Krieger, Basa. Mit schnellen Kamelen hast du begonnen, in der Wüste Nagas, zwischen Dünen und in flirrender Hitze. Inzwischen führst du deinen Kampf mit Steinquadern und Balkenkonstruktionen. Du willst hoch hinaus, sehr hoch, und wenn es einem gelingen wird, dann wahrscheinlich dir.« Der Stadtfürst strich sich über das markante Kinn, ein seltsamer Gegensatz zu seinen sonst eher weichen, fast weiblichen Zügen, über denen stets ein Hauch von Melancholie zu liegen schien. »Solange jedoch der Skorpion des Hasses in deinem Herzen wohnt, wirst du niemals Ruhe finden.«
Wie gelähmt hatte Basa zugehört, unfähig zu einer Reaktion. Montemhet hatte seinen Arm berührt, nur einen Lidschlag lang, was Basa kaum ertragen konnte, und sich dann abgewandt. Niemals mehr war er auf seine seltsame Äußerung zurückgekommen, auch nicht, als die Kapelle längst fertig und ihrer Bestimmung zugeführt war. Dennoch hatte es gedauert, bis Basa sich ihm wieder halbwegs unverkrampft nähern konnte, ohne sich entblößt vor ihm zu fühlen. Und bis zum heutigen Tag war ein Gefühl tiefer innerer Unsicherheit in ihm zurückgeblieben.
Inzwischen war er vor Montemhets Stadtpalais angelangt, einem erlesen eingerichteten Anwesen, das wie die meisten Häuser der Oberschicht einen eigenen Anlegeplatz besaß. Die Mauer, die den Garten umschloss, war nicht hoch genug, um jeden Einblick zu verwehren. Stimmengewirr und undefinierbare Geräusche drangen vom Ufer herüber. Unwillkürlich stellte sich Basa auf die Zehenspitzen. Dunkelhäutige Männer waren damit beschäftigt, schwere Holzkisten auf. zwei bauchige Lastsegler zu laden, die hintereinander geankert zur Abfahrt bereit schienen. Auf keinem von beiden konnte er das Wappen Montemhets entdecken, die blaue Lotosblüte, die jeden seiner Erlasse zierte und sich als Schmuckfries überall in seinem Haus wiederfand.
Für einen Augenblick erfasste Basa leichter Schwindel, und seine Handflächen wurden feucht. Was, wenn der Stadtfürst plante, ohne großes Aufsehen mit seinen wertvollsten Schätzen stromaufwärts zu segeln? Das würde bedeuten, dass Pharao Tanutamun die Stadt bereits aufgegeben hatte, um sie schutzlos den Truppen Aschurbanaplis zu überlassen.
Dann jedoch wurde Basa wieder ruhiger.
Gemeinsam hatten sie den Gefahren der westlichen Wüste getrotzt und den großen Fluss bis hinauf zum vierten Katarakt befahren, wo Napata lag, die sagenhafte Hauptstadt der Kuschiten. Montemhet verdankte er seinen Aufstieg, seinen Reichtum, in gewisser Weise sogar das Leben. Unterwegs hatte er unzählige Male Gelegenheit gehabt, den Charakter des Stadtfürsten zu studieren, und den Reisen waren Jahre ertragreicher Zusammenarbeit in Waset gefolgt. Mochte sein Gönner auch ein Meister der politischen Intrige sein, immer wieder zu Entschlüssen fähig, die alle vor den Kopf stießen – bestimmt aber war er kein Feigling und Verräter, der seine Stadt im Stich lassen würde.
»Du kommst spät.«
Es lag kein Vorwurf in der Stimme Montemhets, und trotzdem war es Basa, als habe er einen gut gezielten Hieb zwischen die Schulterblätter erhalten. Der Stadtfürst war ihm ein Stück entgegen gegangen, das Haar noch feucht von seinem morgendlichen Bad im Nil, das er niemals versäumte.
»Ich wurde aufgehalten«, sagte Basa kurz, weil er es hasste, sich unterlegen zu fühlen. Es kostete ihn Mühe, scheinbar gleichmütig weiterzusprechen, aber schließlich gelang es ihm. »Familienangelegenheiten. Mein Sohn scheint es eilig zu haben, zur Welt zu kommen. Aber es gibt offenbar Schwierigkeiten. Und ich habe seiner Mutter versprochen, bald zurück zu sein.« Sein Atem hatte sich beschleunigt. Die Lüge jedoch ging glatt und wie selbstverständlich über seine Lippen.
»Offenbar ein Held oder ein Narr.« Montemhet kam näher. »Und für beide brechen denkbar schlechte Zeiten an.« Er rieb sich die Augen, und erst jetzt bemerkte Basa die Schatten der Müdigkeit und die hohl gewordenen Wangenknochen. »Ich bin froh, dass meine beiden Söhne noch länger im Goldland bleiben werden. Komm ins Haus, Basa! Wir haben einiges zu besprechen.«
Er ging schnell voran, und seine Schritte waren fest, aber dennoch glaubte Basa, jenes seltsame Netz von Melancholie über ihm zu spüren, in dem man sich wie in einem feinen Gespinst verfangen konnte, wenn man nicht vorsichtig war. »Sind die Arbeiten an der Mauer abgeschlossen?«, fragte Montemhet, sobald sie den Innenhof erreicht hatten, um den sich seine privaten Gemächer gruppierten. Er bot ihm nicht die kleinste Erfrischung an, was Basa mit leisem Erstaunen registrierte. Obwohl die Sonne noch nicht hoch stand, war es bereits brütend warm, als hätte sich eine Hitzeglocke über die Stadt gestülpt.