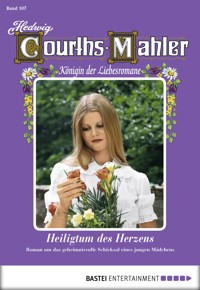Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von seiner Familie entfremdet, kehrt Lutz von Berndorf dem elterlichen Gut den Rücken und sucht in Berlin sein Glück. Als er eines Tages einen Brief von seiner erhält, in dem sie ihn zu einer reichen Heirat drängt, ahnt Lutz nicht, dass er kurz darauf einer außergewöhnlichen Frau begegnen wird, deren Anmut sein Herz entflammen lässt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Die schöne Melusine
Saga
Die schöne Melusine
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1924, 2022 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950458
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
I
Mein lieber Lutz!
Ehe mir der nahende Frühling zu viel Arbeit bringt und meine Zeit dadurch knapp wird, will ich Dir noch einmal ausführlich schreiben. Du weißt ja, wenn draußen die Feldarbeiten beginnen, bin ich den ganzen Tag unterwegs. Die Jahresabrechnung, die ich Dir kürzlich sandte, wird Dir gezeigt haben, daß ich wieder trotz aller Mühe einen sehr geringen Reingewinn erzielt habe, und es ist mir sehr lieb, daß Du auf jeden Zuschuß von zu Hause verzichtest.
So kann ich ein paar notwendige Arbeiten vornehmen lassen. Am Kuhstall und an der großen Scheune müssen die Dächer ausgebessert werden, und einige Zimmer im Wohnhaus brauchen unbedingt neue Tapeten. Du weißt, unnötig gebe ich keinen Pfennig aus, dafür kennst Du Deine Mutter.
Käthe muß für den Sommer einige Kleider haben, sie wächst so schnell aus allem heraus, und da sie nun eine erwachsene junge Dame ist, kann ich sie in den alten Fähnchen nicht mehr herumlaufen lassen. Sie verspricht bildhübsch zu werden. Von Muttereitelkeit weiß ich mich frei, es ist mein objektives Urteil. Ich hoffe, Käthe macht bald eine gute Partie, ich sehe mich schon langsam danach um, denn mit achtzehn Jahren ist eine junge Dame heiratsfähig. Findet sich hier im Umkreis keine Partie für sie, muß man sie im Winter vielleicht nach Berlin oder Dresden bringen, damit sie Gelegenheit zu einer passenden Bekanntschaft findet.
Du wirst natürlich die Stirn kraus ziehen, wenn Du dies liest. Ich kenne ja Deine leider recht unvernünftigen Ansichten über diesen Punkt. Es wäre mir aber sehr viel lieber, Du wärst nicht so ideal veranlagt, sondern hättest meinen praktischen Sinn geerbt. Dann hättest Du Dich längst nach einer reichen Frau umgesehen, denn eine arme kannst Du keinesfalls brauchen. Das wäre das Ende, Lutz, wenn Du Dich an ein armes Mädchen verplempertest. Das darfst Du mir nicht antun, mein Sohn.
Du wirst denken, daß ich mir unnötige Sorgen wegen unserer Lage mache, weil uns das Erbe Onkel Rudolfs sicher ist. Damit rechne ich freilich und mehr als Du. Ohne die Hoffnung, daß uns der Wildenauer sein Hab und Gut vermacht, hätte ich längst die Flinte ins Korn geworfen. Eines Tages, das weiß ich, werden alle unsere Sorgen von uns genommen werden, denn Onkel Rudolf kann ja niemand als uns zu seinen Erben einsetzen. Da er selbst weder Frau noch Kind hat, stehen wir ihm am nächsten. Und außerdem hat er vor Jahren Deinem verstorbenen Vater versprochen, ihm Wildenau zu vererben. Sehr lange hat Onkel Rudolf kaum noch zu leben, obwohl er kaum fünfundvierzig Jahre alt ist. Sein Leiden wird ihm einen frühen Tod bringen. Aber – man täuscht sich auch manchmal. Doch wie dem auch sei, eines Tages gehört uns all sein Reichtum und sein herrlicher Besitz.
Deshalb ertrage ich willig seine galligen, sarkastischen Ausfälle, die mir oft das Leben schwermachen. So oft wir mit ihm zusammenkommen, läßt er es nicht an allerlei häßlichen Bosheiten fehlen. Doch ich ertrage sie für Euch, für Dich und Käthe.
Trotz seines Herzleidens kann er aber auch länger leben als wir annehmen, denn er ist noch unglaublich rüstig, wenn er auch von Zeit zu Zeit sehr zusammenfällt. Er erholt sich immer wieder. Und deshalb können wir auf Jahre hinaus noch nicht mit dem Erbe rechnen. Das legt Dir die Pflicht auf, eine reiche Frau heimzuführen, damit wir ein bißchen freier atmen können. Und Käthe muß auch eine gute Partie machen, dafür sorge ich. Dann können wir mit Ruhe Onkel Rudolfs Ende abwarten.
Also, sei vernünftig, Lutz, und sieh Dich bald nach einer reichen Frau um. Du weißt ja, daß die Einkünfte von Jahr zu Jahr geringer werden und daß ich nicht viel mehr als die Hypothekenzinsen herauswirtschafte, obwohl ich von früh bis spät auf dem Posten bin.
Nun habe ich Dir noch etwas anderes zu melden. Denke Dir, gestern kam aus Amerika ein Brief an Deinen Vater an. Er war von Maria Hartau, einer Kusine Deines Vater, die wohl nichts von seinem Tod gehört hatte. Du wirst Dich erinnern, daß Dein Vater zuweilen von dieser »Lieblingskusine« gesprochen hat. Ich habe sie wenig gekannt, weiß nur, daß sie mit einem obskuren Maler in die weite Welt gelaufen ist, weil ihre Eltern sie vernünftigerweise mit einem vermögenden Mann verheiraten wollten. Sie hat dann diesen Maler Hartau in England geheiratet und ist mit ihm nach Amerika ausgewandert. Dort ist es ihr natürlich ziemlich schlechtgegangen, wie sie in ihrem Brief schreibt. Ich habe ihn selbstverständlich geöffnet und gelesen, da Dein Vater nicht mehr am Leben ist.
Diese Maria Hartau, die bisher nie etwas von sich hören ließ, ist gestorben. Sie hat sich vor ihrem Tod daran erinnert, daß sie mit Deinem Vater sehr sympathisiert hat, und wohl auch daran, daß er immer ein idealer Weltverbesserer war und allen Menschen helfen wollte. Sie spekuliert jedenfalls auf diese Gutmütigkeit und schickt uns quasi als teures Vermächtnis ihre Tochter, als ganz sicher nimmt sie an, daß diese in Berndorf Aufnahme finden wird. Sie läßt uns gar keine Möglichkeit, nein zu sagen. Und wenn wir nun nicht als Barbaren gelten wollen, müssen wir sie aufnehmen, wenigstens bis sich ein anderes Unterkommen gefunden hat. Da ihre Mutter unstreitig eine Freiin von Berndorf war und außer uns keine Berndorfs mehr existieren, haben wir eine gewisse moralische Verpflichtung, uns ihrer anzunehmen.
Das fehlt mir gerade noch, daß mir die Sorge um anderer Leute Kinder aufgebürdet wird. Unnütze Brotesser können wir wirklich in Berndorf nicht brauchen. Was sagst Du dazu, mein Sohn? Ich lege Dir den Brief Maria Hartaus mit ein, sende ihn mir zurück in Deinem Antwortschreiben.
Aber nun will ich schließen, gleich wird Onkel Rudolf kommen, ich habe ihn zum Mittagessen eingeladen. Ein Genuß ist seine Gesellschaft nicht, aber man muß ihn mit Geduld ertragen. Käthe fürchtet sich geradezu vor seiner spöttischen Art und liefe am liebsten davon, wenn er kommt. Aber sie ist gottlob vernünftig und weiß, was auf dem Spiel steht. Trotz ihrer Jugend kann sie sich in Fällen, wo es nötig ist, tadellos beherrschen.
Also für heut lebe wohl, mein lieber Lutz, und laß bald von Dir hören. Käthe läßt Dich grüßen. Wann wirst Du wieder einmal nach Berndorf kommen?
Mit herzlichem Gruß
Deine Mutter.«
Als Lutz von Berndorf diesen Brief zu Ende gelesen hatte, faltete er ihn nachdenklich zusammen. Seine Brust hob sich, als mühe er sich, die Last loszuwerden, die ihn bedrückte.
Seine Mutter war ihm immer innerlich fremd geblieben. Ihre Art war von der seinen so verschieden, daß es bei ihnen kein herzliches Einverständnis geben konnte, wie es zwischen ihm und seinem Vater geherrscht hatte. Er wußte sehr wohl, daß die kalte, kleinliche und berechnende Art der Mutter diesem das Leben verbittert hatte. Freilich, ohne sie wären die Verhältnisse in Berndorf noch weniger geordnet gewesen. Wenn sie nicht gerechnet und geknausert hätte, wäre das Gut schon unter den Hammer gekommen. Sein gutherziger Vater hatte zuviel an andre gedacht und zuwenig an sich selbst. Lutz wußte aber, daß seine Mutter eine tüchtige und sparsame Wirtschafterin war.
Deshalb hatte er ihr auch gutwillig das Regiment abgetreten, als er nach seines Vaters Tod Herr von Berndorf wurde. Er hatte von seinem verstorbenen Vater die Erlaubnis erhalten, Chemie zu studieren. Er wollte seine Zukunft nicht auf das verschuldete Berndorf aufbauen und noch weniger auf die Möglichkeit, seinen Onkel Rudolf in Wildenau zu beerben. Rudolf von Wildenaus Mutter war eine Freiin von Berndorf gewesen. Er und Lutz von Berndorfs Vater waren Vettern. Lutz war eine zu tatkräftige Natur, um zuzusehen, wie sich die Verhältnisse auf Berndorf täglich verschlimmerten. Ändern konnte er es nicht, deshalb suchte er seine Zukunft auf eine andre Art zu meistern.
Seine Mutter hatte nur widerstrebend ihre Einwilligung zu seinem Studium gegeben. Sie sah in ihrem Sohn den Erben des fürstlichen Besitzes Wildenau und wollte nicht, daß er einen andern Beruf als den des Landwirts ergriffe. Aber in dieser Angelegenheit hatte ihr sonst nur zu nachgiebiger Gatte ein Machtwort gesprochen.
»Der Landwirt liegt Lutz ohnedies im Blut. Kommt er dazu, Herr auf Wildenau zu werden, so wird er sich schnell einarbeiten. Unbedingt sicher ist das aber durchaus nicht, denn Rudolf ist in den besten Jahren und kann trotz seines Herzleidens noch jeden Tag heiraten oder sein Hab und Gut anderweitig vererben. Dann bliebe Lutz nur Berndorf. Ich möchte nicht, daß er, wie ich, seine besten Kräfte daransetzt, die Hypothekenzinsen herauszuwirtschaften, um schließlich, wenn er sich Jahr um Jahr damit abgequält hat, vor dem Ruin zu stehen. Mein Sohn soll frei sein von dieser Last. Er soll einen Beruf ergreifen, den er mit Lust und Liebe ausübt und der ihn in den Stand setzt, im Leben vorwärtszukommen. Im übrigen können ihm seine Studien als Chemiker später auch von Nutzen sein, wenn er sich vielleicht einmal als Landwirt betätigt. Die Zeit, die er seinem Studium widmet, ist keinesfalls für ihn verloren.«
So hatte Lutz’ Vater zu seiner Gattin gesprochen, und in diesem Fall hatte sie sich seinem Willen gefügt.
Jetzt war sie auch ganz einverstanden, daß ihr Sohn diesen Beruf ausübte, denn er hatte nach Beendigung seiner Studien bereits ein Einkommen, daß ihn auf jeden Zuschuß von zu Hause verzichten ließ. Er war Assistent eines berühmten Professors an einem chemischen Laboratorium geworden und lebte jetzt in Berlin.
Langsam hatte er den Brief zusammengefaltet und wollte ihn wieder in das Kuvert schieben. Da erblickte er erst den eingelegten Brief, den die Mutter erwähnt hatte, und zog ihn aus dem Kuvert. Er las:
»Lieber Vetter Theo, liebe Martha!
Ihr werdet Euch wundern, nach so langer Zeit von einer zu hören, die für Euch alle verschollen war. Ich habe Euch in all der Zeit absichtlich keine Nachricht gegeben, denn meine Eltern und Geschwister haben meine Briefe ungeöffnet zurückgeschickt, und so wollte ich Euch nicht in die peinliche Lage versetzen, mich ebenfalls verleugnen zu müssen. Daß Du, mein lieber Vetter, mich nicht verdammt hast, weil ich meinem Herzen und dem Mann meiner Liebe folgte und mich nicht an den ungeliebten Mann verkaufte, dem mich die Eltern ausliefern wollten, weiß ich. Du hast mir ein gutes Wort damals auf meinen Weg gegeben: Bleib Dir selbst treu, Maria, denn keine Untreue bestraft sich härter als die gegen sich selbst! – Für dieses Wort danke ich Dir noch heute in meinen letzten Lebensstunden. Und ich habe es allezeit beherzigt. Meine Eltern und Geschwister sind tot – ich erfuhr es durch fremde Menschen – ganz zufällig. Auch sonst lebt niemand von meinen Verwandten mehr als Ihr beiden, Du, Theo, und Deine Gattin. Und so kann ich mich jetzt in meiner Herzensnot auch nur an Euch beide wenden.
Ich habe nicht viel Glück im Leben gehabt, soweit das Glück aus realen Gütern des Lebens besteht. Wir sind arm geblieben, mein Mann und ich, haben immer nur aus der Hand in den Mund gelebt. Aber sonst war mein Leben ein reiches und gesegnetes, ich habe lieben dürfen und bin geliebt worden, wie es nur wenigen Menschen beschieden ist. Solange wir beide arbeiten konnten, blieb uns auch ernste Sorge fern. Wir hatten, was wir brauchten, für uns und unser einziges Kind, unsre Tochter Winnifred.
Aber nun ist all mein bescheidenes Glück zerbrochen. Mein geliebter Mann starb nach langem Leiden vor zwei Jahren. Seine Krankheit zehrte unsern Sparpfennig und meine Kräfte auf. Der Arzt gibt mir nur noch eine kurze Frist. Da ist die Angst um Winnifred, meine Tochter, riesengroß an mich herangekrochen. Was wird aus dem Kind, wenn ich die Augen schließe?
Winnifred ist ein sehr sensitives schüchternes Geschöpf, paßt nicht in dieses Land, wo man seine Ellenbogen rücksichtslos gebrauchen muß, wenn man seinen Platz behaupten will. Sie ist gar nicht geeignet für den Lebenskampf. Mein Mann und ich haben uns heimlich immer an ihrer zärtlichen Gemütsart gefreut. Wir konnten ja bisher die Hände über sie breiten, nichts Rauhes und Böses durfte an sie heran. Aber nun, wenn ich nicht mehr bin, steht sie einsam, schutzlos im Leben, hier in fremdem Land, in dem sie sich mit ihrer Art nie zurechtfinden wird. Sie würde hier zugrunde gehen, ich fühle es.
Und da habe ich in meiner Angst und Not an Euch gedacht, an Dich, Vetter Theo, den ich als einen edlen, gütigen Menschen kenne. Ich hörte, daß Ihr noch in Berndorf wohnt. Erbarmt Euch meines Kindes, lieber Theo, liebe Martha. Ich habe keine Zeit mehr, erst bei Euch anzufragen, ob ich Euch Winnifred ins Haus schicken darf, ich tue es, weil ich mir keinen andern Rat weiß. Einer Sterbenden letzte Bitte fleht um Eure Hilfe! Winnifred hat eine sehr sorgfältige Erziehung genossen und scheut sich vor keiner Arbeit. Könnt Ihr sie nicht in Eurem Hause gebrauchen, so verhelft ihr zu einer Stellung, in der sie Familienschutz und Anschluß findet, vielleicht als Gesellschafterin oder dergleichen. Sie ist sehr musikalisch und hat alles gelernt, was sie in solcher Stellung braucht. Ich will mit dem beruhigenden Gedanken den letzten Schritt ins dunkle Nichts gehen, daß Ihr barmherzig sein werdet.
Winnifred ist neunzehn Jahre alt. Sie hat mir versprechen müssen, gleich nach meinem Tod nach Deutschland zu reisen, unter dem Schutz eines Freundes meines Mannes, des Kapitäns Karst, der sie auf seinem Dampfer mitnehmen will. Sie wird Euch herzlich dankbar sein für alles, was Ihr für sie tun werdet. Ich bitte Euch, laßt sie einige Zeit wenigstens in Berndorf bleiben, bis sich ein anderes sicheres Unterkommen für sie findet. Seid gütig und großherzig. Des Himmels reichster Segen wird es Euch lohnen.
Dieser Brief soll erst nach meinem Tod an Euch abgehen, er soll Euch melden, daß ich nicht mehr am Leben bin. Winnifred wird also bald nach diesem Schreiben bei Euch eintreffen. Zürnt ihr nicht, falls sie Euch ungelegen kommt. Ich habe ihr die Überzeugung beigebracht, daß Ihr sie gern aufnehmen werdet auf einige Zeit. Sonst hätte sie sich nicht zu Euch gewagt. Erbarmt Euch – ich will mit dem Glauben an Eure Güte und mit dem heißen Wunsch, daß sie Euch gesegnet wird, die Augen schließen.
Lebt wohl, Gott mit Euch auf allen Wegen.
Eure Kusine
Maria Hartau, geb. Freiin Berndorf.«
Lutz sah sinnend vor sich hin, als er den Brief zu Ende gelesen hatte. Armes Ding! – Sie wird in Berndorf nicht auf Rosen gebettet sein, dachte er. Er sah auf die Uhr. Eine Stunde hatte er noch Zeit, ehe er ins Laboratorium ging. Schnell beendete er sein Frühstück, um den Brief seiner Mutter zu beantworten.
Diese Antwort lautete:
»Liebe Mutter!
Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief. Beiliegend erhältst Du auch das Schreiben von Maria Hartau zurück. Es freut mich, daß Du Dich entschlossen hast, Winnifred Hartau bei Dir aufzunehmen.
Ob sie uns erwünscht kommt oder nicht, ist zweitrangig. Sie ist eine Hilflose und uns verwandt, also besteht für mich kein Zweifel, daß wir ihr eine Heimat bieten müssen. Was dann weiter mit ihr geschehen soll, werden wir sehen. Man muß sie erst kennenlernen.
Bitte teile mir nur mit, wann sie eingetroffen ist und welchen Eindruck sie macht. Vielleicht freut sich Käthe auf eine junge Gefährtin. Und wenn sie bescheidene Ansprüche hat, die wir erfüllen können, dann läßt es sich wohl einrichten, daß sie für immer bleibt. Sie kann Dir ja ein wenig zur Hand sein.
Doch das können wir noch besprechen. Ostern komme ich auf vierzehn Tage heim. So lange wird das Laboratorium geschlossen. Dann können wir auch über andere Dinge reden.
Momentan stecke ich in wichtigen Arbeiten, von denen ich Dir berichten will, wenn ich heimkomme. Es wird Dich interessieren. Deshalb habe ich jetzt keine Zeit, ausführlich zu schreiben. Grüße Käthe herzlich und auch Onkel Rudolf. Laßt Euch durch seine Grillen nicht so sehr gegen ihn einnehmen. Er ist doch ein guter, edler Mensch, mit dem ich mich viel besser stehen würde, wenn er mir von Dir nicht immer als Erbonkel vorgehalten würde. Das reizt mich geradezu, ihm schroff gegenüberzustehen, damit ich nicht in den Verdacht der Erbschleicherei komme, dazu habe ich kein Talent.
Mit herzlichen Grüßen
Dein treuer Sohn Lutz.«
Als er mit diesem Brief fertig war, begab er sich ins Laboratorium.
II
Lutz von Berndorf hatte unterwegs den Brief an seine Mutter zur Post gegeben.
Mit Eifer machte er sich dann an seine Arbeit. Wie immer war er ganz bei der Sache. Er blieb auch über die Mittagszeit im Laboratorium, weil er in dieser Pause an einer Erfindung arbeitete, die er gemacht hatte und die sein Geheimnis war. Durch den Diener ließ er sich das Essen holen, damit er nicht fortzugehen brauchte, nahm schnell seine Mahlzeit ein und begab sich wieder an seine Arbeit.
Er war in diese so vertieft, daß er sich überrascht aufrichtete, als der Diener zu ihm trat und sagte:
»Herr Doktor, ich sollte Sie daran erinnern, daß Sie heute pünktlich Schluß machen müssen, weil Sie bei Exzellenz Blümer eingeladen sind.«
Lutz sah dem anderen einen Moment geistesabwesend ins Gesicht. Dann richtete er sich auf und lachte: »Ach so, Leimert! Richtig! Ich danke Ihnen, helfen Sie mir, die Gläser in Ordnung zu bringen. Wie spät ist es denn?«
Er sah auf die Uhr und nickte. »Ich komme noch zurecht.«
Schnell ordnete er alles Nötige auf seinem Arbeitsplatz, und wenige Minuten später schritt er seiner in der Nähe gelegenen Wohnung zu. Diese bestand aus zwei behaglich eingerichteten Zimmern, die ihm die Witwe eines Rechnungsrats vermietet hatte. Das Dienstmädchen öffnete ihm mit freundlichem Gesicht die Wohnungstür. »Ich habe schon alles zurechtgelegt, Herr Doktor«, sagte es.
Er nickte ihr lächelnd zu. »Sie sind wirklich eine Perle, Berta. Bitte, sagen Sie Frau Rat, ich hätte gern noch eine Tasse Tee und einige belegte Butterbrote, ehe ich gehe.«
Berta ging, um den Auftrag auszurichten, und Lutz betrat seine Zimmer.
Schnell machte er Toilette. Der Ankleidespiegel warf seine schlanke, vornehme Erscheinung zurück. Auf der sehnigen, kraftvollen Gestalt saß ein Kopf, den man nicht leicht übersehen konnte. Das gebräunte Gesicht hatte markante, ausdrucksvolle Züge. Um den schmallippigen Mund lag ein Zug, der Energie und Entschlossenheit verriet, und die tiefliegenden Augen, über denen sich die schöne gedankenvolle Stirn wölbte, sahen voll Klugheit und Wärme ins Leben.
Meist war er ernst und nachdenklich gestimmt. Er hatte nicht die sonnige Heiterkeit, die über Menschen liegt, denen eine glückliche, sorglose Jugend beschert wurde. Die Verschiedenheit seiner Eltern, ihr wenig harmonisches Verhältnis zueinander, hatte Schatten auf seine Entwicklung geworfen und ihn ernst und reif über seine Jahre gemacht. Aber wenn zuweilen sein Gesicht von einem Lächeln erhellt wurde, bekam es etwas Unwiderstehliches. Und dann hingen der Frauen Augen sehnsüchtig an ihm.
Er war aber Damen gegenüber sehr zurückhaltend. So, wie sein Vater verheiratet gewesen war, mochte er es um keinen Preis sein. Das stand fest bei ihm. Und deshalb wollte er vorsichtig sein bei der Wahl einer Lebensgefährtin. Ob sie reich oder arm war, war ihm nicht wichtig; ihm war die Hauptsache, daß eine Frau sein Wesen harmonisch ergänzte. Jedenfalls teilte er durchaus nicht den Wunsch seiner Mutter, auf jeden Fall eine reiche Frau heimzuführen.
Als er seinen Anzug beendet hatte, trat er in sein Wohnzimmer. Dort hatte die Perle Berta schon den Tisch sauber gedeckt, und Frau Rat brachte ihm eigenhändig den gewünschten Imbiß. Sie bemutterte den jungen Herrn, der schon seit einigen Jahren bei ihr wohnte, gern ein wenig.
»Sie bemühen sich selbst, Frau Rat«, sagte Lutz mit der Liebenswürdigkeit, die der Ausdruck seines innersten Wesens war.
Die alte Dame nickte lächelnd. »Ich will bei dieser Gelegenheit meine alten Augen ein wenig an Ihnen erfreuen, Herr Doktor. Die jungen Damen werden wieder ihr Herz festhalten müssen, wenn sie Ihnen gegenüberstehen.«
Lutz lachte. »Wollen Sie mich eitel machen, Frau Rat?«
»Ach, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der weniger Anlage zur Eitelkeit hat als Sie. Wie stolz muß Ihre Frau Mutter auf Sie sein«, sagte die alte Dame, seine Tasse mit Tee füllend.
Er schüttelte den Kopf. »Sie irren, meine Mutter ist gar nicht stolz auf mich. Jedenfalls ist sie oft herzlich unzufrieden mit mir.«
»Aber sicher nicht im Ernst, das glaube ich Ihnen nicht, obwohl ich Sie als einen sehr wahrhaften Menschen kenne. Aber nun will ich Sie nicht länger stören, guten Appetit, Herr Doktor.«
Die alte Dame ging hinaus, und Lutz verzehrte nun mit gutem Appetit den verlockend servierten Imbiß.
Dann warf er seinen Mantel um, nahm Handschuhe und Zylinder und verließ seine Wohnung. Unten rief er ein Auto an und traf einige Minuten später in der Villa von Exzellenz Blümer, eines Freundes seines Vaters, ein.
Hier herrschte schon ein lebhaftes, festliches Treiben. Exzellenz Blümer führte ein großes Haus, wozu ihn seine Stellung berechtigte und verpflichtete. Seine Gattin, eine feinsinnige, geistreiche Frau, und seine Tochter, eine bildhübsche junge Dame, die seit kurzer Zeit mit einem jungen Offizier, einem Freund von Lutz, verlobt war, begrüßten ihn bei seinem Eintritt herzlich.
Auch Exzellenz Blümer trat hinzu. »Willkommen, lieber Herr von Berndorf – oder muß ich Herr Doktor zu Ihnen sagen? Am liebsten sagte ich wie früher, wenn ich in Berndorf zu Gast war, lieber Lutz zu Ihnen.«
»Darum möchte ich bitten, Exzellenz, es wird mir immer eine Auszeichnung sein.«
»Na schön, lieber Lutz, bleiben wir dabei.«
»Sie haben sich in letzter Zeit sehr rar gemacht, Herr Doktor«, schalt Ihre Exzellenz liebenswürdig.
»Ich hatte viel Arbeit und konnte mich nicht freimachen, so gern ich auch gekommen wäre.«
»Immer fleißig! Das ist recht, aber die Jugend will auch ihr Recht haben. Und heute abend sollen Sie sich amüsieren«, erwiderte der Hausherr.
»Zu diesem Zweck werde ich Herrn von Berndorf jetzt entführen«, sagte die Tochter des Hauses und legte ihre Hand auf den Arm des jungen Mannes. »Kommen Sie, Herr Doktor, bis mein Verlobter kommt, will ich mich Ihnen in alter Freundschaft widmen.«
Lutz verneigte sich lächelnd. »Mit großer Freude vertraue ich mich Ihrer Führung an, gnädiges Fräulein. Ist Egon noch nicht hier?«
Egon von Tressen war der Verlobte der jungen Dame.
»Nein – denken Sie, so eine Niedertracht von seinem Vorgesetzten, ausgerechnet heute abend hat er bis 8 Uhr Dienst. Aber in spätestens einer Viertelstunde wird er hier sein. So lange will ich mich Ihnen widmen.«
»Das ist außerordentlich liebenswürdig.«
Sie gingen plaudernd davon in die anstoßenden Festräume.
»Ich will Sie heute einer jungen Dame vorstellen, Herr von Berndorf, die Sie noch nicht kennen – ein neuer Stern an unserm Gesellschaftshimmel, der alle andern überstrahlt.«
»Das dürfen Sie Egon nicht hören lassen, gnädiges Fräulein. Als sein Freund muß ich protestieren. Einen Stern wird dieser neue Stern nicht überstrahlen, nämlich den, der mir jetzt so freundlich das Geleit gibt.«
»Ach, wie galant, Herr Doktor! Das haben Sie wundervoll gesagt. Aber ich fühle mich nicht getroffen. Und ganz ernsthaft, die junge Dame, der ich Sie vorstellen will, ist das schönste Mädchen, das ich kenne. Es ist die junge Baroneß Glützow, eine ehemalige Pensionsfreundin von mir, die gegenwärtig einige Monate in Berlin bleibt. Eine bekannte Dame, Frau von Sucher, die mit ihrer verstorbenen Mutter befreundet war, hat sie eingeladen, um sie in die Gesellschaft einzuführen. Sie lebt sonst in ziemlich freudlosen Verhältnissen bei ihrem grilligen alten Papa, der eines Leidens halber als Major seinen Abschied nehmen mußte. Sie hat hier nicht wenig Aufsehen erregt. Die Verehrer umschwärmen sie, obwohl es bekannt ist, daß sie keinerlei Vermögen besitzt. Das will doch viel heißen, nicht wahr?«
»Ich wage nicht zu widersprechen, gnädiges Fräulein, und gestehe, daß ich furchtbar neugierig bin auf den neuen Stern.«
»Scherzen Sie nicht so leichtsinnig, sonst ereilt Sie das Geschick, und Sie müssen dann den schönen Stern umflattern wie die Motte das Licht.«
»Ein verlockendes Gleichnis, ich werde mir hoffentlich nicht die Flügel verbrennen.«
»Seien Sie froh, wenn es nur die Flügel kostet, und geben Sie auf Ihr Herz acht.«
Sorglos lächelnd drückte Lutz die Hand aufs Herz.
»Ich werde es festhalten.«
Sie sahen sich an und lachten.
Suchend flog der Blick der jungen Dame umher. Sie betraten soeben den großen Festsaal. Hier herrschte ein lebhaftes geselliges Treiben. Diener wanden sich durch die Gruppen der Gäste, geschickt große Tabletts mit Erfrischungen herumreichend. Scherzen und Lachen tönte ihnen entgegen.
Zielsicher steuerte Fräulein von Blümer auf eine Gruppe junger Herren zu, die sich um eine junge Dame scharten, die in einem Sessel unter dem großen Spiegel saß: die Baroneß Sidonie von Glützow.
»Liebe Siddy, du gestattest, Herr Doktor von Berndorf bittet um die Ehre, dir vorgestellt zu werden«, sagte Anni von Blümer, vor ihr stehenbleibend.
Die Baronesse blickte interessiert auf. Anni von Blümer hatte ihr bereits viel von diesem ausgezeichneten jungen Mann erzählt; von seinen Charaktereigenschaften sowohl als auch von seinen Wildenauer Erbaussichten.
Und sie hatte nicht geahnt, daß Baroneß Siddy hauptsächlich von dem Umstand Notiz genommen hatte, daß Dr. von Berndorf Gutsbesitzer und Erbe eines fürstlichen Besitzes sei, denn das war für sie die Hauptsache.
Interessiert richtete sie sich deshalb aus ihrer graziös lässigen Haltung empor und sah mit großen Augen zu dem jungen Mann auf.
Und was waren das für wundervolle, rätselhafte Augen! Lutz stand wie geblendet von soviel Schönheit und Liebreiz und sah die junge Dame an wie eine Offenbarung, wie ein holdes Wunder.
Wahrhaftig, Baroneß Siddy Glützow war ein Wesen von sinnbetörender Schönheit.
Lutz war momentan fassungslos, dieser vollendeten Anmut und Lieblichkeit gegenüber. Sein Herzschlag schien auszusetzen, und er war blaß vor Erregung geworden.
»Die schöne Melusine!«
Hatte ihm das jemand zugeflüstert, oder wurde diese Bezeichnung im Moment in seinem Empfinden geboren wie eine instinktive Warnung?
Langsam ebbte sein Blut zum Herzen zurück. Er faßte sich gewaltsam, um nicht aufzufallen, und verneigte sich vor ihr wie vor einer jungen Königin. Er sprach auch einige Worte mit ihr, aber er wußte nicht, was er sagte. Sein ganzes Wesen war in einem Aufruhr, wie es ihm nie zuvor geschehen war.
Baroneß Siddy war eine sehr kluge junge Dame und sich ihrer Schönheit und ihres gefährlichen Zaubers bewußt. Sie merkte sehr wohl den Eindruck, den sie auf den jungen Mann machte. Und er gefiel ihr sehr, abgesehen davon, daß ein fürstliches Erbe verklärend hinter ihm stand. Wohlgefällig sah sie an seiner ranken, schlanken Gestalt empor, die einen so vornehmen, bedeutenden Eindruck machte.
Sie war in Berlin, um eine gute Partie zu machen – um jeden Preis. Zu diesem Zweck hatte sie sich von Frau von Sucher einladen lassen, weil sich in dem kleinen märkischen Städtchen, in dem sie mit ihrem Vater wohnte, keine Gelegenheit zu einer solchen fand. Zwar hatte sie schon einen ihrer Verehrer zur Verwirklichung ihrer Absicht in Aussicht genommen. Es war ein Herr von Solms, dessen Vater ein enormes Vermögen und den erblichen Adel durch die Güte eines von ihm gebrauten Bieres verdient hatte. Aber dieser Herr von Solms war ein gewöhnlich aussehender Mensch mit etwas albernem Wesen, der ihr widerwärtig war. Trotzdem hatte sie ihn an ihren Triumphwagen gefesselt. Er wich nicht von ihrer Seite und stand auch jetzt in seiner unvorteilhaften Plumpheit neben ihrer leuchtenden Schönheit.
In dem Moment, wo Lutz von Berndorf vor ihr auftauchte, sanken sofort die Chancen des Herrn von Solms. Trotzdem war die Baronesse aber nicht gesonnen, ihn ganz fallenzulassen.
Sie überlegte, daß es auf alle Fälle ratsam sei, zwei Eisen im Feuer zu haben. Und während sie das überlegte, plauderte sie mit ihrem weichen hellen Stimmchen so lieb und reizend mit Lutz, daß er vollends rettungslos dem Bann ihrer bezaubernden Persönlichkeit verfiel.
Mit einer ihm sonst fremden, fast schlaffen Ergebung fühlte er, daß er seinem Schicksal heute abend begegnet sei, einem Schicksal, das er hinnehmen mußte. Aus dem Bann dieser perlmutterartig schimmernden Nixenaugen konnte er sich nie mehr lösen, so lange sie ihn festhalten wollten.
Wo blieb jetzt sein Wille, vorsichtig zu sein? Er hatte alles über ihrem Anblick vergessen, den ganzen Abend wich er nicht von ihrer Seite, und auch Herr von Solms folgte dem schönen Mädchen wie ein Schatten.
Dessen Anwesenheit verdroß Lutz, er erschien ihm wie eine Dissonanz neben der Baronesse. Und ärgerlich wandte er sich einige Male zur Flucht, nur um diesen Menschen nicht mehr neben ihr sehen zu müssen. Aber wie magnetisch angezogen kehrte er immer wieder zu der Baronesse zurück und wurde dann mit einem Blick und einem Lächeln belohnt, das ihm ein ganz unsinniges Glücksempfinden einflößte.
Wie dieser Abend verging, was er getan und gesagt hatte, das wußte er später nicht mehr. Es war wie ein Rausch, der ihn gefaßt hatte. Und er kam erst wieder zur Besinnung, als er nicht mehr im Bereich von Siddys Augen weilte. In der Nacht, als er endlich Schlaf gefunden hatte, träumte er von Nixen und rätselhaften Zauberwesen. Und als er am Morgen erwachte, fühlte er nur eins – eine brennende Sehnsucht nach dem Anblick des schönen Mädchens. Jetzt versäumte er keine gesellige Gelegenheit, um sie so oft wie möglich wiederzusehen. Und es ergab sich, daß er fast täglich mit ihr zusammentraf.
Dabei wurde er blaß und nervös, er, der sonst Nerven von Stahl zu haben schien. Seine Arbeit fesselte ihn nicht mehr. Er mußte sich Gewalt antun, um bei ihr auszuharren. Immer war es wie ein rastloses Fieber in seiner Brust, das erst wich, wenn er die Geliebte wiedersah, wenn sie ihn bezaubernd und verheißungsvoll anlächelte und mit ihm sprach.
Aber seltsam war es, daß er jedesmal, wenn er ihr gegenübertrat, zuerst das sonderbare Empfinden hatte, als wehe ihm etwas Feuchtes, Kühles entgegen. Vielleicht lag das an dem nixenhaften Eindruck, den sie machte und den sie immer noch unterstrich durch die von ihr so bevorzugten grünlich schimmernden Schleiergewänder, die freilich ihrer Schönheit den rechten Rahmen gaben. Eines Tages hörte Lutz, wie ein Herr aus der Gesellschaft die Baroneß Glützow »die schöne Melusine« nannte.
Er stutzte, es fiel ihm ein, daß er selbst sie bei sich so genannt hatte, als er ihr im ersten Augenblick gegenüberstand. Aber dann lächelte er. War es nicht natürlich, daß man sie mit einem schönen Zauberwesen verglich? Selbstverständlich sah er in ihr das Ideal seiner Träume und stattete sie in seinem Herzen mit allen Vorzügen und Tugenden aus, die ihm an einer Frau liebenswert erschienen.
Baroneß Siddy war klug und hatte die Absicht, Lutz von Berndorf für alle Zeit zu fesseln. Deshalb gab sie sich Mühe, ihm zu gefallen. Sie verstand sich so zu geben, wie er sie haben wollte, und spielte ihm allerliebste kleine Komödien vor.
Sicher war, daß ihr Lutz mit seiner vornehmen Erscheinung, mit seiner imponierenden Männlichkeit besser gefiel als je vorher ein Mann. Es löste ein gewisses eitles Behagen in ihr aus, daß sie auch diesen Mann zur Strecke gebracht hatte. Und es war bei ihrer Veranlagung viel, daß sie ihm den Vorzug gab vor Herrn von Solms. Denn dieser war bereits im sicheren Besitz eines nach Millionen zählenden Vermögens, während, wie sie glaubte, Lutz zwar sehr wohlhabend war, aber ein fürstliches Vermögen erst nach dem Tod seines Onkels erwarten konnte. Zur Beruhigung hatte sie aber in Erfahrung gebracht, daß dieser Onkel herzleidend war und sicher kein langes Leben haben würde.
»Er steht mir gut zu Gesicht, Herr von Solms kleidet mich nicht«, hatte die Baronesse eines Tages zu Frau von Sucher gesagt, als sie mit dieser über ihre Verehrer sprach. Und das brachte sie so drollig heraus, daß Frau von Sucher lachen mußte, obwohl sie es nicht gern sah, daß ihre Schutzbefohlene nach beiden Seiten kokettierte.
»So machen Sie doch ein Ende, Siddy, und entscheiden Sie sich für Dr. von Berndorf«, sagte sie.
Siddy zuckte die Achseln und streichelte dann schmeichelnd die Hände der alten Dame.
»Nur noch ein Weilchen Geduld, liebste Vizemama. Die Sache ist noch nicht spruchreif, sie soll es erst werden.«
»Aber Sie können doch wenigstens Herrn von Solms klarmachen, daß er nichts zu hoffen hat.«
Die Baronesse tippte lächelnd die Fingerspitzen gegeneinander. »Und wenn dann Herr von Berndorf doch nicht ernst macht mit seiner Werbung? Nein, so unklug werde ich nicht sein. Erst wenn ich mich mit Dr. von Berndorf verlobt habe, ist es Zeit, Herrn von Solms aufzugeben. Sie kennen doch das Gleichnis von dem Sperling in der Hand und der Taube auf dem Dach.«
Mit einem seltsamen Blick sah Frau von Sucher ihre Pflegebefohlene an. »Sie sind unheimlich klug, liebe Siddy, zu klug für Ihre Jugend.«
Es lag ein leiser Tadel in diesen Worten, den Siddy indessen ignorierte.
Inzwischen hatte sich die Baronesse bei Anni von Blümer gründlich über Lutz von Berndorfs Verhältnisse erkundigt.
Anni gab ihr auch bereitwillig Auskunft, soweit sie selbst unterrichtet war. »Warum bewirtschaftet aber Herr von Berndorf sein Gut nicht selbst, weshalb hat er studiert?« fragte Siddy eines Tages.
»Weil er eben mehr Lust zum Studium hatte. Seine Mutter ist übrigens eine hervorragend tüchtige Landwirtin, die Berndorf gut verwaltet. Soviel ich gehört habe, will sich Herr von Berndorf später selbst ein chemisches Laboratorium auf seinem Grund und Boden bauen und dann nur die Oberleitung seiner Besitzungen in die Hand nehmen.«
»Oh – du meinst, wenn sein Onkel gestorben ist?«
»Dann oder früher, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist er ein kluger, bedeutender Mensch, sonst hätte ihn Professor Hendrichs nicht zu seinem ersten Assistenten gemacht. Mein Vater glaubt, daß Dr. von Berndorf eines Tages eine Kapazität in seinem Beruf sein wird. Er soll auch eine Erfindung gemacht haben.«
Das letztere interessierte Siddy weniger. Ihr war die Hauptsache, daß sie über die Vermögensverhältnisse des jungen Mannes orientiert war. Sie war nun sicher, daß Lutz von Berndorf die gewünschte glänzende Partie war, und ließ all ihre Minen springen, um ihn zu einer Werbung zu veranlassen. Lutz war sehr bald zu der Überzeugung gelangt, daß er sein Lebensglück nur in einer Verbindung mit Baroneß Siddy finden würde. Er glaubte, sie schon so gut zu kennen, daß er ohne weiteres um sie angehalten hätte. Und er tat es nur noch nicht, weil er meinte, er dürfte sie nicht mit seiner stürmischen Leidenschaft überrumpeln, sondern müsse ihr Zeit geben, ihn kennenzulernen, Vertrauen zu ihm zu fassen und sich klar zu werden, ob sie ihm angehören wolle. Außerdem hielt er es für seine Pflicht, seine Mutter von seinem Vorhaben, sich mit Baroneß Glützow zu verloben, zu unterrichten.
Daß Baroneß Siddy auf seine Werbung mit einem Nein antworten würde, befürchtete er nicht. Ohne arrogant zu sein, mußte er sich eingestehen, daß ihm ihr ganzes Wesen deutlich verriet, daß er auf sie einen ähnlichen Eindruck gemacht hatte wie sie auf ihn. Das sagten ihm ihre Augen, ihr Lächeln, der weiche, zärtliche Ton ihrer Stimme – ihr ganzes Wesen. Daß dies alles nur ein wohlberechnetes Spiel war, ahnte er nicht. So beschloß er also, Ostern, wenn er daheim seinen Urlaub verbrachte, mit seiner Mutter zu sprechen und, sobald sich diese etwas beruhigt hatte, nach Berlin zurückzukehren, um Siddys Hand anzuhalten und sie dann seiner Mutter vorzustellen.
III
Der große Luxusdampfer »Urania« befand sich auf der Reise zwischen New York und Hamburg auf offener See. Er war seinem Bestimmungsort Hamburg schon bedeutend näher als seinem Auslaufhafen.
Das Wetter war ruhig und klar, kaum ein Lüftchen regte sich, und das Meer spielte nur in ganz leichten Wellen. Und wenn um die Mittagszeit die Märzsonne intensiv auf das Deck des Dampfers brannte, war es warm wie im Sommer, und die Passagiere promenierten ohne Überkleider auf der breiten Deckpromenade. Sogar die empfindlichsten alten Herrschaften hielten nach Tisch ihre Siesta in einem windgeschützten Eckchen auf Deck. Der Tee wurde von den meisten nachmittags noch im Freien genommen. Es war um die fünfte Stunde des Nachmittags, der Tee wurde soeben serviert. Plaudernde Gruppen saßen zusammen, und die Schiffsmusik konzertierte.
Etwas abseits von dem buntbewegten Treiben stand an der Reling eine schlanke junge Dame in schlichter Trauerkleidung. Sie stützte den Kopf in die Hand und sah mit großen traurigen Augen über das Meer.
Niemand bekümmerte sich um die Einsame, deren bescheidenes Äußeres auffallend gegen den Toilettenluxus der anderen weiblichen Passagiere der ersten Klasse abstach. Einige Herren hatten versucht, im Verlauf der Reise sich der jungen Dame zu nähern, weil ihre schlanke Gestalt auch in den schlichten Trauerkleidern attraktiv wirkte. Aber wenn sie das blasse Antlitz hob und seltsam scheu und ängstlich mit traurigen Augen emporblickte, dann verging ihnen die Lust, sich weiter mit ihr zu beschäftigen.
Man wußte, daß die junge Dame unter dem Schutz des Kapitäns Karst, der die »Urania« führte, reiste. Sie nahm mit ihm die Mahlzeiten ein, und er bemühte sich sichtlich, sie aufzuheitern und zu ermuntern. Und dann huschte zuweilen ein schattenhaftes Lächeln über ihr Antlitz.
Auf ihren Wunsch machte sie aber der Kapitän mit niemand bekannt, und wenn sich jemand besonders neugierig bei dem Kapitän nach der jungen Dame erkundigte, so sagte er nur:
»Sie ist eine Waise, die kürzlich ihre Mutter verloren hat und nun zu Verwandten nach Deutschland reist.«
Als die junge Dame etwa eine halbe Stunde bewegungslos an der Reling gestanden hatte, trat Kapitän Karst zu ihr heran und legte sanft die Hand auf ihren Arm.
»Wieder in traurige Gedanken versunken, liebe Winnifred? Kommen Sie, wir wollen jetzt gemeinsam den Tee einnehmen und ein wenig plaudern. Ich habe jetzt ein halbes Stündchen Zeit für Sie.«
Winnifred Hartau sah zu dem blonden Hünen auf. Ihre tiefblauen Augen leuchteten klar und rein wie ein Bergsee, und um den feingeschnittenen Mund zuckte ein dankbares Lächeln.
»Sie sind so gütig, Herr Kapitän. – Ich freue mich darüber.«
Er nahm ihren Arm und führte sie fort. »Dort drüben habe ich ein Tischchen für uns in die Sonne rücken lassen. Ich möchte doch gern, daß Sie auf der Überfahrt frischere Farben bekommen.«
»Oh, ich fühle mich sehr wohl, Herr Kapitän, ich bin ja jung und gesund. Nur – Sie wissen ja – ich kann es noch nicht verwinden, daß ich sobald nach dem Vater auch die geliebte Mutter hergeben mußte.«
Er schob ihr einen Sessel zu, und nachdem sie sich niedergelassen hatte, nahm auch er Platz.
»Ja, ja, Kind, das Schicksal ist hart mit Ihnen umgesprungen. Aber der liebe Gott wird schon wissen, warum. Sie wissen doch, was Ihre liebe Mutter kurz vor ihrem Ende gesagt hat: Nicht verzagen, meine Winnifred, mein Segen ist bei dir auf allen Wegen.«
Winnifred nickte mit feuchten Augen. »Ich will auch nicht verzagen, lieber Herr Kapitän.«
»Das ist schön. So – und nun langen Sie tapfer zu.«
Es wurde ihnen Tee und der dazugehörige delikate Imbiß, der auf den eleganten Dampfern als Zwischenmahlzeit eingenommen wird, serviert.
Winnifred mußte tüchtig zugreifen, dafür sorgte der Kapitän. Sie tat es in ihrer schüchternen, etwas unsicheren Art. Kapitän Karst hatte ihr die Überfahrt auf diesem Luxusdampfer dadurch ermöglicht, daß er sie als seinen Gast betrachtete.
Er war in New York so oft bei Winnifreds Eltern eingeladen gewesen, daß es ihm Freude machte, sich gewissermaßen revanchieren zu können. Der Kapitän war der einzige Mensch, der Winnifreds Eltern in all den Jahren freundschaftlich nahegestanden hatte. Als diese vor zwanzig Jahren nach Amerika gingen, waren sie auf dem Dampfer mit Kapitän Karst zusammengetroffen. Er war ein Jugendfreund von Winnifreds Vater und damals noch nicht zum Kapitän avanciert. Das junge Paar, das sein Glück schwer hatte erkaufen müssen und sich in Amerika eine bescheidene Existenz gründen wollte, hatte Karst viel nützliche Winke in bezug auf die neue Heimat zu danken. Da er immer Fühlung mit ihnen behalten, hatte er Winnifred sozusagen aufwachsen sehen, und die Freundschaft für ihren Vater, die Verehrung, die er ihrer Mutter zollte, hatten sich als warme Teilnahme auf die Tochter übertragen.
Gern hatte er Frau Maria Hartau vor ihrem Tod versprochen, Winnifred auf seinem Dampfer mit nach Deutschland zu nehmen und sie im Auge zu behalten, bis sie bei ihren Verwandten die erhoffte Aufnahme fände.
Er sah nun lächelnd zu, wie Winnifred sich die guten Sachen schmecken ließ.
»So, das ist richtig, tüchtig essen und trinken hält Leib und Seele zusammen. Und nicht mehr verzagt sein, Winnifred«, sagte er.
Sie lächelte zu ihm auf. »Was ich an meinen Eltern verloren habe, wissen Sie besser, als ich es Ihnen sagen kann.«
Er nickte. »Das weiß ich. Ihre Eltern waren zwei selten gute, feinfühlige Menschen. Nur für den Lebenskampf eigneten sie sich nicht – und vollends nicht für Amerika. Drüben muß man großes Geschrei von sich machen und rücksichtslos seine Ellenbogen gebrauchen, wenn man sich durchsetzen will. Das konnte Ihr Vater nicht, Winnifred. Was meinen Sie, welchen Erfolg er gehabt hätte mit seinen Bildern, wenn er die Reklametrommel kräftig gerührt hätte.«
»Das hätte Vater nie getan!«
»Leider nicht. Er hat seine schönsten Bilder um einen Spottpreis an einen Kunsthändler verkauft, der ein Heidengeld dafür bekommen hat. Während Ihre Eltern kaum genug zum Leben hatten, ist der Kunsthändler an Ihrem Vater ein reicher Mann geworden.«
Winnifred strich sich mit einer hilflosen Gebärde einige widerspenstige Löckchen aus der Stirn.
»Ich konnte Vater so gut verstehen, wie es Mutter auch tat. Seine Kunst war ihm zu heilig, als daß er sie durch Reklame hätte entweihen können. Es hat ja auch immer für uns gereicht, was Vater verdiente. Daß er so früh sterben würde, konnten wir nicht ahnen, er war gesund und kräftig, bis ihn das böse Fieber ergriff. Und wir hofften immer noch, daß Vater auch ohne Reklamerummel die ihm gebührende Anerkennung finden würde.«
»Oh – ihr weltfremden Menschen! Das wäre ja nicht einmal in unserm lieben Vaterland möglich gewesen, viel weniger drüben im Land der Bombenreklame. Wie oft habe ich Ihren Vater vergebens aufgestachelt, von sich reden zu machen. Er ließ es sich ruhig gefallen, daß der Kunsthändler seinen Kunden erklärte, der Maler Hartau sei in Deutschland eine Berühmtheit, und es sei ihm nur möglich, dessen Bilder zu einem hohen Preis zu beziehen. Statt dessen saß der Maler Hartau einige Straßen entfernt von der Kunsthandlung in seinem kleinen kahlen Atelier und erhielt eine Bagatelle für seine Bilder. Als ich diesem Schwindel eines Tages zufällig auf die Spur kam, habe ich meinem alten Freund Hartau zugeredet wie einem kranken Kind, das Medizin nehmen soll, er möge dem Kunsthändler auf die Bude rücken und die Geschichte an die Öffentlichkeit bringen, was ihm schnell zu seinem Recht verhelfen würde. Aber er war nicht dazu zu bewegen. Wissen Sie, was er mir geantwortet hat, Winnifred?«
Sie lächelte über seinen Eifer. »Nein, ich weiß es nicht.«
»Nun, so will ich es Ihnen sagen. Er hat mir geantwortet: Der Kunsthändler war der einzige Mensch, der mir meine Bilder abkaufte und es mir dadurch ermöglichte, für meine Familie zu sorgen. Ohne ihn wären wir dem Elend preisgegeben gewesen. Soll ich nun so undankbar sein, ihm Schwierigkeiten zu machen, weil er ein besserer Geschäftsmann ist als ich? Nein, lieber Freund, das kannst du nicht von mir verlangen. Ich unternehme nichts gegen den Mann. – Sehen Sie, Winnifred, das war die Absicht Ihres Vaters, und weiß Gott, man mußte ihm dafür noch gut sein, wenn man in seine guten, ehrlichen Augen hineinsah.«
Winnifreds Augen leuchteten. »Ja, Vater war ein seltener Mensch. Aber Mutter teilte seine Ansicht. Die Eltern behaupteten immer, Vater bekäme seine Bilder noch besser bezahlt als in Deutschland.«