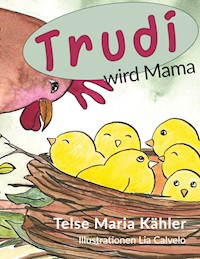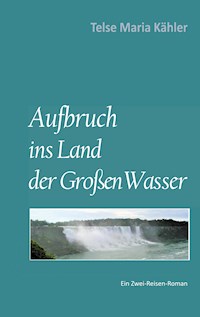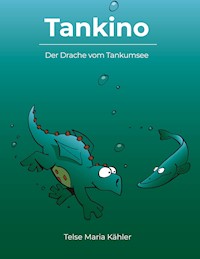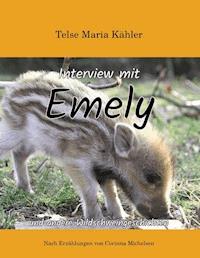Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schreiben kann ein ganzes Leben verändern. Es kann glücklichere Menschen aus uns machen. Das ist die Botschaft des Buches von Telse Maria Kähler. Eine Auswahl der schönsten Kurzgeschichten, eingebunden in eine zauberhafte Rahmenhandlung, beschreibt, wie die Protagonistin zum Schreiben kam, und warum sie nicht mehr davon lassen konnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Suche nach dem Taggeheimnis
Einmal mit den Sternen tanzen
Kein Zurück
Körpergeschichten
Ankommen
Gesichter
Eingefroren
Eigentlich
Du warst so jung
Nichts geht mehr
Tinas Kochbuch
Eine Stunde Nichtstun
Mathilda und Emie
Grenzkontrolle
Es ist ein Lied in allen Dingen
Gedankenecho
Falsche Gedanken
Sichtweisen
Was will ich?
Tränen traten mir in die Augen. Mein Herz klopfte, doch innerlich lachte ich vor lauter Freude. War ich es, die diese Zeilen da eben geschrieben hatte? Hatte wirklich ich dieses nette, kleine Kindermärchen verfasst? Langsam und staunend las ich die Zeilen noch einmal durch.
Es war ein wunderschöner Oktobertag. Ich saß am Schreibtisch meines Büros in der Einliegerwohnung unseres Vorstadtreihenhauses. Die Sonne schien durch das Fenster. Rund um mich herum lagen Stapel mit Rechnungen, Bankbelegen, Briefen und Ordnern, denn ich arbeitete freiberuflich als Buchführungshelferin.
Ich las meine handschriftlichen Aufzeichnungen behutsam ein weiteres Mal durch und staunte wiederum über mich selbst:
DIE SUCHE NACH DEM TAGGEHEIMNIS
Jakob blickte in den Himmel. Ihm war langweilig. Er war traurig – und eigentlich wollte er gar nicht auf dieser Welt sein. Alles schien ihm so sinnlos – so farblos – so eintönig – und hatte ihn überhaupt jemand richtig lieb? Trübsinnig starrte er Löcher in die Luft.
„Hast du heute schon dein Taggeheimnis entdeckt?“, flüsterte etwas. Jakob war sich nicht sicher, ob er eine zarte Stimme oder nur seine eigenen Gedanken gehört hatte, die ihm diese Worte ins Ohr säuselten. Was Jakob dachte, war manchmal derart laut, dass er glaubte, nicht nur er selber, sondern jede Person im Raum könnte es hören.
„Das Taggeheimnis, was ist das?“, fragte er in Gedanken zurück.
„Du kennst das Taggeheimnis nicht? Jeder Tag hat ein Geheimnis, und dieses Geheimnis möchte von dir entdeckt werden. Hast du heute dein Taggeheimnis schon entdeckt?“, flirrte es.
„Taggeheimnis?“ Natürlich hatte Jakob sich nicht mit einem Taggeheimnis beschäftigt. Erstens wusste er überhaupt nicht, dass es so etwas gab, und zweitens hatte er hier im Bett gelegen und Trübsal geblasen. „Taggeheimnis, so ein Quatsch!“
„Warum Quatsch? Kennst du dein Taggeheimnis, oder kennst du es nicht?“ Diese innere Stimme war wirklich nervend.
„Nein, ich kenne es nicht!“, rief Jakob erbost. Er war sichtlich erschrocken, als er seine eigene Stimme laut hörte. Dann brummte er: „Taggeheimnis, Taggeheimnis, was soll das sein?“
„Jeder Tag hat ein Geheimnis. Wenn du jeden Tag dein Taggeheimnis suchst, es findest und es zu lösen versuchst, wirst du wissen, warum du lebst, wer dich lieb hat und wen du lieb hast und wie die Dinge sind“, lautete die Antwort, kaum dass er die Frage gestellt hatte.
Jakob stutzte. Hatte er sich nicht gerade gefragt, ob ihn überhaupt jemand lieb hatte? Wie konnte so ein Taggeheimnis ihm verraten, wer ihn liebte? Taggeheimnis, was sollte das überhaupt sein? Und wenn es so etwas gab, wie sollte man es entdecken?
„Das ist ganz leicht …“ Das hörte sich gut an. „Du musst einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen, versuchen, einmal hinter die Dinge zu schauen, und neugierig sein, dann wirst du heute Abend sagen können, was dein Taggeheimnis für heute ist.“
Jakob fragte sich, ob er wohl zu viel allein war und ob er jetzt wohl anfing zu phantasieren. Doch da spürte er die nasse Schnauze seines Hundes Gina an seiner Hand. Gina sah ihn erwartungsvoll mit ihren treuen braunen Augen an, als wollte sie sagen: „Worauf wartest du noch? Nun komm schon!“
Natürlich wollte Gina nur mit ihm Gassi gehen. Aber – konnte man einer so liebevollen Aufforderung widerstehen? Also sprang Jakob auf. Vielleicht könnte man bei dieser Gelegenheit ja einmal testen, was es mit der Suche nach dem Taggeheimnis auf sich hatte.
Zwar etwas neugierig, aber immer noch ziemlich gelangweilt machte sich Jakob also auf die Suche nach dem Taggeheimnis. Zusammen mit seinem Hund ging er in den Park. Er war diesen Weg schon oft gegangen. Nichts schien anders zu sein als sonst. Die Sonnenstrahlen fielen durch die Baumwipfel. Die Blätter hatten eine herbstliche Färbung, und in der Sonne leuchteten sie strahlend bunt. Schön sah es aus, und doch, es war nichts Besonderes. Schließlich war Herbst, und im Herbst sah es immer so aus. Kein Mensch begegnete den beiden. An den anderen Tagen waren immer Leute mit ihren Hunden unterwegs. Auch das Eichhörnchen, das Jakob sonst manchmal beobachtete, ließ sich heute nicht blicken. Nichts – gar nichts.
Enttäuscht blieb Jakob stehen. Wo war es denn nun, das Taggeheimnis, und wo sollte er eigentlich suchen? Intuitiv schloss er die Augen in der Hoffnung, diese Gedankensäuselstimme würde sich wieder melden.
Ein Gurgeln klang an sein Ohr. Jakob versuchte genauer hinzuhören. Aus dem Gurgeln wurde ein Plätschern. Jakob hörte noch genauer hin. Das Plätschern hörte sich fröhlich an. Nun öffnete Jakob die Augen und schaute sich um.
Ganz in seiner Nähe floss ein Bach. Langsam ging Jakob auf ihn zu. Wie oft hatte er schon am Rand dieses Baches gesessen? Manchmal war er mit nassen Füßen nach Hause gekommen, weil er feststellen wollte, wie tief der Bach war, und manchmal hatte er auch Steinchen in den Bach geworfen. Doch das war früher und schon lange her.
Jakob blieb stehen und blinzelte. Lichtstrahlen fielen auf das Wasser. Sie lenkten seinen Blick zu einem kleinen Wehr. Offensichtlich hatten Kinder versucht, mit Ästen und Steinen einen Staudamm zu bauen. Durch diese Konstruktion wurde das Wasser zuerst gestaut, doch an einigen Stellen lief es über den Damm hinweg und plätscherte lustig über die darunter aufgeschichteten Steine. Es sah fast aus wie ein kleiner Wasserfall. Das Plätschern klang so fröhlich, als würde das Wasser vor Vergnügen lachen. Vor dem kleinen Staudamm sah das Wasser ganz trübe aus. Unter dem kleinen Wasserfall aber war es klar. Man konnte bis auf den Grund schauen. Winzige Wassertropfen aus dem Wasserfall spritzten und hüpften munter in der Sonne. Es sah aus, als würden die Sonnenstrahlen mit dem glucksenden Wasser spielen.
Vom Zusehen und Zuhören wurde Jakob richtig vergnügt. Seine traurige Stimmung war verschwunden, und er fühlte sich fröhlich und aufgeregt. Fast war ihm nach Lachen zumute. Plötzlich fragte er sich, ob Wasser wohl auch lachen konnte.
Jakob wusste, dass Wasser ein Gedächtnis hatte. Auch viele andere Dinge wusste er über das Wasser, aber konnte Wasser auch Spaß haben?
Den ganzen Tag über beschäftigte sich Jakob mit dieser Frage. Er las noch einmal in einem Buch nach, was es mit dem Gedächtnis des Wassers auf sich hatte, und wusste auch bald, warum das trübe Wasser; nachdem es unten an dem kleinen Wasserfall angekommen war, wieder klar war. Doch ob es Spaß haben konnte, dieses Geheimnis konnte er nicht lüften.
Als Jakob abends in seinem Bett lag und über den Tag nachdachte, wurde ihm bewusst, wie viel Freude ihm die Suche nach dem Taggeheimnis bereitet hatte.
Zu entdecken, dass es ein Geheimnis gab, und zu versuchen, dieses Geheimnis zu entschleiern, war sehr spannend und aufregend gewesen. Er hatte den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend mit seinen Recherchen verbracht. Von Langeweile keine Spur.
Jetzt freute sich Jakob auf den kommenden Tag. Würde er wiederein Taggeheimnis entdecken? Und wenn nicht, dann war das auch nicht schlimm. Die Frage, ob Wasser lachen kann, würde ihn noch ein wenig beschäftigen. Jedes Mal, wenn er daran dachte, musste er schmunzeln.
Jakob war dankbar, denn ihm wurde plötzlich bewusst, dass er sich nie mehr zu langweilen brauchte. Wenn es jeden Tag ein Taggeheimnis zu entdecken gab, hatte er viel zu tun, und für Langeweile würde es einfach keine Zeit mehr geben.
Glücklich und zufrieden dankte er Gott und schlief ein.
Da saß ich nun, las die Geschichte immer und immer wieder und konnte doch nichts entdecken, was ich hätte ändern wollen. Nichts störte mich. Die Geschichte war perfekt, einfach perfekt – jedenfalls in meinen Augen.
Ich hatte eine Geschichte geschrieben! Ganz unerwartet hatte ich eine Idee bekommen, und schon hatte ich angefangen zu schreiben. Mitten in all meiner Arbeit, mitten am Tag – einfach so.
Unendlich glücklich schaute ich auf meine Zeilen und dann auf meinen Schreibtisch.
Mit einem Mal war mir, als würden mich die Stapel mit all den Belegen herausfordernd angrinsen und rufen: „Sei endlich vernünftig und arbeite! Die Steuererklärung muss bis Freitag beim Finanzamt sein.“
Doch in diesem Moment waren Beruf und Steuern mir vollkommen egal – ich saß nur da und starrte verzückt auf meine Geschichte. So ein wunderschönes Gefühl hatte ich seit langer Zeit nicht mehr erlebt.
Mein Leben war eine ziemlich langweilige Sache geworden. Nach zwanzig Jahren Ehe reihten sich die Tage ohne große Höhen und Tiefen aneinander. Ein Tag sah aus wie der andere – eine perfekt organisierte monotone Tagesroutine rund um das Familienleben mit zwei fast erwachsenen Kindern und einem Beruf, der immer öder und trockener zu werden schien. Mit 45 Jahren sollte ich eigentlich mitten im Leben stehen. Eigentlich, denn die Realität sah anders aus. Immer öfter schlich sich der Gedanke „Lebe ich noch, oder werde ich gelebt?“ in mein Bewusstsein.
Das Leben hatte so viel zu bieten. Obwohl ich es wusste, war ich doch nicht in der Lage, es in meinem Leben zu verwirklichen. „Lebe ich oder werde ich gelebt?“ – dieser Frage war ich auf der Spur, als sich an diesem sonnigen Oktobermorgen eine kleine Geschichte in mein Leben schlich.
Ist es möglich, dass eine simple kleine Geschichte ein Leben verändert? Zunächst wollte ich es nicht glauben, und doch war es so. Obwohl ich es am Anfang kaum bemerkte, begann sich langsam, ganz langsam etwas in meinem Leben zu verändern.
Ich liebte die Geschichte vom Taggeheimnis sehr. So war es kein Wunder, dass ich nach und nach begann, meine eigenen Taggeheimnisse zu entdecken und zu leben. Diese Geschichte war ein Geschenk des Himmels für mich, das wusste ich. Wie das Leben des kleinen Jakob, so war auch mein Leben oft öd und grau, und just an diesem sonnigen Oktobertag hatte ich wieder einmal das Gefühl, alles in meinem Leben wäre eh vollkommen egal.
Was ich auch tat, nichts konnte mich aus dieser deprimierten Stimmung herausholen. Als mich an diesem Morgenmein täglicher Spaziergang an den Bach führte, funkelte mit einem Mal die Sonne im plätschernden Wasser. Der Gedanke, eine Geschichte zu schreiben, tauchte in mir auf. Kaum war ich wieder zu Hause angekommen, griff ich nach Stift und Papier und konnte nichts anderes tun, als die Geschichte aufzuschreiben. Viel zu groß war die Angst, ich könnte sie wieder vergessen.
Zwei Monate nach diesem Erlebnis war das anders. Für meine trostlosen Gedanken hatte ich keine Zeit mehr. Fast täglich machte ich mich selber auf die Suche nach meinem Taggeheimnis.
Wie spannend der eigene Alltag sein kann, hatte ich vollkommen vergessen. Fast täglich entdeckte ich etwas Neues, etwas Geheimnisvolles oder etwas Bekanntes neu. Manchmal fragte ich mich, warum ich bisher nicht gesehen hatte, wie schön die Natur war und welches Wunderwerk sie Tag für Tag vollbrachte oder wie klug und verspielt die Tiere doch waren. Dann wieder stellte ich fest, wie prächtig sich meine Tochter entwickelt hatte oder welch eine interessante Gesprächspartnerin die alte Frau von nebenan doch war. Mein Alltag bekam eine neue Farbe. Am eigenen Erleben durfte ich feststellen, dass der Alltag gar nicht so grau war, wenn man bereit war, etwas genauer hinzuschauen.
Die Geschichte vom Taggeheimnis war mein ganz persönliches Geheimnis. Lange Zeit behielt ich sie ganz für mich. Dann eines Tages zeigte ich sie mutig meinen Kindern. Wenn es jemanden gab, der mir unverblümt die Wahrheit über mein literarisches Können sagen würde, dann waren es meine Kinder. Mit klopfendem Herzen wartete ich ängstlich und erwartungsvoll auf ihr Urteil – und auf ihre Kritik. Ich wusste, sie würden mir schonungslos die Wahrheit sagen, denn Kinder sind die ehrlichsten Kritiker, die es gibt.
Während ich auf ihr Urteil harrte und die beiden beobachtete, lachten sie. Mit „Oh, die ist schön!“ fingen sie gleich an zu überlegen, ob auch sie ein Taggeheimnis hätten und wie man es finden könnte.
Leise, ganz leise keimte in mir ein Gedanke auf oder eher ein verborgener Wunsch – eine Hoffnung: Sollte ich etwa schreiben können? Sollte ich wirklich schreiben können? Eine bisher unbekannte Sehnsucht machte sich in meinem Herzen breit.
***
Einige Tage später besuchte ich mit meiner Freundin Christine in der Stadt den Vortrag des spirituellen Heilers Alexander Aandersan. Neugierig, wie ich war, wollte ich mir ein eigenes Bild von den Dingen des Leben machen und mich nicht auf die Meinung anderer verlassen. So auch an diesem Tag. Aus irgendeinem Grund beabsichtigte ich mehr über Heiler erfahren. Was tun Heiler? Was sind das für Menschen? Worin unterscheiden sie sich von anderen Menschen? Wie können sie helfen, und vor allem: Was können sie?
Endlich hatte ich eine Gelegenheit bekommen, einen Heiler live zu erleben. Die ungewöhnliche Inszenierung der Veranstaltung beeindruckte mich sehr. Sie konfrontierte mich mit befremdenden Denkansätzen und außergewöhnlichen Sinneseindrücken, und doch ging ich an diesem Abend mit mehr Fragen nach Hause, als ich gekommen war.
„Glaubst du, dass es stimmt, was er gesagt hat?“, fragte Christine mich auf dem Heimweg. Christine war meine beste Freundin. Als langjährige Vertraute konnte ich mit ihr über alle großen und kleinen Dinge des Lebens reden, diskutieren und lachen.
„Was meinst du? Er hat viel gesagt, und bei einigen Dingen fällt es mir sehr, sehr schwer, es zu glauben“, antwortete ich.
„Na, das mit der Pubertät. Dass wir uns daran erinnern sollten, was wir in der Pubertät für unser Leben wollten“, sagte Christine.
„An den Träumen, die wir in der Pubertät für unser Leben haben, können wir erkennen, was wir für unser Leben wirklich wollen und welche Aufgaben wir mit in dieses Leben gebracht haben. Meinst du das?“, gab ich zurück.
„Ja, genau. Das meine ich. Glaubst du, dass das stimmt?“ Fragend sah Christine mich an.
„Dieser Satz ist an sich nichts Neues. Ich kenne diese Behauptung schon aus der Entwicklungspsychologie und auch aus der Biografiearbeit. Allerdings habe ich mir bisher noch nie darüber Gedanken gemacht, ob es stimmen könnte. Vorstellen könnte ich mir das schon. Mal überlegen, was hatte ich damals für Lebensträume?“ Schule, Berufsausbildung, Jugend – alles lag schon so lange zurück. Was hatte ich damals für Lebensziele? Mir fiel ein Aufsatz ein, den ich früher einmal in der Schule geschrieben hatte.
„Ich wollte Kriminalbeamtin werden, heiraten und zwei Kinder haben“, lachte ich.
„Und ich wollte immer Menschen helfen“, stellte Christine fest.
„Und das tust du Tag für Tag.“ Christine war Arzthelferin. Sie hatte eine sehr liebevollen Ausstrahlung und vermittelte allen Menschen etwas Beruhigendes und Zuversichtliches. Sie half gern und viel.
Ob sie vielleicht so glücklich wirkte, weil sie das tat, was sie schon immer tun wollte, überlegte ich. Wie als Echo auf meine Gedanken sagte sie: „Eigentlich tue ich das, was ich schon immer tun wollte.“
„Stimmt, und du scheinst auch keinen Zweifel daran zu haben, ob es richtig ist, was du tust“, fügte ich hinzu.
„Nein, ich weiß, mein Beruf ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich wollte schon als Kind Arzthelferin werden, und ich möchte auch heute nichts anderes tun. Anders sieht es mit meiner Beziehung aus!“, kam es bitter.
„Auf diesem Gebiet sind meine Wünsche in Erfüllung gegangen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Einen Jungen und ein Mädchen, genau wie ich es mir damals erhofft habe.“
„Und warum bist du nicht Kriminalbeamtin geworden?“, wollte Christine wissen.
„Auf dem Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz habe ich mich einmal auf einem Polizeirevier nach dem Berufsbild einer Polizeibeamtin erkundigt. Alles klang sehr interessant und spannend. Dann erzählte der Polizist, wie bitter es wäre, dass er meistens nur zu den Menschen käme, um ihnen eine schlechte Nachricht zu bringen. Ganz selten klingelte er an Türen, um frohe Kunde mitzuteilen. Da wurde mir klar, wie Recht er hatte. Nach diesem Besuch auf dem Polizeirevier stellte ich für mich fest: Das kann ich nicht! Eltern zu erzählen, ihr Kind sei tödlich verunglückt, oder der Ehefrau zu berichten, ihr Mann hätte ein Verbrechen begangen. Dazu fühlte ich mich einfach nicht in der Lage. Durch dieses Gespräch hatte ich für mich erkannt, dass dieser Beruf nichts für mich war. Ich war einfach zu sensibel, um so einen Beruf ausüben zu können.“
„Und jetzt? Bist du in deinem Beruf glücklich?“, fragte Christine.
„Du meinst, als Buchführungshelferin? Nein, eigentlich nicht. Mir fehlt der Kontakt zu den Menschen. Buchhaltung ist sehr trocken. Es gibt für alles Vorschriften und Regeln. Du weißt genau, was du zu machen hast. Und wenn du einmal das Rätsel von Soll und Haben gelöst hast, weißt du, wie der Hase läuft“, entgegnete ich etwas ironisch.
„Nun sei mal ernst. Bist du in dem Beruf so glücklich, dass du ihn bis zur Rente ausüben willst?“ Christine ließ nicht locker.
„Nein! Weißt du, an dem Beruf der Kriminalbeamtin hatte mich vor allem fasziniert, Spuren zu suchen, Geheimnisse aufzudecken, in Bewegung zu sein und mit Menschen zu arbeiten. Buchhaltung ist genau das Gegenteil. Du hast es mit Zahlen zu tun, mit Belegen. Die Menschen, mit denen ich zusammenkomme, sind meine Kunden, und die ärgern sich meistens, weil sie so viele Steuern zahlen müssen. Doch um noch einmal auf deine Frage zurückzukommen: Nein, ich empfinde mein Tun als ziemlich halbherzig. Ich tue es, weil ich es einmal gelernt habe und weil ich Geld verdienen muss, nicht mehr. Aber mein ganzes Leben ist zur Zeit ziemlich halbherzig!“, antwortete ich.
Ja, genau das war es. Ich lebte halbherzig. Das, was ich tat, tat ich, weil ich es tun musste, nicht weil ich es tun wollte.
„Weißt du, da gab es noch eine Sache, von der ich damals geträumt habe. Ich wollte ein Buch schreiben“, fuhr ich fort und dachte an meine Träume von früher.
Christine blieb stehen. Erstaunt sah sie mich an. „Ein Buch?“, fragte sie interessiert.
„Ja, so einen richtigen schönen Schmachtroman, mit ganz viel Herz, Schmerz und Abenteuer“, sagte ich.
„Hört sich gut an. Und warum hast du es nicht getan?“, erkundigte sich Christine.
„Oh, habe ich. Ich hatte sogar schon einige Kapitel fertig gestellt und etliche Skripte auf Lager, einen ganzen DIN A4-Ordner voll“, erinnerte ich mich.
„Hast du die Sachen noch? Ich würde sie gern einmal lesen.“
„Oh, ich auch!“, lachte ich. „Das wäre bestimmt lustig. Ich habe all meine Aufzeichnungen verbrannt, auch meine Tagebücher und Poesiealben und so weiter.“
Meine Worte klangen ganz lässig, als wäre es die normalste Sache der Welt, seine Manuskripte und Tagebücher zu verbrennen Doch tief in mir spürte ich, wie ich traurig wurde und ein tiefes Bedauern sich breit machte. Eigentlich schade, dachte ich und sah vor meinen Augen das Feuer, in dem all meine geistigen Ergüsse in Flammen aufgingen.
In meiner Kindheit war es üblich, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst auf der nahe gelegenen Wiese ein Feuer anzuzünden, um Gartenabfälle, Buschwerk, alte Zeitungen und Holz zu verbrennen. In dem Jahr, als ich mit meinem künftigen Ehemann Michael zusammenziehen wollte, verbrannte ich all meine Tagebücher, Briefe und andere Papiere und auch das Manuskript für mein Buch beim großen Frühjahrsfeuer. Damals, als ich mein Elternhaus verlassen wollte, wollte ich nur mitnehmen, was ich wirklich für mein neues Leben brauchen würde.
„Warum hast du das getan?“ Christine sah mich an. Ihre Augen schienen zu rufen: Wie kann man nur!