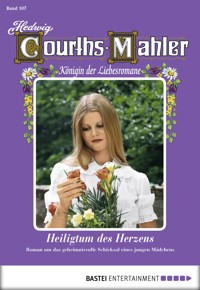Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ganz viel Herzschmerz wird auch in diesem Liebesroman der erfolgreichen Schriftstellerin Hedwig Courths-Mahler garantiert. Armin von Leyden ist am Boden zerstört, als seine große Liebe einen anderen Mann heiratet, der ihr, anders als Armin, ein Leben in Wohlstand bieten kann. Doch das Schicksal meint es gut mit dem armen Assessor. Er wurde als Erbe in einem Testament eingesetzt, bei dem der Nachlass zudem mit einer besonderen Auflage verbunden ist...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Die Testamentsklausel
Saga
Die Testamentsklausel
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1915, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950335
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
„Lass uns zum Presseball gehen, Armin!“
„Was sollen wir dort?“
„Uns unterhalten, den Abend totschlagen.“
„Guter Kerl, das hilft mir auch nicht darüber hinweg.“
„Aber es lenkt dich ab.“
„Als ob meine Gedanken heute einen Weg gingen, der nicht schliesslich doch da hinführte, wo sie nicht sein sollen! Ich möchte lieber nach Hause.“
„Um Grillen zu fangen. Das hat doch keinen Zweck.“
„Es hat ebensowenig Zweck, dass ich zum Presseball gehe. Da soll ich am Ende noch geistreich sein. Nein, Hans, ich mag heute keine Menschen sehen.“
„Du bist dir selbst der schlechteste Gesellschafter. Komm nur mit! Schlieven und Werdern sind auch dort.“
„Ein Grund mehr für mich, wegzubleiben. Für diese beiden grossen Frauenverächter wäre ich heute eine Zielscheibe des Spottes. Sie wissen so gut wie du und ich, dass Alexandra Wendhoven heute Hochzeit hält und dass ich von ihr zum Narren gemacht wurde. Für ihren Zynismus wäre das gefundenes Futter. Ich mag diese beiden Pessimisten überhaupt nicht leiden. Trotzdem mich eine Frau verriet, glaube ich noch an die Frau. Um sie frivol in den Staub ziehen zu lassen, hab ich meine Mutter zu hoch verehrt und geliebt. Nein — lass mich zufrieden. Gehe du doch allein bin, wenn dich danach verlangt.“
Hans von Rippach drehte an seinem blonden Schnurrbart und zuckte die Achseln.
„Mir liegt nichts daran,“ sagte er abwehrend. ,,Ich wollte nur für dich Zerstreuung.“
„Du meinst es gut, Hans, ich danke dir. Aber da hilft Zerstreuung nichts. Solche Stunden muss man wehrlos über sich ergehen lassen. Denkst du, ich könnte heute einem andern Gedanken Raum geben, als dem an sie? Dass sie heute das Eigentum eines andern wird und über den Toren lacht, der sich vermass, sie an seine Armut fesseln zu wollen. Als ob eine Alexandra zu nichts Besserem auf der Welt wäre, als zu warten, bis ein simpler Assessor für sie und sich eine bescheidene Brotstelle errungen hat!“
Es klang eine tiefe Bitterkeit und grimmige Selbstverspottung aus seinen Worten. Armin von Leyden litt scheinbar schwer an dieser Enttäuschung.
Schweigend gingen die beiden jungen Leute weiter. Rippach sah ein, dass es besser war, dem Freunde nachzugeben. Nach einer Weile fragte er ruhig:
„Willst du mich los sein, dann sag es ehrlich, ich nehme es dir nicht übel.“
„Nein. Wenn du dich durch meine Missstimmung nicht stören lässt, dann lass uns in irgendeinem ruhigen Winkel eine Flasche Wein trinken.“
„Gut, das ist doch ein Wort. Wo wollen wir hingehen?“
„Einerlei.“
„Dann hier rechts um die Ecke. Da finden wir, was wir brauchen.“
Sie bogen in eine stillere Nebenstrasse ein. In wenigen Minuten hatten sie ein Weinlokal erreicht. Durch Holzwände mit Kunstverglasungen waren hier Nischen gebildet. In einer derselben nahmen sie Platz.
Rippach bestellte Wein und schenkte ein. Als er dem Freunde zutrank, sagte er ernst:
„Auf baldige Heilung deiner Herzenswunde! Eine Alexandra ist es nicht wert, dass sich ein Mann sein Lebert durch sie verpfuschen lässt.“
Leyden tat ihm schweigend Bescheid. Die Unterhaltung schleppte sich mühsam hin. Leyden zwang sich zu Rede und Gegenrede, und Rippach konnte den lustigen, lebensfrohen Ton nicht finden, auf den er sonst gestimmt war. Sein hübsches, frisches Gesicht trug den Ausdruck grossen Unbehagens. Es war ihm sehr niederdrückend, dem Freund nicht helfen zu können.
Nach zwölf Uhr stand Leyden plötzlich auf.
„Nimm es nicht krumm, Hans, ich möchte nach Hause, bin wahrhaftig müde.“
„Auch gut — wie du willst.“
Er rief den Kellner und zahlte. Dann verliessen sie das Lokal.
Rippach begleitete Leyden schweigend bis an seine Wohnung. Dort trennten sie sich mit einem kurzen, warmen Händedruck.
„Morgen auf Wiedersehen.“ —
Leyden stieg langsam die Treppe hinauf und betrat seine Wohnung, die aus Wohn- und Schlafzimmer bestand. Noch im Dunkeln warf er den Überrock ab, tastete nach den Streichhölzern und zündete die Lampe an.
Starr sah er eine Weile in das zuckende Licht. Es beleuchtete sein ausdruckvolles, scharfgeschnittenes Gesicht und spiegelte sich in seinen dunklen Augen wider.
Dann sank er willenlos in einen Sessel, stützte den Kopf auf die Hände und vergrub sein Gesicht darin. Stundenlang sass er so, ohne sich zu regen. Dann endlich weckte ihn die Kälte aus seinem Brüten. Er erhob sich und trat ans Fenster. Das war mit Eisblumen bedeckt. Nur eine zackige Ecke an jeder Scheibe war frei davon. Drunten auf der Strasse zuckte das Laternenlicht im eisigen Windhauch. Armin seufzte tief auf, verlöschte dann sein Licht und ging mit einer brennenden Kerze ins Schlafzimmer.
Ruhe fand er aber nicht diese Nacht.
— — — — — — — — — — — —
Als er am nächsten Tage eben vom Amt nach Hause gekommen war, trat Rippach bei ihm ein.
„Servus, Armin! Ich hatte dich am Alexanderplatz im Gewühl verloren. Dachte mir, dass ich dich hier finden würde. Hast du nicht was Trinkbares?“
„Kognak kannst du haben.“
„Her damit!“
Leyden kramte aus einem Schränkchen eine Flasche und zwei Gläser. Als er sie vollgeschenkt hatte, schob er Rippach auch Zigarren und Feuerzeug, hin.
„Bediene dich!“
„Danke. Rauchst du nicht?“
„Doch, gleich nach dir.“
Beide steckten sie sich Zigarren an. Eine Weile rauchten sie und bliesen nachdenklich den Rauch von sich. Dann trat Leyden plötzlich mit leichtem Lächeln an Rippach heran und legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Du brauchst dich nicht aufzuopfern, mein Alter. Ich erkenne ja den guten Willen dankbar an. Es ist aber nutzlos, dass du dich in meiner Gesellschaft langweilst.“
„Unsinn,“ fuhr Rippach auf, „ich langweile mich gar nicht! Habe manchmal ganz gern so ’ne stille, beschauliche Stunde.“
„Hm, das ist mir neu an dir. Übrigens könntest du solche Beschaulichkeit bedeutend gemütlicher in deiner eleganten Wohnung geniessen.“
„Vier gefällt es mir gerade sehr gut.“
„Schön, dann bleib. Ich gehe aber heute nicht aus.“
„Vortrefflich. Ich habe ebenfalls keine Lust dazu. Muss man denn jeden Abend in der Kneipe sitzen oder Konzerte und Theater unsicher machen?“ sagte Rippach mit grosser Überzeugung.
Armin lachte.
„Du bist ein Heuchler.“
Rippachs Gesicht strahlte.
„Gottlob, jetzt hast du endlich einmal wieder gelacht. Sag mal, hast du schon zu Abend gegessen?“
„Nein, meine Wirtin besorgt mir Tee und belegte Butterbrote. Willst du mithalten?“
„Aber selbstredend. Hunger hab ich, und wenn du durchaus hierbleiben willst, musst du mich bewirten.“
„So gut ich kann. Bist ein guter Kerl, Hans.“
„Na, wieso denn?“ wehrte dieser verlegen ab.
„Weisst schon, wieso. Aber ich lasse dir Bier holen, oder eine Flasche Wein, damit deine Freundschaft, auf keine zu harte Probe gestellt wird. Was willst du haben?“
„Also Bier — da bin ich kein Unmensch.“
Sie sassen dann ganz gemütlich beim Abendessen. Rippach trieb allerhand Allotria und freute sich wie ein Kind, wenn Leyden zu seinen Schnurren lachte. —
Die beiden waren schon seit Jahren eng befreundet.
Leydens Vater war Arzt gewesen und schon vor Jahren gestorben. Damals stand Armin mitten im Studium. Viel Vermögen hinterliess der Vater nicht, es hätte nur gerade für seine Witwe ausgereicht zum schlichten Lebensunterhalt. Aber Frau von Leyden war eine jener Mütter, die für ihre Kinder lächelnd das Schwerste vollbringen. Sie hatte sich jede Annehmlichkeit versagt, um Armin das Weiterstudieren zu ermöglichen. Als ihr Sohn Assessor geworden war, starb ihm auch die Mutter. Nun konnte er die Zinsen des kleinen Vermögens für sich verwenden, und seine Lage war damit eine angenehmere geworden. Rippach hatte in allen Schicksalsfügungen in treuer Freundschaft neben ihm gestanden. Als Sohn vermögender Eltern kannte er Lebenssorgen nicht. Sein heiteres, lebensfrisches Temperament übte stets einen wohltätigen Einfluss auf den etwas schwerblütigen Freund aus, dessen geistige Überlegenheit er ebenso neidlos anerkannte, wie seine körperlichen Vorzüge. Und Armin bremste hinwiederum oft, wenn Rippach über die Stränge schlagen wollte. Die beiden ergänzten einander vorzüglich, und dieser Umstand befestigte ihre Freundschaft mehr und mehr. Denn Gegensätze ziehen sich an.
Dass Armin sich mit der ganzen Innigkeit seines Herzens in die schöne, verwöhnte, aber vermögenslose Alexandra Wendhoven verliebte, machte Rippach von Anfang an Sorge. Er hätte den Freund gern davor behütet, denn er erkannte mit seinem klaren, praktischen Blick bald, dass Alexandra sehr kokett und gefallsüchtig war und viel zu verwöhnt, um die Frau eines armen Assessors zu werden. Seine Warnungen fruchteten natürlich nichts. Wann hätte ein Liebender sich durch Vernunftgründe besiegen lassen? Die Verlobungsanzeige Alexandras erhielt Leyden zwei Tage nach einem Ball, auf dem ihr die Geliebte zärtlicher und liebenswürdiger denn je behandelt hatte. Der Schlag traf ihn unerwartet und verwundete ihn um so mehr, als er den Unwert der Geliebten erkennen musste. Trotzdem er sie verachten musste, hörte er nicht auf, sie zu lieben. Und der gestrige Tag, der Alexandra zur Gattin eines anderen machte, eines Mannes, der nichts als ein riesiges Vermögen in die Wagschale zu werfen hatte, rüttelte alle Schmerzen wieder in ihm wach.
Hans Rippach bewährte sich auch in diesem Falle als treuer, ergebener Freund. Und Armin wusste es ihm Dank, wenn er auch ebensowenig Worte darüber verlor, als Rippach.
* * *
Inmitten der Thüringer Berge liegt auf einer Anhöhe Schloss Burgwerben. Diese Anhöhe wird von zwei schmalen Flussarmen umspült und bildet eine Insel. Eine breite Brücke führt über den Fluss auf die Fahrstrasse, die zum Schloss hinaufführt. Schloss Burgwerben ist ein grosses graues Gebäude mit einem hohen Mittelbau und zwei viereckigen, schmucklosen Ecktürmen. Es steht fest und trutzig auf dem kleinen Inselberg und wirkt trotz mangelnder architektonischer Schönheiten in der landschaftlich reizvollen Umgebung sehr malerisch. Jenseits des Flusses breiten sich fruchtbare Täler und prächtige Waldungen aus bis zu den waldbewachsenen Höhenzügen.
Das schmucke Dörfchen, welches den gleichen Namen führt wie das Schloss, zieht sich mit seinen freundlichen roten Ziegeldächern längs des Flusses hin, der dicht hinter dem Burgberg seine beiden Arme wieder vereinigt. Eine kleine, sehr malerisch wirkende Kirche strebt mit schlankem Turme über die Bauernhäuser hinaus.
Einige Villen und Landhäuser liegen verstreut teils am Waldrand, teils oben am Fluss. Die Schönheit der Gegend hat manchen gelockt, sich hier anzusiedeln, und die Gemeinde tritt gern für blankes Geld ein Stück des Bodens zu diesem Zwecke ab.
Schloss Burgwerben samt dem dazugehörigen grossen Grundbesitz ist das Eigentum Friedrich von Leydens. Dessen Vater hat durch die Heirat mit der letzten Gräfin Burgwerben diesen herrlichen Besitz und ein grosses Vermögen an sich gebracht. Und Friedrich von Leyden ist der einzige Sohn dieses Paares. Er ist jetzt etwa sechzig Jahre alt und unverheiratet. Einst ein lustiger, lebensfroher Gesell, der alle Freuden der Welt in vollen Zügen genoss, war er vor fünfundzwanzig Jahren als ein finsterer, stiller Mann heimgekehrt aus der grossen Welt. Der Verrat einer Frau, ein damit zusammenhängendes Duell, in dem er seinen besten Freund erschoss, hatte den Grund zu seinem veränderten Wesen gelegt. Näheres erfuhr niemand.
Friedrich von Leyden wurde ein menschenscheuer Sonderling. Frauen litt er nicht in seiner direkten Umgebung. Was auf dem Schlosse an weiblicher Bedienung gebraucht wurde, musste in den Wirtschaftsgebäuden untergebracht werden und sich seiner Person möglichst fernhalten. Er lebte nur seinen Büchern und der Bewirtschaftung seines ausgedehnten Besitzes. Darin unterstützte ihn Inspektor Scheveking, ein knorriger, kurzangebundener Mann, der gleich seinem Herrn von den ,Frauensleutenʻ nichts hielt und ebenfalls unbeweibt in der Inspektorwohnung hauste.
Das weibliche Regiment lag in den Händen Mamsell Wunderlichs. Die kleine, behäbige Person rächte sich für den auf Schloss Burgwerben herrschenden Frauenhass durch eine offen zur Schau getragene Männerfeindschaft. Sie stand fortwährend auf Kriegsfuss mit Scheveking, und die beiden Leute, die miteinander alt und grau geworden waren, sagten sich täglich die auserlesensten Grobheiten. Das gehörte zu ihrem Wohlbefinden. —
Friedrich von Leyden hatte einen grossen Verwandtenkreis. Die Leydens waren aber alle arm, wie es sein Vater vor seiner Verheiratung war. Als man nun merkte, dass der Besitzer von Burgwerben ehelos blieb, kam man angezogen, um sich in Erinnerung zu bringen. Es begann eine seltsame Jagd nach dem Glück. Friedrich von Leyden wurde von seinen Verwandten mit Liebe überschüttet, einer lief dem andern den Rang ab, einer übertrumpfte den andern mit Liebesbeweisen.
Der finstere Mann wehrte sich dagegen. Ein grimmiges, spottdurchtränktes Lächeln setzte er all den süssen Reden entgegen. Da drängten sich die Frauen der Familie an ihn heran. Das war ihm zu viel. Er liess sich einfach nicht vor ihnen sehen. Die Klügeren schickten deshalb ihre Frauen schleunigst wieder nach Hause, um sich ihm angenehm zu machen. Andere, die von dem Liebreiz und der Klugheit ihrer Frauen und Töchter überzeugt waren, ersannen einen anderen Plan, um Friedrich von Leyden mit ihnen zusammenzubringen.
Sie beriefen nach dem nächsten Städtchen einen allgemeinen Leydenschen Familientag. Ein Hotel würde zum Versammlungsort bestimmt und der Herr von Burgwerben so lange um sein Erscheinen angebettelt, bis er sein Kommen zusagte.
Mit einem undurchdringlichen Gesicht war er zum Familientag in das Städtchen gefahren. Mit einer ebensolchen Gesicht war er heimgekehrt und hatte am nächsten Tage seinen Rechtsanwalt holen lassen. In Gegenwart von Inspektor Scheveking hatte er sein Testament gemacht und dieses dann bei Gericht niedergelegt.
Das war vor fünfzehn Jahren gewesen. —
Danach war das Leben weitergegangen. Das Schmeicheln seiner Verwandten, die sich gegenseitig bei ihm verleumdeten, um in Gunst zu kommen, widerte ihn an und verbitterte ihn immer mehr. Don den Frauen hatte auf dem Familientag keine einen günstigen Eindruck auf ihn gemacht. Man hatte sich verrechnet.
Scheveking und Mamsell Wunderlich hatten einen Punkt, wo sie sich sympathisch begegneten. Das war der Ärger über die ,lieben Verwandten‘ ihres Herrn, die ihm das Leben schwer machten. Sie wären am liebsten mit einem kräftigen Donnerwetter dazwischengefahren. Scheveking bereitete nur der eine Umstand Genugtuung, dass er genau wusste, keiner dieser kriechenden Erbschleicher würde sein Ziel erreichen. Er allein wusste ausser dem Rechtsanwalt, wen Friedrich von Leyden zu seinem Erben eingesetzt hatte.
Im letzten Spätherbst begann Leyden zu kränkeln und blieb ans Zimmer gefesselt. Noch stiller und wortkarger wurde er darüber. Seine Augen schweiften oft mit einem seltsam schwermütigen Blick zum Fenster hinaus in das herbstlich gefärbte Land. Er empfing keine Besuche, auch seine Verwandten nicht, so sehr sie sich auch bemühten, Einlass in sein Zimmer zu finden. Der Schlossherr musste schweren, drückenden Gedanken nachhängen, dem Ausdruck seines Gesichts nach zu urteilen. Von seinem Rechtsanwalt empfing er oft lange Berichte, die ihn scheinbar sehr interessierten. Nur diese Berichte rissen ihn zuweilen aus seinem Dahinbrüten.
Das Ergebnis dieser Grübeleien war eine erneute Beratung mit seinem Rechtsanwalt, die zur Folge hatte, dass Leyden sein vor fünfzehn Jahren niedergelegtes Testament erneuerte und mit einem Anhang versah. Dieser Anhang enthielt eine Bestimmung, von der auch Scheveking nichts erfuhr. Er hätte wohl auch sehr verwundert den Kopf dazu geschüttelt.
Als wenn ihn nun nichts mehr am Leben hielte, so verfiel Friedrich von Leyden zusehends. Wohl raffte er sich noch einige Male auf und unternahm sogar in der Silvesternacht, wie jedes Jahr, wenn Schnee lag, eine lange, einsame Schlittenfahrt. Dabei zog er sich aber eine Erkältung zu, die ihn aufs Krankenbett warf.
Der herbeigerufene Arzt stellte Lungenentzündung fest.
Hartnäckig bestand der Kranke darauf, dass man ihm seine Verwandten fernhielt. Ausser dem Arzt durfte nur sein alter treuer Diener Villenberger und Inspektor Scheveking zu ihm. Diese beiden von ihm erprobten Männer übernahmen abwechselnd die Pflege ihres Herrn und verteidigten seine Tür, dass niemand zu ihm gelangen konnte, den er nicht sehen wollte.
Die Lungenentzündung hatte ein Nierenleiden im Gefolge. Der Zustand des Kranken gab zu Besorgnis Anlass genug.
Inzwischen verging der Winter, im März kamen schon warme Tage. Schnee und Eis gab es seit Mitte Februar nicht mehr. Auf den Feldern sollte die Arbeit beginnen. Scheveking musste den Kranken jetzt viel mit Villenberger allein lassen. — — —
An einem hellen, sonnigen Märzmorgen ritt Scheveking mit trübem Gesicht vom Felde heim. Am Rande des Waldes, der sich neben dem Fahrdamm der Eisenbahnlinie dahinzog, kam ihm ein junges, schlankes Mädchen in Trauerkleidung entgegen. Ihr blasses, liebliches Gesicht zeigte die Spuren vergossener Tränen. Scheveking hielt dicht vor ihr sein Pferd an.
„Guten Morgen, Fräulein Delius!“
,,Guten Morgen, Herr Inspektor! Wie geht es Herrn von Leyden?“
Das Gesicht des Alten umschattete sich wieder.
„Er hatte keine gute Nacht. Ich fürchte, es steht schlimm.“
„Der arme alte Herr!“
Es klang warmes, herzliches Mitleid aus diesem Ausruf. Scheveking nickte.
„Ja, das weiss Gott — er ist mehr zu bedauern, als man glaubt. Na, und Sie? Haben wieder geweint, kommen gewiss wieder vom Kirchhof?“
Sie wandte die Augen von ihm fort, um zu verbergen, dass es feucht darin aufstieg.
„Ich habe meinem Vater ein paar Blumen hingetragen, die ich zur Blüte brachte. Er liebte die Blumen so sehr.“
Scheveking nickte wieder.
„Sie sind ein gutes Kind, mal eine Ausnahme Ihres Geschlechts. — Nun sind schon drei Wochen um feit der Herr Professor da draussen unter der Erde schläft. Den hat auch eine von denen auf dem Gewissen, die der Herr im Zorne erschuf. Was macht denn die Frau Stiefmama, he?“
Ein wilder Grimm lag in seiner Stimme.
Eva Marie Delius zog die Stirn wie im Schmerz zusammen.
„Sie schilt uno jammert über unsere Armut. Lieber Herr Inspektor, wenn doch Herr von Leyden bald wieder gesund würde! Er wollte uns doch unser kleines Anwesen für fünfunddreissigtausend Mark abkaufen. Die Zinsen würden wenigstens meiner Stiefmutter ein bescheidenes Auskommen sichern.“
„Na, und Sie?“
„Sobald ich wieder fähig bin, mich aufzuraffen, will ich mir eine Stellung suchen, ich bin jung und gesund und habe allerlei gelernt.“
„Sie sind imstande zu so einer Dummheit. Unsinn, der Frau Stiefmama alles hinzugeben! Sie sind genau so gutmütig wie Ihr Herr Vater,“ polterte Scheveking los.
Eva Marie schlang die Hände ineinander.
„Ich kann nicht länger anhören, wie sie auf meinen Vater schilt. Sie soll alles haben, damit sie Ruhe gibt.“
Scheveking lachte grimmig auf.
„So ist’s recht, stecken Sie ihr das letzte auch noch zu, damit sie es auch noch durchbringt, wie das ganze schöne Vermögen Ihres Vaters. Und Sie drücken sich dann bei fremden Leuten herum. Herrgott nochmal, da kann einen die Wut wieder packen!“
Er riss wild an den Zügeln, so dass sein Pferd erschreckt zur Seite sprang. Das junge Mädchen blickte mit wehmütigem Lächeln zu ihm auf.
„Zanken Sie nicht, ich weiss ja doch, dass Sie nicht halb so bös sind, als Sie sich immer den Anschein geben.“
Scheveking machte ein schnurriges Gesicht.
„Guten Morgen! Ich muss mich beeilen, um zu meinem Kranken zu kommen.“
Damit brach er das Gespräch kurz ab, gab seinem Pferd die Sporen und ritt eiligst davon.
Eva Marie sah ihm eine Weile nach, dann setzte sie ihren Weg fort. In unmittelbarer Nähe der kleinen Bahnstation lag am Waldrand ein schlichtes Landhäuschen inmitten eines grossen Gartens. Dieses Häuschen hatte Professor Delius früher mit seiner Familie nur als Sommerfrische benutzt. Seit aber sein Vermögen durch die Verschwendungssucht seiner zweiten Frau verloren gegangen war und eine lange Krankheit ihn zwang, seine Professur niederzulegen, hatte er sich ganz hierher zurückgezogen. Seine Frau, einst eine bewunderte Schönheit, jetzt ein übermässig starkes, aufgedunsenes Weib, machte ihm und seiner Tochter das Leben zur Hölle durch Klagen und Schelten über das ,jammervolle Knauserleben‘, das sie doch durch ihre Verschwendungssucht selbst verschuldet hatte.
Eva Marie suchte mit der schmalen Pension das Leben in dem kleinen Häuschen so erträglich wie möglich zu gestalten und dem Vater ein wenig Sonnenschein zu geben. Als Botaniker liebte er die Blumen sehr. Seine grösste Freude war sein Garten, in dem er von früh bis abends schaffte, solange seine Kräfte reichten. Er zog die schönsten Rosen in der Umgegend, und Eva Marie unterstützte ihn nach Kräften. —
Nun war Professor Delius seit drei Wochen tot. Damit erlosch auch seine Pension. Die beiden Frauen besassen nun nichts mehr, als das kleine Anwesen und die bedeutend zusammengeschmolzene Bibliothek des Professors. Den grössten Teil derselben hatte Frau Professor Delius vor vierzehn Tagen für tausend Mark vertauft. Davon fristeten die beiden Frauen jetzt ihr Leben. —
Eva Marie war zu Hause angelangt und begab sich gleich in ihr Zimmer. In der Küche schalt die kreischende Stimme ihrer Stiefmutter das junge Dienstmädchen aus, welches die Hausarbeit besorgte. Sie hatte die Milch überkochen lassen, das merkte man an dem scharfen Geruch, der das Haus durchdrang. Da gab es sicher wieder Anlass zu endlosen Klageliedern. Und davor fürchtete sich das junge Mädchen unsagbar. Ihrem vornehmen, feinen Empfinden war das ganze Wesen der Stiefmutter stets peinlich gewesen. Sie hatte nie verstehen können, dass ihr verehrter, geliebter Vater diese Frau hatte lieben können. Sie wusste in ihrer jugendlichen Unerfahrenheit nichts von jenem oft rätselvollen Zug, der den Mann zum Weibe zieht ohne Rücksicht auf alles andere, blind für alle Fehler und Schwächen.
So lieb sie ihren Vater gehabt hatte, so fern stand sie innerlich ihrer Stiefmutter. Die beiden Frauen hatten nicht eine Saite gemeinsam, auf der sie harmonisch zusammenstimmten. In Eva Marie stand es seit dem Tode ihres Vaters fest, dass sie ihr Leben von dem der Stiefmutter trennen wollte. Nichts hielt sie mehr bei dieser fest. Und wenn sie ihr den Kaufpreis für das Anwesen überliess, würde es ihr gewiss nicht einfallen, sie zurückzuhalten. Nur einige Monate wollte sie noch hier verbringen, bis das Häuschen verkauft war, dann würde sie sich inzwischen nach einem Unterkommen bei fremden Menschen umgesehen haben.
* * *
Friedrich von Leyden war am zwanzigsten März gestorben in den Armen seines treuen Dillenberger. Niemand war zugegen, als der Arzt und Hermann Scheveking. Bis zum letzten Atemzuge ihres Herrn hatten die beiden treuen Menschen den beutegierigen Verwandten den Weg zu ihm versperrt. Friedrich von Leyden war in Ruhe und Frieden eingeschlafen. Noch ehe er beerdigt war, fielen die Leydens über Scheveking her und suchten ihn auszuforschen, ob der Verstorbene ein Testament hinterlassen und wer zum Erben bestimmt war. Scheveking fuhr sie in seinem Schmerz um den Toten grob an und schob die buschigen Augenbrauen immer finsterer zusammen.
Das trug ihm feindliche Blicke genug ein. Alle waren einig, dass Scheveking ,fliegen‘ müsse, wenn das Gericht erst die Erben bestimmt hatte. An ein Testament glaubten die wenigsten. Hatte doch niemand eine Ahnung davon, dass es seit jenem Familientag schon bei Gericht lag. War kein Testament vorhanden, so erbten alle etwa zu gleichen Teilen, da kein naher Verwandtschaftsgrad bestand. Das Vermögen würde dann in fünfzehn Teile gehen, und jeder hatte schon ausgerechnet, wie viel auf seinen Teil kam.
Da gab es nun eine grosse Aufregung, als es plötzlich kund wurde, dass Friedrich von Leyden doch ein Testament hinterlassen hatte. Die Gemüter waren sehr beunruhigt, denn keiner konnte sich rühmen, dass Friedrich von Leyden ihm ein Zeichen besonderen Wohlwollens gegeben hatte. Im Gegenteil. So ängstlich sie es auch den andern verhehlten, sich selbst gestanden sie es doch ein, dass er stets unfreundlich gewesen war.
* * *
Armin von Leyden hatte nach schweren inneren Kämpfen seine Ruhe wiedergefunden. Hans von Rippach konstatierte mit Vergnügen, dass er wieder ein leidlich vernünftiger Mensch wurde. Dass Armin Alexandra Wendhoven noch nicht vergessen hatte, sondern sie trotz allem noch liebte, gestand er nur sich selbst ein. Er sprach mit Rippach nicht mehr davon.
Zum Glück weilte die junge Frau mit ihrem Gatten während des Winters an der Riviera. Er brauchte ihr also in der Gesellschaft nicht zu begegnen. So fehlte es den beiden Freunden nicht an Zerstreuung. Sehr oft verkehrten sie im Hause von Rippachs Oheim, der gern junge Leute um sich sah und, selbst kinderlos, seinen zahlreichen Neffen und Nichten oft Gesellschaften gab. Seine Gattin, von Hans instruiert, verstand es vorzüglich, Armin von seinem Schmerz abzulenken und ihm etwas philosophischen Gleichmut einzuimpfen. So ging der Winter vorüber.
Eines Tages sassen die beiden Freunde im Kaffeehaus und blätterten Zeitungen durch. Da stiess Armin plötzlich einen leisen Ruf der Überraschung aus. Rippach sah auf.
,,Was gibt’s?“
„Ich lese hier eben, dass Friedrich von Leyden gestorben ist.“
„Ein Verwandter von dir?“
„Ja, so über sieben Dörfer hinweg. Ein Vetter meines Vaters. Übrigens ein Naturwunder.“
„Wieso?“
„Der einzige Leyden, der Geld hat, Geld und einen herrlichen Grundbesitz in Thüringen. So hörte ich von meinem Vater.“
„Etwa eine Art Erbonkel? Dann gratuliere ich.“
„Nicht nötig Er ist zwar unverheiratet und ohne Leibeserben. Indes hat meine ganze Verwandtschaft vor Anbetung fast auf dem Bauche vor ihm gelegen. Ein widerliches Treiben. Mein Vater hat sich stets von ihm zurückgehalten, der war gottlob zu ehrlich zum Erbschleicher. Friedrich von Leyden pochte auf seinen Reichtum und war der unliebenswürdigste, kratzbürstigste Mensch, den man sich denken kann.“
Rippach hatte seine Zeitung weggelegt und sah Leyden interessiert an.
„Hast du ihn gekannt?“
„Ein einziges Mal bin ich mit ihm zusammengetroffen. Das ist aber schon sehr lange her. Ich war damals noch auf dem Gymnasium. Die Familie Leyden hatte nämlich aus irgendeiner Veranlassung einen sogenannten Familientag einberufen. Dazu hatten sie meinen Vater auch stark genötigt. Dieser unternahm gerade zu derselben Zeit mit mir eine Fusstour durch Thüringen. Der Familientag war, jedenfalls dem reichen Leyden zu Gefallen, in die seinen Gute nächstgelegenste Stadt verlegt worden. So konnte mein Vater ohne Mühe dabei sein. Und ich wurde mitgenommen und kam mir ungeheuer wichtig vor. Wer weiss, was ich mir unter so einem Familientag gedacht habe. Jedenfalls etwas Welterschütterndes. Jch fand jedoch nur eine Anzahl Menschen von sehr uninteressantem Aussehen, die sich alle riesig um einen Menschen bemühten, der mich sehr interessierte. Das war der bewusste Friedrich von Leyden. Mein Vater hatte mir unterwegs erzählt, dass dieser seinen Freund im Duell erschossen hatte vor langen Jahren. Na, kannst dir ja denken, dass ich ihn ansah mit einem Gefühl, aus Grauen und Bewunderung gemischt.“
„Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber erzähle weiter, das interessiert mich.“
„Es gibt nicht mehr viel zu erzählen. Mein Vater hielt sich sehr abseits von diesem Reigen um das goldene Kalb. Und ich begriff nicht, warum sich alle die Menschen von Friedrich von Leyden so schlecht und verächtlich behandeln liessen. Habe wohl auch recht finstere Blicke zu ihm hinübergeworfen. Irgend etwas muss ihn aufmerksam auf uns gemacht haben. Er schob plötzlich energisch all die andern von sich und trat auf uns zu. Ich sah ihm gespannt entgegen und ballte die Hände in den Taschen. Wollte er etwa auch mit uns so umspringen? Ich sah ihn fest und kampfesmutig an. Ein leises Lächeln glitt über seine finsteren Züge, und seine Augen bohrten sich in die meinen. Mir wurde unter diesen durchdringenden Augen gar nicht wohl, aber ich hielt seinen Blick aus. Dann wandte er sich zu meinem Vater und reichte ihm die Hand.
„,Du bist Adolf von Leyden, und das ist dein einziger Sohn Armin?‘
„,So ist es,‘ sagte mein Vater und legte seine Hand nur flüchtig in die des reichen Vetters.
„,Warum begrüssest du mich nicht auch so freundlich wie die da?‘
„Er zeigte auf die übrigen. Mein Vater zuckte die Achseln.
„,Ich bin zu ehrlich, um dir mehr Freundschaft zu heucheln, als ich empfinde.‘
„‚Also du bist mir nicht freundlich gesinnt?‘
„,Ich kenne dich zu wenig.‘
„,Ja, du besuchst mich nie. All die andern kommen oft. Du niemals.‘
„,Ich habe als Arzt wenig freie Zeit — und was soll ich bei dir?‘
„Da lachte Friedrich spöttisch, aber voll Bitterkeit.
„,Ein bisschen erbschleichen, wie die andern auch.‘
„Mein Vater sah ihn ernst an.
„,Du kennst mich nicht, sonst würdest du so nicht reden. Ich habe es nicht nötig, mich zu demütigen, und täte es auch nicht, wenn ich’s nötig hätte.‘
„,Ah, du bist selbst vermögend?‘
„,Nein, aber ich verdiene als Arzt, was ich brauche, um meine Familie zu ernähren.‘
„,Aber du hast einen Sohn, tätest du es auch nicht für ihn?‘
„,Der wird sich seinen Platz im Leben auf ehrliche Weise schaffen wie sein Vater. Davor ist mir nicht bange.‘
„Friedrich von Leyden sah meinen Vater lange durchdringend an, dann mich in gleicher Weise. Schliesslich legte er mir die Hand auf den Kopf.
„,So — meinst du?‘ fragte er langsam.
„Ich schüttelte im Knabenungestüm seine Hand ab und sah ihn trotzig an.
„,Lass mich, ich mag dich nicht, du sollst meinen Vater in Ruhe lassen!‘ rief ich laut.
„Da lachte er in sich hinein und sah die andern an, die sich unser abweisendes Verhalten zunutze machten und ihn doppelt umschmeichelten. Er hat uns kein Wort und keinen Blick mehr gegönnt, wir waren wohl gründlich in Ungnade gefallen.
„Mein Vater sah sich das Treiben nicht lange mehr mit an. Wir entfernten uns bald. Unterwegs machte ich meinem Unmut über Friedrich von Leyden Luft. Da sagte mein Vater: „Sei still, Armin, schilt ihn nicht. Er ist ein armer, beklagenswerter Mensch, trotz seines Reichtums.‘
„Ich vergass ihn lange nicht. Manches Wort, das meine Eltern über sein Schicksal verloren, hielt mein Interesse an ihm wach. Seit ich von zu Hause fort bin, hörte ich nichts mehr von ihm, bis ich eben seine Todesanzeige las.“
Rippach sah nachdenklich aus.
„Da bin ich doch nun neugierig, wen er zum Erben eingesetzt hat. Vielleicht fällt doch ein Teil auf dich.“
Armin lachte herzlich.
„Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Weil du es in deiner Freundschaft für mich wünschest, hältst du es für möglich. Darüber kannst du ruhig schlafen. Er wird uns die schnöde Abweisung nicht vergessen haben. Nun sei so gut und lass mich mit dem Thema zufrieden. Zu viel sprachen wir schon davon.“
„Also dann ein ander Bild. Was tun wir heute abend?“
„Weiss nicht. Gib mal die Zeitung her!“
Armin durchblätterte die Zeitung.
„Opernhaus: Carmen. Da gibt es keine Einlasskarten mehr. Schauspielhaus: Schwur der Treue. Danke, nichts für uns. Deutsches, Lessing-, Berliner-Theater: dasselbe. Komische Oper: Hoffmanns Erzählungen — das wäre etwas. Wollen wir?“
„Hm. Einverstanden.“
Sie zahlten und gingen. Unter den Linden war reger Verkehr. Die kaiserliche Familie wurde von einer Ausfahrt zurückerwartet. Da stauten sich die Menschen.
Als die Freunde bis zu Schulte gekommen waren, sahen sie einen dichten Menschenknäuel vor dem Kunstinstitut stehen um ein Automobil vom Hofe. Gleich darauf kam der Kronprinz mit seinen drei Brüdern heraus von Schulte. Nur Prinz Adalbert fehlte, der zurzeit im Süden weilte.
Lachend und freundlich für die Grüsse dankend, stiegen die Söhne des Kaisers in das Automobil. Es war sehr klein, sie mussten eng zusammenrücken fast aufeinander sitzen. Das machte ihnen Spass und dem angesammelten Volke auch.
Endlich fuhr das Automobil davon. Gleich darauf fuhr auch des Kaisers Automobil über die Linden. Die beiden Majestäten und Prinzess Vittoria sassen darin.
Equipagen und Droschken jagten hintereinander her. Dazwischen Automobile und andere Fahrzeuge. Auf dem breiten Gehweg schoben die Menschen auf und ab. Verkäufer von Zeitungen und grossen Büscheln Veilchen boten ihre Waren an. Es war ein buntes, bewegtes Bild. Leyden und Rippach hatten viel zu grüssen, sprachen auch zuweilen einige Worte mit diesem und jenem Bekannten. Schliesslich nahmen sie einen davon ins Schlepptau, der seinen Abend noch nicht untergebracht hatte. Es war ein junger Offizier, Otto von Sanden.
Mit diesem zusammen suchten sie später das Theater auf.
* * *
Einige Tage später sass Leyden beim Frühkaffee, ehe er ins Amt ging. Seine Wirtin brachte ihm einige Briefe und Drucksachen, die er während des Frühstücks durchsah.
Es war nichts von Bedeutung darunter. Er legte alles schnell beiseite. Nur auf dem letzten Brief ruhte fein Blick länger, trotzdem er nur wenig Worte enthielt.
„Sehr geehrter Herr von Leyden!
In einer dringenden Angelegenheit habe ich mit Ihnen zu verhandeln. Wenn Sie nicht anders bestimmen, werde ich heute nachmittag um drei Uhr in Ihrer Wohnung sein. Hochachtungsvoll
Heinrich Beckmann, Rechtsanwalt.“
Armin schüttelte verwundert den Kopf.
„Kenne ich nicht, diesen Herrn Beckmann. Was gibt er denn für eine Adresse an? Ah hier, Hotel Kaiserhof! Hm! Also um drei Uhr. Das lässt sich machen. Erwarten wir demnach diesen Herrn Rechtsanwalt. Wahrscheinlich irgendeine amtliche Sache mit privatem Anhang.“ So dachte er.
Ruhig beendete er sein Frühstück und ging. — —
Schon vor drei Uhr betrat er seine Wohnung, und pünktlich stellte sich Rechtsanwalt Beckmann bei ihm ein.
Armin lud ihn zum Sitzen ein, nahm ihm gegenüber Platz und fragte artig:
,,Womit kann ich Ihnen dienen, mein Herr?“
Beckmann entnahm seiner Brusttasche ein Schriftstück.
„Bitte, Herr von Leyden, wollen Sie dieses Schriftstück durchsehen. Es ist die Abschrift eines Testaments meines Auftraggebers, Friedrich von Leyden.“
Armin nahm das Papier mit zögerndem Staunen.
„Sie sind beauftragt, mir dies Schriftstück zu überbringen?“
„Ja, von dem Verstorbenen selbst. Aber bitte, nehmen Sie Einsicht, ehe wir weitersprechen.“
Armin las zögernd, mit einiger Befangenheit. Sein Gesicht verriet beim Lesen das ungläubigste Staunen, und plötzlich sprang er auf.
„Herr, das ist ein schlechter Scherz!“ rief er zornig.
Beckmann lächelte.
„Es ist Ernst und volle Wahrheit, Herr von Leyden,“ sagte er nachdrücklich.
Armin strich sich durch das dunkle Haar, lief einige Male hin und her und blieb dann wieder vor Beckmann stehen.
„Ich kann das nicht fassen, nicht glauben. Mich soll Friedrich von Leyden zum Erben seines Besitzes und seines Vermögens eingesetzt haben, mich allein? Warum gerade mich? Ich habe ihm doch nie nahe gestanden.“