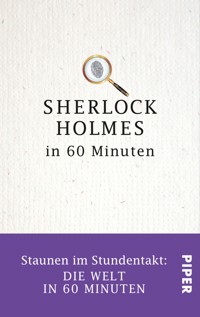6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Amsterdam – Stadt der Tulpen, Stadt des Todes: Amsterdam, 1671. Seltsame Morde an ehrbaren Bürgern erschüttern die Stadt und das Vertrauen in die Obrigkeit, die unfähig scheint, Licht ins Dunkel zu bringen. Jeder Ermordete hält das Blütenblatt einer unbekannten Tulpenart in der Hand: schwarz mit roten Tupfern, die wie Blut aussehen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der »Bluttulpe«, und welche Absicht hinter den Morden? Inspektor Jeremias Katoen, mit der Aufklärung beauftragt, gerät bald zwischen die Fronten von eigenwilligen Tulpenzüchtern und fanatischen Tulpenhassern. Katoen wird klar, dass eine Blume tatsächlich den Tod bringen und sogar die gesamten Niederlande aus den Angeln heben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jörg Kastner
Die Tulpe des Bösen
Roman
Für Corinna Für Dich soll’s tausend Tulpen regnen JK
Die Begebnisse der alten Zeiten schlummern meistenteils in neblichten Schatten; zuweilen schlafen sie in stockdicken Düsternissen; ja oft liegen sie gar als im Tode mit einer tiefen Stille umgeben. Daher ist es sehr mühsam, durch ihren Nebel zu schauen; es ist fast unmöglich, in ihrer Dunkelheit ein Licht zu suchen, ja ihren sprachlosen Leichnam zu finden.
PHILIPP VON ZESEN,
Beschreibung der Stadt Amsterdam (1664)
Die Personen
Joan Blaeu – Kartenmacher und Ratsherr
Henk Bogaert – Büttel
Christoffel, genannt Stoffel – Sargmachergehilfe
Jan Dekkert – Büttel
Jaepke Dircks – Kuppler
Willem van Dorp – Tulpenzüchter
Ebbo – Faktotum von Willem van Dorp
Felix – das »Schlangenkind«
Greet Gerritsen – Witwe und Hauswirtin
Pieter Hartig – Apotheker
Joris Kampen – Büttel
Jeremias Katoen – Amtsinspektor
Balthasar de Koning – Bankier
Noortje – Frau des Büttels Joris Kampen
Dela Oetgens – Nachtläuferin
Claes Pieters – einäugiger Werftarbeiter
Paulus van Rosven – Sohn des Werftbesitzers Jacob van Rosven
Philipp Schuiten – Seilermeister und Ratsherr
Anna Swalmius – Tochter von Sybrandt Swalmius
Sybrandt Swalmius – der Tulpenhasser
Antonius Swildens – Herausgeber des Amsterdamer Volksblattes Barent Vestens – Hauptkontorist des Kartenmachers Joan Blaeu
Geert Willems – Inhaber des Wirtshauses Zu den drei Tulpen
Catrijn van der Zyl – Schwester von Nicolaas van der Zyl
Nicolaas van der Zyl – Amtsrichter
Masse, Währung, Kaufkraft und Löhne in den Niederlanden des siebzehnten Jahrhunderts
Fuß: Ein Fuß entspricht ungefähr dreißig Zentimetern.
Klafter: Ein Klafter besteht aus sechs Fuß.
Pfennig: Der Pfennig war die kleinste Recheneinheit bei der Preisgestaltung, aber es wurde keine entsprechende Münze geprägt. In der damaligen Zeit waren die Münzen verschiedenster Länder im Umlauf, gerade in einem globalen Handelszentrum wie Amsterdam.
Stüber: Ein Stüber entspricht zwölf Pfennigen.
Gulden: Ein Gulden besteht aus zwanzig Stübern.
Ein Krug Bier kostete etwa so viel wie ein Laib Brot, nämlich einen halben Stüber; der Preis eines Halbliterkruges als Gefäß (ohne Bier) betrug fünfzehn Stüber. Ein Bettlaken kostete sechseinhalb Stüber, ein Tisch drei Gulden.
Ein Facharbeiter verdiente im Jahr 150 Gulden, ein Lehrer oder Prediger 200 Gulden, ein Tuchmacher 250 Gulden, ein mittelständischer Kaufmann 1500 Gulden und ein Großkaufmann das Doppelte.
Das alles sind nur Richtwerte, ausschlaggebend waren Zeit und Ort. Eine Stadt wie Amsterdam dürfte ein teureres Pflaster gewesen sein als weite Teile der übrigen Niederlande.
Die Tulpe und die Niederländer
Eher zufällig sollen im Jahre 1562 die ersten Tulpenzwiebeln aus dem Osmanischen Reich in die Niederlande gelangt sein. An Bord eines Handelsschiffes, aus irgendeinem Grund zwischen Tuchballen eingeklemmt. Der überraschte Tuchhändler tat, was man mit Zwiebeln gemeinhin tut: Einen Teil der unbestellten Ware ließ er sich geröstet und mit Essig und Öl angemacht servieren. Das Gericht mundete ihm so gut, dass er die restlichen Zwiebeln in seinem Gemüsegarten in die Erde steckte, um im nächsten Jahr mehr davon essen zu können. Aber daraus wurde nichts, denn im Frühling überraschte ihn in seinem Beet eine farbenfrohe Tulpenpracht – so will es zumindest die Überlieferung.
Fest steht, dass die Tulpe im Verlauf des sechzehnten Jahrhunderts aus dem Osmanischen Raum nach Europa kam und sich schnell ausbreitete. Im Jahre 1570 wurde sie in Augsburg gesichtet, zwei Jahre später in Wien, 1582 in England, 1593 in Frankfurt, 1598 in Südfrankreich. Die Tulpe fand überall Freunde und Bewunderer, nicht so sehr als Nahrungsmittel – obwohl sie dem Gelehrten Carolus Clusius in Zucker eingelegt ganz prächtig gemundet haben soll –, sondern wegen ihrer Schönheit. Die Vielfalt ihrer Formen und besonders Farben hatte es den Bewunderern angetan, vor allem aber die Tatsache, dass die Zwiebeln zuweilen ganz neue Blütenmuster hervorbrachten.
Besonders vernarrt in die Tulpe waren die Niederländer, denen ebenjener Gelehrte Clusius, im Jahre 1593 als Professor für Botanik an die Universität von Leiden berufen, die Blume nahebrachte. Die tüchtigen Niederländer machten aus der Leidenschaft ein Geschäft, und in den folgenden Jahrzehnten nahm der Handel mit Tulpenzwiebeln ungeahnte Ausmaße an, das Land verfiel in ein regelrechtes Tulpenfieber. Für eine einzige Zwiebel einer der seltenen Sorten, die sich durch ein ungewöhnliches Muster auszeichneten, wurden bald tausend, dann fünftausend, ja zehntausend Gulden gezahlt. Für diese Summe wäre schon ein feines Haus in bester Grachtenlage mitten in Amsterdam zu haben gewesen.
Doch im Jahre 1637 fand der Tulpenwahn ein jähes Ende, als die Nachfrage dem Angebot nicht mehr folgte. Immer mehr Spekulanten, die zu Geld gekommen waren, indem sie die Zwiebeln schon weiterverkauften, bevor sie die Ware überhaupt in Händen hielten, blieben auf ihren sündhaft teuer angekauften Beständen sitzen. Große wie kleine Tulpenhändler stürzten gleich reihenweise in die Armut.
Auf einmal stand die Tulpe in einem schlechten Ruf. Zwar gab es weiterhin Liebhaber, die mit ihr Handel trieben, aber die Preise waren fortan gesetzlich reguliert.
Nie wieder würde die Tulpe die Niederlande an den Rand einer Katastrophe bringen – dachte man …
Prolog
Montag, 8. Mai 1671
Am Abend des achten Mai im Jahre des Herrn 1671 verließ Balthasar de Koning das Wirtshaus Zu den drei Tulpen zu später Stunde. Er war guter Laune, weil es ein anregendes Beisammensein gewesen war und weil er nicht wusste, dass dies die Stunde seines Todes sein sollte.
Die Gespräche mit seinen Freunden hatten die Zeit wie im Fluge vergehen lassen, längst hatte die Nacht ihren dunklen Mantel über Amsterdam gebreitet. Ohne die neumodischen Öllampen, die seit dem vergangenen Jahr die Straßen und Grachten der Stadt säumten, wäre der Heimweg beschwerlich gewesen. So aber konnte der angesehene Bankier unbesorgt sein, und der bloße Gedanke an sein Bett ließ ihn gähnen.
Eine frische Brise wehte, und zu de Konings plötzlicher Müdigkeit gesellte sich ein leichtes Frösteln. Während er den Umhang über der Brust zusammenzog, fiel sein Blick auf das Schild der Gaststube, das mit leisem Quietschen im Wind schaukelte: drei ineinander verschlungene Tulpen, eine, wie er trotz der Dunkelheit wusste, mit roten, eine mit gelben und eine mit blauen Blütenblättern.
Einst, als er noch ein junger Mann gewesen war, hatte man ähnliche Schilder fast überall in Amsterdam gesehen. Damals, bevor so viele ehedem brave Bürger ihr Vermögen, wenn nicht gar Haus und Hof, bei der großen Tulpenspekulation verloren hatten. Seither haftete der Tulpe, die doch nichts für all den Wahnsinn konnte, ein Makel an. Aus einer schönen, unschuldigen Blume war eine Unheilsbotin geworden, ja fast eine Monstrosität. Nur noch wenige Gasthäuser trugen sie im Namen, aber Geert Willems, der Wirt der Drei Tulpen, war nach wie vor ein Freund jener besonderen Blume, so wie Balthasar de Koning und die anderen »Verehrer der Tulpe«, die sich jeden Montagabend bei ihm trafen.
Während de Koning den Weg zum Dam einschlug, beglückwünschte er sich dazu, einen Vater gehabt zu haben, dessen gesunder Geschäftssinn nie von ungesunder Gier nach immer noch mehr Reichtum verdrängt worden war. Er selbst war diesem Vorbild gefolgt, und so hatten die de Konings ihr Bankhaus allmählich vergrößern können. Jetzt gehörte es zu den fünf, sechs einflussreichsten der gesamten Niederlande. Er besaß Macht und Einfluss, aber er war sich auch seiner Verantwortung bewusst – für die junge Republik und die Menschen, die in ihr lebten. Es war sein Land, und Amsterdam war seine Stadt.
Mit Wohlgefallen ließ er seinen Blick über die schmalen Backsteinfassaden der Kaufmannshäuser gleiten, die wie die Perlen einer Kette die Grachten säumten. Hier wurde von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang der Wohlstand Amsterdams erwirtschaftet, wurden Güter auf Schleppkähne verladen, Geschäfte besiegelt, ungeduldig Nachrichten über die Schiffe erwartet, auf denen die Waren der Amsterdamer Kaufleute um die halbe Welt reisten. Manches Schiff kehrte nicht zurück, verloren im Sturm, an aufsässige Eingeborene oder englische Piraten, aber das Risiko blieb kalkulierbar, besonders für den, der seine Mittel streute und nicht – wie damals die vom Tulpenwahn Verblendeten – alles auf ein einziges Geschäft setzte.
Den ganzen Tag lang waren die Menschen fleißig, abends erholten sie sich bei Bier und Tabak, bei Musik und Tanz. Balthasar de Koning hatte nichts dagegen, solange sich die Vergnügungen in einem vernünftigen Rahmen hielten. Konnten die Menschen für ein paar Abendstunden die Mühen des Tages vergessen, fiel ihnen das Aufstehen am nächsten Morgen nicht so schwer. Deshalb schmunzelte er nur, als ihm auf der Brücke vor der Zuiderkerk ein paar Angetrunkene begegneten, die inbrünstig, wenn auch in den verschiedensten Tonlagen, ein Lied über die Seefahrt und die Segnungen ferner Gestade schmetterten.
Er blieb stehen, um die wackeren Sänger vorüberzulassen, und setzte dann seinen Weg fort. Am Fuß der Brücke aber hielt er erneut inne, denn dort stand im Schatten eines Mauervorsprungs eine Gestalt, gerade so, dass sie vor dem Licht der Straßenlaternen verborgen blieb. Ob das Zufall oder Absicht war, vermochte er nicht zu sagen, gab es in Amsterdam doch leider allerlei lichtscheues Gesindel. Während er noch überlegte, ob es ratsam war, lauthals nach der Nachtwache zu rufen, kam Bewegung in die Gestalt, und sie trat vor ihn ins Licht.
Erleichtert stellte de Koning fest, dass er es nicht mit einem finsteren Straßenräuber, sondern mit einer Frau zu tun hatte, die zum Schutz gegen den Wind ein Tuch um ihr Haupt geschlungen hatte. Wollte sich hier eine Nachtläuferin an ihn heranmachen, ihm im Tausch gegen ein paar Stüber ihren Leib anbieten? Doch dann fiel sein Blick auf das lange Messer, das an ihrem Gürtel hing, ein Messer von der Art, wie ehrbare Frauen sie beim Einkauf auf dem Markt dabeihatten, um sich die jeweils benötigte Menge Käse oder Butter abzuschneiden.
»Verzeiht, Mijnheer«, hob die Frau schüchtern an. »Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe mich verlaufen, und diese Betrunkenen eben mochte ich nicht ansprechen.«
De Koning nickte verständnisvoll, doch dann runzelte er zweifelnd die Stirn. »Ihr habt Euch verlaufen, Mevrouw? Aber Ihr steht geradewegs neben der Zuiderkerk! Von hier aus sollte jeder Bürger Amsterdams seinen Weg finden.«
»Das mag sein, doch es nützt mir nichts, weil ich fremd bin in Amsterdam. Ich besuche hier meinen Bruder, um seine kranke Frau zu pflegen und mich um die Kinder zu kümmern, bis die Schwägerin wieder auf den Beinen ist.«
»Und wo müsst Ihr hin?«
»Zum Dam.«
De Koning hob den rechten Arm und zeigte in die Richtung, in die er ohnehin wollte. »Wir haben denselben Weg. Erlaubt also, dass ich Euch begleite.«
Die Frau lächelte. »Das wäre mir eine große Hilfe. So ganz wohl ist mir zu dieser späten Stunde nicht, mutterseelenallein in einer fremden Stadt.«
»Jetzt seid Ihr nicht länger allein, Mevrouw. Mein Name ist Balthasar de Koning.«
Er verbeugte sich leicht, und als er sich wieder aufrichtete, sah er dicht vor sich die Klinge ihres Messers aufblitzen.
»Ich weiß, wie Ihr heißt«, sagte die Frau mit seltsam veränderter Stimme und rammte ihm das Messer tief in die Brust.
1. Kapitel: Das Labyrinth bei Nacht
Das Labyrinth war niemals still, nicht einmal in der tiefsten Nacht. Raue Seemannskehlen, gewiss nicht zum Singen geschaffen, grölten unanständige Sauflieder. Musikanten spielten auf und ließen ihre Rohrflöten, Lauten und Drehorgeln um die Wette zetern. Frauen lachten, viel zu laut und viel zu schrill. Alles schien zu singen, zu fiedeln, zu schreien, zu lachen, selbst die Wände. In Jeremias Katoens Vorstellung war das Labyrinth ein lebendiges Wesen, ein Tier von gigantischen Ausmaßen, das atmete, das fraß, das soff, das nie zur Ruhe kam. Es ernährte sich von jenen, die hier nach geistloser Zerstreuung und billigem Vergnügen suchten, saugte sie mit ihren kleinen Sehnsüchten und nichtigen Begehrlichkeiten in sich auf und spie sie als ausgelaugte Hüllen seelenlosen Fleisches wieder aus.
»Ich glaube, da kommen sie«, sagte Jan Dekkert, der durch das winzige Fenster nach draußen spähte, auf die düsteren Gassen des Labyrinths.
Das Labyrinth – so nannten sie das unübersichtliche Gewirr enger, verwinkelter Gassen am Hafen, wo sich Spelunke an Spelunke reihte und ein ehrbarer Bürger binnen einer Nacht sein Geld, seine Ehre und leicht auch sein Leben verlieren konnte.
Hier war ein Menschenleben nicht mehr wert als einige Stüber, ein paar Becher Bier oder einen Krug Anisschnaps.
Katoen schob Dekkert sanft beiseite und blickte selbst nach draußen. Drei Personen näherten sich dem Haus, zwei Männer und eine Frau. Die Frau hatte sich bei einem der Männer eingehängt, flötete ihm etwas ins Ohr und strich mit der freien Hand über seinen Unterleib. Vergeblich bemühte sich Katoen, die Gesichter der drei zu erkennen.
Seit dem vergangenen Jahr gab es Straßenlaternen in Amsterdam, fast zweitausend an der Zahl, aber hier, am Rande der Stadt, herrschte weiterhin die altbekannte Finsternis. Es schien, als sträube das Labyrinth sich gegen jede Veränderung, als zöge es seine schmalen Gassen noch enger zusammen, damit kein unerwünschter Lichtschein auf das allnächtliche wüste Treiben fiel.
Auf der anderen Seite der Gasse befand sich ein Musico, ein Musiklokal namens Der Goldene Hahn, aus dem die leiernde Melodie einer überbeanspruchten Drehorgel herübertönte. Der helle Schein, der durch die großen Fenster des Lokals nach draußen fiel, beleuchtete für einen Augenblick auch die drei späten Fußgänger. Die Frau war etwas zu massig, etwas zu alt, und ihr Gesicht war etwas zu aufgedunsen, als dass ein Mann mit klarem Verstand an ihr hätte Gefallen finden können. Aber ihr Begleiter war nicht bei klarem Verstand, das zeigte sein schwankender Schritt. Er hatte genug intus, um auch die hässlichste Nachtläuferin noch schön zu finden. Seine saubere, ordentliche Kleidung verriet, dass er nicht in dieses Viertel gehörte. Ein ehrbarer Handwerker oder Kaufmann, den der Wunsch nach etwas Ablenkung vom harten Tagewerk hierher getrieben hatte. Gewiss hatte der andere Mann ihm die Erfüllung seines Wunsches in Aussicht gestellt. Er war sehr groß und kräftig – und ganz Herr seiner Sinne. Das breite, knochige Gesicht wirkte angespannt, obwohl er den Betrunkenen anlächelte und ihm irgendeinen Scherz zurief, der für Katoen jedoch im leiernden Singsang der Drehorgel unterging.
Katoen wandte sich seinem Gehilfen zu, der ihn erwartungsvoll ansah. »Sie sind es tatsächlich, Jaepke Dircks und die Dicke Dela. Mit einem Fisch an der Angel, der offenbar mit Freuden angebissen hat.«
»Ja, ganz freiwillig«, sagte Dekkert. »Eigentlich ist es ungerecht, dass wir uns wegen ein paar vergnügungssüchtiger Saufbrüder die Nacht um die Ohren schlagen.«
»Vergnügungssucht ist kein Verbrechen, jedenfalls nicht vor dem weltlichen Gesetz, Diebstahl dagegen schon. Und da einer der Geprellten ein guter Freund des Amtsrichters ist, wie van der Zyl mir zu verstehen gegeben hat, sollten wir dem Treiben ein Ende bereiten, wenn wir nachts wieder in Frieden schlafen wollen.«
Insgesamt vier Männer hatten sich bei den Behörden darüber beschwert, dass ihnen ihr sämtliches Geld gefehlt habe, als sie dieses Haus nach ein paar vergnüglichen Stunden, wie einer von ihnen es genannt hatte, verließen. Vermutlich gab es noch mehr Bestohlene, aber so manchen mochten die näheren, so »vergnüglichen« Umstände der Tat davon abhalten, die Sache zur Anzeige zu bringen.
Katoen hatte kein Mitleid mit ihnen. Erwachsene Männer sollten wissen, worauf sie sich einließen. Wer sich in den brodelnden Strudel des Labyrinths begab, musste damit rechnen, unterzugehen. Aber als einer der Amtsinspektoren der Stadt Amsterdam hatte er den Befehlen des Amtsrichters Folge zu leisten. Außerdem war er neugierig und wollte herausfinden, wie Dircks und seine Dirne vorgingen. Keiner der Bestohlenen, die bei den Behörden vorstellig geworden waren, hatte etwas von dem eigentlichen Vorgang des Diebstahls bemerkt. Erst hinterher hatte ein jeder von ihnen feststellt, dass der Platz seiner Börse nur noch von leerer Luft ausgefüllt wurde.
Die beiden Männer und die Frau verschwanden im Eingang des Hauses und damit aus Katoens Blickfeld. Dafür waren sie jetzt umso deutlicher zu hören, als sie lärmend die Treppe heraufkamen und schließlich vor der Tür des Nebenraums stehen blieben. Ein Schlüssel wurde herumgedreht, und die Tür nebenan schwang mit einem hellen Quietschen auf.
Katoen nahm einen der beiden wackligen Stühle, die zusammen mit einem Tisch und einem Bett von ähnlich zweifelhafter Qualität die ganze Einrichtung des Mietzimmers darstellten, und rückte ihn an die Wand zum Nebenraum. Er setzte sich und beugte sich vor, bis er durch das kleine Loch sehen konnte, das Dekkert eine Stunde zuvor in das zwar dicke, aber morsche Holz gebohrt hatte. Es war ihr Glück, dass hier am Hafen noch viele alte Häuser standen, bei deren Bau man hauptsächlich Holz verwendet hatte. Neue Gebäude mussten in Amsterdam schon seit vielen Jahren aus Backstein er richtet werden, um die Gefahr einer Feuersbrunst zu verringern.
Im Nebenzimmer entzündete Jaepke Dircks die Flamme einer kleinen Lampe, die neben einer bauchigen Flasche und drei schmucklosen Steingutbechern auf dem einzigen Tisch stand. Dann nahm er die Flasche und füllte sämtliche Becher.
»Auf Euer Wohl, Mijnheer! Trinkt nur, der gute Genever hier geht auf mich!«
Die Dicke Dela, im Trinken geübt, hatte ihren Becher als Erste geleert und machte sich nun an den Kleidern ihres Freiers zu schaffen, wobei Katoen nicht ganz klar war, ob ihre leicht fahrigen Bewegungen der Erregung oder dem Entkleiden des Mannes dienen sollten. Der jedenfalls fühlte sich offenbar überrumpelt und stolperte zwei Schritte zurück.
Dircks stellte lachend seinen Becher ab. »Nicht so eilig! Erst das Geschäft und dann das Vergnügen. Über den Preis waren wir uns ja einig, Mijnheer. Wenn Ihr also so gütig wärt?«
»Aber selbstverständlich«, sagte der Freier mit schwerer Zunge, stieß einen mächtigen Rülpser aus und kramte einen ledernen Beutel hervor; ein paar Münzen wanderten in die Hände des Kupplers. »Dreißig Stüber, wie abgesprochen.«
Dircks ließ die Münzen in einer Tasche seines Wamses verschwinden und zeigte auf das Bett im hinteren Teil des Zimmers. »Macht es Euch nur bequem, Mijnheer, damit Dela Euch verwöhnen kann. Ihr werdet es nicht bereuen.«
Der Freier steckte die Börse zurück unter sein Wams. Halb aus eigenem Antrieb, halb von Dela gezogen, fiel er aufs Bett, und die Nachtläuferin zog ihm die Hose herunter bis auf die Waden. Ihre kräftigen Hände packten sein Geschlecht und rieben es.
Er schloss die Augen. Sein Atem ging heftiger, und in regelmäßigen Abständen grunzte er wohlig. Die Hure fuhr fort, mechanisch wie ein Uhrwerk, bis der Mann sein Glied steif und fest in die Höhe reckte.
Jaepke Dircks saß die ganze Zeit über am Tisch, nippte hin und wieder an seinem Genever und sah dem Treiben auf dem Bett gelangweilt zu. Wenn Katoens Verdacht zutraf, sah er Ähnliches Abend für Abend, und die dreißig Stüber Hurenlohn waren das wenigste, was er daran verdiente.
Die Dicke Dela ließ für einen Moment von dem Freier ab und raffte ihre Röcke, bis ihr bloßes Hinterteil zum Vorschein kam. Und was für ein Hinterteil! Zwei mächtige rosige Fleischkugeln, deren Gewicht Katoen lieber nicht zu schätzen versuchte.
Dekkert, der die ganze Zeit über auf dem zweiten Stuhl neben ihm gesessen hatte, beugte sich vor und flüsterte Katoen ins Ohr: »Was habt Ihr denn? Ihr seht so erschrocken aus.«
»Ihr wärt auch erschrocken, hätte man Euch zwei solche Schinken präsentiert«, erwiderte Katoen, ebenfalls im Flüsterton.
»Schinken?« Dekkerts Augen wurden groß, und er strich sich über den Bauch. »Das erinnert mich daran, dass ich schon seit Stunden nichts mehr gegessen habe.«
Im Nebenraum hatte die Nachtläuferin mit erstaunlicher Behändigkeit ihren schweren Leib auf den Freier geschwungen und begann, sich auf und nieder zu bewegen, in einem Rhythmus, den die Erfahrung aus tausend anderen Nächten sie gelehrt hatte. Der Mann grunzte lauter, und sein Unterleib schloss sich ihrem Rhythmus an.
»Gut macht Ihr das!«, stöhnte Dela ohne echte Begeisterung. »Keiner macht das so gut wie Ihr!«
Ein zweifaches Grunzen war die Antwort.
Sie erhöhte die Geschwindigkeit des Auf und Abs, und ihr breiter Hintern klatschte wieder und wieder auf die Oberschenkel des Mannes. Sein Grunzen ging in ein fortwährendes Stöhnen über, als er sich aufbäumte und an Delas runden Armen festkrallte. Mit geweiteten Augen blickte er zur schimmeligen Zimmerdecke, während er seinen so mühevoll hervorgeholten Samen in den Schoss der Nachtläuferin ergoss.
»Endlich«, sagte Katoen kaum hörbar. Er fand dieses Treiben abstoßend; ihm wäre es am liebsten gewesen, man hätte sämtliche Dirnen aus Amsterdam verbannt.
Als ihr Freier sich beruhigt hatte, beendete die Dicke Dela ihre Anstrengungen. Sie rutschte von dem Mann herunter und legte sich neben ihn. Zum Glück, wie Katoen fand, rutschten dabei ihre Röcke über den wuchtigen Hintern. Mit einem fleckigen Taschentuch, das sie zwischen ihren Brüsten hervorgezogen hatte, betupfte sie die schweißnasse Stirn des Mannes.
»Ihr wart wunderbar«, flötete sie. »Noch niemand hat es mir so gut besorgt wie Ihr.«
Er murmelte etwas, das sich anhörte wie »leider schon vorbei«, und traf Anstalten, aus dem Bett zu steigen. Schnell zog Dela ihn zurück und hielt ihn fest.
»Aber Ihr wollt doch nicht schon gehen! Die Nacht ist noch jung. Ruht Euch ein wenig aus, und danach dürft Ihr noch einmal. Keine Sorge, das ist im Preis enthalten.« Während sie sprach, entblößte sie eine ihrer schweren, aber längst nicht mehr straffen Brüste und schob sie dem Freier in den Mund. Sanft strich sie ihm über das lichte Haar wie eine Mutter, die ihr Kind wiegt. »Entspannt Euch, Mijnheer. Schlaft ein wenig, damit Eure Kräfte zurückkehren.«
Sie sprach so leise, so sanft, dass Katoen um ein Haar darüber eingenickt wäre. Ihr Freier hielt die Augen geschlossen. Eine Weile nuckelte er an Delas Brust wie ein hungriger Säugling, dann rollte sein Kopf etwas zur Seite und lag still. Sein Unterleib war noch immer nackt, und sein erschlafftes Geschlecht wirkte nun geradezu kümmerlich. Er schien tatsächlich zu schlafen, woran der reichlich genossene Schnaps vermutlich die Hauptschuld trug.
Dela hob den Kopf und sah zu dem Kuppler hinüber, der ihr aufmunternd zunickte. Daraufhin streckte sie ihre rechte Hand zum Kopfende des Bettes aus, krümmte den Zeigefinger und klopfte mit dem Knöchel leise gegen die Wand, wobei sie offenbar einen bestimmten Takt einhielt.
Keine halbe Minute später tat sich in der Wand ein Loch auf, aus dem sich etwas hervorzwängte und lautlos ins Zimmer glitt. Jeremias Katoen hatte in seinen vielen Jahren als Ordnungshüter schon so einiges gesehen, aber bei diesem Anblick schlug sein Herz schneller. Das Licht der Tranfunzel war zu schwach, als dass er hätte erkennen können, was dort aus der Wand gekommen war. Ein Lebewesen zweifelsohne, aber ob Mensch oder Tier, das blieb im Schatten jenseits des Bettes verborgen. Konnte das überhaupt ein menschliches Wesen sein? Das Loch in der Wand war bei Weitem nicht groß genug für einen Erwachsenen, und selbst ein Kind konnte dort nicht hindurchpassen, wenn es nicht gerade ein Säugling war.
Vorsichtig durchsuchte die Dicke Dela die Kleider ihres Freiers, bis sie endlich seine Geldbörse in der ausgestreckten Hand hielt. Mit einer flinken Bewegung schnappte das Wesen, das jenseits des Bettes am Boden kauerte, die Börse. Das geschah mit einer solchen Schnelligkeit, dass Katoen nicht sah, ob eine menschliche Hand oder eine Klaue nach dem Lederbeutel gegriffen hatte. Das Wesen glitt zurück in das Loch und verschloss es, vermutlich durch einen simplen Mechanismus.
Die Nachtläuferin hatte ihre Aufgabe erfüllt und wälzte sich aus dem Bett, das unter ihrem Gewicht bedenklich ächzte. Ihr Opfer drehte den Kopf etwas, hielt die Augen aber weiterhin geschlossen. Der wohlige Schlaf des Berauschten und Erschöpften hatte ihn fest im Griff.
Katoen sprang auf und zischte: »Es ist so weit, Dekkert. Gebt Kampen Bescheid!«
Dekkert eilte ans Fenster und riss es auf, um mit einem halblauten Zuruf seinen Kollegen auf der Straße zu alarmieren, der sich in einem engen Durchgang neben dem Goldenen Hahn versteckt hielt. Derweil nahm Katoen die beiden Doppelpistolen vom Tisch und überprüfte sie, bevor er eine an Dekkert weiterreichte. Sie liefen hinaus auf den Gang, und im selben Moment öffnete Jaepke Dircks die Tür des Nachbarzimmers.
Er staunte nicht schlecht, als er in vier Pistolenläufe blickte, stellte sich aber rasch auf die neue Situation ein und zwang sich sogar zu einem Lächeln. »Oh, bin ich etwa in fremdem Revier unterwegs, Freunde? Seid gewiss, dass ich euch nicht zu nahe treten wollte. Wir können uns sicher einig werden.«
Seine rechte Hand glitt in eine Tasche des dunklen Wamses.
»Lass die Hand, wo sie ist!«, befahl Katoen. »Sonst schieße ich sie dir in Fetzen!«
Dircks lächelte noch immer, aber ein heftiges Zucken in seinen Augenwinkeln verriet, wie angespannt er wirklich war. »Ihr missversteht mich, Freunde. Ich wollte meine Börse hervorziehen, um meine Einnahmen mit euch zu teilen. Ich wusste nicht, dass dieses Gebiet schon besetzt ist. Wenn ich’s mir recht überlege, könnt ihr auch alles haben. Als kleine Entschädigung für den Ärger, den ihr durch mich hattet.«
»Wir sind nicht deine Freunde«, knurrte Katoen. »Ich bin Inspektor Jeremias Katoen, Beauftragter des Amtsrichters von Amsterdam, und das ist mein Büttel Jan Dekkert.«
»Trotzdem könnt ihr meine Einnahmen haben, und ich lege sogar noch was drauf. Ich weiß doch, dass die Leute des Amtsrichters nicht gerade üppig bezahlt werden.«
Dircks zeigte mit dem Daumen auf die Nachtläuferin, die, eine Brust noch immer entblößt, hinter ihn getreten war und mit jedem Atemzug eine Wolke billigen Fusels ausstieß. »Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch mit der Dicken Dela vergnügen, ganz umsonst. Einer nach dem anderen oder beide zugleich, wie es euch beliebt.«
»Was sind ’n das für Kerle?«, fragte Dela. »Noch mehr Arbeit diese Nacht?«
»Schnauze!«, fuhr der Kuppler sie an.
Katoen nahm Dekkert die doppelläufige Radschlosspistole ab, und der junge Büttel legte den beiden eiserne Handfesseln an, wobei er Dircks’ rechte an Delas linke Hand schloss. Anschließend durchsuchte er sie und zog einen Dolch mit langer, spitz zulaufender Klinge aus Dircks’ Stiefelschaft. Außerdem nahm er die gut gefüllte Börse des Kupplers an sich, bevor Katoen ihm die Pistole zurückgab.
Der Freier war durch den Lärm geweckt worden. Er rieb mit dem Unterarm über seine Augen und wälzte sich stöhnend aus dem Bett. Da er nicht an seine heruntergezogene Hose dachte, brachten ihn die ersten Schritte zu Fall. Er fluchte laut, rappelte sich auf und zog die Hose hoch. Katoen schätzte ihn auf fünfundvierzig bis fünfzig. Vermutlich warteten zu Hause eine Frau und eine Horde Kinder auf ihn. Die Augen des Mannes verengten sich zu Schlitzen, während er die Situation zu erfassen versuchte.
Bevor er noch eine Frage herausbrachte, erklärte Katoen: »Man hat Euch bestohlen, Mijnheer, Eure Börse ist weg.« Mit der linken Hand deutete er auf das traurige Hurenzimmer. »Das hier ist eine Falle.«
Jetzt schien der Mann hellwach zu sein. Hastig tastete er sein Wams und die Weste nach der Börse ab.
»Vielleicht kann ich Euch Euer Geld wiederbeschaffen«, fuhr Katoen fort. »Wartet hier!«
Während Dekkert bei den Gefangenen und dem bestohlenen Freier blieb, verließ Katoen das Haus. Viele Zimmertüren, die bei dem Lärm einen Spaltbreit geöffnet worden waren, wurden rasch geschlossen, als er an ihnen vorbeiging. Hier gab es noch mehr lichtscheues Gesindel und wohl auch manch braven Bürger auf Abwegen, und niemand legte Wert darauf, dem Amtsinspektor zu begegnen.
Draußen in der engen Gasse wurde die salzige Brise, die landeinwärts blies, überlagert von den Gerüchen des Unrats von Mensch und Tier. Das Labyrinth war eine der übelsten Gegenden von Amsterdam, und genau so stank es hier auch. Katoen hätte am liebsten die Luft angehalten.
»Hierher!«
Der Ruf kam von links. Katoen erkannte die etwas schrille Stimme von Joris Kampen. Der Büttel stand in dem Durchgang neben dem baufälligen Haus, aus dem Katoen gerade gekommen war, und winkte. Als Katoen nähertrat, sah er, dass Kampen seine Pistole auf einen Bretterverschlag am Ende des Durchgangs gerichtet hielt. Er wischte sich mit einem Ärmel den Schweiß von der Stirn, und auf seinem breiten, etwas teigigen Gesicht zeichnete sich Erleichterung ab.
»Gut, dass Ihr hier seid, Mijnheer Katoen. Das Ding ist ganz schön flink. Nur der Anblick meiner Pistole hat es davon abgehalten, einfach an mir vorbeizulaufen. Jetzt hockt es in dem Verschlag da. Weiß der Allmächtige, was es gerade ausbrütet.«
»Ein Ding? Wovon redet Ihr?«
»Wenn ich das wüsste! Es ist so düster hier, man kann kaum etwas erkennen. Erst habe ich es für einen Menschen gehalten, dann wieder dachte ich, es sei ein Tier. Eine Raubkatze vielleicht oder ein großer Affe. Jedenfalls war es behände wie ein Tier, als es an der Hauswand entlang kletterte. Wir müssen vorsichtig sein, damit es uns nicht entwischt!«
»Dann holen wir doch die Nachtwache zu Hilfe«, schlug Katoen vor, zog eine hölzerne Rassel hervor und ließ sie mit einer hundertfach geübten Bewegung kreisen.
Der durchdringende Laut rief die Wächter herbei, die bei Nacht in Amsterdams Straßen und Grachten patrouillierten, und bald standen Katoen fast zwei Dutzend Bewaffnete zur Verfügung. Eine der Streifen führte einen Hund mit sich, ein großes Tier mit nachtschwarzem Fell und einem eindrucksvollen Gebiss.
Katoen ließ die Männer vor dem Durchgang eine enge Kette bilden und näherte sich, die Pistole noch immer in der Hand, dem windschiefen Verschlag. Die Bretter waren so nachlässig aneinandergenagelt worden, dass breite Ritzen zwischen ihnen klafften. Dennoch konnte er nicht erkennen, wer oder was sich da drinnen versteckte. In dem Durchgang war es schon dunkel genug, aber in dem Verschlag herrschte völlige Finsternis.
Das Tor war nur angelehnt, ein Schloss gab es nicht. Hier wurden wohl keine Kostbarkeiten aufbewahrt. Die Pistole in der rechten Hand, öffnete er mit der linken vorsichtig das Tor.
Jetzt hörte er leises, hastiges Atmen, wie von einem Tier, das sich, in die Enge getrieben, panikerfüllt in einen dunklen Winkel drückt. Aber das Einzige, was er sah, waren ein paar leere Säcke auf dem Boden.
»Eine Laterne!«, rief er.
Einer der Nachtwächter trat näher, und das flackernde Licht seiner Handlaterne fiel ins Innere des Verschlags. Eine Gestalt hockte zusammengekauert in der hintersten Ecke. Wie eine Schnecke, die sich in ihr Haus zurückgezogen hat, dachte Katoen. Doch dieses Wesen hatte kein Haus, in das es sich verkriechen konnte. Es war vollkommen nackt. Arme und Beine waren dünn, geradezu dürr, und wirkten ebenso zerbrechlich wie der schmale Leib. Von dem in den Händen verborgenen Kopf war nur das lange Haar zu sehen, dunkel und verfilzt, verdreckt wie der ganze Körper.
Vor Katoen hockte ein menschliches Wesen, ein Kind, ein Junge von vielleicht acht oder neun Jahren. Niemals zuvor war der Inspektor einem Erdensohn begegnet, der ihn mehr an ein wildes Tier erinnert hätte. Schuld daran war nicht allein der Schmutz. Die ganze Haltung des sehnigen Körpers war die eines Tieres, und die Augen, die ihn jetzt zwischen den vor dem Gesicht gespreizten Fingern hindurch ansahen, schienen keine menschliche Regung zu spiegeln. Was Katoen in ihnen las, waren nur die Angst des gestellten Wildes und das verzweifelte Sinnen auf einen Ausweg.
Der Junge hatte die Arme um die Knie geschlungen, eine Hand umklammerte die gestohlene Börse – die Beute des Raubtiers. Mit der freien Hand zeigte Katoen auf den Lederbeutel.
»Gib mir den Beutel, Junge!«
Er sprach ruhig, aber mit Nachdruck. Der Junge aber rührte sich nicht, sondern starrte nur ängstlich auf die Doppelmündung der auf ihn gerichteten Pistole. Katoen senkte den Zwillingslauf.
»Ich will dir nichts tun. Aber du musst mir den Beutel geben, er gehört dir nicht!«
Ganz langsam bewegte sich der Junge, und schließlich hielt eine zitternde Hand den Beutel hoch. Katoen nahm ihn an sich, steckte ihn ein und wollte dann nach der Hand des Jungen greifen. Doch der zuckte zusammen und zog die Hand blitzschnell zurück.
»Nicht!«, wimmerte er. »Nicht schlagen, bitte!«
»Ich werde dich nicht schlagen. Niemand wird dich schlagen, das verspreche ich dir. Aber du musst jetzt nach draußen kommen!«
Katoen trat ein paar Schritte zurück, bis er außerhalb des Verschlages stand. Vielleicht fühlte der Junge sich so weniger bedroht. Tatsächlich erhob sich der kleine Dieb schwankend, und jetzt erst erkannte Katoen, wie mager er wirklich war. Dennoch war ihm schleierhaft, wie der Junge durch das kleine Loch in der Wand gepasst hatte. Er nahm sich vor, das noch eingehend zu untersuchen.
Mit vorsichtigen Schritten kam der nackte Junge, am ganzen Leib zitternd, nach draußen, in den vollen Schein der Laterne.
Während Katoen noch überlegte, wo er ein paar Kleider für den Knaben herbekam, überstürzten sich die Ereignisse. Der Hund riss sich von dem Wächter los, der ihn an der Leine gehalten hatte, und sprang unter lautem Gebell auf den Verschlag zu. Dabei rannte er den Mann mit der Laterne einfach über den Haufen. Er streifte auch Katoen, und das mit solcher Wucht, dass der Inspektor ins Taumeln geriet.
Ein weiter Sprung, und der Hund landete auf dem Jungen und riss ihn mit sich zu Boden. Sie überschlugen sich, und es sah nach einem Ringkampf aus. Aber der Junge hatte der Bestie nichts entgegenzusetzen. Das Tier drückte ihn zu Boden und öffnete sein geiferndes Maul, um ihm den Hals zu zerfetzen.
Katoen riss die Pistole hoch, hielt sie mit beiden Händen und feuerte beide Läufe gleichzeitig ab.
Die doppelte Explosion war längst verhallt, als der Pulverrauch ihm noch Tränen in die Augen trieb. Er fuhr sich mit dem Ärmel übers Gesicht und schaute genauer hin. Vor ihm lagen zwei reglose Gestalten, der Junge und der Hund. Das Blei aus Katoens Pistole, aus solcher Nähe abgefeuert, hatte den Hundeschädel in unzählige Teile zerlegt. Überall klebten Fetzen von Fell und Knochen, auch auf dem nackten Leib des Jungen, der erneut zu zittern begann. Immerhin, dachte Katoen, er lebt!
Er reichte die abgeschossene Pistole Kampen, der mit offenem Mund dastand, und half dem Jungen auf die Beine. Der hatte jetzt, besudelt mit dem Blut und den Überresten des toten Hundes, noch mehr Ähnlichkeit mit einem wilden Tier. Katoen schickte einen der Nachtwächter ins Haus, aus irgendeinem Zimmer eine Decke holen. Wenig später kam der Mann mit einem löchrigen Wollfetzen zurück, den Katoen um die schmalen Schultern des Knaben legte.
Der Nachtwächter, der ursprünglich den Hund an der Leine gehalten hatte, schien nur langsam zu begreifen, was geschehen war. Er trat ein paar Schritte vor und starrte mit aufgerissenen Augen auf die traurigen Überreste des Tieres. Sein anfängliches Entsetzen verwandelte sich in Wut, und er fuhr Katoen an: »Wie konntet Ihr das tun? Ihr habt ihn einfach erschossen, meinen Hans!«
»Der Hund hätte den Jungen zerfleischt.«
»Na und? Mein Hans war ein wertvolles Tier, viel wertvoller als dieser Gossenjunge. Der ist doch auch nicht mehr als ein Tier!«
Das Kind ließ nicht erkennen, ob es sich von den Worten des Nachtwächters getroffen fühlte. Vermutlich hatte es in seinem kurzen Leben schon ganz andere Beschimpfungen über sich ergehen lassen.
»Dies ist ein Mensch«, erwiderte Katoen, »Euer Hans dagegen war ein Tier, ein gefährliches obendrein. Ihr hättet besser auf ihn aufpassen müssen, Mann! Soll ich einen Bericht darüber schreiben, dass der Hund sich aufgrund Eurer Nachlässigkeit losreißen konnte und erschossen werden musste?«
Katoen war laut geworden, und der Nachtwächter wich unter seinen Worten zurück wie unter Peitschenhieben.
»Nein, schon gut«, sagte er kleinlaut und ging zu seinen Kameraden zurück.
Katoen beachtete ihn nicht weiter und wandte sich wieder dem Jungen zu, der noch immer am ganzen Leib zitterte. »Wie heißt du?«
Die Augen unter dem verfilzten Haar musterten den Amtsinspektor mit einer Mischung aus Furcht und Ratlosigkeit; es schien, als wüsste das Kind seinen eigenen Namen nicht. Zweimal wiederholte Katoen seine Frage, doch er erhielt keine Antwort. War der Junge nur so verängstigt, dass es ihm die Sprache verschlagen hatte, oder konnte es tatsächlich sein, dass er nicht wusste, wer er war?
Katoen, der vor dem Jungen in die Hocke gegangen war, erhob sich seufzend. »Also gut, dann werde ich dich Felix nennen. Felix, der Glückliche. Denn heute hast du Glück gehabt, wie mir scheint, und ich hoffe, dass dir glücklichere Zeiten bevorstehen, als du wohl hinter dir hast.«
Im Keller unter dem Neuen Rathaus roch es nach Schweiß und Exkrementen, nach Verderbnis und Furcht. Schon viele hatten hier ihre Untaten gestanden, und Jaepke Dircks würde keine Ausnahme machen, da war Jeremias Katoen sicher. Joris Kampen holte zum nächsten Schlag aus, das Leder zischte kurz durch die Luft und fraß sich mit einem klatschenden Geräusch in das Fleisch des Kupplers. Ein blutiger Striemen mehr auf seinem Rücken, und Dircks schrie auf, während er sich vor Schmerz wand.
Das Amsterdamer Recht erlaubte zwar nur, bereits Verurteilte auszupeitschen, aber hier unten nahm das niemand so genau. Die Peitsche war oft das einzige Mittel, einen verstockten Strolch zum Reden zu bringen. Jeder wusste das, und niemand störte sich daran. Nicht von ungefähr wurde dieser Ort gemeinhin Geißelkeller genannt.
Katoen packte den Gefangenen bei seinem hellen Schopf und zog seinen Kopf unsanft nach hinten, bis er in das schweißnasse Antlitz sehen konnte. Die Wut, die er in Dircks’ Blick las, wog nichts gegen den Schmerz. Kein Zweifel, die Peitsche hatte den Willen des Mannes gebrochen.
»Ich habe den Eindruck, du willst jetzt reden. Oder?«
Dircks atmete schwer, und seine Lippen zitterten; Blut quoll aus der Unterlippe, auf die er sich vor Schmerz gebissen hatte. »Was bleibt mir übrig? Sonst schlägt Euer Büttel mich in Fetzen. Was wollt Ihr wissen?«
»Ich will ein Geständnis, Kuppler. Ich glaube dir nicht, dass du heute Abend zum ersten Mal einen Freier beraubt hast. Der geheime Zugang zu dem Zimmer – das ist viel zu viel Aufwand für eine einmalige Geschichte.«
Noch immer war es Katoen ein Rätsel, wie der Junge, den er Felix genannt hatte, sich da hatte durchzwängen können. Er hatte den Schacht in Augenschein genommen, soweit das von den beiden Zugängen her möglich war, und hätte schwören können, dass selbst dieser magere Junge da nicht hindurchpasste.
»Also gut, ich gebe es zu. Es war nicht das erste Mal.«
»Sondern?«
»Ich habe nicht mitgezählt. Neun oder zehn Männer haben es wohl mit Dela getrieben, seit mir das Schlangenkind gehört.«
»Das Schlangenkind?«
»Der Junge.«
»Wie ist sein Name?«
»Keine Ahnung, ist doch auch gleichgültig. Der alte Schausteller, von dem ich ihn gekauft habe, hat ihn Schlangenkind genannt, weil er sich winden kann wie eine Schlange. Der kommt überall durch, so was habe ich vorher noch nie gesehen.«
»Und das hat dich auf die Idee gebracht, nicht nur die Dicke Dela zu verkuppeln, sondern ihren Freiern gleich das ganze Geld abzunehmen. Und wenn einer seine Börse vermisst hat, konnte er Dela und dich ruhig durchsuchen. Ihr beide hattet nichts zu befürchten.«
»Ja, genau so.« Dircks verzog seinen Mund zu einem unangemessen wirkenden Grinsen. »Vielen Dank auch, Herr Amtsinspektor.«
»Wofür?«
»Wie ich hörte, habt Ihr einen Eurer eigenen Hunde erschossen, um den Jungen zu retten. Dafür bin ich Euch dankbar, der dreckige kleine Bengel hat mich nämlich fünfeinhalb Gulden gekostet.«
»Ich wette, er hat dir ein Vielfaches davon eingebracht.« Das Flackern in den Augen des Gefangenen bestätigte Katoen in seiner Vermutung. »Nun, damit ist es vorbei, Dircks. Der Junge untersteht ab sofort der Obhut der Obrigkeit.«
»Der Obhut der Obrigkeit?« Dircks wiederholte das ganz langsam. »Was heißt das?«
»Ich habe ihn ins Waisenhaus gebracht.«
Katoen wurde den Anblick des Jungen beim Abschied nicht los. Seit der Hund ihn angefallen hatte, war Felix stumm geblieben. Widerstandslos hatte er sich zum Waisenhaus bringen lassen, aber als Katoen sich zum Gehen wandte, hatte der Junge ihn angeschaut wie ein Ertrinkender die ausgestreckte Hand eines Retters. Er würde es vielleicht schwer haben in der ersten Zeit, aber im Waisenhaus war er hundertmal besser aufgehoben als bei Dircks oder im Rasphuis, dem Amsterdamer Zuchthaus für Männer und Jungen.
»Dazu hattet Ihr kein Recht!«, krächzte Dircks. »Das Schlangenkind gehört mir!«
»Du willst deine schmutzigen Geschäfte mit dem Jungen wohl lustig weiterführen, was?«
Dircks wollte ihm etwas an den Kopf werfen, Widerworte oder eine Beschimpfung, wie sein Mienenspiel verriet, besann sich dann aber und sagte ruhig, nicht ohne einen beißenden Unterton: »Nein, natürlich nicht, ich bin doch ein reuiger Sünder.«
Diese Dreistigkeit trug ihm einen weiteren Peitschenhieb ein, und Katoen hatte nichts dagegen, dass sein Büttel das Leder schwang. Solches Gesindel verdiente keine Rücksicht. Aber der Schmerz würde vergehen und, so befürchtete der Amtsinspektor, keinen dauerhaften Eindruck bei dem Kuppler hinterlassen.
Katoen legte Kampen eine Hand auf die Schulter. »Wir können jetzt Schluss machen und uns etwas Schlaf gönnen. Die Nacht ist bald vorbei.« Zu Dircks gewandt, sagte er: »Und du vergiss nicht, dein Geständnis morgen vor dem Richter zu wiederholen!«
Dircks bedachte ihn mit einem Blick, der zu sagen schien: Dir wünsch ich alle Übel dieser Welt an den Hals.
2. Kapitel: Der Tote an der Zuiderkerk
Dienstag, 9. Mai 1671
Es war ein Fehler gewesen, erst noch seine Amtsstube im Rathaus aufzusuchen und dort mit Jan Dekkert etwas von dem Heidelbeerschnaps zu trinken, den er letzte Woche aus Utrecht mitgebracht hatte. Als Joris Kampen eintrat und ganz entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten den angebotenen Trunk ablehnte, fragte Katoen sich augenblicklich, ob er in dieser Nacht noch Schlaf finden würde.
»Eben ist ein Bote vom Amtsrichter eingetroffen«, meldete Kampen. »Ihr sollt sofort zur Zuiderkerk kommen. Dort ist ein Mord geschehen.«
Katoen leerte seinen Becher und leckte die letzten Tropfen der rotblauen Flüssigkeit, die ihn mit angenehmer Wärme erfüllte, von seinen Lippen. »Wer hat wen ermordet?«
Ratlos hob Kampen die Hände an. »Ich weiß es nicht, Inspektor.«
»Würde man den Täter kennen, wäre Eure Anwesenheit kaum erforderlich«, sagte Dekkert und konnte ein schadenfrohes Grinsen nicht unterdrücken.
»Unsere Anwesenheit, meine Herren«, korrigierte Katoen und erwiderte Dekkerts Grinsen. »Was wäre ich ohne meine beiden wackeren Büttel?«
Mitternacht war längst vorüber, als sie den schlanken, hohen Turm der Zuiderkerk vor sich auftauchen sahen. Dem Inspektor kam er vor wie der mahnend in den Nachthimmel gereckte Zeigefinger eines Riesen. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn, die unbestimmte Ahnung von einer großen Gefahr, die in den Schatten des nächtlichen Amsterdam zu lauern schien. Vielleicht, versuchte er sich zu beruhigen, bin ich einfach nur übermüdet.
Schon von Weitem sah er, dass in der Nähe der Kirche, die Hendrik de Keyser im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts als erstes protestantisches Gotteshaus der Stadt erbaut hatte, etwas Ungewöhnliches vorgefallen war. Eine große Anzahl von Menschen hatte sich dort versammelt, darunter viele Nachtwächter, ausgerüstet mit Laterne und Spieß. Sie erkannten den Amtsinspektor und bildeten, ohne dass er sie dazu hätte auffordern müssen, eine Gasse für ihn und seine Büttel, bis sie vor dem Amtsrichter standen.
Nicolaas van der Zyl war ein beeindruckender Mann, allein schon durch seine Größe. Katoen hätte sich selbst nicht gerade als klein beschrieben, aber der Amtsrichter überragte ihn um Haupteslänge. Van der Zyls scharfe Gesichtszüge und die lange, leicht gebogene Nase verliehen ihm eine Strenge, die schon so manchem Angeklagten die Knie hatten zittern lassen. Zu dieser späten – oder frühen – Stunde wirkte er allerdings eher abgekämpft und besorgt. Katoen zog seinen federgeschmückten Hut, und der Amtsrichter erwiderte den Gruß mit einem kurzen Nicken.
»Gut, dass Ihr so rasch gekommen seid, Inspektor. Ich hatte gehofft, dass mein Bote Euch noch im Rathaus antrifft.«
»Ja, wir haben den Kuppler Dircks auf frischer Tat ertappt, und Freund Kampen hier vermochte ihm mit der Peitsche ein Geständnis zu entlocken.«
»Schön, schön«, murmelte van der Zyl und schien dem Fall, mit dem er Katoen doch selbst betraut und auf dessen Dringlichkeit er gepocht hatte, kaum noch Bedeutung beizumessen. »Kuppelei und das Berauben von Freiern ist eine Sache, Mord eine andere. Und gar ein Mord wie dieser. Seht doch, zwei Nachtwächter haben die Leiche vor einer Stunde gefunden!«
Der Richter trat zur Seite und gab den Blick frei auf einen wuchtigen Körper, der vor einer kleinen Brücke lag. Die Laterne eines Nachtwächters stand neben dem reglosen Mann auf dem Boden und beleuchtete sein fleischiges Gesicht, das von einem grauen Bart umrahmt wurde. Der Mann hatte seinen Hut verloren, und das graue Haar hing wirr um sein Gesicht. In seinen Augen war kein Leben mehr.
»Den kenne ich«, sagte Katoen leise. »Ist das nicht der Bankier Balthasar de Koning?«
»Ganz recht«, bestätigte van der Zyl mit düsterer Miene.
Schlagartig begriff Katoen die Schwere des Vorfalls. De Koning war einer der einflussreichsten Männer Amsterdams, wenn nicht der ganzen Niederlande, gewesen. Kein Wunder, dass der Amtsrichter höchstpersönlich an den Ort des Geschehens geeilt war.
Van der Zyl trat dicht neben Katoen und sagte leise, sodass niemand außer dem Inspektor es verstehen konnte: »Dieser Fall ist von großer Brisanz, Katoen, und Ihr müsst ihn unbedingt lösen, schnell und diskret. Gut möglich, dass ich damit das Schicksal der gesamten Niederlande in Eure Hände lege!«
Die Eindringlichkeit, mit der van der Zyl das sagte, beunruhigte Katoen. »Ihr glaubt nicht an einen gewöhnlichen Raubmord?«
»Nein, auch wenn dem Toten die Börse fehlt. Ich gehe nicht davon aus, dass der Mörder sie hat. Vermutlich hat jemand von unseren Leuten sie ihm abgenommen. Wir wissen doch alle, dass die Nachtwächter jede Gelegenheit nutzen, ihre karge Besoldung aufzubessern.«
»Schon wahr, aber was macht Euch in diesem Fall so sicher?«
»Das hier.«
Als der Amtsrichter sich neben den Leichnam kniete, tat Katoen es ihm nach und sah zu, wie van der Zyl vorsichtig die geballte Rechte des Ermordeten öffnete. Darin lag etwas Flaches, Längliches, und erst bei genauerem Hinsehen erkannte Katoen, dass es sich um ein Blütenblatt handelte.
»Ein Blatt?«
»Von einer Tulpe, um genau zu sein«, sagte van der Zyl.
Katoen schaute es sich gründlich an. »Solch eine Tulpe habe ich noch nie gesehen. Das Blatt ist tiefschwarz, und diese tropfenförmigen roten Flecken erinnern an Blutstropfen.«
»Eine sehr seltene Tulpe, gewiss. Eine, mit der man zur Zeit des Tulpenfiebers ein Vermögen hätte verdienen können.«
»Oder verlieren«, gab Katoen zu bedenken.
»Oder verlieren, ja.«
Katoen ließ seinen Blick über den Leichnam schweifen; in der Brust klaffte ein tiefes Loch, und die Kleidung ringsum war blutgetränkt. »Ein Stich direkt ins Herz, mit großer Wucht ausgeführt. Der Mörder muss kräftig sein, oder großer Zorn hat ihn zu der Tat getrieben. Aber was hat dieses Blütenblatt damit zu tun? Und wie habt Ihr davon wissen können?«
»Ich hatte seine Faust schon geöffnet, bevor Ihr kamt. Gewusst habe ich es nicht, aber vermutet. Schließlich war es bei dem anderen Toten genauso.«
»Der andere Tote?«, fragte Katoen und hatte das ungute Gefühl, dass er etwas sehr Unerfreuliches zu hören bekommen würde.
Van der Zyl erhob sich mit einem leisen Seufzen. »Das sollten wir nicht hier unter all diesen Leuten besprechen. Gehen wir zum Rathaus!«
Die flackernde Öllampe erhellte nur einen Teil der geräumigen Amtsstube van der Zyls. Die Schatten der Möbel tanzten an den Wänden, zuckten hin und her, als hätte die Unruhe der beiden Männer sie angesteckt. Katoen stand an einem der beiden Fenster und blickte hinaus auf die nächtliche Stadt. Sie erschien ihm wie ein Moloch, dem es finstere Geheimnisse zu entreißen galt.
Seine Büttel, Dekkert und Kampen, waren auf sein Geheiß bei der Leiche geblieben. Sie sollten die Bewohner der umliegenden Häuser danach befragen, ob sie etwas Wichtiges gesehen oder gehört hatten. Aber Katoen ahnte, dass das, was der Amtsrichter ihm zu eröffnen hatte, viel schwerwiegender war als das, was seine Gehilfen möglicherweise herausfanden.
Van der Zyl hatte sich, wie auch Katoen, seines Umhangs und Huts entledigt und war damit beschäftigt, sich eine Pfeife anzuzünden. Als der leicht beißende Geruch des glimmenden Tabaks sich ausbreitete, lehnte er sich auf seinem wuchtigen Stuhl zurück. Entspannt wirkte er jedoch keineswegs.
»Der andere Tote, von dem ich sprach, ist Jacob van Rosven«, hob er an.
»Der Werftbesitzer, ja, ich habe davon gehört. Er verstarb letzte Woche, nicht wahr?«
Der Amtsrichter nickte. »Genau vor einer Woche, am vergangenen Montag. Ich hätte Euch die Sache gleich anvertrauen sollen, aber Ihr wart nicht in Amsterdam.«
»Ich habe meinen Onkel in Utrecht besucht«, erklärte Katoen und dachte einen Augenblick lang sehnsuchtsvoll an die gemütlichen Abende, die Onkel Adalbert und er bei Heidelbeerschnaps und Tabak verbracht hatten. »Ich weiß nicht viel über den Mord an van Rosven, habe nur gehört, dass es auf dem Gelände seiner Werft auf der Insel Marken geschehen ist. Einer der Büttel sagte, es sei ein Raubmord gewesen.«
»Das war es nicht. Im Gegensatz zu de Koning trug der tote van Rosven seine Börse noch bei sich, als wir ihn fanden. Wir haben die Umstände seines Todes in der Öffentlichkeit heruntergespielt und das Ganze absichtlich als Raubmord dargestellt, weil van Rosven ein bedeutender Mann gewesen ist und wir in unruhigen Zeiten leben. Ihr wisst, die Republik der Sieben Vereinigten Niederlande steht am Vorabend eines Krieges.«
Katoen nickte. »Wir werden den Franzosen zu mächtig, und König Ludwig ist ein neidischer, gieriger Mann. Wenn er die Gelegenheit wittert, sich ein paar neue Provinzen unter den Nagel zu reißen, dann haben wir wohl bald Krieg mit Frankreich.«
»Wenn wir Pech haben, nicht nur mit Frankreich, sondern mit allen unseren Nachbarn. Die kleineren Staaten bereiten mir weniger Sorge, aber auch die Engländer scheinen mit Ludwig, den sie aus unerfindlichen Gründen den Sonnenkönig nennen, obgleich er doch einen gewaltigen Schatten wirft, gemeinsame Sache zu machen. Der englische König Karl und Ludwig sollen schon im vergangenen Jahr ein geheimes Bündnis gegen uns geschlossen haben. England neidet uns den florierenden Überseehandel, und den Franzosenkönig gelüstet es, wie Ihr so richtig sagt, nach noch mehr Land und noch mehr Macht. Unsere Kundschafter in Frankreich melden, Ludwig ziehe insgeheim Truppen ein, um seine Landstreitkräfte auf einen Eroberungskrieg vorzubereiten. Und jetzt diese Morde! Jemand scheint es auf genau jene Herren abgesehen zu haben, auf deren Unterstützung die Niederlande im Kriegsfall angewiesen sind. De Koning war stets bereit, die Verteidigungsanstrengungen mit Geld zu fördern, und auf van Rosvens Werft sind einige unserer besten Kriegsschiffe gebaut worden. Wir müssen verhindern, dass der Mörder unserem Land weiteren Schaden zufügt – und auch, dass die Bevölkerung durch die Morde in Unruhe gerät. Die Lage erscheint ebenso bedrohlich wie vor zwei Jahren, als die Affäre mit den Todesbildern Amsterdam erschütterte. Damals habt Ihr unserer Republik gute Dienste geleistet und uns alle vor einer Katastrophe bewahrt, Katoen. Ich setze großes Vertrauen in Euch, mehr als in jeden anderen meiner Leute. Deshalb bitte ich Euch, die Morde an van Rosven und de Koning aufzuklären. Ihr braucht auf nichts und niemanden Rücksicht zu nehmen, ich halte Euch den Rücken frei!«
Van der Zyl hatte sich weit nach vorn gebeugt und starrte Katoen über seinen Tisch hinweg halb bittend, halb fordernd an. Es war offensichtlich, dass er sich große Sorgen machte.
»Denkt Ihr an gedungene Attentäter, die im Auftrag der Franzosen oder der Engländer handeln?«, fragte Katoen.
Der Amtsrichter nickte. »Etwas in der Art, ja.«
Katoens Blick blieb an dem Gemälde hängen, das die Wand zu seiner Rechten schmückte. Es zeigte einen Mann mit hoher Stirn, der, eine Hand auf eine Schiffskanone gestützt, die andere in die Hüfte gestemmt, den Blick des Betrachters stolz erwiderte. Das war Maarten Harpertszoon Tromp, der als Oberbefehlshaber der niederländischen Marine den Feinden der jungen Republik schwere Niederlagen beigebracht hatte. Im Jahr 1639 hatte er die Zweite Spanische Armada, die nach Flandern unterwegs gewesen war, besiegt und damit das Ende der spanischen Seemacht eingeleitet. Später hatte er mit großem Einsatz die Engländer bekämpft, bis ihn 1653 in der Schlacht von Ter Heijde die tödliche Kugel eines Scharfschützen traf. Während er das Bild betrachtete, überkam Katoen das eigenartige Gefühl, dass Tromp ihm aufmunternd zuzwinkerte. Sein Vater hatte unter dem Admiral gedient und in der Schlacht gegen die Zweite Armada sein Leben verloren. Verlangte Tromp jetzt von ihm, dass auch er sein Leben für die Vereinigten Niederlande wagte?
Er lenkte seine Gedanken wieder auf die Gegenwart.
»Erzählt mir mehr von dem ersten Mord, Mijnheer van der Zyl!«
»Es geschah am späten Abend, als die Nachtwächter schon unterwegs waren. Aber sie konnten den Mord an van Rosven ebenso wenig verhindern wie den an de Koning. Van Rosvens Leiche ist erst am nächsten Morgen auf dem Gelände seiner Werft entdeckt worden. Niemand weiß, was er bei Nacht da gesucht hat. Auch er wurde durch einen Stich ins Herz getötet, und in seiner Faust fand man das hier.«
Van der Zyl erhob sich, ging zu einem schmalen Schrank und entnahm ihm eine kleine, schmucklose Holzschatulle. Als er sie geöffnet vor Katoen auf den Tisch stellte, sah dieser etwas Dunkles darin liegen. Er nahm es heraus. Es war ein verwelktes Blütenblatt, schwarz und mit roten Tropfen gemustert.
»Dieselbe Tulpensorte«, sagte der Amtsrichter und legte das Blütenblatt, das er bei de Konings Leichnam gefunden hatte, ebenfalls auf den Tisch.
Katoen nahm auch das zweite Blatt hoch und hielt beide nebeneinander. »Eine immense Ähnlichkeit, in der Tat. Aber was will der Mörder uns damit sagen?«
»Vielleicht, dass er es auf die ›Verehrer der Tulpe‹ abgesehen hat. Ihr kennt die Vereinigung gewiss.«
»Ja. Gehört Ihr nicht auch dazu?«
Van der Zyl zog ausgiebig an seiner Pfeife und nickte. »Einige hochstehende Bürger unserer Stadt, denen die schönste Blume der Welt am Herzen liegt, haben sich in der Vereinigung zusammengeschlossen, und ich darf mich dazuzählen. Jeden Montagabend treffen wir uns im Wirtshaus Zu den drei Tulpen in der Jodenbreestraat, wobei unsere Liebe zur Tulpe nicht der einzige Grund der Zusammenkünfte ist. Wir setzen uns für wohltätige Zwecke ein, aber auch wichtige politische und wirtschaftliche Fragen werden dort ganz zwanglos besprochen, was zuweilen ergiebiger ist als eine offizielle Unterredung. Beide, Jacob van Rosven und Balthasar de Koning, haben unserem Kreis angehört, und beide sind an einem Montagabend getötet worden, nachdem sie das Wirtshaus verlassen hatten.«
»Da seid Ihr sicher?«
»Gewiss, ich war bei beiden Zusammenkünften zugegen. Ich war noch nicht lange zu Hause und hatte mich noch nicht meiner Kleider entledigt, als ein Nachtwächter kam, um mir von dem Mord an de Koning zu berichten. Deswegen konnte ich so schnell bei der Zuiderkerk sein.«
Allmählich begriff Katoen, dass die große Sorge, die er bei Nicolaas van der Zyl spürte, nicht nur dem Schicksal der Niederlande galt, sondern auch seinem eigenen.
3. Kapitel: Tulpenfieber
Als Jeremias Katoen am späten Vormittag das Gelände der Werft betrat, die bis vor kurzem Jacob van Rosven gehört hatte, schlug ihm ein Gemisch aus den unterschiedlichsten Geräuschen und Gerüchen entgegen. Eine salzige Brise kam vom IJ, dem Meeresarm der Zuidersee, der Amsterdam vom nördlich gelegenen Volewijk trennte. Sie vermengte sich mit der schweren, klebrigen Ausdünstung von erhitztem Pech. Rechts von ihm hatten die Werftarbeiter ein dickbauchiges Handelsschiff gekielholt, um die Planken auszubessern. Über einer ummauerten Feuerstelle hing ein großer Kessel, in dem zwei Männer, die sich zum Schutz gegen den Gestank Tücher vor Mund und Nase gebunden hatten, das Kalfaterpech erhitzten, mit dem andere Arbeiter die neuen Plankengänge abdichteten. Überall auf der Werft wurde gehämmert und gesägt, und gellende Zurufe dienten der Verständigung. Die Möwen, die gelassen über allem kreisten, schienen sich einen Spaß daraus zu machen, den Lärm der Menschen mit ihrem schrillen Geschrei noch zu übertönen.
Die allgemeine Geschäftigkeit erfüllte Katoen mit Stolz auf sein Land und seine Mitbürger. Mit Fleiß, Disziplin und Zähigkeit hatten sich die Niederlande zur führenden Seefahrts- und Handelsmacht hochgearbeitet. Kein Wunder, dass andere Nationen mit Neid und Furcht verfolgten, was sich in den Vereinigten Provinzen tat. Vor Katoens innerem Auge füllte sich das Meer vor Amsterdams Küste mit feindlichen Schiffen; überall waren Kanonendonner und Pulverrauch, und fremde Soldaten zogen mordend, brandschatzend und plündernd durch die Stadt. Er war fest entschlossen, es nicht so weit kommen zu lassen. Was immer in seiner Macht stand, um Amsterdam und die Vereinigten Niederlande zu beschützen, er wollte es tun. Sein Vater hatte mit Admiral Tromp auf See gekämpft, und er führte seinen Kampf hier, um jene Feinde zu vernichten, die womöglich gefährlicher waren als fremde Seeleute und Soldaten: Spione und Mörder.
Er stand neben dem gekielholten Schiff und sah sich um, als er plötzlich schnelle Schritte hörte und aus den Augenwinkeln eine schemenhafte Bewegung hinter sich wahrnahm. Alarmiert versuchte er, sich umzudrehen und gleichzeitig zur Seite auszuweichen. Doch es war zu spät: Etwas schlug hart gegen sein Kreuz und warf ihn zu Boden. Katoen fiel in den Schmutz und verlor seinen breitkrempigen Hut mit dem blauen Federbusch. Schnell rollte er sich zur Seite und entging dadurch einem weiteren Angriff. Ein kurzes Stück von einem Seil, am Ende zu einem dicken Knoten gebunden, klatschte auf die Stelle, an der er eben noch gelegen hatte.
Der Angreifer war ein nicht sonderlich großer, aber kräftiger Mann, fast haarlos, mit einer braunen Lederklappe über dem linken Auge. Schnaufend wie ein wilder Stier, drehte er sich zu Katoen um und holte mit seinem geknoteten Seil zu einem weiteren Schlag aus.
Jetzt kamen Katoen die Übungsstunden zugute, die er bei dem stadtbekannten Ringkämpfer Robbert Cors genommen hatte. Scherenartig umschlossen seine Beine die Unterschenkel des anderen, und der stürzte, noch bevor er seinen Schlag ausführen konnte, neben dem Amtsinspektor in den Schmutz. Der Mann stieß mit dem Kopf gegen einen Stapel Schiffsplanken und war für einen Augenblick benommen. Die Zeit reichte Katoen, um ihm das Seil zu entreißen und es weit von sich zu schleudern. Er hockte sich rittlings auf den Gestürzten und sah, dass dessen Augenklappe verrutscht war. Darunter gähnte eine leere Höhle.
Aber schon drohte neue Gefahr. Die Werftarbeiter kreisten die beiden am Boden liegenden Männer ein und bedachten Katoen mit misstrauischen, ja feindseligen Blicken. Es waren durchweg kräftige Gestalten, und viele von ihnen hielten ein Werkzeug in Händen.
Ebenso ablehnend wie ihre Blicke waren ihre Worte: »Was will der fremde Stutzer hier?« – »Er schnüffelt rum!« – »Ist vielleicht van Rosvens Mörder oder ein Freund von ihm!« – »Jedenfalls hat er hier nichts zu suchen, geben wir’s ihm!«
Der Mann, der zuletzt gesprochen hatte, ein stiernackiger Rotschopf, hielt in der Rechten einen Hammer mit einem länglichen, zylindrischen Kopf, einen Kalfathammer. Er trat einen Schritt auf Katoen zu und hob sein Werkzeug.
»Ich werde ihm mal ein bisschen auf den Kopf klopfen, das wird ihm die Neugier austreiben!«
Katoen trug keine Schusswaffe bei sich, aber an seiner rechten Hüfte hing ein Dolch. Den zog er mit blitzartiger Geschwindigkeit aus der Scheide und hielt die Spitze vor das einzige Auge seines ersten Gegners.
»Wenn sich einer von euch auch nur ein kleines Stück bewegt, könnt ihr euren Freund im Blindenhaus besuchen!«
Der Mann mit dem Kalfathammer erstarrte mitten in der Bewegung. Er schien nicht daran zu zweifeln, dass es Katoen ernst war. Katoen hatte keinen Grund, den Einäugigen zu schonen, der Mann hatte ihn ohne jede Rücksicht angegriffen.
Wieder bei vollem Bewusstsein, erkannte auch der Einäugige, in welcher Gefahr er schwebte. Die Dolchspitze dicht vor seinem Auge ließ ihn in kurzen, heftigen Stößen atmen; Angstschweiß glänzte auf seiner Stirn.
»Du kannst uns nicht alle besiegen, Fremder«, ergriff der Rotschopf das Wort. »Wenn du Claes etwas antust, schlagen wir dich zu Brei!«
»Das wird dem blinden Claes nichts mehr nützen«, erwiderte Katoen so ruhig und überlegen, wie es ihm in der angespannten Lage möglich war. »Und täuscht euch nicht, Freunde, ich bin sehr geschickt mit dem Dolch! Ein paar von euch nehme ich noch mit!«
»Wir wissen, wie geschickt du damit bist. Unseren Herrn, Jacob van Rosven, hat dein Dolch das Leben gekostet. Deswegen werden wir dich auf keinen Fall davonkommen lassen!«
Bevor Katoen etwas erwidern konnte, erscholl eine laute Stimme: »Was ist da los? Warum wird hier nicht gearbeitet?«
Die Männer bildeten eine Gasse, und ein vornehm gekleideter Herr trat hindurch. Unter dem sauber gestutzten Bart, der über dem Mund und am Kinn wuchs, steckte ein noch junges Gesicht. Katoen schätzte den Mann auf Mitte bis Ende zwanzig.
»Also, was ist hier los?«, fragte dieser noch einmal.
»Wir haben einen Fremden erwischt, der hier rumgeschnüffelt hat«, antwortete der Mann mit dem Kalfathammer. »Der Kerl sagt, er ist geschickt mit dem Dolch, und droht, Claes Pieters sein Auge auszustechen. Wahrscheinlich ist er der Mörder Eures Vaters, Mijnheer van Rosven.«
»So ein Unsinn!«, sagte Katoen. »Ich bin Amtsinspektor Jeremias Katoen, und der Amtsrichter hat mich beauftragt, den Mord an Jacob van Rosven zu untersuchen.«
»Das kann jeder behaupten«, knurrte der Rotschopf.
»Wir können ja gemeinsam zum Rathaus gehen. Wenn du recht hast, Rotkopf, darfst du mir mit deinem Hammer den Schädel einschlagen. Sollte aber ich recht behalten, lasse ich dich öffentlich auspeitschen. Nun, was hältst du davon?«
Unsicherheit flackerte in den Augen des Rothaarigen auf, und er blickte sich hilfesuchend nach seinen Kollegen um. Die aber scheuten die Verantwortung, eine Entscheidung zu fällen, und blickten betreten zu Boden.
Der junge van Rosven hob Katoens Hut auf und wandte sich an die Arbeiter. »Ich kenne diesen Mann aus dem Rathaus. Er gehört tatsächlich zu den Leuten des Amtsrichters. Also geht besser wieder an eure Arbeit, bevor er euch allesamt einlochen lässt.«
Zögernd leisteten die rauen Burschen der Aufforderung Folge, während Katoen sich aufrappelte und den Dolch in die lederne Scheide an seiner Hüfte steckte. Claes Pieters blieb starr am Boden liegen, nur sein Auge folgte jeder Bewegung Katoens. Angst lag in seinem Blick, nun allerdings nicht mehr die Angst vor dem Dolch, sondern die vor der strafenden Hand des Gesetzes.
»Nehmt den Männern ihr Verhalten nicht übel, Mijnheer Katoen«, bat van Rosven. »Es sind schlichte, aber treue Seelen. Seit mein Vater hier ermordet aufgefunden worden ist, herrscht auf der Werft eine überaus gereizte Stimmung. Ihr habt es selbst erlebt. Mein Vater war bei seinen Leuten sehr beliebt, und jedem einzelnen von ihnen wäre es ein Vergnügen, den Mörder mit bloßen Händen zu richten.«
Katoen sah den Einäugigen an und seufzte. »Steh auf und geh an deine Arbeit zurück!«
Das ließ der Mann sich nicht zweimal sagen. Flink wie eine Katze kam er auf die Beine und verschwand hinter einem großen Holzschuppen.