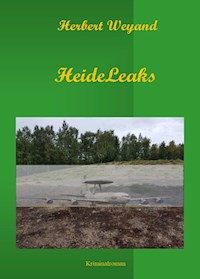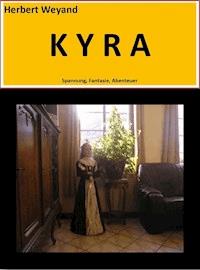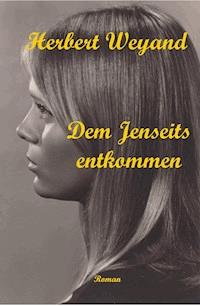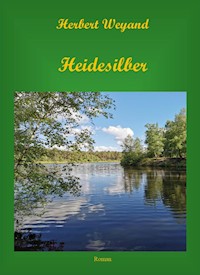Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Kriminalpolizei und ein Dorf werden mit der Vergangenheit konfrontiert. Beim Abriss des Feuerwehrhauses wird eine riesige autarke Bunkeranlage entdeckt. Einundzwanzig tote Kinder liegen in einem Schutzraum. Die polizeilichen Ermittlungen ergeben sehr schnell, dass die Toten nicht die sind, die 1944 bei einem Luftangriff verschüttet wurden. Haben die Kinder damals den Luftangriff überlebt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Weyand
Die vergessenen Kinder
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
28. Mai 2012
Bericht der vergessenen Kinder I (1944) Klaus
Dienstag 29. Mai – 03. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder II (1944) Klaus
30. Mai 2012
Bericht der vergessenen Kinder III (1945 - 1949) Klaus
04. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder IV (1945 - 1949) Klaus
05. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder V (1950) Klaus
06. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder VI (1950) Klaus
07. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder VII (1962) Tilde
08. Juni 2012
09. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder VIII Tilde
10. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder IX (1964) Tilde
12. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder X (Tilde)
Bericht der vergessenen Kinder XI (Tilde 2012)
13. Juni – 16. Juni 2012
Bericht der vergessenen Kinder XII (Tilde) 2012
17. Juni 2012
18. Juni 2012
19. Juni 2012
20. Juni 2012
21./22. Juni 2012
23. Juni 2012
24. Juni 2012
Vergessene Kinder XIII
25. Juni 2012
Vergessene Kinder XIV
26. Juni 2012
27. Juni 2012
28. Juni 2012
Vergessene Kinder XV
29. Juni 2012
30. Juni 2012
01. Juli 2012
02. Juli 2012
02. Juli 2012
Impressum neobooks
Wir Wilhelm
von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen
verordnen aufgrund des Artikels 61 der Verfassung des Deutschen Reiches, im Namen des Reiches, was folgt:
Im Reichsgebiet werden an sieben Standorten Schutzkeller eingerichtet, die tausend Reichsangehörige im Bedarfsfall aufnehmen.
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer
Prolog
Schon Minuten lag das Brummen in der Luft, als plötzlich die Bomber der Alliierten, wie Heuschrecken die Sonne verdeckten. Bomben fielen in dichtem Hagel vom Himmel und explodierten beim Aufschlag. Die Erde bebte und die Mauern wankten. Doch sie hielten der Belastung des Drucks und den erdbebenartigen Wellen stand.
Die Kinder saßen zusammengekauert im Schutzkeller und hörten entsetzt auf den gewaltigen Lärm um sie herum und über ihnen. Die Schockwellen trafen sie körperlich. Zum Weinen blieb keine Zeit. Das Entsetzen und die Angst nahm ihnen die Stimme.
Auch, wenn die Maschinen schon geraume Zeit zu hören waren, erfolgte der Angriff der Alliierten überraschend und der Großteil des Dorfes schaffte es nicht in den Schutzraum.
Die Landung der Amerikaner und Engländer in der Normandie war natürlich Gesprächsthema der letzten Tage. Hitler forderte die Menschen der Dörfer auf, ihre Heimat zu verlassen … die englischen Radiosender forderten das Gegenteil. Die Wehrmacht fegte auf der Flucht am Dorf vorbei. Nur wenige Soldaten machten im Dorf halt. Und wenn auch nur, um zu plündern und den Bewohnern Widerstand einzuimpfen.
Die Kinder lebten seit Tagen in dem einzigen Schutzraum des Dorfes und die Einwohner wechselten sich täglich bei deren Versorgung ab. Weil die Wehrmachtssoldaten flüchteten, war klar, dass die Vorzeichen des Krieges umgekehrt wurden. Die Angst vor den Eroberern wurde genommen, weil, von einem Augenblick auf den anderen, das Gerücht im Raum stand, die Amerikaner würden die Orte verschonen und niemandem etwas tun, der sich ergibt. Weit gefehlt.
Nach weniger als einer Stunde war der Spuk des Angriffs vorüber. Am nächsten Tag rückten die Alliierten an. Die Tanks der Amerikaner walzten durch die wenigen Straßen des Dorfs. Die Einwohner jubelten den Eroberern zu, die, ungeachtet der Ovationen, die Überlebenden des Luftangriffs wie Vieh zusammengetrieben und am 16. November in das Camp Vught nach Nordbrabant brachten, und internierten. In dem nunmehr leeren Dorf wurden die Häuser von den anrückenden alliierten Soldaten besetzt.
Niemanden scherten die Einwände von ängstlichen Eltern, deren Kinder im Schutzkeller waren.
Erst Jahre später fiel einem ehemaligen amerikanischen Soldaten in seinen Memoiren auf, dass in diesem Dorf beim Einzug der Siegermächte keine Kinder lebten. Keiner der internierten Einwohner war damals jünger als zehn Jahre.
Nach dem Krieg kehrten die Einwohner zurück. Das Gelände über dem Luftschutzkeller war verwüstet und glich einer Mondlandschaft. In vielen Gesprächen kamen die Familien überein, das Massengrab nicht zu öffnen. Die Totenruhe sollte nicht gestört werden. Viele Eltern der verschütteten Kinder hatten den Krieg nicht überlebt. Die Trauerarbeit für andere wollte im Grunde niemand übernehmen. In diesem Krieg gab es so viele Tote, sodass der Mensch, müde und abgestumpft wunde. Sie wendeten sich der Zukunft zu und machten einen Schnitt mit der Vergangenheit. Ein neuer Lebensabschnitt begann und sie machten sich daran, ihre Häuser aufzubauen. Die neu geborenen Kinder wuchsen in dem Wissen heran, dass ihre älteren Geschwister während des Krieges umkamen. Eine ganze Generation und mehr war ausgelöscht.
Die Stunde null begann, denn die Häuser waren ausgeraubt und alle Wertgegenstände als Kriegsbeute weggeschafft. Selbst die vergrabenen Schätze in ihren sicheren Verstecken der Gärten waren und blieben verschwunden. Das Dorf stand vor dem Nichts und wurde Meister im Entwickeln von Überlebensstrategien. Industrie gab es keine, lediglich Landwirtschaft.
Mit dem Wiederaufbau der Schule wurde 1949 begonnen. Zwei Jahre später wurden die ersten Kinder eingeschult.
Das Feuerwehrhaus wurde auf dem Fundament des zerstörten Bunkers aufgebaut, neben dem grauen Haus aus der Vorkriegszeit, 1931 stand im Giebel. Niemand dachte an die Kinder, die dort ihr Grab gefunden hatten. Das damalige Geschehen war ausgelöscht.
Nach und nach verdrängten die Familien des Dorfes die Gräuel des Krieges. Die Männer fanden Arbeit auf den umliegenden Zechen oder auf der Glasfabrik in Herzogenrath. Das Lebenskarussell drehte ein Zacken weiter.
1955 rückten Bagger an und bauten auf dem Grundstück gegenüber dem Sportplatz, der zur Schule gehörte, Kies ab. Faktisch die Fortsetzung der aufgefüllten Kiesgrube aus den Anfängen des Jahrhunderts. Niemand machte sich Gedanken um den hohen Bretterzaun, der die Abgrabungsstelle vor Blicken und unbefugtem Eindringen schützte. Es wurde so viel geklaut.
Langsam sickerte durch, dass das Abgrabungsgelände, ungefähr dreißigtausend Quadratmeter Land, an Fremde verkauft worden war, die nicht im Dorf lebten und das Förderrecht der Firma Bernstein Kies gehörte. Nutznießer war Karl Dreßen, ein älterer Bauer, der 1952 das Dorf mit unbekanntem Ziel verlassen hatte und somit den Einwohnern aus der Ferne ein Schnippchen schlug.
Als der Bretterzaun 1959 entfernt wurde, sahen die Dorfbewohner auf eine dichte Buchenhecke, die mindestens schon drei Jahre gewachsen war. Es war der Sommer, der mit Hitzerekorden aufwartete und in dem es von Mitte März bis Ende September nicht regnete. Es war auch der Sommer, in dem junge Familien Angst hatten, ein Contergan geschädigtes Kind zu bekommen.
Die Zufahrt zu dem Grundstück lag dem Dorf abgewandt. Die Straße wurde vor einigen Jahren, extra neu gebaut. Sie führte auf die L42, der Straße zum Militärflugplatz, und kam aus dem Nichts. Der Beginn oder das Ende, je nach Betrachtungsweise, lag am Heiderand.
Im Winter, als die Hecke licht wurde, sahen Spaziergänger und Bewohner einen Gebäudekomplex, der im Dorf seinesgleichen suchte. Im Verborgenen war das Gebäude gewachsen und es sollte den Bewohnern verborgen bleiben. Denn nie setzte jemand, der im Ort wohnte oder verwandtschaftliche Beziehungen dorthin unterhielt, einen Fuß über die Schwelle der Villa.
Wenigen fiel die Errichtung des Komplexes auf, weil der Umbau des Feldflugplatzes zu einem Flughafen der Royal Air Force in unmittelbarer Nähe zur gleichen Zeit stattfand. Das militärische Sperrgebiet verlief hart an der Grenze des neuen Anwesens, sodass durchaus der Eindruck entstehen konnte, die ehemalige Kiesgrube gehöre dazu. Die Spekulationen der Dorfbewohner gingen dementsprechend in diese Richtung. Hinzu kam, dass die Zuneigung, der alliierten Engländer den Deutschen gegenüber, sich in Grenzen hielt.
Als, Anfang der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die NATO Air Base entstand,verschwendeteniemand mehr Gedanken daran, dass, zwischen Flughafengelände und dem Gebäude, ein Abstand von mehreren Hundert Metern entstand. Der Sicherheitsbereich des militärischen Geländes wurde einfach enger gezogen. Zweihundert Meter jenseits der Verbindung zur Landstraße wurde der Sicherheitszaun für den Bereich der Base errichtet. Neue Arbeitsplätze standen in Aussicht und die Konzentration, um die möglichen Bewohner der Villa, ließ nach. Das Dorf hatte sich an den Klotz gewöhnt.
*
28. Mai 2012
Der Tag, für die Anwohner Hinter den Höfen und dem Küfenweg, begann bescheiden. Nicht nur dort. Der, sich stetig wiederholende laute Schlag begann Punkt sieben Uhr. Viele wurden aus den schönen Träumen gerissen, die sonderbarerweise nur in den frühen Morgenstunden auftraten. Andere kniffen mit letzter Kraft den Schließmuskel des Harnleiters zusammen, um noch einige Minuten im Bett zu retten.
Mit dem ersten lauten Schlag … vorbei.
Kinder, deren Minuten, bis sie zum Schulbus oder in den Kindergarten mussten, geplant waren, stürzten ans Fenster oder zur Tür. Dem älteren Herrn, drei Häuser die Straße hinunter, fiel die Kaffeetasse aus der Hand. Er war schwerhörig und dachte, sein Gehör wäre wiedergekommen, weil er das Klopfen an der Türe hörte. Als er sie öffnete, stand niemand dort, doch das Klopfen blieb. Er beschloss, den Arzt aufzusuchen.
Die Schockwellen der Schläge setzten sich im Boden fort und vibrierten noch einige Hundert Meter weiter. Katzen suchten miauend das Weite. Hunde der Nachbarschaft bellten tobend. Eltern schrien ihre Kinder an, weil die Zeit drängte und Kinder weinten, weil die Eltern schrien.
Die breite Schaufel des Baggers schlug auf das Dach des Feuerwehrhauses, immer wieder und wieder. Nach einer halben Stunde ein kleiner Erfolg. Ein Riss. Weitere zehn Schläge. Ein erstes Loch brach ins Innere des Gebäudes.
Die freiwillige Feuerwehr hatte ausgedient und das ehrwürdige Gebäude wurde abgerissen. Heutzutage konnte man bei einem Brand abwarten. Vor fünfzig Jahren war das anders. Vielleicht brannten die Häuser damals besser und schneller oder die Versicherungspolicen waren nicht so lukrativ. Im Dorf wurde gemunkelt, dass die Landesregierung überlege, das generelle Rauchverbot auf die Haushalte auszudehnen, in deren Orten es keine Feuerwehr gab. Auf dem Bolzplatz an der alten Schule sollte eine Raucherecke eingerichtet werden. Auf jeden Fall wurde das Dorf, bei Gefahr, nun von der Nachbargemeinde bedient. Für die Bewohner ein großer Verlust. Das Feuerwehrfest war immer eine gut besuchte, feucht fröhliche Veranstaltung.
In der vergangenen Woche, direkt nach der Frühkirmes der Schützen - auf dem Zelt durfte übrigens noch geraucht werden, da stand aber auch das Feuerwehrhaus noch - begannen die Beschäftigten der Stadt damit, das große automatische Tor und die Kunststoffteile abzubauen. Tagelang stießen die Arbeiter mit breiten Kratzern die Teerpappe vom Flachdach. Nicht nur Mülltrennung in den Haushalten, auch beim Abriss des Gebäudes. Der Feuerwehrausfahrt gegenüber war die Straße aufgerissen. Die Lebensader wurde abgetrennt und das endgültige Aus der Feuerwehr besiegelt. Was ist eine Feuerwehr ohne Wasser? Das Wasserwerk trennte die Verbindung der Leitung, die über Jahrzehnte den Schmutz von Geräten und Fahrzeugen beseitigte.
Im Vorfeld war die Stadt bemüht, das Gebäude loszuwerden. Die Stadtverwaltung suchte eine andere Nutzung, denn der Abriss war nicht billig. Die Bemühungen, das Gebäude einer anderen Nutzung zuzuführen, liefen ins Leere, weil die Instandhaltung und Betreibung keinen wirtschaftlichen Nutzen versprach und für die ortsansässigen Vereine zu teuer war.
Nach und nach stürzte das lang gestreckte Gebäude nach innen. Dicke Staubwolken wirbelten über den Vorplatz der Schule, die in ungefähr fünfzig Metern Entfernung stand und seit der Bildungsreform Ende der siebziger Jahre nicht mehr für den Lehrbetrieb genutzt wurde. In der ersten Etage des alten Gebäudes lagen zwei ehemalige Lehrerwohnungen, die von der Stadt vermietet wurden.
Mit dem Feuerwehrhaus wurde auch der hohe Mast, samt Sirene, abgebaut. Manch einem wurde angst und bange. Der auf- und abschwellende Ton diente schließlich nicht nur zur Warnung vor einem Brand, sondern auch dem Katastrophenschutz.
Vom Feuerwehrhaus gesehen, lag rechts der Spielplatz, an den sich der Bolzplatz mit Grillstelle für die Jugendlichen des Dorfes anschloss. Daneben streckte sich die hohe Buchenhecke, hinter der ein zweistöckiger Gebäudekomplex aus der Nachkriegszeit lag, dem etwas Geheimnisvolles anhaftete. Links lagen die Gärten der Grundstücke, deren Häuser im Küfenweg lagen.
Binnen zwei Tagen war das Feuerwehrhaus dem Erdboden gleichgemacht. Lediglich das Betonfundament lag deplatziert auf der geräumten Fläche, ungefähr fünfzig Zentimeter unter Bodenniveau. Die Arbeiter beratschlagten, wie sie am besten weiter vorgehen sollten. Die Mehrzahl war dafür, den Betonklotz dort zu belassen und das Loch mit Recyclingmaterial zu füllen und rote Asche, wie auf dem Rest des Platzes, aufzubringen.
Die Platte musste weg, ordnete der Baudezernent der Stadt Geilenkirchen an.
Der Bagger schaufelte also weiter und begann links vom ehemaligen Gebäude. Er hob die Erde auf den bereitstehenden Laster.
„Stopp“, rief Josef Dohmen, ein kräftiger, ungefähr ein Meter neunzig großer Arbeiter und hob die Hand. „Da ist etwas. Mach‘ mal langsam.“ Er stieg mit dem Spaten bewaffnet in das Loch und krabbelte nach wenigen Minuten, schnell wieder heraus. „Eine Bombe. Und was für ein Kaliber. Wir müssen absperren.“ Er klebte sein Handy an die Backe und rief im Bauhof an. Eine halbe Stunde später rückten weitere Fahrzeuge der Stadt mit Absperrgittern und die Polizei an.
„Ein Blindgänger“, bestätigte der ältere Polizeibeamte und kratzte sich ausgiebig am Kopf. „Ich habe schon einige gesehen. Das ist eine amerikanische Zehnzentnerbombe. Normalerweise haben die einen Langzeitzünder und der Kampfmittelräumdienst müsste schnell damit fertig werden.“ Er stieg in sein Auto und holte über Funk weitere Anweisungen. „In fünfhundert Meter Umkreis die Häuser räumen“, stellte er fest, als er wieder ausstieg. Die Kollegen sind gleich hier.“
„Das sind zwei Drittel des Dorfes“, sagte Josef Dohmen zu seinem Kollegen, der mit den Schultern zuckte.
Weniger als eine halbe Stunde später begann die Polizei mit der Räumung der Häuser. Zwei Beamte fuhren um das Dorf herum und näherten sich über die Zufahrtsstraße des etwas außerhalb liegenden Gebäudekomplexes. Er war nur von hier zugänglich, lag jedoch in dem halben Kilometer Radius des Sicherheitsbereiches. Sie hielten vor dem riesigen schmiedeeisernen Tor, dessen Angeln rechts und links in stabiles Gemäuer eingelassen waren. Je fünf Meter maß ein Flügel in der Breite und sieben Meter in der Höhe, ungefähr einen Handbreit unter der Regenrinne des Hauses. Nichts signalisierte Leben. Keine Klingel, kein Klopfer. Ratlos sahen die beiden Polizisten sich an.
„Was wollen Sie?“, fragte die Stimme aus einer nicht zu identifizierenden Quelle.
„Sie müssen ihre Wohnung oder ihre Wohnungen räumen. Auf dem Platz neben Ihrem Grundstück wurde ein Blindgänger gefunden, der heute entschärft wird“, erklärte der kleinere der Beamten dem Tor oder der Wand, er wusste es nicht.
„Ja, in Ordnung. Vielen Dank“, sagte die Stimme.
„Wir müssen die Evakuierung begleiten“, brachte der andere Polizist seine Anweisung an den Mann.
„Das ist unnötig. Wir werden die Wohnungen verlassen.“ Die Stimme klang bestimmt, ließ keinen Widerspruch zu.
„Das geht nicht. Wir müssen sicher sein, dass alle Häuser geräumt sind“, begehrte der kleinere. „Öffnen Sie das Tor.“
„Verschwinden Sie“, stellte die Stimme abschließend und ohne Emotionen fest.
„Aber …“, begann der Beamte und wurde von seinem Kollegen am Weiterreden gehindert, weil er ihm am Arm zupfte und eine Kopfbewegung zum Fahrzeug machte.
„Da können die Bonzen ran. Wir fahren“, sagte er im Auto.
Das Technische Hilfswerk baute in Windeseile eine kleine Zeltstadt auf und koordinierte das Durcheinander der heranfahrenden PKW, die auf eine Wiese, nahe der Heide gelegen, gelenkt wurden. Gott sei Dank war das Wetter der letzten Tage trocken, sodass keine größeren Probleme auftraten. Nicht jeder war begeistert über das unverhoffte Zeltlager und viele trugen das Herz auf den Lippen. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun.
*
Hauptkommissarin Claudia Plum verließ in der Waldstraße ihr Haus, als das Handy leise Mozarts kleine Nachtmusik spielte. Edgar musste auf seine Runde und sie hatte keine Lust auf einen Anruf. Nach einem kurzen Blick auf das Display nahm sie das Gespräch an.
„Plum“, meldete sie sich.
„Frau Plum. Gut, dass ich Sie erwische“, Dengler der Staatsanwalt war an der Strippe. „Wo sind Sie?“
„In Gottes freier Natur. Mein Dackel muss Gassi.“ Sie wollte ihm nicht auf die Nase binden, wo genau sie war. Verdammt fluchte sie. Wenn Dengler während ihres Urlaubes anrief, brannte es irgendwo. „Sie müssen Amtshilfe leisten. In Ihrem Dorf wurde eine Bombe gefunden und soll in den nächsten Stunden entschärft werden.“
„Ich habe davon gehört. Unser Haus liegt an der Grenze des Evakuierungsbereiches.“
„Neben der Bombe befindet sich ein Gebäude, dessen Bewohner nicht zugänglich sind und der örtlichen Polizei, die Überprüfung der kurzzeitigen Aussiedlung, nicht gestatten. Ich möchte, dass Sie sich dieser Angelegenheit annehmen.“ Dengler klang eindringlich.
„Nicht schon wieder. Ich habe Urlaub“, murrte die Beamtin. „Beim letzten Mal hatte ich eine Entführung am Hals.“
„Tun Sie mir den Gefallen. Wir haben im Moment niemanden frei. Den Tag Urlaub hängen Sie hinten an.“
„Nun gut. Ich wollte immer schon einmal in die Trutzburg.“ Sie schaltete das Handy aus. „Edgar, wir müssen heute in die andere Richtung.“ Claudia schlug fluchend den Weg zum Kämpchen ein. Den Dackel nahm sie mit. So konnte sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Claudia Plum war zweiunddreißig Jahre alt und leitete seit zwei Jahren die Aachener Mordkommission. Die Liebe hatte sie nach Grotenrath verschlagen, dem Dorf in dem Sie geboren wurde und ihren Bruder auf tragische Weise verlor. Mit ihren einhundertsiebzig Zentimetern war sie keine große, aber auch keine kleine Frau. Ihre Figur war sportlich schlank. Aus dem intelligenten Gesicht sahen graue Augen lebensfroh und häufig auch skeptisch in die Welt. Das brünette Haar lockte halblang bis auf die Schultern. Ein objektiver Beobachter würde sie als attraktiv und interessant bezeichnen. Sie trug eine verwaschene Jeans und Birkenstocklatschen sowie über das Shirt eine leichte helle Leinenjacke. Also ihr absolutes Freizeitoutfit. Im Dienst trug sie normalerweise Kostüm mit Bluse. Das einzige Zugeständnis an ihren Beruf waren dann ein Paar vergammelte Sportschuhe, die sie immer im Auto mitführte, falls es ins Gelände ging. Claudias Beruf war ihre Leidenschaft. Ungern erinnerte sie sich an die Auseinandersetzungen mit ihren Eltern, die sie im Familienbetrieb wissen wollten. Heute verstand sie, weshalb.
Erst vor wenigen Wochen erfuhr sie von ihrem Bruder Fabian, der brutal vergewaltigt worden war und wie ein Stück Müll auf den Komposthaufen des Friedhofs geworfen wurde. Sie hatte die Tat mit angesehen, jedoch aus ihrem Bewusstsein verdrängt. Nach mehr als zwanzig Jahren hatte sie den Täter überführt und damit sich gegenüber, die letzte Legitimation für ihre Berufswahl erlangt.
Ihr Gesicht trug einen mürrischen Ausdruck, als sie am Küfenweg rechts abbog und etwa einhundert Meter weiter, den linken geteerten Wirtschaftsweg nahm. Damit betrat sie die private Sperrzone des Grundstücks, wie das Hinweisschild signalisierte. Claudia schritt zügig auf die Zufahrt Anwesens zu, dessen Bewohner sie von der Evakuierung überzeugen musste. Während sie dem Grundstück näherkam, stiegen zwei Hubschrauber aus dem Innenbereich des Anwesens empor und flogen nach Norden. Was mochte dort geschehen? Eine Frage, die immer wieder gestellt wurde. Sie verließ den geteerten Feldweg und erreichte die Privatstraße. Nach wenigen Schritten quietschten Reifen vor und hinter ihr. Die beiden schwarzen Mercedeslimousinen mit getönten Scheiben zwangen sie zum Halt.
„Was wollen Sie hier? Das ist Privatgrund. Können Sie nicht lesen?“ Ein dunkelhaariger, wild aussehender Riese sprang mit einem mächtigen Satz aus dem Auto und musterte sie drohend.
„Nicht so hastig“, sagte Claudia ruhig, trotz des Schrecks, den sie gerade durchlebte, um niemanden zu provozieren.
„Ich gebe Ihnen gleich hastig“, knurrte der Mann.
„Bleiben Sie cool“, beruhigte sie. „Ich greife jetzt in meine Tasche und nehme meinen Ausweis heraus.“ Sie fasste vorsichtig in die Gesäßtasche, fischte nach der Plastikkarte und hielt sie hoch. „Hauptkommissarin Plum. Kriminalpolizei. Ich bin für die Evakuierung dieses Grundstücks zuständig.“ Sie zeigte auf den riesigen Bau, der mit Feldbrandsteinen gebaut oder verklinkert, in einhundert Meter Entfernung die Landschaft verbaute. Sechzig oder fünfundsechzig Meter Kantenlänge dachte sie. Dieser blöde Wachmann will mich aufhalten. Sie empfand keine Furcht.
„Verschwinden Sie ganz einfach“, sagte der Mann.
„Ich werde jetzt zu diesem Gebäude gehen und die dort lebenden Menschen zum Sammelplatz bringen.“ Sie geriet langsam in Rage. Was bildete der Typ sich ein? Ein Gorilla in Menschengestalt.
„Sie werden gar nichts.“ Er fasste an sein Ohr und lauschte irgendwelchen Ansagen, die er wahrscheinlich über Funk bekam. „Sehen Sie“, er deutete mit der Hand zu dem riesigen Tor, das sich langsam öffnete. Die Evakuierung läuft. Wir bekommen das alleine hin.“
Eins, zwei, drei, vier …“, zählte Claudia die verdunkelten Mercedeslimousinen, die das Gelände verließen. Zwölf an der Zahl und ein großer Reisebus mit ebenso undurchsichtigen Scheiben. Dahinter landeten zwei Hubschrauber, wahrscheinlich die, die vorhin von dort gestartet waren. „Ihren Namen, bitte“, forderte Claudia.
„Sagen Sie einfach Schneider zu mir“, antwortete er nach kurzem Zögern. „Jetzt verschwinden Sie. Sie werden das Gelände so oder so nicht betreten. Ich verbürge mich für die Sicherheit der Bewohner dieses Komplexes.“
„So einfach kommen Sie mir nicht davon.“ Claudia geriet in Zorn. Was bildete der sich ein?
„Und ob“, sagte er ruhig, stieg in das Auto und folgte dem Bus. Das Tor verschloss wieder und selbst, wenn sie spurtete, würde sie es nicht schaffen.
Hilflos, gedemütigt und rasend vor Wut stand sie am Straßenrand. „Was für ein Arsch“, fluchte sie. Claudia zückte ihr Handy und rief den Staatsanwalt an. Sie schilderte kurz das Geschehen.
„Ich informiere die örtliche Polizei darüber, dass das Gebäude geräumt ist. Vielen Dank, Frau Plum“, sagte Dengler kurz und merkwürdig frostig. Er brach das Gespräch ab.
Dann stand sie mit Edgar allein in weiter Flur und gab sich einen Ruck. Zu dem einen Arsch kam ein weiterer. Wollten die sie veralbern? Nachdenklich trat sie den Rückweg an und hatte das altbekannte Drücken in den Gedärmen, das nahendes Unheil anzeigte.
Seit eineinhalb Jahren lebte sie hier und fragte sich, wie alle Einwohner des Dorfs, was wohl hinter den Mauern dieses Hochsicherheitstraktes geschehen mag. Die Hubschrauber, die jeden Tag dort starteten und landeten, mussten einen Sinn haben, der sich jedem Außenstehenden entzog. Die Fahrzeuge, die das Gebäude verließen, hatten allesamt verspiegelte Scheiben. Sie wusste von den Nachbarn, dass das Gebäude nach dem Krieg errichtet wurde. Es wurde als Kastell, Trutzburg, Hochsicherheitstrakt oder Knast bezeichnet. Sie kannte niemanden, der schon einmal Kontakt mit den Bewohnern hatte. Vor Monaten hatte sie ihre Kollegin Oberkommissarin Maria Römer aus purer Neugierde darauf angesetzt. Maria war die PC-Spezialistin ihres Teams und es gab kaum etwas, das sie, falls es irgendwo im Netz stand, nicht fand. Das Gebäude existierte nicht und war selbst auf Google Earth nicht verzeichnet. Sie taten das damit ab, weil der militärische Sicherheitsbereich der NATO Air Base an das Gelände des Anwesens grenzte und irgendwann, in grauer Vorzeit, mit einschloss. Jetzt war endlich die offizielle Gelegenheit gegeben in diese geheimnisvolle Villa einzudringen und sie wurde ausgebremst. Sie würde am Ball bleiben, so sicher wie das Amen in der Kirche.
*
Die Bombe neben dem Fundament war freigelegt und der Kampfmittelräumdienst war dabei, die Umgebung des Zünders zu säubern.
Experten gehen davon aus, dass zwanzig Prozent, der im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben, Blindgänger sind. Die Fluggeschwindigkeit der Abwurfmaschinen spielte dabei ebenso eine Rolle, wie vorher explodierende Bomben, deren Luftdruck dem Projektil eine andere Flugrichtung geben konnte. Bomben, die mit dem Körper gegen eine Wand prallten, taumelten zu Boden, ohne dass der Zünder punktgenau aufschlug.
Der Entschärfungstrupp legte vorsichtig ein Gestell um die Bombe. Es sah fast aus, wie eine Ständerbohrmaschine. Vorsichtig brachten sie einen Ring um den Zünder an und zogen ihn durch Druck von einer Hydraulikmaschine, die drei Meter neben ihnen Öl komprimierte, an. Daumendicke Leitungen liefen zu dem Gestell. Nach einer letzten Prüfung suchten die zwei Entschärfer Schutz hinter einer dicken Stahlwand, an der ein Flachbildschirm befestigt war. Ein Dritter hantierte mit einer Tastatur und nickte den beiden zu. Sie hoben die Daumen.
Mit dem Druck auf die Entertaste zog das Gestell gegen den Bombenkörper. Ein dumpfes Geräusch, nicht lauter wie der Korken, der aus einer Weinflasche gezogen wurde, und der Zünder war getrennt. Die Maschine hatte die Gewindegänge kaputt gezogen. Ein unspektakulärer technischer Vorgang, der nicht ungefährlich war.
Der Greifarm des Baggers fuhr wieder in das Loch und hob die unscharfe Bombe, die in dicken Stahlseilen hing, heraus. Sein Gestell schwenkte zu einem Lastwagen, auf dem das Geschoss abgeladen wurde.
„Ihr macht dann weiter“, forderte der Bauhofleiter seine Leute auf. „Aber schön vorsichtig. Nicht, dass noch einer in die Luft geht“, lachte er meckernd. Er hatte einen Witz gemacht.
Josef Dohmen sah ihm zu, wie er in seinen Geländewagen stieg und davonfuhr.
„Wir machen Pause.“ Josef deutete seelenruhig zur Bank-Tisch-Kombination, die einen Ruhebereich des Spielplatzes kennzeichnete. Erst vor Kurzem wurde sie vom Trommler- und Pfeiferkorps des Dorfes gespendet und aufgebaut. „Der Zauber hat vier Stunden gedauert. Ich habe Hunger.“ Er sah nach oben. Das tackende Geräusch der Propeller lag in der Luft.
Noch war der Hubschrauber nicht zu sehen. In den letzten Tagen konnten sie den Flugverkehr aus dem Gebäudekomplex und wieder hinein verfolgen. Drei bis vier Mal täglich landete und startete eine Maschine.
Während der Pause der Bautruppe wurde die Evakuierung aufgehoben.
„Scheiße. Hier ist ein großer Hohlraum“, rief der Baggerführer. Das Loch war jetzt über vier Meter tief und zehn Meter breit an einer Betonkante entlang und kein Ende in Sicht. Längst waren die Arbeiter sicher, dass an den alten Geschichten etwas dran war. Seit sie denken konnten, erzählten die alten Dorfbewohner von einem Bunkerkomplex unter der alten Schule, und zwar aus einer Zeit des Ersten Weltkriegs.
Die Baggerschaufel hing vor der Oberkante eines Lochs in der Wand, das möglicherweise rechteckig nach unten zog, ungefähr zwei Meter mal ein Meter groß, wie ein Eingang.
Josef Dohmenbedeutete, die Schaufel herauszuziehen. Er kletterte hinein. „Lass‘ mich langsam runter. Ich schau‘ mal nach.“ Langsam senkte sich der Arm in die Grube und hielt vor dem Loch. „Scheinbar eine Türe. Sie ist nach innen gefallen. Dahinter ein Hohlraum. Ich kann sonst nichts erkennen. Zu dunkel“, rief er nach oben. „Hol‘ mich hoch.“ Nachdenklich kletterte er heraus. „Die Wand nach innen ist mindestens ein Meter dick“, berichtete er. „Wir sollten noch einige Schaufeln Erde herausholen.“
„Ruf‘ Heiner an. Sonst bekommen wir noch einen Anschiss.“ Heiner Offergeld war der Leiter des Bauhofs.
„Er wird alles in die Wege leiten“, sagte Josef, nachdem er das Gespräch beendet hatte. „Wir sollen das Loch … den Eingang freilegen und wieder absperren. Ja ich weiß“, wehrte er den Einwand seine Kollegen ab. „Um unsere Absperrung eine weitere ziehen. Der Hänger mit den Gittern steht ja noch da.“ Er wies zu den Linden, wo der Anhänger mit der Absperrung für die Bombenentschärfung noch stand.
*
Claudia war noch keine zehn Minuten von ihrem Spaziergang zurück, als das Telefon schrillte. Sie zuckte zusammen. Kurt der Spinner hatte wieder den Ton eines alten Wählscheibentelefons eingestellt. Jedes Mal erschrak sie.
„Hallo Claudia. Maria hier.“
„Ich hab‘ Urlaub. Was ist denn jetzt schon wieder?“, meldete sie sich ungehalten. Maria rief nur an, wenn etwas Dienstliches anlag.
„Was hast du mit dem Staatsschutz zu tun?“, fragte Maria platt.
„Gar nichts. Was soll die Frage?“
„Hier läuft alles durcheinander.“
„Ja und? Wie gesagt, ich hab‘ Urlaub.“
„Fabian hat vorhin angerufen. Er wird sich wohl bei dir melden.“
„Was ist jetzt mit dem Staatsschutz?“
„Ich bin erleichtert, dass du zuhause bist. In deinem Dorf kannst du mit den Typen nicht in Berührung kommen. Hier geht das Gerücht, du habest dich heute Morgen mit der Landesbehörde für Verfassungsschutz angelegt.“
„Ich?“ Claudia war empört. „Heute Morgen hab‘ ich auf Wunsch Denglers eine Evakuierungsmaßnahme begleitet. Warte mal. Da war schon eine komische Situation.“ Sie überlegte. Dieser Wachmann oder was er immer war, Schneider. „Vor ungefähr zwanzig Minuten hab‘ ich mich mit einem Arsch angelegt. Schneider hieß der. So ein riesiger Urzeitmensch. Davon könnt ihr nichts wissen. Und Staatsschutz? Nein, so sah der nicht aus.“
„Ich will dich nur warnen.“
„Danke Maria.“
Claudia lehnte gegen die Arbeitsplatte der Küche und knabberte ein Stück Schokolade. Während sie mit Maria telefonierte, wurde ihr ganz komisch. Sie tippte auf Unterzucker. Ein Grund, irgendeine Süßigkeit zu naschen. Sie konnte sich das leisten. Egal wie viel und was sie aß, sie wog immer um die siebenundfünfzig Kilo. Doch auch die Nascherei vertrieb das Gefühl nicht, das, wie sie wusste, nichts Gutes bedeutete. Was geschah dort draußen hinter den Mauern? Keinen Augenblick bezweifelte sie, dass Schneider vom Verfassungsschutz war. Doch was hatten die Bewohner in der burgähnlichen Anlage damit zu tun?
„Hast du schon gehört?“ Kurt kam aus dem Garten in die Küche. „Am Feuerwehrhaus …“
„Ja. Ich war schon im Einsatz, das weißt du doch.“ Sie unterbrach ihn, wie immer. Wenn er einmal ins Erzählen geriet, hörte er nicht auf. „Die Bombe.“
„Nicht die Bombe.“ Er winkte ab. „Die Baggerschaufel ist in einen unterirdischen Raum gefallen. Vielleicht ein Bunkersystem oder etwas Ähnliches.“
„Ein Bunker.“ Sie sah sinnend zu Kurt. Schön, dass ich den gefunden habe, dachte sie. Er zählte fünfunddreißig Lenze, war etwa 190 Zentimeter groß und hatte breite Schultern und schmale Hüften. Mittelblondes Haar lockte sich, wie in den sechziger Jahren, um die jungenhaften Züge. Kurt war der neugierigste Mensch, den sie kannte. Er steckte seine Nase in alles hinein. Grüne Augen sahen sie gespannt an. „Ich wusste heute Morgen schon, dass irgendeine Sch … auf uns zukommt.“ Sie verschluckt das Sch Wort.
„Was hast du damit zu tun?“
„Ich weiß noch nicht. Doch mein Gefühl trügt mich selten, wie du weißt.“
Und ob, dachte er und erinnerte sich an die haarsträubenden Aktionen der letzten eineinhalb Jahre. „Du hast doch Urlaub. Sollen wir an die See fahren?“ Mit See war die Nordsee gemeint, die gerade einmal einhundertachtzig Kilometer entfernt lag.
„Nein. Lieber nicht. Vorhin bei der Evakuierung hatte ich die Begegnung mit der dritten Art. Maria rief mich an. Der Verfassungsschutz hat sich über mich beschwert. Jetzt bin ich natürlich neugierig.“ Sie lächelte grimmig.
„Ach“, er winkte ab. „Das sind zahnlose Tiger. Das weißt du doch. Die sind auf das Husten von Flöhen programmiert.“
„Hast du einen Zoologiekurs absolviert?“
„Du weißt, was ich meine“, er grinste verschmitzt. „Hunde, die bellen, beißen nicht. Im Moment wird das Gelände abgesperrt.“
„Was machen die jetzt eigentlich?“, fragte sie.
„Keine Ahnung. Die schicken jemanden dort hinein oder reißen ganz einfach weiter ab.“ Er zuckte mit den Schultern. „Ich mach‘ uns einen Kaffee.“ Er werkelte an der Senseo Maschine herum. Normalerweise brühten sie Kaffee, aber so im späten Nachmittag konnte es auch einmal schnell gehen.
Kurt war einer der Männer, die alles Selbst machten. Ein Allroundtalent, das schon einmal etwas falsch machte … was dann teurer wurde, als wenn er von vornherein den Handwerker geholt hätte. Auf jeden Fall beherrschte er seine Küche und das war ja schon viel für einen Mann.
„Ich spring‘ schnell unter die Dusche“, schmunzelte Claudia bei ihren Gedanken und zählte. Sie kam bis zwei.
„Da komm‘ ich aber mit. Den Kaffee mach‘ ich später.“ Er ließ bewusst lüstern seinen Blick über ihre Figur gleiten.
„Ich bin zuerst oben“, rief sie und spurtete schon die Treppe zum Bad hoch. Er jagte hinterher und packte sie im Flur. Unten schrillte das Telefon. Claudia zuckte zusammen, ergab sich jedoch Kurts Liebkosungen.
*
Bericht der vergessenen Kinder I (1944) Klaus
Plötzlich hört der Bombenlärm auf. Die Erde bebt nicht mehr. Langsam werden die Kinder unruhig.
„Ich schau‘ mal nach der Tür“, sage ich, einer der beiden Erwachsenen, die mit den Kindern im Schutzkeller sind.
Seit wenigen Tagen dokumentiere ich unsere Eindrücke und Erlebnisse, in der Hoffnung, eines Tages an die Oberfläche zu gelangen. Falls dies nicht gelingt, gebe ich den Geschichtsschreibern zunächst ein Bild von mir, eine kurze Beschreibung meiner Person:
Ich bin untersetzt und trage kurzes krauses Haar. Um meine grauen Augen liegen schon ein paar Falten. Was will ich als Fünfzigjähriger mehr erwarten. Aufgrund einer Beinverletzung bin ich an der Heimatfront. Zu Beginn des Krieges arbeitete ich auf der Zeche Carolus Magnus. Später hatte ich den Arbeitsunfall. Unter Tage, in einem Streb knickte eine Stütze weg und klemmte mein linkes Bein ein. Erst mehrere Stunden später wurde ich befreit. Ärztliche Kunst und mein eigener Wille bewahrten mich zwar davor, das Bein zu verlieren, jedoch war es so gut, wie gebrauchsunfähig. Danach habe ich nicht mehr unter Tage auf der Zeche gearbeitet und wurde Übertage für das Ausbauholz der Flöze zuständig. Eine reine Schreibtischarbeit.
Aus heiterem Himmel machte ich eine Erbschaft, die mir sehr viel Geld bescherte. Ich möchte nicht näher auf Einzelheiten eingehen. Mein neuer Reichtum machte mich unabhängig und gab mir Möglichkeiten, dass ich Nachbarn unterstützend unter die Arme greifen konnte. Die meisten Bewohner unseres Dorfes sind in der Landwirtschaft tätig und abhängig vom Erfolg der jährlichen Ernte. Einige hatte es schon auf die Glaswerke in Herzogenrath verschlagen und andere, wie mich, auf die umliegenden Zechen. Ich erwarte keine Dankbarkeit und ganz ehrlich gesagt beabsichtige ich nicht, die geliehenen Summen jemals einzufordern. Wie gesagt, es war sehr viel Geld, das mir in den Schoß fiel. Aber eben nur Geld.
Ich bin nicht verheiratet. Nicht, dass ich aussehe wie Nosferatu, es ergab sich einfach nicht, vielleicht, weil ich wenig gesellig bin und weder der freiwilligen Feuerwehr noch einem anderen Verein angehöre. Natürlich kenne ich die ein oder andere willige Frau. Doch ich bin diskret, und zwar so, dass ich den Ruf habe, dem anderen Ufer anzugehören. Das schert mich nicht. Obwohl 1942 die, von den Nazis unterwanderte Polizei von mir wissen wollte, ob ich schwul sei. Jemand hatte mich damals angezeigt. Da musste ich leider die Diskretion aufgeben, um Referenzen zu erhalten.
Meinen Bericht halte ich so sachlich wie möglich. Die Emotionen, die wir hier erleben sind, für jeden nachvollziehbar, deshalb werde ich sie auf ein Mindestmaß beschränken. Weitere Informationen zu mir werde ich einfließen lassen.
Ich humpele also zum Ausgang und betätige die dortige Schleuse, die in einen kleinen Vorraum führt. Kaum schwingt die Luke auf, sehe ich die Bescherung. Erdreich hat die metallene Eingangstür nach innen gedrückt. Oben muss mehr passiert sein, als wir hier unten mitbekommen haben. Wir müssen also warten, bis Hilfe von oben kommt. Schulterzuckend wende ich mich ab. Hilfe würde kommen, da war ich sicher. Auch, wenn es nicht um mich geht … schließlich sind die Kinder hier.
„Tilde, die Tür nach draußen ist verschüttet. Wir müssen warten, bis Hilfe kommt.“
„Eingeschlossen? Das ist ja furchtbar. Wir haben neunundzwanzig Kinder hier.“ Sie schreit ihre Angst heraus. Eine junge Frau von zweiundzwanzig Jahren, deren Mann, irgendwo in Europa, an der Front ist. Sie haben vor Kurzem geheiratet, eine Nottrauung, wie sie zurzeit häufig vorkommt. Der verdammte Krieg veränderte alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Ehe vollzogen haben. Am Tag der Hochzeit war der Bräutigam so blau, dass es an ein Wunder grenzt, wenn er in der Nacht einen hochbekam. Am nächsten Tag war er schon wieder auf dem Weg an die Front. Tilde ist eher der mütterliche Typ mit rosigen Wangen und halblangem braunen Haar. Ihre Figur ist von harter Arbeit auf den Feldern geprägt. Stramme Schenkel und Oberarme. Eine Frau, die zupacken kann. Aber selbst fast noch ein Kind. Im Moment steht das blanke Entsetzen in den braunen Augen. „Herr Heinen, was sollen wir jetzt tun? Ich will noch nicht sterben.“
„Ich auch nicht. Halb so schlimm“, beruhige ich sie. „Ich war zwanzig Jahre unter Tage, bis das mit dem Bein passierte. Wir sind sicher. Der Betonklotz hält ewig.“
„Ihr Wort in Gottes Ohr“, sie bekreuzigt sich. „Ich habe dennoch Angst.“
„Kannst du auch.“ Ich lege begütigend meine Hand auf ihre Schulter. „Doch jetzt kümmerst du dich um die Kinder. Ich sehe mal nach, was dort hinten ist.“ Natürlich geht mir auch die Muffe. Doch die Zeit auf der Grube, wo es neunhundert Meter in die Tiefe ging, hat nun ein Gutes. Ich sieze Tilde nicht, weil ich sie seit ihrer Kindheit kenne.
Wir haben einige Karbidlampen, von denen ich eine Zweite anzünde. Die andere muss bei Tilde und den Kindern bleiben. Ich gehe weiter in den Keller hinein und verschwinde hinter einem Vorsprung. Dazu muss gesagt werden, dass der Schutzkeller aus vier Räumen, die im Quadrat liegen, besteht und vielleicht auch als Keller für ein Haus dienen sollte. Aber nein, er besteht ja aus Kunststein, diesem Gemisch aus Sand, Steinen und Zement und dazu gusseiserne Streben. Die Decke ist nach oben gewölbt. Dadurch hält sie eine größere Drucklast. Die hintere Wand des Raumes ist eingestürzt. Die Decke wird jedoch von der Eiseneinlage gehalten. Vorsichtig räume ich Gesteinsbrocken beiseite. Sand rieselt nach. Schließlich stößt meine Hand ins Leere. Hastig räume ich mehr Schutt beiseite und leuchte mit der Lampe in ein dunkles Loch, einen weiteren Raum, den ich nicht vermutet habe. Es dauert einige Zeit und viel Kraftaufwand, bis ich den Durchbruch so weit erweitere, dass ich durchsteigen kann. Der dahinter liegende Raum ist nicht so unversehrt geblieben, wie der vordere Schutzkeller. Die Erschütterungen der Bomben – vielleicht ist auch eine direkt drauf geknallt - haben dicke Betonbrocken von der Decke gelöst. Ich überlege umzukehren, gehe jedoch vorsichtig tastend weiter. Wie sich später erweist, ein glücklicher Umstand. Der Einbruch hier ist älteren Datums. Die Bruchstellen an den Brocken sind nicht frisch. Ich zwänge mich durch einen Spalt, jeden Augenblick darauf gefasst, dass weitere Brocken sich lösen und mich zerquetschen. Plötzlich stehe ich frei in einer großen Halle und bestaune Tonnen von Lebensmitteln, die in Regalen lagern.
Meine Gefühle, in diesem Moment, kann ich schlecht beschreiben. Vor wenigen Minuten, so gut wie sicher zum Tode verurteilt und jetzt ein Funken Hoffnung.
Die Decke in dem ungefähr zweihundert Quadratmeter großen Raum wird von mächtigen Stützen getragen. An den Wänden gehen Türen ab, die gleichzeitig Schleusen sind, wie ich an den Dichtungen sehe. Also eine Tür öffnen, einen kleinen Vorraum betreten, der maximal drei Personen fasst, die Türe wieder schließen und die folgende öffnen. Die zweite Türe bleibt verriegelt, solange die Erste geöffnet ist.
Ich öffne also Türen und finde Räume, die unterschiedlichen Nutzungen dienen. Teils Büros, teils Aufgaben, die ich noch nicht erkenne. Eine Schleuse öffnet einen längeren Gang von ungefähr zwei Meter Breite. Ich folge ihm und finde wohnliche Räume, von denen es in Schlafkabinen geht, die entlang der Wände, in die Tiefe, angeordnet sind. Je ein Bett und eine Ablage. Auf dem Boden liegt Linoleum in verschiedenen Farben, der offensichtlich ein Synonym für die entsprechende Nutzung ist. Ich folge dem braunen Belag, der vor den Schlafkojen unendlich entlang läuft. Ich zähle einhundert Kabinen von ungefähr sechs Quadratmetern Größe. Zwischen jeweils zehn Schlafgelegenheiten liegt ein Gemeinschaftsbad. Wasser läuft keins, als ich an einem Rad drehe. Es wäre ja zu schön.
Ich kehre in den Wohnraum zurück, den ich als Erstes betreten habe und überlege. Ehrlich gesagt bin ich total erledigt und setze mich auf einen Stuhl. Mein Bein schmerzt ob der ungewohnten Belastung. Jetzt bekomme ich es auch mit der Angst zu tun. Niemand, wirklich niemand im Dorf hat jemals über diese Anlage gesprochen, von der ich noch nicht weiß, wie groß sie ist. In welch eine Geschichte bin ich hier hineingeraten? Klar, die Nazis geistern seit Jahren durch die Gegend und da ist auch noch der Flugplatz drüben in der Heide. Wenn der Einbruch der Decke nicht wäre, niemand hätte je davon erfahren, außer den Erbauern natürlich. Für uns ist diese Anlage, die Chance zum Überleben.
Am besten hole ich Tilde und die Kinder hierhin. Vielleicht dauert es ein paar Tage, bis wir befreit werden. Niemand von uns weiß, was dort oben los ist.
„Haben Sie von diesem Bunker gewusst“, fragt Tilde Stunden später, nachdem die Kinder versorgt und zu Bett gebracht sind.
„Nein“, ich schüttele den Kopf. „Aber es ist merkwürdig, dass niemand im Dorf jemals etwas davon gesagt hat.“
„Ich habe Angst und will hier raus. Ich kann nicht atmen.“ Sie fasst mit der Hand an den Hals. Der Puls rast und ist an der Halsschlagader sichtbar.
„Es kann nicht mehr lange dauern und wir werden gerettet.“ Ich strahle Optimismus aus, den ich nicht empfinde. Ich würde sie gern in den Arm nehmen und halten. Aber sie ist verheiratet und es schickt sich nicht.
Was, wenn die Verwüstungen über uns derart sind, dass jemand auf die Idee kommt, hier könne niemand mehr leben. Dann sitzen wir hier mit den Kindern. Fünfzehn von ihnen sind älter als sechs Jahre und vierzehn jünger. Aber keines mehr als zehn. Wasser ist im Moment auf einige Kanister begrenzt. Doch ich bin der festen Überzeugung, dass ich welches finde, denn um Nahrung müssen wir uns keine Sorgen machen.
Aber welchen Sinn macht es, möglicherweise weiterzuleben? Der Gedanke an die verwüstete Landschaft über uns festigt sich und irgendwie weiß ich: Ich muss uns selbst rausbuddeln. „Wir schlafen jetzt und morgen früh oder welche Zeit wir haben, mache ich mich noch einmal auf die Socken. Vielleicht gibt es doch einen Ausgang.“
In der Nacht, also während der Schlafperiode, gibt es einen kurzen trockenen Schlag. Ich weiß sofort Bescheid, das Hangende ist heruntergekommen. Ich denke in den Fachausdrücken des Bergbaus. Irgendwo hat die Decke nachgegeben. Wie sich herausstellt im Durchgang zum ursprünglichen Schutzkeller. Wir haben Glück im Unglück. Ohne diesen neuen Keller wären wir tot. Jetzt sind wir jedoch endgültig abgeschnitten.
„Ihr müsst keine Angst haben“, beruhige ich zu Beginn der Wachperiode Tilde und die Kinder, die ihre Situation nicht verstanden. Gedanklich habe ich die Zeit schon in Schlaf- und Wachperiode eingeteilt, irgendwo muss ich beginnen. Wir werden durchhalten. „Tilde wird euch jetzt Aufgaben aufgeben, die ihr bitte widerspruchslos ausführt. Wer nicht gehorcht, wird bestraft. Wir müssen, wenn wir überleben wollen, zusammenhalten.“ Ich sehe ihnen in die großen angstvollen Augen und mir blutet das Herz. Tapfer widerstehen sie den Tränen. Der Ton, den ich anschlage, kommt an. „Du bist Stefan?“ ich zeige auf einen von den größeren Jungen, der nickt. „Und du, Christel“, ich nicke dem Mädchen zu. „Ihr begleitet mich bei der Erkundung des Kellers. Und du, Friedrich, besorgst nachher Reis aus dem Lager. Damit bauen wir eine Uhr. Du hast dann die Aufgabe, die Zeit festzuhalten.“
Wir packen diverse Werkzeuge zusammen und zünden die Karbidlampen an. Dann machen wir uns auf den Weg. Die Keller, die wir durchqueren, sind vollgepackt mit Dingen des täglichen Gebrauchs. Wir könnten ein unbekanntes fernes Land besiedeln. Hoffentlich bleibt es nicht diese Unterwelt. Ich muss Wasser finden.
„Irgendwo kommt hier Luft herein. Sonst wären wir schon erstickt und die Lampen würden nicht brennen“, murmele ich.
„Von dort kommt ein Luftzug.“ Christel zeigte die Regale entlang.
„Ich spüre nichts. Bist du sicher?“ Ich mustere das ungefähr ein Meter zwanzig große Mädchen mit den braunen Locken. Sie ist die Tochter eines Glasarbeiters und wohnt in meiner Nähe.
Christel nickt.
„Geh voraus, solange du den Zug spürst.“
Einige Male bleiben wir stehen, wenn Christel die Nase wie ein witterndes Tier in Luft hebt. Mittlerweile haben wir mehrere kleinere Tore und Räume passiert. Überall liegen kleine Betonbrocken auf dem Boden, die jedoch keinerlei Anlass dazugeben, der Keller könne einstürzen.
„Hier ist das Wetter stark. Ich bemerke es jetzt auch.“ Kurze Zeit später stehen wir in einem Keller, in dem die Luft stark aus einem Loch in der Wand bläst. Aus der gleichen Mauer kommen Rohre unterschiedlicher Stärke, die zu dicken Regelventilen laufen und in einer Art Verteiler in verschiedenen Deckenkanälen enden.
„Wer sagt’s denn“, ich bin schlichtweg erstaunt und drehe an dem großen gusseisernen Rad, das butterweich läuft. Wir hören strömendes Wasser. „Jetzt schnell zurück und die Augen auf, sonst überschwemmen wir die Bude.“ Ein Stück des Weges weiter, bleibt uns das Herz stehen. Der Boden stampft gleichmäßig vibrierend. Nach einer knappen Minute weiß ich Bescheid. Der Bunker wird nicht einstürzen. „Pumpen. Da laufen mehrere Pumpen“, sage ich mir immer wieder selbst vor. Nachdenklich setzten wir den Weg fort. Je näher wir dem Keller kommen, den wir bezogen haben, umso deutlicher dringt Jauchzen an unsere Ohren. Staunend beobachten wir die ausgelassene Bande, die Fangen spielt. Erst nach geraumer Zeit bemerke ich die Veränderung. Es brennt Licht. Scheinbar wurde mit der Wasserzufuhr irgendwo Strom eingeschaltet.
„Wir haben Strom und Wasser.“ Tilde lächelt glücklich. Die Angst ist verflogen. „Und hier … schau mal. Hast du so etwas schon einmal gesehen.“ Sie steht vor einer Arbeitsplatte aus Metall, auf der sich, ungefähr zwanzig unterschiedliche Erhebungen befinden. Darunter ebenfalls aus Stahl, Türen. Ich öffne eine: Kochtöpfe, nagelneue emaillierte Kochtöpfe.
„Davon habe ich schon einmal gehört“, sage ich nachdenklich. „Auf diesen Platten können wir wahrscheinlich mit Elektrizität kochen.“ Vorsichtig drehe ich einen Knopf, auf dem sich eine Skala bis zehn befindet. Ich lege nacheinander die Hand auf eine Platte und schreite die Reihe ab. „Scheiße“, fluche ich. „Ich habe mich verbrannt. Tatsächlich können wir hier kochen. Haben wir Kaffee. Wir kochen uns eine Kanne. Aber sei vorsichtig Tilde, diese … Ich weiß nicht was, werden so heiß, wie von Holz oder Kohle.“ Während sie das Wasser aufsetzt, suche ich in einem der Vorratskeller nach Kaffee.
*
Dienstag 29. Mai – 03. Juni 2012
Nachdem die Nachricht von dem Schutzkeller an die zuständige Landesbehörde übermittelt war, lief sie von dort durch die Bundesrepublik und die Welt. Sie verursachte hektische Betriebsamkeit, aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Telefone liefen heiß, der Mailverkehr nahm zu und Besprechungen wurden einberufen. Manche Mitarbeiter der Behörden fragten sich, was die Aufregung sollte, andere wirkten fahrig und nervös. Ein Schneeball begann zu rollen und wurde größer und größer.
„Herr von Bernstein.“ Der Staatssekretär sah im Nordwesten von Brüssel auf den Boulevard Leopold und wünschte sich weit weg. Die Vergangenheit seiner Eltern holte ihn ein.
„Ja“, sagte er kurz und sah zu einer der Vorzimmerdamen, die abwartend in der Türe stand. „Frau Lemaitre …“
„Herr Staatssekretär. Der Generalsekretär ist auf der sicheren Leitung.“
„Ich bin unterwegs.“ Er eilte durch den Raum und das angrenzende Vorzimmer. Er ging schräg über den Flur in die abhörsichere Zentrale. Der Bedienstete wies auf ein Glaskabuff, in dem die grüne Lampe des Schnurtelefons blinkte. Von Bernstein schloss die Tür und damit alle Geräusche aus. Bis auf eines. Aus der Verriegelung der Tür klang ein leises summendes Geräusch und signalisierte ihm, vollkommene Abgeschiedenheit. Erst, wenn er den heutigen Zahlen- und Buchstabencode eingab, konnte er die Kabine wieder verlassen.
Friedhelm von Bernstein war ein kleiner untersetzter Mann in der Mitte der Vierzig. Sein braunes, widerborstiges Haar stand in die Höhe und unter den buschigen, über der Nasenwurzel zusammengewachsenen Augenbrauen schauten kühle und berechnende graue Augen.
„Herr Generalsekretär. Was kann ich für Sie tun?“ Seine Stimme klang rau und belegt.
„Herr von Bernstein. Gut, dass ich Sie antreffe.“ Der Generalsekretär klang munter, sein dänischer Akzent erfrischend. „Ich möchte Sie nicht auf die Folter spannen. Wir haben vor einigen Wochen über ihre persönliche Situation gesprochen. Sie erinnern sich?“
„Selbstverständlich, Herr Staatssekretär.“
„Im Umfeld Ihrer Produktionsstätte sind Aktivitäten zugange, die Ihr Eingreifen notwendig machen.
„Ich weiß Bescheid. Ich habe vorhin einen Anruf erhalten.“
„Ich möchte die Angelegenheit diskret erledigt wissen.“
Im Bundesamt für Verfassungsschutz in der Merianstraße in Köln saß Karl Christian Schreier von Bernstein an seinem Schreibtisch und fluchte leise. Der Anruf seiner Großmutter erinnerte ihn an die Pflichten, die er der Familie gegenüber hatte. Nachdenklich griff er zum Telefon und wählte aus dem Kopf eine Nummer.
„Ich bin es“, sagte er, als auf der anderen Seite das Gespräch angenommen wurde.
„Was gibt es?“, fragte eine Frauenstimme.
„Code Orange. Der Bunker ist entdeckt.“
„Du spinnst.“
„Damit macht niemand Spaß.“ Seine Stimme klang sauer. „Du weißt, was du zu tun hast?“
„Klar.“ Sie legte auf.
Regierungsdirektor Helmut Groß von Bernstein erreichte der Anruf auf dem Tennisplatz. Er war Verwaltungsbeamter des Militärischen Abschirmdienstes Stelle vier in Koblenz. Gerade, als er zum Matchball und sechs zu vier im laufenden Satz aufschlug, es war der zweite Aufschlag, wurde er von der Seite gestört.
„Herr Groß von Bernstein. Ein dringendes Telefonat.“ Der junge Mann aus der Verwaltung hielt das Mobilteil des Telefons hoch.
Prompt verriss er den Schlag und der Ball ging weit ins aus.
„Vierzig, vierzig“, rief der Schiedsrichter.
„Verdammt. Ich wurde gestört.“ Er war rasend und versuchte den Störenfried mit Blicken zu töten, der weiterhin das Mobilteil hochhielt.
Nach kurzer Unterhaltung mit dem Schiedsrichter stürmte er zum Spielfeldrand und riss das Telefon an sich.
„Ja.“ Er bellte in die Sprechmuschel.
„Helmut. Code Orange.“
„Verdammt.“ Er fluchte laut und drückte die Aus-Taste. „Das Spiel habe ich verloren“, rief er zum Schiedsrichter hinüber. „Ich muss dringend weg.“
„Herr Kriminaldirektor. Wir haben eine Nachricht aufgefangen.“ Der junge Mann stand befangen in der Bürotür.
„Was gibt es denn?“ Fabian Schröder sah unwillig hoch.
„Herr Schröder, wir sollen Sie bei festgelegten Wortkombinationen benachrichtigen.“ Er hielt ein Blatt Papier in die Höhe und trat vor den Schreibtisch.
„Gib her“, sagte Schröder und nahm das Papier. Mit der anderen Hand winkte er den Überbringer hinaus. Er studierte die Nachricht und griff den Telefonhörer. „Martha. Verbinde mich bitte mit dem Innenminister.“ Kurze Zeit später stand die Direktleitung und das Freizeichen ertönte, bis nach kurzer Zeit abgenommen wurde.
„Herr Innenminister. Hier Schröder. Bundeskriminalamt. Ich möchte Sie nicht lange aufhalten.“ Er redete einige Minuten und schloss mit den Worten: „Danke. Dann werde ich die kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Sonderkommission leiten.“ Er horchte seinem Gegenüber und antwortete: „Die örtliche Kriminalpolizei stark einbinden? Gut. Das kann ich veranlassen. Sie faxen die Anweisung. Vielen Dank.“
Befriedigt lehnte er sich zurück. Schröder hatte erreicht, was er wollte.
„Hallo Stefan. Mutter hat Code Orange ausgelöst.“ Christel von Bernstein sprach abgehetzt, als wäre sie gelaufen.
„Ich dachte, es wäre alles vorbei.“ Er wusste, wie jeder in der Familie, was der Alarm bedeutete. Das unterirdische Gefängnis war entdeckt worden. „Wir halten uns da heraus, Christel.“
„Wie sollen wir das machen?“
„Wie immer. Reagieren, anstatt agieren. Darin haben wir beide doch jahrzehntelange Übung.“ Der alte Herr schüttelte angewidert den Kopf. Wollte die Vergangenheit sie nie in Ruhe lassen?
„Auch meine Meinung. Ich wollte mich nur noch einmal versichern.“
„Ich liebe dich.“
„Ich liebe dich.“
*
Die Telefonate lösten Aktivitäten aus, die die Konzentration vieler Personen auf jenen kleinen Ort richteten, in dem die Fliegerbombe entschärft und wo, in diesem Zusammenhang, der kleine Schutzkeller gefunden wurde.
*
Mathilda von Bernstein saß in ihrem Rollstuhl und sah blicklos aus dem Fenster. Niemand sah ihr an, wie sie triumphierte. Das alte, etwas runde, Gesicht zeigte keine Gemütsbewegung. Der Zeitpunkt, auf den sie fast siebzig Jahre hingearbeitet hatte, war nahe. Ausgelöst durch einen Zufall. Die Welt kannte also doch noch Gerechtigkeit. Die Isolation, in die ihre Familie sie geschickt hatte, verpuffte wirkungslos. Die Welt würde von der Ungerechtigkeit gegen sie und ihrer Rache erfahren. Sie wusste, der Zeitpunkt kam für die Familie ungünstig. Aber, was schert sie, die anderen. Nachdenklich und mit Schaudern dachte sie an die Vergangenheit. Damit auch an die Aufzeichnungen, die sie lange vernachlässigt hatte.
Seit etwa fünfzehn Jahren war Mathilda Gefangene ihres alten Körpers und der Senilität einiger ihrer Kinder. Mit sechsundsiebzig Jahren hatte sie einen leichten Schlaganfall und seitdem eine Gehstörung im linken Bein. Wenn sie sich sehr anstrengte, gelangen kurze Wege mit dem Stock. Im Grunde war jedoch der Rollstuhl ihr Fortbewegungsmittel.
Ihre eigenen Kinder hielten sie gefangen. Nicht alle, jedoch ein großer Teil. Was regte sie sich auf? Ihre Pflegerin ermöglichte ihr den Freiraum, den sie für die noch notwendigen Aktivitäten zur Erfüllung ihres Schwurs benötigte.
Code Orange … Sie kicherte. Diesen Einfall hatte sie in den achtziger Jahren. Zum damaligen Zeitpunkt hatte sie die Familie noch im Griff. Die Gier der Kinder nach Macht und Reichtum war damals ungebrochen.
Sie sollten sich alle wundern …
*
Bericht der vergessenen Kinder II (1944) Klaus
„Wie lange sind wir jetzt schon hier?“, fragt mich Tilde kurz vor einer Schlafperiode.
„Ungefähr drei Monate.“ Die Idee mit dem Reis und der Uhr funktioniert nicht. Wir entwickeln immer wieder neue Ideen, die wir regelmäßig verwerfen. Im Moment verwenden wir eine Idee Christels zur Zeitmessung. Das Mädel, mit seinen neun Jahren, ist unglaublich. Sie entdeckt in einem Vorratsraum Kerzen. Ein halber Zentimeter brennt ungefähr eine halbe Stunde. Eine Kerze somit fünf Stunden. Sie überlegt eine halbe Stunde und setzt dann um, was sie vor Kurzem in der Schule gelernt hat. Sie löst mehrere Kerzen in einem Topf auf und knüpft Dochte aneinander. Die Wachsmasse gießt sie in ein rechteckiges Gefäß, mehr ein Rohr, das sie irgendwo her besorgt hatte, und hält den Docht in der Mitte. „Die neue Kerze darf nicht zu dick werden, sonst geht sie aus“, erläuterte sie ihre Arbeit. Schließlich ist es so weit und das Zeitmessgerät wird entzündet. Stefan hat einen halben Zentimeter markiert. Die beiden zählen die Sekunden, indem sie sich abwechseln. Der halbe Zentimeter brennt zwei Stunden und zwanzig Minuten. Bei siebzehn Zentimeter Länge, etwa fünfundvierzig Stunden. Wir haben also unsere ungefähre Zeitmessung. Nachdem wir wissen, dass unser Aufenthalt länger sein wird, als uns lieb ist, ist Zeit jedoch nicht mehr so wichtig. Wir sichern unseren Alltag und das Überleben der Gruppe. Die anfängliche Platzangst ist durch den Gewöhnungsprozess gewichen. Strom und Wasser geben uns natürlich Sicherheit. Nach wenigen Wochen unterliegen wir einem gefügten Rhythmus, weil wir uns regelmäßig in der Gruppe beschäftigen, wobei wir die ganz kleinen bewusst einbeziehen.
„Meinst du, wir kommen hier noch einmal heraus?“
„Wir kommen hier raus. Verlass dich drauf, und je nachdem, wie und ob die uns da oben haben hängen lassen, ist der Teufel los. Das lass dir gesagt sein.“ An Tildes erschrockener Reaktion bemerke ich die Wut, die mein Gesicht verrät.
„Ob unseren Familien etwas passiert ist?“ Sie stellt die Frage bang, doch mit großer Ruhe.
„Ich weiß es nicht Tilde. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, dass meine Freunde und Nachbarn nicht nach uns suchen.“ Seit Tagen geistern die Gedanken in meinem Kopf und der furchtbare Verdacht nistet sich ein.
„Ob der Krieg wohl vorbei ist?“
„Ich denke nicht. In der Zeit, die wir hier unten sind, wird keine große Veränderung eingetreten sein. In spätestens ein paar Wochen sind wir hier heraus. Du wirst sehen und wenn ich uns selbst rausbuddeln muss.“ Ich stehe auf und recke mich. „Die Kinder schlafen. Ich gehe unter die Brause.“
Das Wasser wird elektrisch erhitzt. Wie?, verstehe ich nicht. Davon ließ ich auch die Finger. Strom war lebensgefährlich. Außer der Gemeinschaftsbrause gibt es einzelne Zellen, die alleine genutzt werden können.
Ich werde die Gegenwartsform aufgeben, weil ich sowieso nur in stillen Stunden schreibe und im Nachhinein. Die Niederschrift gelingt mir besser, wenn ich den Abstand zu mir schaffe. Übrigens, mein Name ist Klaus Heinen.
Ich erleichtere mich, bevor ich brause. (Da ist es wieder. Jetzt jedoch anders.) Das war auch eine Errungenschaft, von der ich bisher nur gehört hatte. Ein Wasserklo. In meinem Dorf gingen die Notdurft und alles andere in Sickergruben, die im Herbst ausgehoben und auf die Felder verstreut wurden. Anfangs betätigte ich immer wieder die Kette und ließ den Behälter oberhalb des Klos wieder volllaufen, um ihn erneut zu entleeren. Ich hatte Spaß, wie ein Kind. In diesem Keller gab es tatsächlich Klopapier. Zu Hause musste die Zeitung, der Waschlappen oder auch nichts her halten. Zunächst wussten wir nicht, was wir mit diesen komischen Papierrollen anfangen sollten. Bis Friedrich Heinen, ein Sechsjähriger uns zeigte, was wir damit machen konnten. Er war vor Kurzem mit seinen Eltern in Frankfurt bei Verwandten, die Klopapier benutzen. Ich war kaum jemals aus dem Dorf herausgekommen und das neue Spielzeug war neu und willkommen.
Ich stand unter der Brause und seifte mich ein. Ein Brausebad kannte ich ebenso wenig, wie das Wasserklo und genoss die warmen Strahlen von oben. In meiner Familie – auch später, als ich alleine war - wuschen wir uns jeden Tag gründlich mit kaltem Wasser und am Samstag wurde in der Zinkwanne warm gebadet. Der jetzige Luxus, zig Meter unter der Erde, war unvorstellbar. Der Genuss erzeugte ein unbeschreibliches Gefühl. Warmes Wasser ohne Ende. Zu diesem Zeitpunkt machte ich mir noch keine Gedanken über die Technik, die das möglich machte.
Das Geräusch tappender Füße ließ mich aufsehen. Tilde betrat die Brause. Nackt, wie ich, stand sie abwartend im Eingang und beobachtete mich.
Seltsam. In dieser Hinsicht, also als Frau, hatte ich sie während der Zeit, die wir bisher hier verbrachten, nicht wahrgenommen. Klar, sie war eine Frau. Aber eine verheiratete Frau. Nie hatte ich das Gefühl, dass sie mich begehrte. Ihre Nacktheit verstärkte den Eindruck der Erdverbundenheit. Stämmige Beine und Schenkel bildeten ein kräftiges, dicht behaartes Dreieck in der Leistengegend. Der Bauch war flach und die Muskeln angespannt. Ihre Arme hingen locker herunter. Dazwischen reckten sich auf einen mittelgroßen Busen, die Warzen in die Höhe. Das Gesicht trug den normalen freundlichen Ausdruck. Nur die Augen zeigten Anspannung und waren intensiv auf mich gerichtet. Die Einfachheit ihrer Haltung strahlte mehr Sexualität aus, als, wenn sie mich umgarnt hätte. Ich musste nicht an mir heruntersehen, um zu wissen, dass mein Glied erigiert war. Meine Gedanken beschäftigten sich auch nicht mit dem Altersunterschied, der fast dreißig Jahre betrug. Langsam kam sie auf mich zu, nicht aufreizend, sondern irgendwie selbstverständlich und legte die Arme um mich. Wir küssten und liebten uns, wie ein Ehepaar, das schon viele solche Situationen erlebt hatte. Ohne Hast nahmen wir die Vereinigung vor und explodierten in einem unvergleichlichen gemeinsamen Orgasmus. Ohne Worte seiften wir uns gegenseitig ein und suchten ein Nachtlager weit abseits der Kinder. Diese dürre trockene Beschreibung gibt nicht die Gefühle wieder, die wir empfanden. Übrigens: Sie hatte die Hochzeitsnacht vollzogen … wenn ihre Jungfernschaft nicht schon vorher verloren ging.
*
30. Mai 2012
Die beiden Männer beobachteten selbstvergessen den Monitor, der einen kleinen Raum zeigte, mehr ein Würfel von fünfzig Zentimeter Kantenlänge. In der Mitte lag eine mechanische Armbanduhr, der Marke Junghans aus den siebziger Jahren. Aus einer kleinen Öffnung einer Seitenwand quoll eine graue Masse und bewegte sich zielgerichtet auf den Zeitmesser, bis sie ihn komplett bedeckte. In weniger, als einer halben Minute trat die Masse den Rückzug an und verschwand wieder.
„Pass auf.“ Michael zeigte auf einen anderen Monitor. „Jeden Augenblick haben sie Informationen verarbeitet und über das Programm ausgewertet.“
Tatsächlich erschienen Markierungspunkte, die blitzschnell durch Striche geschlossen wurden und die Uhr aus dem Würfel, samt Innenleben und genauer Vermassung, darstellten. Daneben eine Stückliste mit Material- und weiteren Maßangaben.
Michael zeigte auf einen weiteren Monitor, in dem die gleiche graue Masse Materialen bearbeitete und auf ihrer Oberfläche in einen weiteren Würfel transportierte. Dort wurde das Materialstück in den grauen Teppich gezogen, der sich sehr schnell wieder teilte und zurückzog. Es blieb das genaue Duplikat der Uhr mit Befestigungsstiften für das Armband und Schnalle inklusive Dorn zurück.
Michael von Bernstein ging zum Ende der Würfelkette, öffnete den Deckel und hielt die Uhr und die Teile der Person hin, die mit ihm den Vorgang beobachtet hatte. Sie trugen Schutzanzüge und die Atemgeräte erzeugten ein leises pfeifendes Geräusch.
„Und das Armband?“, fragte Anton Schlösser, der für die Forschung zur Waffentechnik der Bundesregierung zuständig war.
„Dazu hätte ich das Material zur Verfügung stellen müssen. Die kleinen Roboter analysieren die Rohstoffe und bedienen sich entsprechend ihrer Programmierung. Naturprodukte stehen noch nicht zur Verfügung.“
„Trotzdem beeindruckend.“ Schlössers Stimme kam verzerrt über die Verständigungsanlage des Anzugs. „Dieser graue Teppich … das sind Maschinen?“
„Ja. Schauen Sie.“ Von Bernsteins Finger flitzten über die Tastatur, bis ein grauer Kasten mit einer Vielzahl, man konnte,