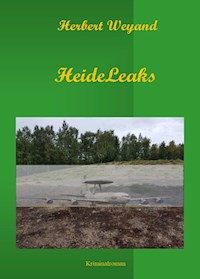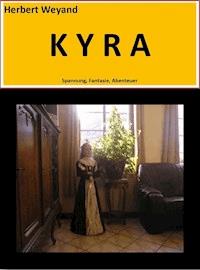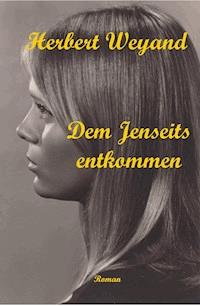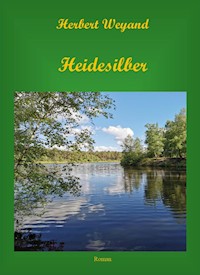Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: KHK Claudia Plum
- Sprache: Deutsch
Das Testament schlägt im Dorf ein, wie eine Bombe. Zwanzig Millionen Euro für die dreihundertköpfige Bevölkerung. Fast ein Sechser im Lotto, wenn da nicht die Bedingung wäre: Innerhalb eines halben Jahres muss ein Verbrechen aufgeklärt werden, das vor fünfzig Jahren geschah. Der Erblasser nennt es "Das Spiel". Während des Spiels werden Beteiligte ermordet. Wen wundert es, dass es im Dorf drüber und drunter geht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Weyand
Verhängnisvolles Testament
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1 (Juni)
Kapitel 2 (Mai/Dezember)
Kapitel 3 (Juni)
Kapitel 4 (Rückblick Februar/März)
Kapitel 5 (Juni)
Kapitel 6 (Rückblick Mai)
Kapitel 7 (01. Juni)
Kapitel 8 (Juni)
Kapitel 9 (August)
Kapitel 10 (August)
Kapitel 11 (August)
Kapitel 12 (August)
Kapitel 13 (September)
Kapitel 14 (September)
Kapitel 15 (August)
Kapitel 16 (Jana/Ägidius)
Kapitel 17 (Ägidius)
Kapitel 18 (Juli)
Kapitel 19 (Kant)
Kapitel 20 (Südafrika)
Kapitel 21 (DieSangoma)
Kapitel 22 (September)
Kapitel 23 (September)
Kapitel 24 (September)
Kapitel 25 (September/Oktober)
Kapitel 26 (November)
Kapitel 27 (November)
Kapitel 28 (Dezember)
Impressum neobooks
Kapitel 1 (Juni)
Das Dorf Grotenrath gibt es wirklich. Die Personen und Handlungen entspringen der Fantasie, es sei denn, das Einverständnis der Figuren, die in der Gegenwart wahrhaftig existieren, liegt vor.
Die Handlungen basieren auf Zeitungsberichten, Erzählungen, Klatsch, Gerüchten etc. undwurden kreativ weitergesponnen.
Natürlich gibt es in diesem Dorf nicht so viele böse Einwohner. Sie sind im Grunde normale Bürger ... jedoch ein wenig eigen. Die Menschen, die Landschaft und die Umgebunginspirieren zu spannenden Geschichten.
Herbert Weyand
Verhängnisvolles
Testament
Mörderkreuz
Kriminalroman
Sie fanden den Toten in den frühen Abendstunden. Rainer Sauber erreichte das sechsundfünfzigste Lebensjahr nicht mehr. Es wareinfach absurd. Er trug die grüne Schützenuniformjacke, auf deren linker Brustseite die Orden eines bewegten Schützenlebens prangten. Mehrals fünfundzwanzig Jahre Mitgliedschaft undwenigerals vierzig Jahre. Das konnte wer auchimmer an den Blechplaketten ablesen. Zweimal König, und zwar 1995 und 2002. Er lehnte auf der Bank, die vor der Obstwiese stand. Jeder, der ihn dort sah, dachte, er schliefe. Der Schützenhut mit der Feder saß keck in die Stirn gezogen und verdeckte die Augenpartie. Das täuschte keineswegsüber den roten Fleck hinweg, der sich auf dem blütenweisen Hemd, entlang des Revers der Jacke zeigte und unter der Krawatte verschwand. Das winzige Loch, unterhalb des Verdienstordens, konntewohl nicht für den Tod verantwortlich sein. Oderdoch?
Sauber saß in Onkel Willis Hütte. Ein schlichter Verschlag, den vor Jahren Nachbarn zum siebzigsten Geburtstag für das Original des Dorfes fertigten. Eine kleine Plakette auf der Bank zeugte davon. Das Holz des Überbaus troff vor Feuchtigkeit. Denn der Mai diesesJahrzeigtekeinesfalls ein sommerliches Gesicht. Seit Tagen drückte feuchte kalte Luft auf das Gemüt undtief hängende Wolken waberten neblig über der Landschaft.
Heute fand das Schützenfest statt. Im vergangenen September wurde eine, fünfzigmalfünfzig Zentimeter messende, Holzscheibe zu einem Vogelmotiv zurechtgeschnitten und mit Farbe bemalt. Das Holzmusstetrocken, jedochnicht zu trockenseinund eine Stärke besitzen, sodass es mindesten einhundert Schuss, aus einem Kleinkalibergewehr, standhielt. Achtundvierzig Schützen wollten wenigstens zweimal auf die Scheibe schießen. Falls sie auf den Holzvogel schossen … dennsollte er fallen, wurde der SchützeKönig. Für ein Jahr König. Eine archaische Tradition, die womöglich aus der Steinzeit stammte. Die Neandertaler entdeckten, dass der Mann zu Mann Kampf wertvolle Krieger kostete. Sie fassten den Entschluss, Steine zu werfen. Wer am weitesten warf, wurde Häuptling. DeshalbSteinzeit. Das warheutenicht anders. Nurwurden die dicken Steine, sinnbildlich, durch kleine ersetzt. Wer genügend Kies besaß, konnte es sich leisten, nicht daneben zu schießenund wurde Häuptling. Zu Ehren dieses Stammesführers fand an diesem Wochenende das Fest statt.
Abergeradeheute lief alles aus dem Ruder. Es fing blöd an.
»Scheiße«, tönte es von der Hecke hinter dem Zelt. »Verdammte Scheiße.«
»Was ist?«, rief Franz Schröder, der an einem Pflock des Zeltes hantierte.
»Scheiße«, schrillte die Stimme. Aberso verzweifelt, dass er nachsehen ging. »Was ist los?«
»Boah«, Gerd Klammer presste die Hände in den Schritt. »Irgendein Idiot hat einen Weidezaun in die Hecke gelegt und ich habe darauf gepisst.«
»Autsch«, meinte Franz. »Das tut weh.« Er spürte, wieseine Hoden krampften. Ein elektrischer Schlag auf die Teilchen war alles andere, als angenehm.
»Wenn ich den kriege, nagele ich seinen Schwanz auf den Boden«, brachte Gerd gepresst vor. Er nahm eine Hand von der Schamgegendund wischte die Tränen aus den Augen. »Es geht wieder«, murmelte er kläglich. Die andereHand verschloss den Reißverschluss der Hose. »Ich geh zur Toilette.« Er schlich, die Oberschenkel weit auseinandergedrückt, um das Zelt herum.
»Haste endlich einen hochgekriegt«, rief jemand, den er nicht ausmachen konnte.
»Noch ein Wort und ich dreh dir den Hals herum.« Wer den Schaden hatte, brauchte für den Spott nicht zu sorgen.
Klammer humpelte um das Torhaus herumund betrat die Toilette. Er sah auf einen Mann und eine Frau, die gespannt den Bildschirm eines iPad beobachteten. »Und was Neues«, fragte er. Beide schüttelten unisono den Kopf. Er trat an das Urinal und erleichterte sich. Der Schmerz des Stromschlags ließ fast sofort nach. Er kramte die Teilchen und wandte sich um, während er den Reißverschluss der Hose hochzog. »Bleibt am Ball«, meinte er undtrat durch die Tür nach draußen.
»Hände waschen, du Sau«, rief die Frau hinter ihm her. Er winkte ab.
*
Kapitel 2 (Mai/Dezember)
Werner Böttcher zog fröstelnd die Jacke um den Körper. Die Eisheiligen machten ihrem Namen alle Ehre. Der gesamte Mai war beschissen kalt. Geranien und Begonien kümmerten vor sich hin. Aber die solltensowieso erst ab dem Fünfzehnten nachdraußen. Er sah zu den Heidbäumen hinaus. Je nachdem, wie die Wolken über den Bäumen zogen, konnte er ziemlich genau das Wetter für den Tag voraussagen. Er trat an den Rand der Terrasse und zündete eine Zigarette an. Bis vor wenigen Wochen rauchte er noch drinnen. Doch seitdem der Arzt seiner Frau die chronische Bronchitis attestierte, verzog er sichnachdraußen. Werners Figur verschmolz mit der grauen Hauswand. Dafür sorgte die drei Viertel lange Jacke, deren Farbe mit dem Hintergrund verschmolz. Werner Böttcherwar normaler Durchschnitt. Er sah weder gutnochschlecht aus. Das Auffallendste an ihm waren die grünen Augen, die er oft zusammenkniff. Insbesondere, wenn er etwas durchsetzen wollte. Mit Leib und Seele stand er der Schützenbruderschaft vor. Der Verein fraß die gesamte Freizeit, insbesondereseit der Sache mit dem beknackten Testament.
Zusätzlich liefen seit Tagen, nein seit Wochen, die Vorbereitungen für die Frühjahrskirmes. In einer Zeit, wo die katholische Kirche, die Kirche insgesamt, in der Kritik stand, wurde es immer schwieriger dem christlichen Anspruch an ein solches Fest, gerecht zu werden. Hinzu kam die Vereinsmüdigkeit. Hinzu kam auch eine Spannung, die über dem Dorf lag und nichts mit dem Fest zu tun hatte.
Der Brief kam um die Weihnachtszeit des vergangenen Jahres und er dachte an einen Scherz. Die Schützenwurden Testamentsvollstrecker eines Witzboldes. Dazu wurde der Vereinsvorsitzende, als Vertreter der Schützen, von einem Düsseldorfer Notar zu der Testamentseröffnung gebeten. Das Anschreiben verlangte absolute Diskretion, weil diese Auflage vom Nachlasspfleger verlangt wurde. Der Rückruf ergab, dass tatsächlich jemand, in seinem Letzten Willen, die Schützen bedachte. Aber Verschwiegenheit … wiesollte er das machen?
Die Vorstandsversammlung, die er einberief, schlug hohe Wellen. Unmöglich, dass der Vorsitzende den Termin alleine wahrnahm. Dafürwar das Misstrauen zu groß, er könne sichselbst bereichern. Alle Versuche die Mannschaft klein zu halten, schlugen fehl. Nach heftigen Auseinandersetzungen wurde für Mittwoch zwischen den Feiertagen ein Kleinbus gemietet. Der gesamte Vorstand, sage und schreibe sechzehn Mitglieder, begabsich in erwartungsvollem Optimismus auf den Weg nach Düsseldorf. Die Anspannung, unter der sie standen, lag auf ihren Gesichtern. Niemand besaß das kleinste Zipfelchen Ahnung, wer wohl der Gönner war. Sie gingenwiederundwieder die Verstorbenen der letzten Monate und Jahre durch. Doch da warnichts, zumindest nicht für die Bruderschaft. Der Nachlass von denenging an die Familien.
Nachgut einer Stunde drängelten sie im Vorraum des Notariats.
»Wer ist der Vorsitzende?«, fragte die jungeFrau aus dem abgeteilten Bereich heraus. Fünf Schreibtische wurdendurch einen Tresen von dem Vorraum abgetrennt. »Den stellvertretenden Vorsitzendenund den Kassierer benötige ich auch.«
Werner Böttcher und die beiden Kollegen traten vor. Sie nannten ihreNamen. Die Notariatsgehilfin bat um die Ausweise und verglich die Daten mit dem Vereinsregisterauszug, der ihr vorlag. »Die Personalausweise bekommen Sie gleich von Herrn Brück zurück.« Sie trat in den Vorraum. »Darf ich Sie bitten.« Die jungeFrau öffnete eine Tür. »Bitte.« Werner Böttcher, Günter Franke und Siegfried Boll betraten den Raum … und die Mannschaft drängte nach.
»Meine Herren, sogeht das nicht. Der Vorstand wurde einbestellt, nicht die gesamte Bruderschaft.«
»Wir sind der Vorstand«, sagte Jakob Senden aufgeregt. »Ich bin der zweite Kassierer.«
»Ich bin der Hauptmann«, meinte HeinerGiersch. »Ich habe das Sagen, wenn wir außerhalb unseres Dorfes agieren. Das sind wir schließlich. Lassen Sie mich durch.« Er stotterte bei der Missachtung seiner Person.
»Das mag sein.« Die Gehilfin nickte betrübt. »Aberhiergeht es um den gesetzlichenVorstandund der wird durchdiese drei Herren repräsentiert. Sie werdennicht gebraucht.«
»Sohaben wir nicht gewettet.« HeinerGiersch packte die Frau an der Schulter.
»Halt«, rief Werner Böttcher mit gedämpfter Stimme. »Fass die junge Dame nicht an. Wir sind der gesetzlicheVorstand. So ist das nunmal. Ihr setzt euch am besten in das Restaurant, dort, wo der Bus parkt und nehmt ein Frühstück auf den Verein.« Er baute die garnichtmalso imposante Figur resolut vor den anderen auf.
»Das habt ihr euch gedacht.« Jakob Senden tratnach vorn. »Ihr könnt uns nachher erzählen, was ihr wollt.«
»Bevor wir einen Aufstand machen«, meinte SiegfriedBoll, »verzichten wir auf das Erbe oder was immer es sein mag. Dannwerden wir wieder normal. Ich habkeine persönlichen Aktien hier.« Er trat zwischen die Männer. »Außerdem stinkt mir das Misstrauen, das ihr uns entgegen bringt.«
»Genau«, meinte Günter Franke, der an und für sichnie viel sagte.
»Gut«, Giersch gab nach. »Da können wir nichts machen.« Jeder sah, wie schwer ihm die Worte fielen. Der Hauptmann redete ansonsten ein gewichtiges Wort mit. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass die satzungsgemäße Regelung vor der gesetzlichen keinen Bestand hatte. »Wir treffen uns später im Restaurant.« Der verkniffene Gesichtsausdruck besagte alles.
»Guten Tag meine Herren.« Notar Brück betrat das Büro. Die dreiSchützen saßen um den runden Tisch, der acht Personen Platz bot. »Sie habensich bei meiner Mitarbeiterin ausgewiesen.« Er schob die Personalausweise in eine Reihe, bis sie exakt ausgerichtet vor ihm lagen. »Ihre Bruderschaft, die durch Sie vertreten ist, wurde von Herrn Beatus Basketmaker zur Testamentsvollstreckerin seines Nachlasses erklärt.«
Die dreiSchützen sahen sich verständnislos an und schüttelten leicht den Kopf. Den Namen kannte niemand von Ihnen.
»Ich muss gestehen, vor mir liegt das ungewöhnlichste Testament, das mir je untergekommen ist.« Das Gesicht des ungefähr sechzigjährigen Mannes trug einen bekümmerten Ausdruck. »Aber das habe ich nicht zu beurteilen.«
*
Kapitel 3 (Juni)
Es war zum Mäusemelken. Am heiligen Sonntag undauchnoch zu einer saublöden Zeit ein Mord. Das fehlte noch, dass er den Tatort im Fernseher verpasste. Heute kam sein Lieblingsteam: Klara und Perlmann vom Bodensee. Seitdem er vor einigen Jahren die Insel Mainau besuchte, liebte er dieses Team, das um Konstanz herum ermittelte. Aber er konntesich die Sendung jaspäter auf dem PC reinziehen.
Oberkommissar Ägidius Habakuk Schmitt, Schmitt ohne Zusatz, das war bei diesen Vornamen nicht nötig, betrachtete aus einiger Entfernung den möglichenTatort. Schmitt sah aus, wie der Ritter von der traurigen Gestalt. Eins neunzig, hager, fast dünn, die Schultern ein wenignach vorn gebogen, alstrüge er eine unbekannte Last. Die kupferfarbene, nicht zu bändigende Haarpracht stand wirr vom Kopf. Viele kleine Locken ringelten in die hohe Stirn. Unter buschigen Augenbrauen musterten grüne Augen die ach so unwürdige Welt, mit der er auskommen musste. Unter der geraden, fast römischen Nase verzog sich der Mund, mit den vollen Lippen, missmutig nachunten. Nicht etwa, weil es der Situation entsprach, nein, dieswar der übliche Ausdruck. Das breite Kinn trug eine senkrechte Kerbe.
Das Gesicht zeigte abweisende blasierte Züge, die sogutwie jeden davon abhielten, ihn anzusprechen. Ägidius trug Jeans, aberkein Modell von Mustang oder Wrangler, sondern die Arbeitshose von van Cranenbroek, die es dort schon für unter fünfzehn Euro gab. Die Hose schlackerte um die Beine. Dazu ein blau kariertes Hemd, eben ein Arbeitshemd aus dem gleichen Laden. Die ausgelatschten Sportschuhe hattenauchschoneinige Jahre auf dem Buckel.
Im Grunde war der Oberkommissar kein schwieriger Mensch. Wer ihn undseine Art zu nehmen wusste, kam gut klar. Aber wehe nicht. Wenn Zeit für den Job war, dachte er ausschließlich daran und in der Freizeit, eben an die Freizeit. Es warganzeinfach.
Mit einigenDingen im Leben konnte er nichtsanfangen. Dazu zählten vor allen DingenMenschen. Nicht, dass er sie hasste. Nein. Sie waren ihm gleichgültig. Schon manch einer fragte sich, weshalb er Polizist wurde und für die Allgemeinheit arbeitete. Das warganzeinfach. Wenn er mit Menschennichtsanfangenkonnte, bedeutete das nicht, dass er sie nichtstudierte. Das gehörte zu seinen Prinzipien. Den Sachen auf den Grund gehen. Das führte dazu, dass er alsjungerMenschzunächst Lehramt studierte. Für ihn war das eine Möglichkeit, die Fehler, die Lehrpersonen, nach seinem Dafürhalten, an ihm begangen hatten, für weiterejungeMenschen auszuschließen. Bis zu seinem Referendariat. Er würdewohl, zumindest im Bundesland Nordrhein Westfalen, niemehralsLehrperson eingestellt werden.
Es warfast genauso, wie zu der Zeit, als er in einer Supermarkt Filiale einen Ferienjob annahm und das Warenordnungssystem in den Verkaufsregalen revolutionierte. Er setzte seine Vorstellung von Ordnung und Verkaufsstrategie um. Beim Supermarkt Süd hatte er Hausverbot.
Mehr zufällig geriet er in die Polizeilaufbahn. Jetzt stand er in diesem Heidedorf undmusstesich mit diesem Fall beschäftigen. Schmitt kam aus Düsseldorf, weil die Aachener Kollegen eine seltsame Urlaubsregelung praktizierten. Das gesamte Kommissariat zum gleichen Zeitpunkt ausgeflogen. Beknackt.
»Halte den Penner dort auf.« Schmitt schreckte hoch. Der uniformierte Kollege wies einen anderen Beamten an, der sich dem Oberkommissar prompt in den Weg stellte.
»Schmitt«, sagte er kurz unddrückte den Mann zur Seite.
»Haben Sie noch alle Tassen im Schrank. Das ist ein Tatort undaußerdem … lege dich zu deinenKollegendort hinten«, er zeigte auf eine kleine Baumgruppe an der Ecke Waldstraße und Panzerstraße. Der Küfenweg, auf dem sie sichbefanden, endete ebenfalls dort. In dem Wäldchen, an der Kreuzung, ,rasteten‹ schonmal Obdachlose, die unterwegs waren.
Ägidius musterte den Wicht, er warnicht mehr alseins siebzig, ausdrucklos. SeineHand schoss nach vorn und packte das linke Ohrläppchen. Er drücktefest zu und drehte es leicht. »Hatdeine Mama dir nicht beigebracht, zu Fremden undinsbesondere Vorgesetzten, freundlich zu sein?« Sein Bass rollte und brachte die Luft zum Vibrieren. Er fasste mit der linkenHand in die Gesäßtasche und zückte den Dienstausweis. »Schmitt«, sagte er, wobei er das Ohr festhielt. »Oberkommissar, Mordkommission.« Er drücktenocheinmal zu und stieß den Polizeibeamten zurück. Ohne ihn weiter zu beachten, näherte er sich dem Toten. »War die Spurensicherung schonhier?«, fragte er.
»Wir sind fertig.« Die Frau trug einen weißen Overall und kam von der Obstwiese, deren Eingang rechts von der Hütte lag. Sie beobachtete den Vorgang mit dem uniformierten Kollegen kopfschüttelnd. »Den Bericht bekommen Sie morgen«, meinte sie kurz angebunden. Der Grobian konntewarten. »Wenn der Arzt den Tod festgestellt hat, wird die Leiche abgeholt und kommt in die Rechtsmedizin nach Köln. Aber ich bin mir sicher, da braucht man keinenMediziner. Toter geht nicht.«
Schmitt nickte kurzund nahm die Szene mit dem Toten auf. Er konnteimmerwieder auf das zurückgreifen, was er jemals gesehen hatte. Sein Gehirn besaß eine visuelle Aufzeichnungsfunktion, die jedochnur bei Bildern funktionierte. Bei Texten klappte das überhauptnicht. Ein Gedanke drängte sichnach vorn: Weshalb kam der Medizinernach der Spurensicherung? Klar …, der wartot, das sah jeder. »Gibt es Augenzeugen?«, fragte er niemand Bestimmtes. Keine Antwort. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er alleine vor der Bank stand. Die anderen hattensich abwartend hinter die Absperrung zurückgezogen. Er zuckte mit den Schultern. Es warnicht das erste Mal. Da musste er durch.
Eine Bewegung hinter ihm ließ ihn dorthin schauen. Eine Frau in Joggingkleidung hob die Absperrungund schritt, ohne ihn zu beachten, zu dem Toten. Ein graubrauner Dackel zockelte hinter ihr hier.
Was sollte das schonwieder? Er fasste sie an die Schulterund wirbelte unversehens durch die Luft. Er landete unsanft auf der Schulterund vermied eine schwerere Verletzung, weil er den Körper während des Flugs automatisch entspannte. Damit hatte er nicht gerechnet, sonstwäre es ihm nicht passiert. Denn er war ein passabler Sportler, auch Kampfsportler. »Das war unnötig«, stellte er fest, indes er auf Hände und Füße rollte. Dabei verdrehte er die Augen. Wie blöd. Klassisch aufs Kreuz gelegt unddazu von einer Frau. »Verlassen Sie bitte den abgesperrten Bereich.« Er saß nochimmer auf dem Boden undmachte eine vage hilflose Bewegung in die Richtung, aus der sie gekommen war. Der Dackel schnüffelte an ihm und der Schwanz drehte wie ein Propeller.
Die Kollegen der Spurensicherung und Technik beobachteten das Schauspiel. Immer mehr Menschen kamen hinzu und kicherten.
Ägidius entwirrte die Knochen und stand umständlich auf. Er zückte den Dienstausweis. »Schmitt, Kriminalpolizei. Treten Sie bitte hinter die Absperrung.« Er musste keine besondere Kraft aufbieten, um sachlich zu bleiben. Auf Deutsch gesagt, ging ihm die Episode am Arsch vorbei.
Die Frau studierte die Plastikkarte und nickte. Wortlos stellte sie sich zwischen das technische Personal der Kripo und schüttelte leicht den Kopf, als jemand sie ansprechen wollte. Sie trug einen belustigten Zug in den Mundwinkeln.
Der Dackel wich nicht von den Füßen des Oberkommissars, was ihn sichtlich nervte. Er hob den Fuß.
»Unterstehen Sie sich«, rief die Frau, mit einer ausgesprochen weiblichen Stimme, in mittlerer Tonlage. Die blöde Kuh, die ihn vorhin aufs Kreuz legte. Er ignorierte den Hund.
»Ihren Namen bitte.« SeineStimme grollte. Schmitt besaß, von Geburt an, einen leichten Sehfehler. Die Augen musterten einen älterenMann, der gegen sein Fahrrad lehnte und auf den Leichnam starrte. Dabei hatte er die Frau im Visier.
»Meinen Sie mich?«, fragte der Mannund bestieg das Rad und radelte davon.
»Clarence«, flüsterte jemand verständlich, wobei die älteren lachten und die jüngeren verständnislos schauten. Daktari, mit dem schielenden Löwen, war eine andere Zeit.
Äußerlich unbeeindruckt ging der Hauptkommissar zur Absperrung. »Ich meine Sie«, sagte er zu der Frau mit dem Hund.
»Claudia Plum.«
»Sie wohnen in diesem Dorf?«
»Ja.«
»Kennen Sie den Toten?«
»Ja.«
»Hat er einen Namen?«
»Ja.«
»Können Sie mir den sagen? Stopp«, er hob eine Hand, »mein Fehler. Sagen Sie mir den Namen des Toten … bitte.«
»Rainer Sauber.« ClaudiaPlumüberlegte, ob sie dem aufgeblasenen Ochsenfrosch sagensollte, wer sie war. Aber nein. Das konntewarten.
»Danke«, murmelte Schmitt abwesend. Die Gedanken richteten sich auf den Toten.
»Er ist faktisch ein Ureinwohner«, fuhr Claudia fort und holte den Oberkommissar zurück. »Im Dorf ist diese Woche Schützenfest. Deshalb die Uniform.« Der Typ tat ihr leid. Was konnte er dafür, dass die Mordkommission in Aachen verwaist war. Sie zückte ihre Plastikkarte, die sie auch im Urlaub bei sichtrug. »Ich befindemich im Urlaub. Normalerweise wäredies mein Fall.«
»Ich weiß«, entgegnete Schmitt. »Sie glauben doch nicht, dass Sie ansonsten ungeschoren davon gekommen wären, nachdem Sie michaufs Kreuz gelegt hatten.« Er grinste und zeigte seine perlweißen Zähne, bei denen zwei Schneidezähne im Oberkiefer überflüssigerweise vorstanden. »Bevor ich vorhin hierher fuhr, habe ich natürlich Erkundigungen eingezogen. Der Tote ist tot. Also hatte ich Zeit.« Er stockte undmusterteihre Erscheinung. Was er sah, gefiel ihm. Auch, wenn der Jogginganzug, den sie trug, großen Muts bedurfte. Zumindest nach seiner Meinung. Ein knalliges Gelb mit je drei roten Streifen an den Seiten. Sie konnte es tragen.
Das braune Haar fiel, leicht gelockt, bis auf die Schultern. Zu ihrer sportlichen Figur gehörte ein normal großer Busen. Nicht zu kleinundnicht zu groß. Aber das war Geschmackssache. Anfang dreißig … na ja … fast zweiunddreißig undeins siebzig groß. Die grauen Augen musterten ihn spöttisch. Aber das kannte er und wiederholte sich bei den vielen Springereinsätzen. Er ließ sich durch den Kopf gehen, was er über sie wusste.
Die Hauptkommissarin wurde vor etwa zwei Jahren nachAachen versetzt und übernahm dort das Dezernat für Tötungsdelikte. Trotz ihresjungen Alters konnte sie zu diesem Zeitpunkt auf einen steilen Aufstieg beim LKA in Düsseldorf zurückblicken. In zwei spektakulären Mordfällen, die längere Zeit bei den Akten lagen, gelang ihr die Aufklärung. Für die fällige Beförderung zur Hauptkommissarin fehlte die entsprechende Planstelle. Es sei denn, die Bewerbung in den Innendienst. Darauf hatte sie keine Lust und bewarb sichnachAachen. Das war die offizielle Geschichte. Schmitt lächelte innerlich, hielt diese Gemütsbewegung jedoch verschlossen. Ein sehr aufmerksamer Beobachter hätte das, belustige Funkeln im Hintergrund der Augen, bemerkt. In Wahrheit uferte das Verhältnis zu einem verheirateten, vorgesetzten Kollegen aus, sodass es angebracht schien, den Berufsstandort zu wechseln.
Gleich bei ihrem ersten größeren Fall, traf sie, im platten Hinterland Aachens, auf einen Menschen namens Kurt Hüffner, der die Liebe ihres Lebens wurde.
Er wusste, dass Frau Plumstets um Distanz bemühtwarund viele schreckte, die sich ihr näherten. Sie besaß Ausstrahlung und beherrschte die Szene sofort, wennsie, sie betrat. Dabeiwar sie immer um Perfektion bemühtund verdeckte ihre, dadurch entstehenden Unsicherheiten perfekt. Das Dossier, das ihm zu ihrer Person zur Verfügunggestellt wurde, enthielt Hinweise auf eine emphatische Veranlagung, was sie als hinderlich ansah. Ihre Sensoren filterten die feinsten Schwingungen ihres Umfeldes. Die Kollegen des Teams, mit denen sie zusammenarbeitete, verdrehten die Augen, wenn ihr Bauchgefühl zuschlug. Dabei stimmte der vorauseilende Ruf, sie löseihreFälle aus dem Bauch heraus, nur teilweise. Letztendlichwar es der analytische Verstand, der Fakten und Gefühle, zu erfolgreichen Ergebnissen fügte. Schmitt wusste, dass sie sichkeinesfalls aus dem Fall heraushalten würde. Das warauchletztendlich die Spekulation, weshalb ihm kein Personal zur Verfügung überlassen wurde. Sein Erscheinen rief an jeder Dienststelle die gleichen Abläufe auf den Plan. Die ortsansässigen Beamten rissen sich den Arsch auf, den Fall vor ihm zu lösen. Die Vorgesetzten wussten mit Rationalisierung umzugehen. Bisher wurde er zu Urlaubsvertretungen in ein Team abkommandiert. Dochhier fehlte die gesamte Mannschaft … bis jetzt. Vielleichtwurden die anderen Kollegen auch auf den Plan gerufen. Ihm sollte es rechtsein.
Vor einem Jahr heiratete Plumihren Hinterwäldler und lebte mit ihrem Kurt in diesem Heidedorf. Dort wo sich Fuchs und Gans Gute Nacht sagten … dort, wo die Gehwege jeden Abend hochgeklappt wurden, damit niemand stolperte. Nicht, dass jemand einen Bürgersteig benötigte. Grundsätzlich liefen die Dörfler mitten auf der Straße, sei es mit Kinderwagen oder Schubkarre.
Für die Kollegin bedeutete es sicherlich einen großen Schritt, aus der Großstadt heraus, in dieses verlassene Kaff. Schmitt erfuhr aus den Unterlagen, dass hier die Uhren anders tickten. Zeitwarrelativ, besondershier. Immerwieder blieben Minuten für eine kurze Unterhaltung, die den alltäglichen Tratsch zum Inhalt hatte. Zeit, die sie nicht besaß unddennoch aufbringen musste.
»Was wollen Sie jetzttun?« Claudias Stimme holte ihn aus den Überlegungen.
»Ich?«, fragte er und schüttelte den Kopf. Klar er, wer sonst. »Ich habe mir den Tatort angesehen und erwarte die Berichte der Spurensicherung und der Mediziner. Aber das wissen Sie alles.« Er musste mit den Gedanken alleinsein. Die vielen Leute und vor allem die beurlaubte Kollegin störten ihn.
»Ich muss jetzt zuerst ins Präsidium undmich dort melden. Der Anruf zu diesem Einsatz erreichte mich auf der A46. Als ich mich auf dem Rastplatz, über das iPad informierte, fand ich alles, nurnicht Ihre Adresse. Die bekomme ich in Aachen. Vielleichtmelde ich mich bei Ihnen.« Sagte es und trabte zum Fahrzeug, das am Hintereingang des Friedhofs parkte.
»Thilo. Was war das für einer?« Sie wandte sich an den Gerichtsmediziner, der mit den Kollegen abseits des Geschehens stand.
»Das war Schmitt … mit tete. Ich habe von ihm gehört. Ein unruhiger Geist, der sich in keine Schublade packen lässt. Ein kluger Verstand undsehrguter Ermittler. Er braucht den Freiraum. Ein typischer Einzelgänger. Sein Ruf eilt ihm voraus undseine Spezialität: Anderen vor den Kopf stoßen.« Der hagere Kollege spulte sein Wissen herunter.
»Mir soll es egal sein«, meinte Claudia. »Ich habe Urlaub. Kurtund ich wollen heute nach Palenberg. Da ist Kaiser Karl Fest.«
»Ich denke, hier ist Schützenfest.« Thilo wirkte fast empört. Wiekonnte jemand ins Nachbardorf gehen, wenn hieretwas los war?
Claudia zuckte mit den Schultern. Doch sie wusstenicht, was mit Kurtwar, der partoutnichts mit den Schützen zu tunhaben wollte. Nurso viel, dass es mit seinem Heimatdorf Teveren zusammenhing. Was genau … jedochnicht.
»Was mach ich jetzt?« Sie fragte rein rhetorisch.
»Am besten ins Auto setzen undnichtswie weg.« Thilo grinste, weil er wusste, dass das nie eintreten würde. »Ich schicke dir den Bericht parallel nach Hause. Damit du auf dem Laufenden bist«, sagte er spöttisch.
»Das ist gut«, meinte Claudia, die den ironischen Tonfall bemerkte. »Man kann ebennicht aus seiner Haut heraus.«
»Sag ich doch.« Thilo winkte und wandte sich der Arbeit zu.
Ein trockener bellender Husten ließ Claudias Kopf herumfahren. »Thilo, der lebt«, rief sie und stürzte zu dem angeblich Toten. »Verdammte Schlamperei«, fluchte sie. Rainer Sauber bewegte die Glieder und versucht von der Bank aufzustehen. »Bleiben Sie sitzen. Sie sindangeschossen.« Er stierte sie ungläubig an und fiel zurück.
»Angeschossen?«, krächzte er kaum verständlich und hob erst den rechtenunddann den linken Arm, alszöge jemand daran. Er schüttelte den Kopf. »Blödsinn.« Er stand schwerfällig auf und wankte. SeinFingerfuhr zum Loch in der Jacke und zog den Hohen Bruderschaftsorden darüber. »Bin in dem blöden Ast dahinten hängen geblieben.« Er nickte vage in Richtung Dorf. »Und die Flecken sind Currysoße. Ich wollte mir ein frisches Hemd anziehen.« Er fuhr mit der Handüber die Stirn. »Wie ich hierher komme, weiß ich jedoch nicht. Sie sind Kurts Frau«, er stieß mit dem Finger auf sie. »Bringen Sie mich nach Hause.« Der Ton war befehlend und ließ keinen Widerspruch zu.
»Sowie ich das sehe, können Sie alleine gehen. Haben Sie getrunken?« Sie hob in Abwehr beide Händeund trat einen Schritt zurück.
»Klar habe ich getrunken. Es ist Schützenfest. Drei oder vier Bier über Stunden hinweg. Im Grundekönnte ich Auto fahren. Ich bin kein Säufer.« Sauber setzte sich. »Es ist die blöde Krankheit. Früher hatte ich noch epileptische Anfälle. Dannhaben die mir ein Loch in den Schädel gebohrt.« Er stierte blicklos in die Gegend. »Jetzthabe ich alle paar Monate diese Aussetzer. Irgendwannwache ich in einem Sarg auf. Das ist verdammte Scheiße.« Er hieb auf das Knie.
»Ihnen geschieht das öfter?« Claudia sah ihn fassungslos an.
»Öfter?« Er winkte ab. »Das warjetzt das vierte Mal. Im Grunde kann ich damit leben.«
»Und du hast den Tod festgestellt«, sagte sie bitter zu Thilo.
»Ich?«, fragte er entrüstet. »Ich habe ihn nicht angefasst. Soweitwar ich nochnicht. Mir wurde gesagt, er sei erschossen. Was sollte ich mich beeilen. Er konntejanicht weglaufen.« Die hagere Gestalt bebte vor Empörung.
Claudiawinkte ab und wollte gehen, als sie das Fahrrad bemerkte, das in sagenhaftem Tempo von der Panzerstraße herauf auf sie zufuhr. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Das warKurt, und wenn er so raste, bedeutete das nichts Gutes. Edgar entdeckte einen Moment früherals sie, wer ihnenentgegen radelte und schoss wie eine Rakete kläffend auf die Straße. Er liefseinem Herrchen entgegen, der ein Ausweichmanöver startete, um den Dackel nicht zu überfahren. Kurtmachte einen Schlenker undknallte mit dem Vorderrad in den Stacheldrahtzaun. Er hob die Schwerkraft für sich auf und segelte in die Wiese. Er knalltewie ein nasser Sack zu Boden. Als sei nichts geschehen sprang er auf die Beine undlief zu Claudia.
»Unten am Kreuz liegt ein Toter«, rief er aufgeregt. Die mittelblonden Haare standen vom Fahrtwind in die Höhe. Die einsneunzig große Gestalt mit den breiten Schultern schien in Ordnung. Der Sturz blieb also ohne Folgen. »Was ist hier los?«, fragte er.
»Falscher Alarm«, meinte sie lakonisch. »Wo ist ein Toter?« Sie musterte ihn misstrauisch. Was war heute los? Das konntedochnicht von dem beknackten Schützenfest herrühren.
»Am Kreuz.« Er kniff die grünen Augen zusammen und über das ansprechende jungenhafte Gesicht zog ein verständnisloser Ausdruck. »Wiesonoch ein Toter?«
»Das ist eine Geschichte, die ich dir spätererzähle.«
»Dochnicht Reiner?« Kurts Zeigefinger stach in Richtung des Schützen und wieherte los. »War der wiedereinmal scheintot? Das weißdoch jeder.«
»Undwieso ich nicht?« Sie baute sich vor Kurt auf und legte den Kopf in den Nacken, um in seineAugen zu sehen. Sie war zwar keine kleine Frau, aber vor ihm wirkte sie zierlich.
»Später. Sag deinen Kollegen Bescheid. Der Typ dahinten ist wirklichtot. Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen.« Er fasste sie bei der Hand und zog sie den Weg hinunter. Kurt arbeitete freiberuflich an der RWTH. Nichtsoganz, denn er war zusätzlich in einem Institut angestellt, wo er einige Stunden ableisten musste. Ansonsten verfügte er über die berufliche Zeit frei. Kurt besaß einen Hang zum Mystischen. Geprägt von der Landschaft und den Menschen, die ihn umgaben. Dabeiwar er unkonventionell undunglaublichneugierig. Er ging allem undnichts auf den Grund. Sehr zum Missfallen seiner Umgebung, der er damit auf den Keks ging.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte Claudia ahnungsvoll, auf dem Weg zum Wegekreuz. In einigen ihrer Fälle hatte sichKurtals Leichenspürhund erwiesen. Die Toten zogen ihn an.
»Das war Zufall.« Er blieb stehen und suchte den Augenkontakt. »Ich wollte dir entgegen fahren. Ich hielt am Kreuz an und überlegte, wo du wohljetzt aushängst. Dann sah ich die Turnschuhe im Gras der Wiese. Du weißt, die dem Peter gehört. Der mäht jasogut, wienie. Jetzt steht sie kniehoch. Ich wollte die Dinger holen und in den Müllbehälter neben der Bank werfen. Wie der Teufel es wollte, hingen da noch Beine dran. Erst da fiel mir die Bescherung auf.«
»Erschlagen sagst du?«
»Nehme ich an. Der Kopf ist voller Blut. So genau hab ich nicht mehr geguckt. Von dir weiß ich ja, dass viele Spuren zerstört werden können.« Er nickte und setzte den Weg fort, der linker Hand von dichten Hecken gesäumt wurde, die einen Einblick in die Grundstücke verwehrte. Rechts dehnten sich die Felder bis nach Teveren. Sie gelangten zum Wegekreuz.
Claudia ließ ihren Blick kreisen. Plattes Land, soweit das Auge blickte. Im Rücken lag der Waldsaum, der das Heidegebiet begrenzte, das aus den Niederlanden herüberzog und mit Unterbrechungen bis zum Niederrhein reichte. Hier am Kreuz liefen sechs Wege zusammen. Zwei direkt ins Dorf. Der eine war der Küfenwegund der andere die Waldstraße. Die befestigte breiteStraße kam direkt von der Fliegerhorst Straßeundführte über die Kreuzung zum Heiderand. Sie wurde im Volksmund Panzerstraße genannt und wurde auf dem Navi mit Reitweg bezeichnet. Die Verlängerung der Waldstraße kam ebenfalls von der Heide. Der letzte Weg führtegerade zur niederländischen Grenze. Eine bekannte Landschaft, die sie jeden Tag währendihres Spaziergangs mit Edgar sah. Doch jetzt, kurz bevor sie mit dem Tod konfrontiert wurde, nahm sie andere Dinge auf, die ihr ansonsten entgingen. JederdieserWegeunterschiedsich von den anderen. Nicht, was die Richtung anging. Nein. Sie unterschiedensich im Ausbau. Jederwar zwar für Pkw befahrbar, dochzwei besaßen keine befestigte Verbindung zu anderenStraßen. Sie führten in die Heide. Auf dem langen Wirtschaftsweg zur Weberkiesstraße fiel faktisch jeder auf, der hier fuhr. Der Küfenwegwar für landwirtschaftliche Fahrzeuge zugelassen und die Waldstraße eine Anliegerstraße. Blieb die Panzerstraße als einziger eventuellerschneller Fluchtweg. Doch aus eigener Erfahrung wusste sie, dass hier niemand Verkehrszeichen beachtete. Die Waldstraße wurde mehrundmehr zu einer Durchgangsstraße.
Das Dorf selbstwar ein Straßendorf durch das sichdie, etwa zwei Kilometerlange, Corneliusstraße schlängelte. Etwas über dreihundert Haushalte. Jeder kannte jeden. Geschäfte gab es keine, wenn sie den Gastronomiebetrieb Jägerhof ausklammerte. Faktisch die Dorfkneipe mit einem angegliederten Restaurant. Sie schüttelte die Gedanken ab.
»Wo liegt er?«, fragte sie und starrte zum Wegekreuz.
»Wir müssen näher heran. Keine Sorge, ich bleibe auf der Straße, damit deine Spuren nicht zerstört werden.« Er machte ein betretenes Gesicht, weil er sie damitimmer aufzog.
Claudia machte die Schritte zum Straßenrand und sah den Sportschuh einer bekannten Firma. Ein teures Stück, wenn auchaltes Modell, dachte sie. Ihre Mutter trug seit Jahren, die gleichen, und schwor darauf. Das führte dazu, dass sie sich im Internet zehn Paare bestellte, bevor sie nicht mehr auf dem Markt waren. Die, den Schuhen anhängende, Gestalt lag im hohen Gras und wurde durch einen Strauch verborgen. Sie zückte ihr Smartphone.
»Thilo? Jetzt haben wir tatsächlich eine Leiche.« Sie beschrieb ihm den Weg undüberlegte, ob sie das Präsidium benachrichtigen sollte. Das konnten die Kollegen tun.
»FrauPlum. Das war ein niederländisches Fahrzeug. Gestern Abend. Ich dachte, eswärewieder Müll. Wer konnte ahnen, dass hier ein Mensch abgekippt wurde.
Die jungeFrau, die sie ansprach, wohnte drei Häuser von IhremHaus auf der anderen Seite der Waldstraße. Sie sprach ihrenNamen unsicher aus. Dennneu für das Dorf war, dass sie ihren Mädchennamen behielt. Für eine Zugezogene war das nicht tragisch. Sie brachte das dynastische Gefüge und die Besitzverhältnisse der Einheimischen nicht durcheinander.
»Einen Augenblick bitte.« Der Name der Nachbarin fiel ihr nicht ein. »Meine Kollegen sind jeden Moment hier.« Sie zuckte entschuldigend die Schultern. »Urlaub. Ich darf nicht arbeiten.« Sie wandte sichKurt zu. »Wir gehen«, flüsterte sie. »Sonst kann ich meinenUrlaub vergessen.«
Er nickte und nahm sie am Arm. Kurt werkelte an dem alten Bauernhaus, dessen Rückseite zum Heidegebiet hinaus ging. Zwischen dem Saum des Waldes und der Grundstücksgrenze lagen keine dreihundert Meter. Zurzeit baute er einen alten Kuhstall zum Pferdestall um. Drei Baustellen auf dem Grundstück entsprachen der Norm. Es konntenauchmanchmal vier oder fünf sein. Der Job ließ ihm im Grunde wenig Zeit für die Restaurierungsarbeiten. In dieser Hinsicht war er eigensinnig nach dem Motto: Selbst ist der Mann. Erst seit dem er Claudia kannte, ging er den Alltag geruhsamer an. Na ja … ganzso freiwillig kam das Kürzertreten nicht. Kurt steckte seine Nase immerwieder in Claudias Fälle. Diese Vorwitzigkeit brachte ihn fast um. Ein Gutes entwuchs aus dieser Angelegenheit: Ihm wurde klar, dass es mehr im Leben gab. Von Haus aus hatte er einiges in petto, sodass er die feste Beschäftigung bei der RWTH reduzierte. Jetzt erledigte er viele berufliche Aufgaben von zu Hause. Das wiederum gab ihm Flexibilität, in Claudias Arbeit hineinzuwirken. Claudia beobachtete die Entwicklung mit zwiespältigen Gefühlen. ZudemwarKurt ein Leichenspürhund. Wenn es im Umkreis von zwanzig Kilometern eine Leiche gab, stolperte er darüber. Was nichtimmer ohne Komplikationen blieb.
*
Kapitel 4 (Rückblick Februar/März)
»Herrschaften. Ich bitte um Ruhe.« Das große Zelt wargut gefüllt. Knappe dreihundert Personen saßen auf den klappbaren Holzstühlen. Ausgewählte Bürger des Dorfes, über achtzehn Jahre, bekamen vor wenigen Tagen die Einladung zu dieser Veranstaltung. Sorichtigwusste niemand, worum es ging, jedoch die Gerüchteküche kochte in den letzten Wochen. Angeblich ging es um viel Geld. »BitteRuhe«, ertönte die, durch Lautsprecher verstärkte Stimme von Werner Böttcher. Langsam verebbte das Gemurmel und gespannte Stille breitete sich aus.
»Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich wende mich heute in einer ungewöhnlichen Angelegenheit an Sie. Das Dorfhat geerbt.« Applaus brandete auf und es dauerte einige Zeit, bis die Erregung sich legte. »Die Schützen, undhier der gesetzliche Vorstand, wurden zum Testamentsvollstrecker bestimmt. Ich möchte Sie nichtlange auf die Folter spannen, muss jedocheinige Dinge klarstellen, sonst geht das Erbeverloren. Der Nachlassgeber machtstrenge Vorgaben, bevor das Erbe angetreten werdenkann. In den letzten Tagen, ich kann sagen Wochen, hat es viel böses Blut gegeben, weil meine beiden Mitstreiter im Vorstand und ich, nichts sagten … nichts sagen durften. Hierundheute geben wir bekannt, was Sie, entsprechend dem Willen des Verstorbenen, wissensollen. Die Eröffnung des Testaments erfolgt Schritt für Schrittundüber einen langen Zeitraum. Oberste Prämisse: Über das Testament darf außerhalb des Ortes kein Wort verlorenwerden. Sollte es dennoch geschehen, ist das Erbe futsch. Das Wissen darüber muss, ich wiederhole: Muss im Dorf bleiben. Betroffen sind die Mitbürger, die am 31. Dezember 2013 ihren Wohnsitz hierhatten. Der Erblasser hat an die Ausschüttung des ErbeseinigeBedingungen geknüpft.«
»Wieviel?«, rief jemand aus dem Publikum.
»Ja. Wieviel?«, schlossen sich andere an.
Es dauerte einige Zeit, bis wiederRuhe herrschte.
»Summen sind uns nichtbekannt. Aber es sollsehrviel Geld sein. Doch, wie gesagt, die Bedingungen müssen erfüllt werden. AlsoRuhe bitte, es ist wichtig. Wie sie bemerkt haben, sindnichtalleEinwohner des Dorfes hier. Zwar sind alle Mitbürger erbberechtigt, jedoch sind die Bedingungen des Erblassers von den Einwohnern zu erfüllen, deren Wurzeln hier liegen, beziehungsweise, deren Familien seit mindestens fünfundsechzig Jahren hier leben. Stichpunkt ist der einunddreißigste Dezember vergangenen Jahres. Familienundderen Nachkommen, die nach 1948 hierher gezogen sind, werden von den Auflagen des Erblassers befreit. Sie kommen für eine Ausschüttung nurdann in Betracht, wenn Sie, die hier Anwesenden, die Bedingungenerfüllen. Dazukomme ich später. Fürs Protokoll: Die Vorgaben haben wir bei unserer Einladung berücksichtigt.«
Werner Böttcher unterbrach und wischte den Schweiß von der Stirn. Er fühlte sichnichtwohl in seiner Haut, denn was vor ihm lag bedurfte aller Kraft, die er besaß. Er trug eine weite Jeans und ein lockeres Sommerhemd, um den kleinen Bauch zu kaschieren. Seine Größe überspielte er mit Dominanz, was fastimmer gelang. Im bürgerlichen Leben, alsonichtals Offizier und Vorsitzender der Schützen, arbeitete er als Steuerberater. Dem sympathischen Gesicht sah man die fünfzig Jahre, die er mittlerweile auf dem Buckel hatte, nicht an. Er bereute jetzt schon, das Erbe, im Namen der Dorfgemeinschaft, angenommen zu haben.
»Bitte stelltEureFragenspäter«, er zeigte auf die beiden Mitstreiter aus dem Vorstand. »Wir beantworten EureFragen … soweit uns das möglich ist. Lange Rede kurzer Sinn: Der Erblasser trägt dem Dorf ein Spiel an, dessen Beginn am 01. Juni 2014 um 18:00 Uhr ist. Das ist der Sonntag unseres diesjährigen Schützenfestes.« Er unterbrach wieder, ob des einsetzenden Gemurmels. Der Saal brummte bei den frei werdenden Emotionen.
»Wie viel?«, rief abermals jemand.
»Ich weiß es nicht«, stellte Werner Böttcher in den Raum. »Um dazuetwas zu erfahren, müsseneinige Bedingungen erfüllt werden. Lassen Sie mich fortfahren. WelchesSpiel wir spielenmüssen, ist mir nichtbekannt. Hier vorne liegt eine Liste mit den Personen, die, die Grundbedingungen des Testaments erfüllen. Erst wenn jeder von Euch mit seinerUnterschrift die kargen Vorgaben akzeptiert, kann ich diesenUmschlagöffnen.« Er hob ein DIN-A4 großes Paket in die Höhe. »Ich weiß, die Situation ist beknackt, aber ich bin lediglich der Überbringer der Botschaft. »Die Regeln sindklar: Jede Information, jedes Wort zu dem Erbe muss in den Reihen der hier anwesenden Personen bleiben. Wir schreiben heute den 01. Februar 2014. Am 28.02.2014 müssen mir alleUnterschriften vorliegen. Vierzehn Tage späteröffne ich in Eurem Beisein diesenUmschlag.« Ich muss mir mal klarwerden, ob ich Ihr oderEuch sage, dachte er. Aber ... es spielte keine Rolle.
»Was soll der Scheiß?« PatrickWander, der in der Stadtverwaltung arbeitete, sprang aufgeregt hoch. »Ich unterschreibe dochkeinen blauen Dunst.«
»Du hast vier Wochen Zeit, Patrick. Falls einer nicht unterschreibt, ist allesfutsch.« Siegfried Boll, der Kassierer ergriff das Wort.
»Und was ist futsch?«, rief jemand von hinten.
»Herrschaften«, rief Werner Böttcher. »Der Ablauf dieser Veranstaltung ist mir vorgegeben. Falls ich davon abweiche, geht der Nachlass an eine gemeinnützige Einrichtung. Jetzt darf ich eine weitere Information geben: Der Erblasser ist ein Mann namens Beatus Basketmaker.« Böttchers Augen kreisten. Unverständnis sah ihm entgegen. Scheinbar konnten die Mitbürger genau so viel mit dem Namen anfangen, wie er. Das Gemurmel im Zelt schwoll an.
»Basketmaker? Der ist nicht aus dem Dorf.« Maria war über achtzig und kannte alle Stammbäume. Sie saß im Rollstuhl und sog an dem Schlauch, der zur Sauerstoffflasche führte, die auf einem Brett befestigt stand. Als ehemalige Raucherin reichte die Kraft der Lungen nichtmehr zur Versorgung des Körpers. »Wollen wir uns wirklich zum Narren machenund auf einen solchen Blödsinn eingehen? Ein ganzesDorf erbt. Soetwashabe ich janochnie gehört.« Sie schüttelte den perückengekrönten Kopf. Nach der letzten Chemo, vor fünf Jahren, wuchsen die Haare nichtmehr. »An den Namen Beatus würde ich mich bestimmt erinnern undBasketmaker … wir sinddochnicht im Wilden Westen.« Leises Gelächter klang auf.
»Was ist das für ein Spiel, Werner? Wie mir scheint, sind wir schon mittendrin.« Oma Lene, wie sie im Dorf liebevoll genannt wurde, stützte ihren Gicht gekrümmten Rücken auf einen knorrigen Stab. Den Eichenstock bekam sie vor fast zwanzig Jahren von ihrem Mann, Gott hab ihn selig. Das von Runzeln und Falten durchzogene Gesicht guckte missbilligend auf die Jugendlichen am Mikrofon. Alle unter sechzig waren für sie Kinder. »Glaub mir mein Junge«, sagte sie zu Werner gewandt, »wenn der von hier