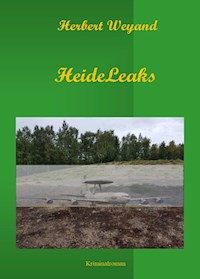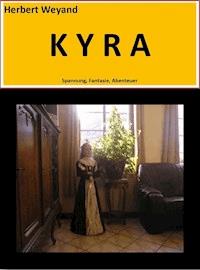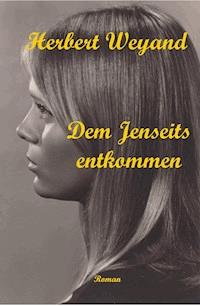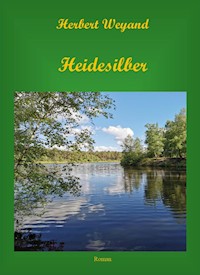4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
Lisbeth Eine tierische Weihnachtsgeschichte. Abendrot macht Wangenrot und gute Leute tot Die himmlische Weihnachtsplätzchenbäckerei. Ein Weihnachtskurzkrimi der besonderen Art. Das Geschenk Nichts für Organspender. Himmlische Zeichen Wenn ein Engel übermütig wird. Der Weihnachtsengel von Amsterdam Wie Träume den Tod besiegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herbert Weyand
Fantastischer Advent
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Lisbeth
Abendrot macht Wangenrot und gute Leute tot
Das Weihnachtsgeschenk
Himmlische Zeichen
Der Weihnachtsengel von Amsterdam
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. KapitelKapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Epilog
Impressum neobooks
Lisbeth
Lisbeth
Eine tierische Weihnachtsgeschichte.
Abendrot macht Wangenrot und gute Leute tot
Die himmlische Weihnachtsplätzchenbäckerei. Ein Weihnachtskurzkrimi der besonderen Art.
Das Geschenk
Nichts für Organspender.
Himmlische Zeichen
Wenn ein Engel übermütig wird.
Der Weihnachtsengel von Amsterdam
Wie Träume den Tod besiegen.
Stimmen zu den bisherigen Veröffentlichungen:
Aachener Zeitung
… mit einer deutlichen Sprache, die das hiesige Land hergibt, die sein schreiberisches Talent aber nicht vor eine unlösbare Aufgabe stellt, skizziert Weyand die Landschaft um seine Historien herum. Eigenheiten, lokale Spezialitäten und auch Dialekte lässt Weyand herzerfrischend aufblühen und bindet sie scheinbar mühelos in sein Schreiben ein.
Aachener Nachrichten
… sondern als einer, der feine Charaktere ausarbeiten kann.
… das nur noch vom Hörensagen her zu erkennen ist, wird bei Herbert Weyand zu lebendiger Geschichte.
Geilenkirchener Zeitung
… gelang Herbert Weyand ein Volltreffer.
… bedient er sich verschiedener Figuren, die alle auf ihre Art einzigartig sind und dennoch typisch für ihre Zeit zu sein scheinen.
Herbert Weyand
Fantastischer Advent
EineAnthologieweihnachtlicherGeschichten für die ganze Familie
Herbert Weyand, »Fantastischer Advent« © 2014 2024 überarbeitet
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung © 2014 by Laura Schruff Druck:www.epubli.de
Erstellt mit Papyrus Autor
Die tierische Weihnachtsgeschichte für die ganze Familie.
Sie lag Mitte Oktober vor dem Tor. Die Ohren waren zerfetzt, und das linke Auge war eine einzige Wunde. Das linke Vorderbein wurde nur noch vom Fell zusammengehalten, und aus dem Ellbogen ragte der Knochen. Auf den vielen Blessuren des Körpers krabbelten dicke Fliegen. Das gesunde Auge flehte um Hilfe. Vorsichtig näherte ich mich dem Hund. Er blieb regungslos liegen, als meine Hand nach ihm griff. Mit letzter Kraft leckte er mit seiner trockenen Zunge meine Hand. Er schaffte es, sich auf die Beine zu stemmen, doch wenig später brach er auf dem Hof vollständig zusammen. Das Tier suchte Asyl, das es erst hinter der Schwelle finden sollte.
Ich musste etwas tun.
Ich holte einen Eimer Wasser und den Schwamm, den wir für das Pferd nutzten. Vorsichtig wusch ich ihm Maul und Nase, denn er war vermutlich durstig. Tatsächlich saugte er gierig das Nass auf und leckte bald die klare Flüssigkeit aus einer Plastikschüssel.
Das Tier brauchte dringend einen Arzt, doch einen Transport würde es nicht überleben. Also griff ich zum Telefon und rief die Tierärztin an, die versprach, so schnell wie möglich vorbeizukommen.
Vor vier Jahren hatten wir unseren letzten Hund begraben. Als wir auf die sechzig zugingen, verzichteten wir auf eine Neuanschaffung. Wer konnte wissen, ob wir nicht vor dem Tier das Zeitliche segnen würden. Jetzt bin ich siebzig und wusste, zugegebenermaßen, nicht, was zu tun war. Schließlich legte ich ihm eine Decke unter und zuckte zusammen, als er leise wimmerte. Jede
Bewegung bereitete ihm Schmerzen. Ich begann, seine Wunden zu reinigen. Vorsichtig wusch ich die Blessuren mit dem Schwamm ab. Bisswunden sah ich keine; das Wesen war offenbar von jemandem zusammengeschlagen worden. Ein Wunder, dass es meine Hand duldete.
»Der sieht furchtbar aus«, sagte die Tierärztin und hockte sich vor das Tier. »Das Auge ist nicht zu retten, und hinsichtlich des Blutverlustes kann ich nur mutmaßen.« Während sie sprach, tasteten ihre Hände über den Körper und erkundeten, was unter dem Fell lag. »Die Arme werden wir wohl einschläfern müssen.« Erst jetzt bemerkte ich, dass der Hund eine Hündin war.
»Kannst du nichts machen?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich gebe ihr eine Narkose und untersuche sie genauer. Wenn es nicht geht … lassen wir sie einschlafen.«
Sie legte einen Zugang und ließ das Narkosemittel in die Vene fließen. Ein kurzes Zucken lief über das Fell, und die Hündin streckte die Glieder.
»Wir legen sie auf den Tisch«, sagte die Ärztin und zeigte auf das Möbelstück, das noch vom Sommer dort stand.
»Pass auf. Sie wiegt mindestens dreißig Kilo.«
Eigentlich war sie zu schwer für meine alten Knochen. Doch es gelang uns, sie sanft auf die Plastikwanne zu legen, die die Ärztin aus dem Auto geholt hatte.
»Sie wurde mit einem scharfen Gegenstand geschlagen. Einer Harke oder etwas Ähnlichem«, sagte sie und sah kurz auf. »Ich versuche, sie zu retten. Sie ist drei bis vier Jahre alt. Wenn sie das hier vergessen kann, hat sie noch eine schöne Zeit vor sich.« Sie richtete sich auf. »Du nimmst sie doch … oder?« Ich nickte. Das war mir klar, seit sie mich vor dem Tor angesehen hatte.
Nach fast zwei Stunden richtete sich die Tierärztin mit krummem Rücken auf. »So. Jetzt liegt alles bei ihr. Ich verspreche nichts.«
Ich stimmte beklommen zu. In der Zwischenzeit war meine Familie, zurück von ihrer Einkaufstour, hinzugekommen. Tochter und Enkel – meine Frau war vor einem halben Jahr verstorben. Die Kinder zeigten das gleiche Entsetzen wie ich.
Kaum aus der Narkose erwacht, stand die Hündin schon auf den Beinen. Wir kannten das von unseren früheren Tieren. Mit vereinten Kräften stützten wir den wankenden Körper. Zwei Stunden später ließ die Betäubung nach, und die Schwäche durch Verletzungen und Blutverlust kehrte zurück. Doch sie verhielt sich geduldig, als wisse sie, dass wir ihr helfen und Schmerzen verhindern wollten.
Zum ersten Mal betrachtete ich sie genauer. Von Hunderassen verstand ich nichts; ich teilte Hunde in klein, mittel und groß ein. Da mussten meine Kinder her, die ständig Rassenamen erwähnten, die ich mir nie
merken konnte. Ich sah auf das mittelgroße Tier mit dem leicht gelockten graubraunen Fell. Vor etwa zwanzig Jahren hatten wir einen ähnlichen Hund – eine Kreuzung aus Collie und Schäferhund. Trotz des Fells bemerkte ich die kräftigen Muskeln und die breite Brust. Der große Kopf lief spitz zur Nase aus, und ihre ausladenden Ohren verliehen ihrem Gesicht einen Ausdruck, der mich an jemanden erinnerte. Richtig, an meine Tante Lisbeth, Gott habe sie selig. Offen gesagt, sah sie ein wenig aus wie eine Fledermaus.
›Hiermit taufe ich dich Lisbeth‹, dachte ich.
*
Mein Name ist Karl Lutter. Ich bin ein mittelgroßer Rentner mit einem leichten Bauchansatz. Meine Haare trage ich mal kurz, mal lang; genauer gesagt, ich besuche höchstens dreimal im Jahr einen Friseur. Zurzeit besitze ich eine graue Wallemähne, um die mich Albert Schweitzer beneidet hätte. Ich bin Vater einer Tochter, Jana, und Witwer. Meine Familie wird durch meinen Enkel Marco und meinen Schwiegersohn Martin vervollständigt.
Im Moment beschäftigte mich vor allem die Frage, wem Lisbeth wohl gehörte. Sollte der Besitzer in irgendeiner Weise mit ihren Verletzungen zu tun haben, würde ich ihm ordentlich die Meinung sagen.
Ich wies Lisbeth die Ecke zu, die schon unsere verstorbenen Hunde genutzt hatten – zwischen dem abgewetzten Ledersessel im Wohnzimmer und der Wand rechts, an der die Uhr hing. Ich hoffte, das Ticken würde sie nicht stören. Mich beruhigte es immer. Auf dem Boden lag eine dicke Decke mit einem gepolsterten Rand, auf den sie den schweren Kopf legen konnte.
Hoffentlich würde das Häuflein Elend durchkommen. Ihr gebrochenes Bein lag geschient, weit ausgestreckt wie ein Fremdkörper. Die Wunde an der Bruchstelle blieb offen, damit das Wundwasser abfließen konnte, ebenso wie die anderen Verletzungen. Allein die Vorstellung, welche Blutergüsse sich unter dem Fell noch verbargen, verursachte mir Übelkeit – mehr aber noch … Wut. Im verletzten Bein steckte ein Zugang, dessen Schlauch zu einem Tropf führte, wahrscheinlich mit Kochsalzlösung, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Warum hatte ich nicht die Ärztin gefragt? Wenn keine Komplikationen auftraten, würde sie in zwei Tagen wieder vorbeischauen. Zum Glück hatten uns die vielen Tiere, die uns im Laufe der Jahre begleiteten, ein gutes Verhältnis zu unseren Tierärzten beschert – das rettete Lisbeth höchstwahrscheinlich das Leben.
Die erste Nacht verbrachte ich im Sessel neben ihr. Eigentlich wollte ich lesen, doch meine Gedanken glitten immer wieder zu der Hündin, die schnell und unruhig
atmete, was mir Sorgen bereitete. Trotzdem wusste ich, dass das allein nichts zu bedeuten hatte.
In Gedanken ließ ich all die Hunde Revue passieren, die mich in den verschiedenen Lebensabschnitten begleitet hatten. Ich rief mir jeden einzelnen vor Augen und verlor mich in den Erinnerungen. Trotz der unterschiedlichen Rassen, Größen und Geschlechter waren sie alle auf eine Art ähnlich – und doch auch so verschieden. Die viel gepriesenen rassetypischen Merkmale traten bei keinem der zwölf Hunde, die uns im Laufe der Jahre begleiteten, wirklich hervor. Meine Familie ermutigte immer die individuellen Eigenheiten der Tiere. Hündinnen waren meist etwas vorsichtiger als Rüden – doch das ist eine andere Geschichte.
Die nächsten Tage wechselten wir uns in der Krankenwache ab. Langsam, sehr langsam, kam Lisbeth wieder auf die Beine. Zwischendurch besuchten wir die Tierklinik, wo sie gründlich durchgecheckt wurde. Die üblichen Untersuchungen – Bluttests, Röntgenaufnahmen und alles, was dazugehörte – bestätigten meine Befürchtungen: Zahlreiche Hämatome, verursacht durch Schläge oder Tritte, bedeckten ihren Körper. Zehn Tage später zog die Ärztin die Fäden, bis schließlich nur noch die Schiene am gebrochenen Bein blieb.
Nach einer weiteren Woche wagten wir den ersten vorsichtigen Spaziergang, den wir jedoch bald
abbrachen, weil Lisbeths Kondition nicht ausreichte. Doch Ende Oktober schafften wir bereits eine halbe bis dreiviertel Stunde am Tag.
*
Dann kam der 4. November, der Tag, den ich nie mehr vergessen werde.
»Guten Tag, mein Name ist Sylvia Becker.« Die Frau, etwa dreißig Jahre alt, trug dem frischen Wetter entsprechende Kleidung.
Ich nickte lediglich zur Begrüßung und bemerkte, wie ihre Begleitung, eine ältere Dame, sie leicht anstieß.
»Nach meinen Informationen haben Sie Dana, meinen Hund.« Ihre Stimme klang warm und voll.
Ihr Gesichtsausdruck irritierte mich; sie schien nach innen zu horchen, etwas zu erfassen, was mir entging. Ich verbarg mein Erstaunen und deutete mit einer Handbewegung wortlos ins Haus. Ihre Begleiterin nahm sie sanft am Ellbogen, und beide traten ein. Ich öffnete die Tür zum Wohnbereich, und sofort drängte sich Lisbeth an mir vorbei und fegte auf Sylvia Becker zu.
Die Hündin schmiegte sich an Sylvia, die in die Knie ging, und begann, ihr Gesicht zu lecken. Ihr Schwanz wirbelte wie ein Propeller. Auch wenn Sylvia zurückhaltend wirkte, war kein Zweifel: Hier war ihre Besitzerin. Und es war offensichtlich, dass diese Frau
nichts mit den Verletzungen zu tun hatte – das zeigte das Verhalten des Tieres. Nach einer Weile wischte Frau Becker sich mit dem Jackenärmel die Tränen vom Gesicht.
»Kommen Sie,« sagte ich heiser und deutete auf die Stühle am Esstisch.
Lisbeth stupste sanft gegen Sylvias Knie, kaum merklich.
»Wir wohnen in Gangelt. Ich bin Sylvias Mutter,« erklärte die ältere Frau, während sie sich setzte. »Wir haben entlang des Rodebachs Suchmeldungen aufgehängt. Den Hinweis auf Sie bekamen wir schließlich über unseren Tierarzt, der Ihre Ärztin kennt.«
»Es ist jetzt fast drei Wochen her, dass Dana zu mir kam,« erwiderte ich stockend – der Name kam mir ungewohnt über die Lippen. »Sie war schwer verletzt.« Lisbeth leckte meine Hand, als spüre sie, was ich empfand.
»Ich war am Rand des Heidegebiets bei Stahe spazieren,« erzählte die jüngere Frau. »Plötzlich wurde ich überfallen. Dana verteidigte mich, und die Angreifer ließen von mir ab. Sie tobten sich stattdessen an meinem Hund aus. Ich hörte, dass Schreckliches passierte.« Sie kraulte Lisbeth zwischen den Ohren.
»Verzeihen Sie, aber … Sie sind blind? Das habe ich nicht bemerkt.« Tatsächlich waren die Berührungen, die Sylvia Becker sanft lenkten, so selbstverständlich, dass sie mir zunächst entgangen waren.
»Ja, von Geburt an,« bestätigte sie. »Dana ist mehr als nur meine Augen. Wir sind Freunde.«
»Sie wird die Schiene am Bein noch eine Weile tragen müssen.« Ich wusste, dass Lisbeth – oder Dana – für mich verloren war. Als ich sah, wie sie mich mit diesen wissenden Augen ansah, meinte ich, so etwas wie Bedauern in ihrem Blick zu erkennen. Krampfhaft hielt ich die Tränen zurück; sie sollten erst fließen, wenn ich allein war. Mir fiel auf, dass Danas Bauch etwas geschwollen aussah, was ich bereits am Vortag bemerkt hatte. Doch sie zeigte keine Schmerzen, als ich ihn abtastete. »Wissen Sie, wer Sie überfallen hat?«
»Nein, ich habe keine Ahnung. Es waren junge Stimmen. Zwei Personen, männlich. Dana hat beide verletzt – das habe ich gehört.« Sie wandte sich mir zu, und ihr Gesicht spiegelte die Gefühle wider, die die Erinnerung in ihr wachrief. »Die Polizei glaubt nicht, dass sie die Täter finden wird. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht mit Nachdruck sucht. Der Hund zählt wenig, und die Aussage einer Blinden ist ja auch fragwürdig. Da ich keine sichtbaren Verletzungen davongetragen habe, wird es schnell als Bagatelle abgetan.«
»Das glaube ich kaum,« entgegnete ich kopfschüttelnd.
»Ich erinnere mich an eine kurze Notiz über die Attacke in der Zeitung, aber ich brachte sie nicht mit Dana in Verbindung. Immerhin liegen zwischen der Heide und hier drei bis vier Kilometer. Unfassbar, wie leichtfertig
solche Dinge unter den Teppich gekehrt werden, nur weil es keine Handyaufnahmen gibt.«
»Ich bin dankbar, dass Sie Dana so gut versorgt haben. Unser Tierarzt erzählte mir von ihren Verletzungen. Ohne Sie wäre Dana tot.«
»Sie haben sie lieb gewonnen,« stellte ihre Mutter fest.
»Und wie …«, antwortete ich leise, mit einem Nicken.
»Falls Sie möchten, können Sie uns besuchen, so oft Sie wollen. Und wir schauen auch gerne mal bei Ihnen vorbei.«
Damit wurde das Kapitel Lisbeth, oder besser gesagt Dana, für mich nicht abgeschlossen. Mein Ehrgeiz packte mich, und ich beschloss, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Bei einem meiner morgendlichen Spaziergänge in der Heide wartete ich auf Claudia Plum, die Kriminalhauptkommissarin der Aachener Kripo und hier eine lokale Berühmtheit.
»Guten Morgen, Frau Plum,« grüßte ich förmlich, als ich ihr auf dem Hauptweg begegnete, der in die Heide führte. Sie war oft mit ihrem Dackel Edgar unterwegs.
»Haben Sie einen Augenblick Zeit?«
»Morgen, Karl. Was ist los? Bin ich dir auf die Füße getreten?« Sie strahlte mich an, leicht verwundert.
»Nein. Ich … habe eine Bitte.« Ich zögerte und kam mir reichlich blöd vor.
»Heraus damit. Ich dachte schon, es wäre etwas Ernstes.« Claudia, etwa ein Meter siebzig groß, ein wenig kleiner als ich, trug ihr braunes Haar halblang bis zur Schulter.
Ich erzählte ihr von Danas Geschichte.
»Ja, davon habe ich gehört,« bestätigte sie. »Eine blöde Sache. Die Kollegen arbeiten daran.« Sie sah mich abwartend an. »Kannst du da nichts machen?«, fragte ich, wieder in dem vertrauten Tonfall, den wir sonst pflegten.
»Ich verstehe, dass dir die Sache zu schaffen macht,« sagte sie. »Ich erkundige mich bei den Kollegen, aber versprechen kann ich nichts.« Sie winkte kurz und setzte ihren Weg fort.
Ich stieg auf mein Fahrrad und radelte, vorbei am Kiefernsee, bis zur Neutralen Straße – dem Niemandsland, das von Stahe nach Abdissenbosch führt. Irgendwie zog es mich zum Rodebach entlang, und erst am Kahnweiher und Schwimmbad in Gangelt bemerkte ich, wo ich war. Unschlüssig stand ich eine Weile herum und wartete auf etwas, das nicht eintrat. Enttäuscht kehrte ich schließlich um, denn jede Faser meines Körpers zog mich zu Lisbeth … oder besser gesagt, Dana.
Nach dem Tod meiner Frau hatte sich das Leben leer angefühlt. Doch mit der Zeit hatte ich mich arrangiert, denn Tatsachen sind unveränderlich. Der Verlust wird
ein Teil des täglichen Lebens. Anders als beim Tod eines Haustiers ist es schwer, sich für einen neuen Gefährten zu entscheiden – auch wenn das natürlich irrational ist. Seine Liebe kann man nicht ersetzen, doch vielleicht wartet irgendwo eine neue Freundschaft, die genau die Eigenschaften in sich trägt, die man verloren glaubt.
Was für Gedanken gingen mir da durch den Kopf?
Der trübe November mit seinen Totengedenktagen verführte dazu. Allein der Gedanke an den profitablen Handel mit der Angst vor dem Tod im elften Monat des Jahres brachte mich zum Kopfschütteln. Ein Geschäft, das uns von Kindesbeinen an mit der Depression vertraut macht, die spätestens an Allerheiligen beginnt – als Vorbereitung zur Geburt des Herrn. Auch wenn ich wenig damit anfangen konnte, wurde ich durch die Familie in den Strudel hineingezogen: Nikolaus, Weihnachtsgeschenke und die allgegenwärtigen Weihnachtsmärkte. Der Glühwein blieb mir verwehrt, weil ich als Chauffeur herhalten musste. Weihnachten bedeutete längst nicht mehr die Erwartung der Geburt des Christkinds.
Hier musste der Ort sein, an dem Dana misshandelt wurde – eine Wegegabelung: Einer führte in die Heide nach Grotenrath, ein anderer in die Niederlande zur Brunssumer Heide, und ich befand mich auf dem dritten Weg. Ich suchte nach Spuren, doch nach über sechs Wochen war nichts mehr zu finden.
Mitte November hatte ich bereits ein grobes Bild der Täter: Drei Leute, die sich gezielt ältere Menschen und solche mit körperlichen Beeinträchtigungen als Opfer suchten. Es ging ihnen nicht um Geld, sondern sie genossen es, die Angst in den Augen ihrer Opfer zu sehen. Mir war unwohl. Ich wollte solchen Typen nicht begegnen. Erst als mein Interesse fast abgeflaut war, hörte ich wieder von Claudia.
»Hallo Karl,« rief sie kurz vor den Abendnachrichten an.
»Leider gibt es immer noch keine Spur in deinem Fall.«
»Hallo Claudia.« Ich erzählte ihr, was ich herausgefunden hatte. »Aber das Wetter ist im Moment so miserabel, dass ich draußen keine weiteren Nachforschungen anstellen möchte.«
»Sei vorsichtig, Karl. Solche Leute sind gefährlich. Ich halte die Augen offen.« Sie wollte schon auflegen, doch dann fragte sie: »Warst du inzwischen bei Frau Becker und Dana?«
»Nein, ich besuche nicht einfach fremde Leute.«
»Frau Becker hat ein paarmal nach dir gefragt.«
»Du hast sie besucht? Wie geht es Dana?«
»Beiden geht es gut. Sylvia Becker bat mich, dir auszurichten, du sollst doch zur Weihnachtszeit mal vorbeischauen.«
»Zwischen den Feiertagen … das ließe sich einrichten.« Dabei hatte ich doch alle Zeit der Welt.
*
Anfang Dezember, kurz vor Nikolaus, besuchte ich den Weihnachtsmarkt in Gangelt. Mein Enkel hatte mich dazu überredet. Zwischen Freunden und Fußball packte ihn die nostalgische Idee, mit seinem Opa durch die Budenreihen zu schlendern. Früher musste ich häufiger dafür herhalten, aber in den letzten zwei, drei Jahren war diese Tradition eingeschlafen. Mit fünfzehn hatte auch ich damals andere Dinge im Kopf.
Wir ließen uns von den Menschen durch die engen Gassen schieben, nahmen die weihnachtlichen Geräusche und Gerüche in uns auf. Auf einem Platz spielte eine Blaskapelle »Ihr Kinderlein kommet,« und ein Chor sang dazu.
»Kann ich einen Glühwein?«, fragte Marco, knapp wie immer.
Ich nickte nur und verkniff mir die Bemerkung, die den Satz vervollständigen sollte. Ich wusste mittlerweile, dass die heutige Jugend Worte sparte. Wir drängten uns durch eine Dreierreihe und ich bestellte zwei Glühweine, einen alkoholfreien für mich. Normalerweise trank Marco keinen Alkohol, aber seit letztem Jahr bestand er darauf, zu Weihnachten einen »richtigen« Glühwein zu trinken. Mittlerweile überragte er mich um einen Kopf. Etwas abseits lehnten wir uns an eine Mauer und ließen die Stimmung auf uns wirken. Meine Augen kreisten über die Menge und blieben etwas zu lange bei einem etwa fünfundzwanzigjährigen Mann hängen, dessen
Unterlippe und Nase jeweils ein Piercing zierten. Ich fragte mich immer wieder, warum Menschen sich derart verunstalteten. Eigentlich hielt ich mich für aufgeschlossen, aber das ging mir zu weit.
»Was glotzt du so blöd, du Wichser?« Der Typ trat einen Schritt auf mich zu, gefolgt von einem weiteren Mann und einer Frau.
»Komm, wir verschwinden,« murmelte Marco und zog an meinem Arm.
»Ruf die Polizei,« sagte ich ruhig, in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. »Ich halte sie so lange hin. Beeil dich.«
Marco trat zur Seite und tippte die Notrufnummer in sein Smartphone.
»Ich rede mit dir,« sagte der Typ und trat noch näher.
»Kann ich etwas für Sie tun?«, fragte ich höflich und versuchte, keine Angriffsfläche zu bieten.
»Kann ich etwas für Sie tun?«, äffte er mich nach. »Du kannst mir die Schuhe putzen, du alter Sack.« Er streckte mir seinen Fuß hin, auf dem ein heller Sportschuh prangte.
Um uns herum verstummten die Gespräche, und ein weiter Kreis entstand. Der Chor sang gerade »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,« und die Marktbesucher nahmen das wohl wörtlich.
»Das geht auch freundlicher,« entgegnete ich, versuchte, meinen Mut zu sammeln und lächelte, so gut ich konnte.
»Bitte!«, spuckte er mir entgegen und hob den Fuß mit einem spöttischen Grinsen. Mit zwei Gefährten im Rücken fühlte er sich offenbar sicher.
In mir sprang eine Sicherung. »Putzen Sie Ihre Schuhe selbst.« Noch blieb ich ruhig, obwohl ich am liebsten geschrien hätte.
»Hört, hört,« mischte sich die Frau ein, die meine Größe hatte und ein hübsches, fast schönes Gesicht, wären da nicht ihre kalten, grauen Augen gewesen. Sie trug eine Wollmütze, sodass ich ihre Haarfarbe nicht erkennen konnte. »Wenn mein Partner dir befiehlt, seine Schuhe zu putzen, dann tust du das. Und wenn er möchte, dass du einen Handstand machst, dann machst du das genauso. Verstanden?« Sie kam so nahe an mein Gesicht, dass ich die Gewürze des Glühweins roch, den sie offenbar getrunken hatte.
Mit der Mauer im Rücken konnte ich keinen Schritt zurückweichen. Ich hätte Marcos Vorschlag, einfach zu verschwinden, vielleicht annehmen sollen. Doch jetzt wurde mir mulmig, aufgeben wollte ich aber nicht.
»Ihr seid also die drei, die alte und wehrlose Menschen drangsalieren,« stellte ich gelassen fest, überrascht, dass die Worte über meine Lippen kamen, denn eigentlich hatte ich das nicht sagen wollen.
Die Frau trat einen Schritt zurück, verblüfft. »Was haben wir denn hier?«, höhnte sie und zog den Satz in die Länge. »Einen kleinen Schlaumeier. Ich werde dir jetzt in die Eier treten.« Sie holte mit dem rechten Fuß aus – und schrie plötzlich auf, als ich ein Knochenknacken hörte.
Ich sah noch einen dunklen Schatten, der in einem riesigen Satz auf sie zusprang. »Lisbeth,« entfuhr es mir. Die beiden Männer standen starr vor Entsetzen, während die Hündin die Angreifer anknurrte, die Lefzen hochgezogen. Sie entblößte ein furchterregendes Gebiss und hielt die beiden in Schach, bis zwei Polizeibeamte eintrafen. Kurz darauf kamen der Notarzt und ein Krankenwagen. Nachdem meine Personalien aufgenommen worden waren, fand ich endlich Zeit, nach Dana zu sehen – doch sie war verschwunden.
»Wir fahren bei Frau Becker vorbei,« sagte ich zu Marco.
»Ich muss mich bei Dana bedanken.« Er nickte zustimmend.
Die Adresse hatte ich im Kopf. Zweimal fragte ich nach dem Weg, dann standen wir vor der Tür des kleinen, freundlichen Hauses. Doch niemand öffnete.