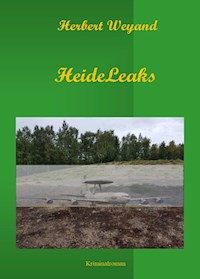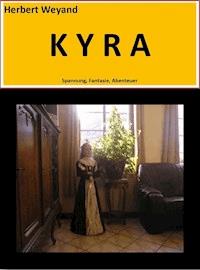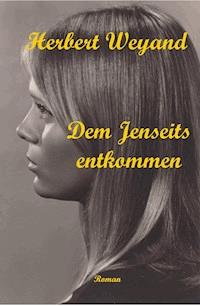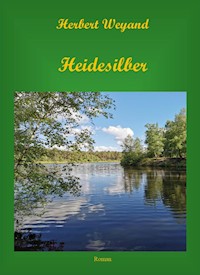Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: KHK Claudia Plum
- Sprache: Deutsch
Der Tod von Karl Wegner stößt die Polizei in einen Sumpf aus Korruption und Vorteilsnahme. Trotz falscher Spuren dringen sie an den Kern vor, was zu weiteren Toten führt. Die Theorie einer Beziehungstat, der Tote Karl Wegner erweist sich Sexmonster, wird fallen gelassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Der Tod von Karl Wegner stößt die Polizei in einen Sumpf aus Korruption und Vorteilsnahme. Trotz falscher Spuren dringen sie an den Kern vor, was zu weiteren Toten führt.
Die Theorie einer Beziehungstat, der Tote Karl Wegner erweist sich Sexmonster, wird fallen gelassen.
Herbert Weyand
Todessturz
KHK Claudia Plum
2. Fall
Kriminalroman
Copyright © 2017 Herbert Weyand:
»KHK Claudia Plum 2. Fall« »Todessturz«
All rights reserved.
Titelbild: © 2017 Laura Schruff
Herbert Weyand
52511 Geilenkirchen
Erstellt mit Papyrus Autor, www..papyrus.de
Eins
Der Morgen begann mit Temperaturen jenseits der fünfundzwanzig Grad Celsius. Ein drückend schwüler Sommertag. Seit Wochen blies das Hoch von Osten trockene warme Luft in den Westen und ein anderes Wetterfeld, feuchtwarme Luft von Westen nach Osten. Der westlichste Zipfel Deutschlands lag direkt an der Grenzlinie. Hier trafen die Luftmassen zusammen. Aus Holland und Belgien schaufelte die Feuchtigkeit herein und machte jede Bewegung zur Qual.
Napoleon bezeichnete Aachen als den Pisspott Europas. Das Wetter strafte ihn seit Wochen der Lüge.
Im Westen der Stadt lag ein lang gestrecktes, immer noch futuristisches, Bauwerk, dessen Insassen bei exakt zweiundzwanzig Grad Celsius ihrer Beschäftigung nachgingen. Erst zum Feierabend schlugen die feuchten fünfunddreißig Grad zu und verstärkten die Temperatur zu einem Grausen, das Schüttelfrost und Schweiß zur gleichen Zeit aus dem Körper trieb. Bis die nächste Klimaanlage im Auto Linderung schaffte, klebte jeder Millimeter Haut. Wer den Luxus nicht besaß, litt und schwitzte.
Für diese Temperaturen waren die Menschen hier nicht geschaffen. Sie zerrten an den Nerven.
Aachen liegt im Dreiländereck Deutschland – Belgien - Niederlande, etwa dreißig Kilometer nördlich des Hohen Venns in einer nach Nordosten geöffneten Mulde, in der die Wurm zur Rur fließt. Die Stadt befindet sich im Einzugsbereich der Maas, direkt in der Euregio Maas-Rhein am Fuß der Eifel, die südlich der Stadt beginnt.
Nicht nur Napoleon brachte Aachen mit Wasser in Verbindung. Die alten Germanen benannten die Stadt mit ihrem Wort für Wasser, Ahha. Der Tradition folgend war es dann nicht verwunderlich, dass die Römer ihre dortige Siedlung, zunächst Aquae Grani und später Aquisgranum nannten. Grannus war der Heilgott der Kelten und Römer, womit fast gesagt ist, dass das Wasser aus der Erde kommt. Aachen hat mit die heißesten Quellen Mitteleuropas.
Seit Karl dem Großen besaß Aachen ein architektonisches Meisterwerk, den Dom. Seit 1982, die Klinik.
*
Kurt Hüffner starrte aus dem Fenster, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. »Verdammt. Da fliegt jemand vorbei.« Er humpelte näher zum Fenster und drückte die Nase an die Dreifachverglasung. Er versuchte, den Landeplatz des menschlichen Flugobjekts auszumachen. So recht wollte er es nicht wahrhaben. Kaum zu glauben. Menschen flogen nicht, und, vor allem nicht freiwillig durch die Luft … es sei denn, Engel oder Selbstmörder.
Kurt sah aus der sechsten Etage nach unten. Zu hoch. Trotz der durchgängigen Fensterfront, an der Vorderseite des Gebäudes, entdeckte er den eventuellen Aufschlagbereich nicht. So schnell es irgend ging, hinkte er mühsam, mit dem sperrigen Infusionsständer im Gepäck zum nächsten Aufzug. Zu dumm, dass die Verletzungen zurzeit die Bewegung behinderten.
Seine Anwesenheit auf dieser Etage war mehr zufällig.
Gerade mal vor einer halben Stunde, gab ihm die Krankenschwester, ziemlich brutal und ohne Rücksicht auf seinen Zustand, zu verstehen: »Raus aus der Falle.« Sie verordnete ihm Bewegung.
Bewegung … man stelle sich vor … schwer verletzt und knapp dem Tode entgangen. Er war schon eine arme Sau.
Kurt begann fluchend und stöhnend mit der Bewegung und humpelte im Krankenzimmer herum. Er wetterte auf das brutale Krankenpflegepersonal, bis ihm das Genörgel selbst auf den Wecker ging. In einem Zeitungsbericht stand vor kurzer Zeit, Krankenschwestern seien sadistisch veranlagt, weil sie sonst ihren Job nicht ausüben konnten. Die Schwester, die ihn pflegte, qualifizierte sich besonders für diese berufliche Tätigkeit. Florence Nightingale kannte die Sadistin sicherlich nur vom Hörensagen.
Kurt saß, besser lag, am kürzeren Hebel, also übte er Bewegung. Zuerst mit Mühe, jedoch mit jedem Schritt mehr Sicherheit bekommend. Wenn Bewegung, dann richtig. Er hinkte zum Aufzug und fuhr ins Erdgeschoss. Vielleicht bekam er in der Cafeteria eine vernünftige Tasse Kaffee und nicht die Plörre, die auf der Station serviert wurde.
Er landete in der falschen Etage. Der Fahrstuhl hielt, ein Pfleger stieg ein und Kurt aus. Vor ihm lag ein langer Gang mit dreihundert Meter Fensterfront. Wie überall im Haus bedeckte auch hier der unmögliche grüne Teppich mit den gelben und grauen, waagerechten Streifen den Boden. Im Flur, der chirurgischen Krankenstation, liefen die Streifen längs. Die Farbe wurde, während der Planung des Gebäudes, seitens der Architekten, auf der Basis von psychologischen Aspekten, ausgewählt, erklärte ihm dieser Tage eine Beschäftigte. Die grüne Farbe diene der Beruhigung … die Streifenmuster der Täuschung. Querstreifen verkürzten und Längsstreifen verlängerten die Illusion. Er erfuhr, dass in der Universitätsklinik Münster der gleiche Teppich lag. Das Gelb war dort kräftiger.
Just in dem Augenblick, als er wieder zum Aufzug wollte, flog dieser Mensch an ihm vorbei. Wie hoch mochte er hier sein? Fünfzehn, zwanzig, dreißig Meter? Keine Ahnung. Dabei lag seine Krankenstation noch zwei Etagen über ihm.
Die Architektur des Gebäudes lenkte ihn ab. Das einzige Gebäude der hightech Architektur der Welt. Nein – falsch. Einziges Klinikgebäude. Ansonsten gab es noch das Centre Viktores Pompidou in Paris und das Kongresszentrum in Berlin, soweit er sich erinnerte. Gedanklich baute er den Betonklotz in der Erinnerung. Vor seinem Auge entstanden vierundzwanzig Türme, die, in einer Vier mal sechs Anordnung, auf der grünen Wiese standen. Dazwischen wuchsen sechs Etagen zwischen den Mauern hoch. Damit nicht genug. Der Raum zwischen den beiden mittleren Türmen wurde noch einmal drei Stockwerke hoch verbaut. Von dort aus verbanden Verbindungsgänge die äußeren Türme.
Weshalb verschwendete er Gedanken? Er musste seine Beobachtungen mitteilen. Kurt klopfte an die ihm gegenüberliegende Tür. Nichts. An den nächsten beiden Türen auch nicht. Ein toter Teil des Stockwerks? Das gab es nicht.
»Hallo. Ist hier jemand?«, rief er. Nur das Rauschen der Klimaanlage. Ansonsten … Stille. Aufgebracht humpelte er zum Fenster. Da liefen Menschen zusammen. Tatsächlich. Er halluzinierte nicht.
Aus den Augenwinkeln nahm er eine Bewegung wahr. Links oben. Die Orientierung zu seinem Standort fiel ihm schwer. Auf dem flachen Dach lief eine Person, behände wie ein Affe. Sie blieb kurz stehen und sah in seine Richtung. Unwillkürlich zog Kurt den Kopf ein, obwohl ihm klar war, dass die Verspiegelung der Scheibe, durch die Sonne, ihn unsichtbar machte. Ein kurzer Augenblick des Schreckens. Kurt speicherte Gesicht, Haltung und Größe im Unterbewusstsein. Er stand am A 5. Also lief die Gestalt zum Aufzugskern A 6. Die auffällige Person öffnete eine Eisentüre und verschwand im Innern.
Was ging hier ab? Nach seinem Dafürhalten lief dieser Mensch gebückt, wollte also nicht gesehen werden.
Der Zeitpunkt war vielleicht wichtig. Neun Uhr siebenundzwanzig.
*
zwei
Zwischenspiel
Siegfried Adler, blond, groß, breitschultrig, sowie stahlblaue Augen kam 1944 als Ergebnis eines Zuchtprogramms der Nazis zur Welt. Alle Kenntnisse der damaligen Genetiklehre wurden bei seiner Zeugung beachtet. Das wusste er jedoch erst seit wenigen Jahren.
In einer, der wenigen sentimentalen Anwandlungen beschäftigte er sich, nach dem Tod des Vaters, mit dem Stammbaum und stieß auf die unglaubliche Erkenntnis. Sein Geburtsort war identisch mit einem sogenannten Lebensbornheim in Wernigerode im Harz und die bis dato Eltern waren nicht die leiblichen. Nach dem Kriegsende 1945 machten sie sich seiner habhaft, anders konnte er es nicht bezeichnen, denn es gab keine Adoptionspapiere. Sicher blieb, dass seine Erzieher einerseits mit dem Naziregime sympathisierten sowie andererseits aus hohen Positionen und Funktionen kamen. Ein normal Sterblicher bekam niemals, auch nach Kriegsende nicht, ein Kind aus einem solchen Heim.
Siegfried wurde in einer Mischung von Arroganz und Intoleranz erzogen. Tief im Innern wusste er, dass er sich von den anderen unterschied. In der Schule und während der Ausbildung lebte er eher unauffällig. Jedoch ständig gelangweilt und unruhig im Geist. Fast schon zu spät fand er eines Tages heraus, dass er einer totalen Unterforderung gegenüberstand. Das begonnene Pädagogikstudium schoss er, mit der neuen Erkenntnis, in den Wind. Er fühlte sich zu Höherem berufen. Zu dem Zeitpunkt lebte er in einem kleinen sauerländischen Dorf. Er brach die Zelte dort ab und zog nach Aachen, um dort zu studieren. Doch es kam anders.
Die Stadtverwaltung suchte händeringend Mitarbeiter. Siegfried stieg nach reiflicher Überlegung ein. Schließlich konnte Vielseitigkeit kein Nachteil sein und das Studium lief nicht weg. Wider Erwarten fand er hier die erste Bestimmung, auch wenn es ihn, Anfang der achtziger Jahre, in die schnell wachsenden städtischen Krankenanstalten zog.
Siegfrieds Berufswahl kam nicht von ungefähr. Er unterlag einer unmerklichen Steuerung. Als ihm dieser Umstand ins Bewusstsein trat, verpasste er den Zeitpunkt zum Handeln oder besser gesagt: Seine Ichbezogenheit ließ ihn die Tatsache verdrängen.
Siegfried Adler war nicht allein. Im erweiterten beruflichen Umfeld gab es mindestens fünf weitere Beschäftigte mit der gleichen Einstellung zum Leben und einer ähnlichen Vita. Jedoch nahm er nicht an, dass sie, ebenso wie er, aus einem Lebensborn kamen. Sie fanden ihren Job in den städtischen Krankenanstalten etwa zum gleichen Zeitpunkt. Sie betrachteten die Umwelt mindestens ebenso misstrauisch, wie er. Was letztendlich besagte, dass sie vordergründig viele Freunde und Bewunderer besaßen, jedoch nie über ihre Lebenseinstellung sprachen. Siegfried kam ausschließlich im Arbeitsumfeld mit ihnen in Berührung.
Je weiter Siegfried beruflich vorankam, umso mehr bemerkte er, dass das System, das ihn einband, gerade mal zur mittleren Ebene gehörte. Im Arbeitsbereich wirkte er zwar als König, doch, wenn er über den Tellerrand schaute ... eine Randnotiz der hierarchischen Ordnung.
Die Erkenntnis traf ihn etwa zum gleichen Zeitpunkt, als der Erzieher starb, den er Vater nannte. Er liebte den Mann, wie einen echten Elternteil und sah es als Pflicht, den Nachlass zu ordnen.
Er stieß auf die Umstände seiner Geburt und Erziehung, auf Zeugnisse seiner Vergangenheit und die Erkenntnis, dass er schon früh auf den Lebensweg vorbereitet wurde, auf dem er dahin vegetierte.
Er verbrachte als Kind die Sommerferien in einem Zeltlager am Lenster Strand in der Nähe von Grömitz. Hier wurde er schon mit zehn Jahren, einer permanenten Schulung unterzogen. Heute bezeichnete er die Freizeit als Gehirnwäsche. Erst später brachte er die Ausbildung mit rechtem Spektrum in Bezug. Seine Zieheltern angesprochen, erklärten geduldig, dass die Vergangenheit nach dem Krieg verschleiert werden musste, weil ihn die Gesellschaft, in der sie lebten, ansonsten ächtete. Sie erzählten ihm Beispiele, wonach Kinder als Nazischweine und Schlimmeres beschimpft wurden. Er verstand es damals nicht. Einerseits musste er seine Herkunft und die Ferien im Jugendlager verschleiern und andererseits wurde er als Mitglied einer Herrenrasse gepriesen. Ein Widerspruch, der ihn das gesamte Leben verfolgte. Er war anders als die anderen, das wusste er nun. Doch er kam nie dazu, die tatsächliche Einstellung zu testen. Egal wie, immer wenn er den Entschluss fasste, der anerzogenen Gesinnung gemäß, einer politischen Gruppierung beizutreten, wurde er davon abgehalten. Auf äußerst subtile Art und Weise … durch die Eltern oder deren großen Bekanntenkreis. Die alten Seilschaften der Nazis bestanden immer noch und er lebte als ein Teil in dieser Ordnung. Doch ähnlich wie Freimaurer bauten sie hohe Mauern und hielten ihre Gemeinschaft geschlossen. Die mysteriöse Vergangenheit hielt ihn im Griff. Die vielen Onkel und Tanten gehörten als fester Bestandteil zu seinem Leben. Alle schlank, groß und blauäugig. In jungen Jahren blond und später mit weißem Haupthaar. Sie begegneten ihrer Umwelt mit Arroganz und Unduldsamkeit. Außerhalb ihrer kleinen Gruppe besaßen sie keine Freunde.
*
Seit Siegfried denken konnte, besaß er ausreichend Geld. Jährlich füllte eine erkleckliche Summe, das Konto bei der Stadtsparkasse. Nachforschungen ergaben, dass die finanziellen Mittel von einer Stiftung überwiesen wurden. Doch, als er versuchte, näher einzusteigen, stoppte ihn ein Schreiben. Es lag, ohne Adressat, im Briefkasten. Falls er die Nachforschungen weiter betrieb, würde das die Einstellung der Zahlungen bedeuten. Gleichzeitig wurde ihm mitgeteilt, dass er, sobald er eine Anweisung unter dem Begriff ›Morgendämmerung‹ erhielt, diese auszuführen habe. Also machten sich die Nazis schon die russischen Dichter zu eigen. Soweit er wusste, schrieb Anton Tschechow irgendetwas zur Morgendämmerung. Wieder ein Bezug zu seiner Vergangenheit? Er stellte schweren Herzens die Erkundigungen ein. Die große Pseudoverwandtschaft, mittlerweile in die Jahre gekommen, wollte oder konnte ihm nichts Näheres dazu sagen.
In diesem Zusammenhang dachte er an ein Zeltlager in Lenste an der Ostsee. Weshalb es ihm in den Sinn kam, wusste er nicht. Die Kinder trieben morgendlichen Sport. Zackig, im Gleichklang, verrichteten sie Leibesübungen. Der Betreuer, mit militärisch kurzen Haaren, fungierte als Übungsleiter. Siegfried verbrachte seine dritten Ferien hier und zählte dreizehn Jahre. Ein Alter, bei dem er einiges hinterfragte. Die Gedanken behielt er für sich. Zurück zum Sport. Ein älterer hochgewachsener Mann trat während der Übung hinzu. Nun geschah etwas, was er später nie mehr erlebte. Der Betreuer erstarrte, presste die Hände an die Hose und reckte den Kopf. Er schnarrte mit harter Stimme: »Gruppe stillgestanden.« Dabei vollzog er eine neunzig Grad Drehung. »Obergefreiter Neuner mit zwanzig Zöglingen angetreten ... Herr Sturmbannführer.«
Der ältere Herr versteinerte und das Blut stieg in seinen Kopf. »Sind Sie von allen guten Geistern verlassen«, rief er flüsternd.
Herr Neuner rührte sich nicht. Kein Gesichtsmuskel zuckte.
»Rühren«, befahl der hinzugekommene Mann. »Was tun Sie hier? Wir benötigen Wissenschaftler und keine Soldaten.« Er machte eine Bewegung mit der Hand. »Schicken Sie die Jungen in ihre Zelte.«
Auf dem Weg zum Zeltplatz beobachtete Siegfried die beiden, die sich scheinbar stritten. Nach dem Ferienlager blätterte er in einem Lexikon und fand die Erklärung für Sturmbannführer. Sie bestätigte seine Vermutung hinsichtlich der Nähe zu den Nazis.
Die Leibeserziehung wurde zwar nicht eingestellt, jedoch die Vorzeichen veränderten sich. Sie unterlagen nicht mehr dem Drill, sondern maßen sich im sportlichen Wettkampf. Ab diesem Zeitpunkt wurde Wert auf politischen Unterricht gelegt. Immer wieder klang ihre besondere Stellung in der Gesellschaft durch.
Anfang der neunziger Jahre machte Siegfried Adler bei einem Empfang in der Staatskanzlei in Düsseldorf die Bekanntschaft eines Herrn, den er niemals wieder sah. Mehr als deutlich empfahl dieser ihm, Geld in der ›Morgendämmerung‹ zu investieren, und zwar zu Dienstleistungen im privaten Bereich. Zurzeit würden die Leistungen noch von den Beschäftigten seiner Klinik erbracht, jedoch stände eine Änderung bevor. Der Rat, es war schon mehr eine Anweisung, erwies sich als kluge Anlage.
Wie dramatisch, dachte er noch. Morgendämmerung … etwas Besseres fiel denen auch nicht ein.
Insgeheim ärgerte er sich. Natürlich verfolgte er die Tagespolitik mit gemischten Gefühlen. Die Privatisierungsbestrebungen der Landesregierung entzogen ihm Personal, das seinem Einflussbereich unterstand. Sie entzogen ihm Macht.
Nichtsdestotrotz kaufte er unter einem Decknamen eine große marode Reinigungsfirma in Köln und pumpte viel Geld in die Infrastruktur. Ein Geschäftsführer machte ihm den Betrieb so fit, dass er europaweit konkurrenzlos arbeitete. Parallel überredete er einen Freund, eine kleine ortsansässige Firma in Aachen zu übernehmen. Geld spielte keine Rolle. Die Quelle schien unerschöpflich.
Kaum tätigte er die Geschäfte, setzte die breite Debatte über zu hohe Personalkosten im öffentlichen Dienst ein. Zunächst liefen die politischen Diskussionen an ihm vorbei. Personalabbau erfolgte zwangsläufig im Job bei sinkenden Zuweisungen des Ministeriums. Der Kampf gestaltete sich von Jahr zu Jahr härter. Oft wandte er in der Funktion als stellvertretender Verwaltungsleiter Finten an, um zumindest das Geld zu bekommen, was im vergangenen Jahr zugewiesen wurde.
Langsam sickerte in Siegfrieds Verstand, dass die Diskussionen um die Personalkosten bewusst hochgehalten wurden und er langsam aber sicher auf ein großes Geschäft zusteuerte. Vor allem, weil ein hoher Ministerialbeamter, sehr dreist, eine Abfindung von ihm forderte, falls er mit seiner Firma ins große Geschäft kommen sollte. Er hatte bis dahin zwar schon von Lobbyismus gehört, jedoch kaum einen Gedanken daran verschwendet. Ihn beunruhigte, dass der Beamte von der Beteiligung an der Dienstleistungsfirma zu wissen schien. Er wies den Geschäftsführer an, jemanden zu finden, der die Aufgabe der Schmiergeldzahlungen an die Politiker übernahm. Die Wahl fiel auf eine junge Betriebswirtschaftlerin, die den Job wahrnahm. Sie war gut, und zwar sehr gut.
Siegfried Adler trat immer weiter in den Hintergrund und hoffte, die Geschäfte so zu verschleiern, dass nichts mehr auf ihn wies.
*
drei
In den zwei Tagen, bevor die Krankenschwester Kurt Hüffner aus dem Bett warf, fraß die Langeweile an ihm. Keine Lust zum Lesen, keine Lust auf Fernseher, keine Lust …
Die Schusswunde im Oberschenkel bereitete Schwierigkeiten. Nachdem er schon entlassen war, brach die Wunde auf und er fand sich nach einer Ohnmacht, in der Klinik wieder. Ehrlich gesagt gehörte er nicht zu den Menschen, die Schmerz klaglos wegsteckten. Auf dem Rücken liegend beobachtete er aus dem Fenster, schräg nach oben, rege Tätigkeit auf dem Dach. Er hätte zu diesem Zeitpunkt nicht sagen können, wo auf dem Gebäude.
Die futuristische Architektur verwirrte ihn. Die Klinik wurde sein persönlicher Irrgarten. Soweit er wusste, kannte die Wissenschaft kein echtes Labyrinth. In zehntausend Jahren würden Forscher hier ihre Freude haben. Vierundzwanzig riesige Türme ragten in den Himmel. Vier mal sechs rechteckige Betonklötze. Futuristisch? ... dann immer noch? Vielleicht. Dennoch kein Naturschauspiel.
Die sozialistischen Brüder und Schwestern wiesen das Gebäude vor der Wiedervereinigung als Raketenabschussbasis aus. Tatsächlich ein bekloppter Baustil. Zwischen den Türmen reihten sich endlose Flure, die im Erdgeschoss, über eineinhalb Etagen, in Büroräume abgingen. Das Stockwerk zog sich noch eine Halbetage in die Höhe. Noch einmal eineinhalb Etagen darunter lagen OP-Säle, die Notfallaufnahme und … insgesamt fast siebentausend Räume. Über allem thronte im oberen Bereich des Betonmonstrums, das Krankenhaus oder besser gesagt, der Bettenbereich. Eingepackt wie ein Sandwich dazwischen, die Polikliniken. Und er irrte mittendrin herum.
Hatte er einen Bauarbeiter oder den … Mörder gesehen? War der Flug vom Dach hinunter vielleicht kein freiwilliger? Im tiefsten Innern wusste er, dass er wiederum einem gewaltsamen Tod begegnete. Es gehörte einfach zu seiner Bestimmung. Wie ein Trüffelschwein suhlte er von einem Leichenfundort zum anderen.
So schnell die Verletzungen es zuließen, humpelte er den Weg nach unten.
*
»Was haben wir mit einem Suizid an der Klinik zu tun?«, maulte Maria.
»Irgendjemand muss dort hin«, meinte Heinz lapidar. »Jetzt, wo wir diese Heidesache über die Bühne haben, sind wir frei.« Dem Kriminalisten, ein kleiner Mann von einsfünfundsechzig und mit beginnender Glatze, perlte der Schweiß von der Stirn. Wieder so ein schwülwarmer Sommertag. Heinz Bauers Auftreten und das Gesicht strahlten sympathische Gemütlichkeit aus. Wasserblaue Augen mit einem hellen Schleier gaben selten preis, was in ihm vorging. Der ansonsten über den Bund hängende Bauch war fast verschwunden. Die anstrengenden letzten Wochen hatten das Ihrige getan. Noch zwei Jahre … dann Pension und Enkelkinder. Jeden Morgen fuhr er die dreißig Kilometer von Windhausen zum Dienst ins Aachener Polizeipräsidium. Heinz lebte in dem kleinen Dorf im nördlichen Teil ihres Zuständigkeitsbereiches. Diese Gegend prägte ihn und bestimmte seinen Charakter. Ein ganz anderer Menschenschlag, als hier in der Aachener Gegend.
Heinz nutze jede freie Minute für die Enkelkinder und unternahm die unmöglichsten Dinge mit ihnen.
Kollegin Maria und er bekleideten den Rang von Kriminaloberkommissaren.
Maria Römer stand kurz vor ihrem fünfzigsten Lebensjahr. So kurz nun auch nicht. Immerhin waren es noch vier Jahre, na ja dreieinhalb. Ähnlich groß wie Heinz, besaß sie das, was landläufig eine frauliche Figur beschrieb. Also Rundungen an den richtigen Stellen. Maria agierte als Computerspezialistin ihres Teams. Sie arbeitete am liebsten im Büro und hasste das weite Umland. Am meisten verabscheute sie das platte Land nördlich von Aachen, die Knollensavanne, also die Gegend, aus der Heinz kam. Die großen Rübenfelder und das unheimliche Heidegebiet empfand sie als reinsten Horror.
Seit Monaten suchte sie den passenden Partner im Internet. Einige Profile, mit vorhandenen und erfundenen Eigenschaften, füllten die Partnerschaftsplattformen. Bisher zog sie nur Nieten. Die Bekanntschaften der letzten Monate, man konnte schon fast Jahre sagen, entwickelten sich durchweg zu katastrophalen Fehlgriffen. Die Frage, ob sie überhaupt noch bindungsfähig sei, beschäftigte sie unablässig. Für die Disco empfand sie sich zu alt und in einen Sabberschuppen wollte sie nicht. Ihre persönliche Situation schlug auf das Gemüt und führte zu ständig wechselnden Haarfarben.
Zu ihrem Team gehörte die Kollegin und Chefin Claudia Plum, die jedoch noch einige Tage urlaubsbedingt fehlte. Ihr, noch nicht oder fast, Lebensgefährte Kurt genas in der Klinik von den lebensgefährlichen Verletzungen, die ihm seine Neugierde einbrachte.
»Gut. Machen wir uns auf die Socken.« Maria fasste den Entschluss und stand, aus dem Fenster schauend, auf. »Es wird Zeit, dass ich hier herauskomme. Der Knast drüben macht mich melancholisch.« Kein Tag im Büro verging, an dem diese Aussicht nicht für Ärgernis sorgte.
Das Polizeipräsidium lag genau gegenüber der Justizvollzugsanstalt in der Aachener Soers. An und für sich schön gelegen, am nördlichen Ende der Stadt, als Abschluss des riesigen Sportgeländes, das den Tivoli, das neue schwarzgelbe Stadion der Alemannia und das Turniergelände des Reitvereins mit allen Gebäuden und Stallungen aufnahm.
*
Sie näherten sich dem Klinikgebäude von hinten, also von Laurensberg kommend, unter der hohen Eisenbahnbrücke hindurch, durch Seffent und an den Siebenquellen vorbei. Links sahen sie in das Tal, das zu dem gewaltigen Gebäude der Klinik auf dem Schneeberg anstieg und in den nächsten Jahren zum Universitätscampus ausgebaut werden sollte. Rechts lag der Golfplatz.
Sie fuhren über den Schneebergweg, umrundeten das riesige Gebäude mit dem angrenzenden Parkplatz.
Maria steuerte das Auto über den Vorplatz durch die Schaulustigen, die rechts vom Haupteingang am Geländer drängelten und nach unten sahen. Dort lag der Liegendkrankeneingang, wie sie wusste. Bestimmt noch einmal fünf Meter oder mehr, tiefer. In den nächsten Tagen sollte hier der Bau des Hubschrauberlandeplatzes beginnen. Irgendwas mit helfender Hand, was immer das sein mochte. Wahrscheinlich genauso futuristisch beknackt, wie das Gebäude.
Menschen drängten zusammen und verhinderten den ungehinderten Blick auf den Unfallort. Ein Bediensteter der Klinik, sie sahen es am Dienstausweis an der Hemdtasche, der ihn als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes identifizierte, stürzte auf sie zu.
»Sind Sie verrückt oder blind. Sie dürfen hier nicht parken. Fahren Sie Ihre Karre weg«, rief er aufgebracht.
Heinz zückte den Ausweis.
»Kriminalpolizei Aachen. Heinz Bauer und meine Kollegin, Maria Roemer.«
»Ich wusste ja nicht«, stotterte der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unsicher.
»Müssen Sie auch nicht«, brummelte Heinz. »Was ist geschehen?«
»Dort unten.« Der Mann zeigte zu dem Menschenknäuel. »Mein Name ist Emonds. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie dort hin.« Er drückte die Schaulustigen zur Seite und führte sie zu einer schmalen Treppe, die nach unten führte. Schon während des Abstiegs sahen sie den mit einem Laken bedeckten Körper. »Er muss oben vom Dach gesprungen sein. Aus einem Fenster ist es nicht möglich. Die sind auf den Etagen nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen. Er ist nicht der Erste. Wir hatten schon einige Male Selbstmörder«, erklärte der Sicherheitsmensch gewichtig.
Heinz Augen kreisten. Hier unten hatte er noch nie zu tun. Und das, nach mehr als zwanzig Jahren Dienst im Aachener Polizeipräsidium. Ein kleiner Kessel, der über eine steile Straße, wie er vermutete, zum Parkplatz führte. Links schloss der Einschnitt zum Vorplatz durch eine Überdachung, die gleichzeitig oben, auf Straßenniveau, den Zugang in die Klinik gewährleistete. Eine Brücke also. In das entstandene Gebäude darunter fuhren die Krankenwagen mit den Patienten hinein … der Liegendkrankeneingang. An der Fensterfront, mindestens eineinhalb Stockwerke unter Erdgeschossniveau des Klinikgebäudes, reihten sich Plastikbänke. Nur ein Meter weiter links, wäre das Opfer auf dem Haupteingang, und damit zwanzig Meter weiter oben, gelandet.
»Männlich.« Heinz schlug das Laken zurück, nachdem er die Szenerie aufgenommen hatte. Die Leiche sah nicht so platt aus, wie er vorher dachte. Wenig Blut. Satt aufgeschlagen, mit der gesamten Körperfläche. Was alles kaputt war, würden die Gerichtsmediziner feststellen. »Kennen Sie den Mann?«
»Ja. Karl Wegner. Ich hatte vorhin Gelegenheit, einen Blick auf ihn zu werfen. Abteilungsleiter in der Beschaffung oder so. Genau weiß ich das aber nicht«, erklärte der Sicherheitsmensch in einer ausgeprägt melodischen Betonung des sächsischen Dialekts. Mitte vierzig, vollzog Heinz eine Musterung. Mittelgroß und von Kopf bis Fuß kugelrund. Dichtes, krolliges Haar wuchs weit in die Stirn hinein.
Jetzt hab‹ ich´s, dachte Heinz verwundert. Die Ägypter verjüngten ihre Pyramiden nach oben. Da konnte niemand im freien Fall herunterstürzen. Wie kam er jetzt auf Pyramiden? Kopfschüttelnd sah er in die schwindelnde Höhe der Fassade hinauf.
»Herr Emonds.« Ein grauhaariger grobschlächtiger Mann unterbrach seinen Gedankengang. »Wie oft muss ich Ihnen sagen, dass wir nicht mit der Presse reden. Dafür ist der Pressesprecher zuständig. Wir sagen nichts.« Er funkelte Heinz und Maria an.
Emonds zuckte zusammen und machte, dass er wegkam. Dabei warf er einen verschlagenen Blick auf den Neuankömmling.
»Wer sind Sie denn?«, fragte Maria mürrisch in ihrem breitesten Aachener Dialekt.
»Wie gesagt. Wir sagen nichts. Außerdem geht Sie das nichts an«, antwortete er zugeknöpft.
»Kriminalpolizei. Wir sind keine Schreiberlinge, sondern die Kriminalpolizei«, erklärte Heinz.
»Wir sagen trotzdem nichts«, stellte der Grauhaarige, mit verstocktem Gesichtsausdruck, abschließend fest. Er sprach einen ausgeprägten Eifeldialekt und wirkte unglaublich wichtig. Zumindest drückte die Haltung das aus.
Heinz wusste so einige Dinge über die Klinik. Vor allem, dass man hier nichts mit normalen Maßstäben maß. Sollte der Tote nicht verunfallt sein, kamen schwierige Tage auf sie zu.
»Wer kann mir etwas sagen?«, fragte er leicht genervt.
»Hier? Bei uns?«, drang es erstaunt und gedehnt aus dem Mund von Herrn Wild, dem Leiter des Sicherheitsdienstes, wie Heinz, auf dessen Ausweis las.
»Ja. Bei Ihnen. Wo denn sonst?«, sprach ihn Maria im gleichen gedehnten Tonfall, jedoch in Oecher Platt an. Sie legte ungewöhnliche Schärfe in ihre Stimme und handelte sich von Heinz einen erstaunten Blick ein. »Was denken Sie, was wir hier wollen?«
»Der Verwaltungsdirektor ist zuständig. Wer sonst?«, gab er verwundert über so viel Unwissenheit von sich. Die Haltung drückte es aus. Waren die bekloppt? Das wusste doch jeder.
»Ist der hier?«, fragte Heinz.
Der Mann sah ihn an, als wenn er nicht alle Tassen im Schrank hätte. Heinz entging jedoch das Glitzern ganz hinten in den Augen nicht. Welches Spiel versuchte der, zu spielen? Jetzt verstand er Maria. Die mussten mit härteren Bandagen bearbeitet werden.
»Haben Sie einen Termin?«, fragte der Typ, als spräche er mit einem Verrückten.
»Verdammt noch mal«, brüllte Heinz. »Wollen Sie mich verarschen? Ich will jetzt im Augenblick eine kompetente Person hier haben. Bei diesem Waschküchenwetter habe ich keine Lust länger hier herumzustehen.« Er wischte sichtlich genervt den Schweiß von der Stirn.
»Bleib ruhig Heinz«, sagte die bekannte Stimme besänftigend.
»Claudia. Was machst du hier? Ich denke, du bist im Urlaub.«
»Bin ich auch. Krankenbesuch bei Kurt … und dann dies. Reg dich nicht auf. Hier arbeitet ein besonderer Menschenschlag. Ich hatte schon einige Male in der Klinik zu tun. Da ticken die Uhren anders.«
»Die können auch nicht anders ticken als bei uns. Mir ist es egal, wer hier arbeitet und wenn es der Papst persönlich ist. Dort liegt ein Toter«, wetterte er weiter und kochte hoch. Doch schnell fuhr er wieder zurück. Es war zu warm für Aufregung. »Wie lange bist du schon hier? Waren unsere Gerichtsmediziner schon an dem Toten?«
»Ich habe gerade die Telefonate geführt und warte. Wir sind die Ersten.«
»Das gibt es doch nicht. Wer hat den Tod festgestellt?«
»Ich.« Ein bebrilltes Jüngelchen, das die gesamte Zeit bei ihnen stand und interessiert der Unterhaltung lauschte, trat in den Vordergrund.
»Sie? Sind Sie Medizinstudent?«, fragte Maria den Jungen überrascht. Er war vielleicht siebzehn bestenfalls achtzehn Jahre alt.
»Assistenzarzt. Hoffentlich bekomme ich keine Schwierigkeiten?« Er sah sie unsicher an und wischte den Schweiß von der pickligen Stirn.
»Wieso sollten Sie Schwierigkeiten bekommen?«, fragte Claudia erstaunt, aber auch unsicher. Der war doch hoffentlich nicht einer von der Kinderuni, die in den Semesterferien der Studenten, an speziellen Vorlesungen teilnahmen.
»Das ist so eine Sache, eine blöde Situation. Ich war selbst nicht dabei. Jedoch in den Vorlesungen wurde darüber gesprochen«, begann er eifrig. »An der Bushaltestelle drüben vor dem Haupteingang«, er wies mit der Hand nach oben, »brach eine Frau zusammen. Herzanfall. Sie bedurfte sofort ärztlicher Behandlung. Ein Kollege leistete etwas mehr als Erste Hilfe, um ihr Leben zu retten, und gab der Patientin eine kreislaufstabilisierende Spritze. Danach bekam er Schwierigkeiten mit den niedergelassenen Ärzten. Die sind wie die Geier, wenn es um Zuständigkeiten geht und außerhalb der Klinik zuständig. Erste Hilfe leisten: ja, aber nicht mehr. Bei, dem«, er nickte zur abgedeckten Leiche, »war ja auch mit Erster Hilfe nichts zu machen. Dennoch habe ich ihn untersucht, um zu gucken, ob er noch lebt. Sie brauchen es ja nicht in ihren Unterlagen zu erwähnen. Da sind die knallhart«.
»So ein Schmarrn«, sagte Heinz.
»Echt«, sagte der Arzt treuherzig, »Schwierigkeiten kann ich nicht gebrauchen. Sowieso, wenn ich gewusst hätte, was das für ein beschissener Job ist. Wenig Geld und eine Arbeitszeit, ich kann Ihnen sagen …«
»Was geschieht jetzt?«, fragte Maria, den jungen Mediziner ignorierend, zu Claudia gewandt.
»Einer von euch wartet hier und wir anderen beiden, versuchen, den Verwaltungsdirektor zu bekommen.«
»Ich bleib hier«, sagte Heinz und holte die Pfeife hervor. Er war passionierter Pfeifenraucher und liebte die aromatischen dänischen Tabaksorten. »Nein«, unterbrach er abrupt den Vorgang und starrte verzweifelt, wie hypnotisiert, über Claudias Schulter. Das ansonsten glatte Gesicht bekam Falten und etwas wie Grauen tauchte hinten in den Augen auf. Seine Gestalt fiel zusammen.
»Doch nicht das, was ich denke«, fragte Claudia ahnungsvoll.
»Genau das. Der Grabräuber. Hat es denn nie ein Ende?« Heinz fuhr mit der freien Hand über die glänzende Stirn. »Jetzt können wir uns einen Unfall abschminken.«
Claudia drehte sich um und starrte auf die Gestalt im Jogginganzug. Sie wirkte krank und zog hinkend einen Ständer mit Infusionen hinter sich her.
»Wo kommst du denn her? Ich denke, du liegst im Sterben«, empfing sie ihn wütend. »Komplikationen kann ich jetzt nicht gebrauchen.«
»Schön, dass du da bist.« Kurt legte den Arm um ihre Schulter und drückte sie kurz. »Die Person«, er zeigte zu dem Toten, den die Gerichtsmediziner und Spurensicherung zurzeit untersuchten, »könnte gestoßen worden sein. Ich sah, kurz, nachdem sie am Fenster vorbeiflog, jemanden über das Dach laufen.«
»Nicht schon wieder.« Maria hielt aufstöhnend die Hände vor die Augen. »Der ist tatsächlich an deinem Fenster vorbei geflogen? Ich glaube es nicht.«
»Was habt ihr? Weshalb benehmt ihr euch so komisch. Hab ich was an mir«, er sah an sich herunter.
»Du gehst am besten auf dein Zimmer.« Claudia schob ihn gnadenlos und rau zu der offenen Glastür. »Im Moment störst du.«
»Schubs mich nicht. Ich bin noch wacklig auf den Beinen. Außerdem schlägt das Wetter auf den Kreislauf.« Er setzte ihrem Druck bockig und quenglig Widerstand entgegen, wobei er ihren Oberarm fasste, damit er nicht umfiel.
»Kurt«, sagte sie bestimmt. »Jetzt mach keine Zicken und geh auf deine Station.«
Er schaute in ihre grauen Augen und sah den Ernst darin.
»Du meinst es ernst«, gab er nach. »Du kommst aber nachher noch einmal vorbei?«, stellte er treuherzig und halb fragend fest.
»Sicherlich.« Sie ging schon wieder auf die Leiche zu.
Nachdenklich schaute er hinterher. Er mochte ihre sportliche Figur, das brünette Haar, wie sie den Po bewegte, wenn sie ging … eigentlich alles. Claudia war so wandelbar. Meist sanft, nachgiebig und liebenswert. Doch wenn es darauf ankam, knallhart.
Kurz dachte er an die vergangenen hektischen Wochen, die sein Leben so veränderten. Das Ohr steckte noch immer in einem Verband und über den Kopf zog sich mittig ein rasierter Streifen mit einer wulstigen roten Narbe. Folgen der Schussverletzungen, als ihn die bekloppte Alte im Fließsand versenken wollte. Die Verletzung am Schenkel war aufgeplatzt. Glatter Durchschuss. Eine gute Woche war das jetzt her. Na ja. Zumindest lernte er dadurch Claudia kennen. Dass sie ihn jetzt wie einen Schwachsinnigen behandelte, gefiel ihm nicht. Darüber würde er noch einmal mit ihr sprechen.
Plötzlich schmerzte ihn jeder Muskel. Selbstmitleid übermannte ihn. Müde schleppte er den geschundenen Körper zum Aufzug, in der Hoffnung, in diesem Labyrinth die Station und das Zimmer zu finden. Plötzlich blieb er stocksteif stehen.
Da war es ja.
Das Automatenrestaurant!
Göttliche Fügung.
Fliegende Menschen konnten auch etwas Gutes haben. Die Lebensgeister erwachten wieder. Die Aufregung war nicht umsonst. Hoffentlich gab es dort etwas Vernünftiges zum Essen. Kaffee wäre nicht schlecht.
*
»Ich glaube nicht an Zufall«, stöhnte Heinz. »Wer kann uns so hassen, dass er uns deinen Leichenspürhund antut. Dem Typen verdanke ich die schlimmsten Wochen meines Lebens. Schau bloß, dass das nichts Ernstes mit euch beiden wird«, maulte er. »Die zwei Jahre bis zu meiner Pension wollte ich eigentlich ruhig verbringen.«
»Langsam glaube ich auch nicht mehr an Zufall«, trötete Maria ins gleiche Horn. »Irgendjemand mag uns nicht.«
»Ich kann doch nichts dafür«, Claudia hob in gespieltem Erstaunen die Schultern. »Er hat eine Nase für solche Sachen. Jetzt kümmern wir uns ums Dach. Heinz, Maria … schaut, dass ihr irgendwie da rauf kommt. Ich geh dann allein zum Herrn des Hauses.«
*
Nach gutem Zureden und einem lauten Brüll von Heinz, führte der Chef des Sicherheitsdienstes die beiden Kripobeamten auf das Dach. Er fuhr mit ihnen in die oberste Etage und öffnete gewichtig im Aufzugsflur eine Tür, die in ein Treppenhaus nach oben führte.
»Das ist aber gewaltig«, staunte Heinz beeindruckt, als sie aus dem Turm auf die gewaltige Fläche heraustraten. Hier herrschte überall Bautätigkeit. Rechts befreiten Bauarbeiter ein, ungefähr zweihundert Quadratmeter großes, Areal von Gehwegplatten, die hier den Boden bedeckten. Die rechteckigen Quader lagen auf Sandsäckchen. Der Sinn erschloss sich ihm sofort. Damit das Regenwasser ablaufen konnte. Einfach, jedoch genial.
»Ja«, erklärte Wild sichtlich stolz. »Zweihundertdreißig Meter lang und hundertdreißig Meter breit. Dann kommen noch die ganzen Nebengebäude hinzu. Früher brachte man alles in diesem Gebäude unter. Mittlerweile platzt es aus den Nähten. Die Anforderungen wachsen und jetzt sind das Personaldezernat und die Verwaltungsspitze dort drüben«, er zeigte, über das Dach und den Parkplatz hinaus, zur Kullenhofstraße. »Und die Technikleitung dort unten«, er wies auf einige Container neben zwei Barackengebäuden.
»Sagen Sie bloß, Sie haben in dieser Betonwüste Falken?« Heinz wies in den milchig blauen Himmel. Dorthin, wo ein Falkenpärchen seine Kreise zog.
»Ja. Turmfalken. Wegen der Tauben. Die Raubvögel sind heilig, wenn Sie verstehen. Jeder, der hier auf das Dach darf, achtet darauf, sie nicht zu stören. Alle zwei bis drei Jahre zieht das Pärchen Junge. Die beiden dezimieren die Plage ganz schön. Wenn Sie mal länger hier sind, regnet es schon einmal aus heiterem Himmel … Taubenfedern.«
»Wo ist die Stelle, die über der Absturzstelle liegt?«, fragte Heinz kopfschüttelnd und lenkte den Blick auf die gewaltigen Türme, die die Technik der Aufzüge und der Klimaanlage trugen. Sie ragten noch mindestens zehn Meter über das schon sehr hohe Dach, auf dem sie standen.
»Hier entlang« Wild führte sie zu einem Geländer an der unmittelbaren Gebäudekante.
»Sie bleiben hier.« Heinz hielt ihn zurück.
»Ich bleibe auch hier«, sagte Maria. »Ich kann da nicht runter gucken. Höhenangst«, sie zuckte mit den Schultern.
Heinz trat ein paar Schritte nach vorn und betrachtete aus ungefähr sieben Metern die Umgebung.
»Ruf die Spurensicherung und die Technik«, sagte er nach hinten zu Maria. »Mein Dorfnachbar hat wieder einmal das große Los gezogen.«
»Das gibt es nicht«, fluchte Maria und zückte ihr Handy.
»Was ist los?«, fragte Wild.
»Das interessiert sie nicht«, sagte Maria kurz angebunden. Sie beendete ihr Telefonat. »Claudia hat eine Ansprechpartnerin aufgetan. Herr Emonds, du hast ihn vorhin kennengelernt, wird unser Führer im Gebäude sein.«
»Herr Emonds? Das geht nicht. Er ist einer meiner Mitarbeiter und kann nicht aus einem anderen Bereiche heraus delegiert werden«, motzte Wild, sichtlich wütend. Er besaß eine cholerische Ader. Das wurde bestimmt heiter.
»Regeln Sie das mit unserer Chefin«, forderte ihn Heinz ruhig und gemütlich, wie es seine Art war, auf. Den jähzornigen Ausbruch von vorhin tat er als Folge des Wetters ab. »Sagen Sie ihrem Mitarbeiter gleich, er soll Absperrband mitbringen. Vom Aufzug dort vorn«, er zeigte auf den A 6, »bis hier, darf niemand mehr hinter die Absperrung. Nein. Warten Sie«, er überlegte. »Ich sperre das gesamte Dach. Von den Arbeitern hier oben nehmen wir die Personalien und dann wird die Arbeit eingestellt, bis wir unseren Job erledigt haben.
*
»Kriminalpolizei.« Claudia zeigte ihren Ausweis an der Information im Eingangsbereich der Klinik, während Maria und Heinz auf dem Weg zum Dach waren.
»Ich habe schon gehört, dass jemand vom Dach gesprungen ist. Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte der freundliche Angestellte, der auch im Sicherheitsdienst arbeitete, wie der Dienstausweis zeigte.
»Ich suche einen Ansprechpartner«, erklärte sie.
»Ich versuche meinen Chef, zu bekommen.« Er griff zum Telefon.
»Den haben wir schon. Einen Herrn Wild.«
»Ja, das ist doch der Richtige«, lächelte er.
»Er kann mir nicht helfen. Können sie mir jemand anderen empfehlen? Jemanden aus der Verwaltungsspitze.«
»Vielleicht die Stabstelle Kommunikation?«, lächelte der Angestellte fragend und wichtigtuerisch.
»Sie haben doch einen Vorstand?«, fragte sie, und überlegte, ob der Typ das Lächeln einoperiert hatte. Müsste doch hier möglich sein. Damit jedoch, wie auf Knopfdruck, verschwand das Grinsen und die Augen fokussierten auf jemanden hinter ihr. Auch die Gestalt schrumpfte.
»Benötigen Sie Hilfe?«, fragte eine kleine schlanke Frau in einem dunklen Kostüm mit ruhiger angenehmer Stimme. »Sie sind von der Polizei«, stellte sie fest. »Ich habe es mitbekommen.«
»Ich suche einen Ansprechpartner oder Partnerin«, wiederholte Claudia.
»Das ist gut. Die sind alle auf Tauchstation. Das ist hier immer so. Kein Aufsehen«, sagte sie bitter. »Nicht nur um der Situation willen, sondern auch um die eigene Person. Die unangenehmen Sachen übernehme ich. Waltraud Krause.« Sie reichte die Hand. »Ich bin die Umweltdezernentin. Kommen Sie bitte.« Sie führte Claudia am Kiosk vorbei zu einer kleinen schmalen Treppe, die im Gewirr aus Stahl und offen liegenden Versorgungsrohren nicht auffiel. Die Dezernentin ging vor. Die Breite der Stiege reichte gerade, hintereinanderzugehen. Gegenverkehr war nicht möglich.
»Dort vorn ist mein Bereich.« Sie zeigte nach links in den Flur, den sie betraten.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Frau Krause in ihrem Büro, das auf einen tristen rechteckigen Innenhof sah.
»Unsere Spurensicherung und Technik wird das Dach um die Absturzstelle untersuchen. Möglicherweise müssen wir einige Befragungen durchführen. Dazu benötigen wir einen Ansprechpartner und mindestens einen Führer.«
»Die berühmte kriminaltechnische Untersuchung also. Ansprechpartnerin bin ich und ansonsten gebe ich Ihnen Herrn Emonds an die Hand.«
»Sie sagten, Sie seien die Umweltdezernentin. Sind Sie für solch außergewöhnliche Angelegenheiten zuständig«, fragte Claudia neugierig.
»Ich bin sozusagen Mädchen für alles«, erklärte die Frau schulterzuckend. »Wahrscheinlich, weil die Abfallentsorgung zu meinem Bereich gehört. Aber vor allem weil ich Frau bin.«
»Makaber, makaber«, sinnierte Claudia. »Übrigens, der Tote ist nicht freiwillig gesprungen. Meine Kollegen fanden Kampfspuren auf dem Dach.«
»Wie furchtbar«, entfuhr es Frau Krause. »Haben Sie schon weitere Anhaltspunkte?«
»Einen Moment bitte.« Claudia nahm ein Gespräch auf ihrem Smartphone entgegen. »Nein. Sie haben es ja gerade gehört«, nahm sie den Faden wieder auf. »Meine Kollegen«, sie hob das Telefon. »Die Technik muss jetzt tatsächlich ran und die Spuren sichern.«
»Wenn Sie etwas benötigen … ich stehe zur Verfügung. Ansonsten sind Sie hier verloren.« Die Dezernentin entließ sie faktisch.
»Einen Augenblick noch. Der Chef der Sicherheitsabteilung macht Ärger. Er möchte seinen Mitarbeiter nicht abstellen.«
»Ach.« Krause machte eine wegwerfende Bewegung. »Vollkommen normal. Darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Hier wird jeder Furz persönlich genommen. Ich regle das.«
*
»Du hast jemanden über das Dach laufen sehen?«, fragte Claudia, anlässlich ihres ursprünglichen Vorhabens, ihn zu besuchen.
»Ja«, antwortete Kurt. »Eine mittelgroße Figur. Sehr behände. Sie trug Jeans und Hemd oder Bluse. Die Farbe Rot, kann aber auch Blau gewesen sein. Ich konnte nicht erkennen, ob es Männlein oder Weiblein war. Weshalb fragst du? Steckt doch mehr dahinter?«
»Weshalb fragst du?« Sie legte die Betonung auf das Du. »Als wenn etwas anderes als ein Verbrechen infrage käme, sobald du involviert bist«, stellte sie aufseufzend fest.
»Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand.« Kurt verteidigte sich sofort. »Also doch. Schon wieder ein Mord.« Er brachte den Oberkörper in eine andere Stellung, hielt jedoch sofort inne. Schmerz und Erschöpfung überzogen das Gesicht. »Ich hab mir zu viel zugemutet.«
»Du bist ein Weichei.« Sie lächelte. »Es hat dich nicht gehindert, über die Leiche zu stolpern. Bleib mal ruhig liegen, die Arbeit bekommen wir auch ohne dich erledigt.«
»Von wegen stolpern. Der Engel ist schließlich an mir vorbei geflogen. Vielleicht kann ich euch doch behilflich sein. Durch meinen Job hab ich manchmal hier zu tun. Einige Leute kenne ich ganz gut.« Er sah sie treuherzig an.
»Um Gottes willen. Tu‹ uns das nicht an. Meine Kollegen wollen mir schon die Zusammenarbeit aufkündigen. Bleib in deinem Bett.«
»Wenn du nicht willst.« Er schloss eingeschnappt die Augen. Doch lange hielt er nicht durch. »Maria und Heinz sind bekloppt. Wisst ihr schon, wer der Tote ist?«
»Ja. Ein Karl Wegner. Er arbeitet in der Finanzabteilung oder im Materialcenter. Beim Einkauf.«
»Ein Angestellter? Wie alt?«
»Sechsunddreißig. Weshalb fragst du?«
»Das bedeutet Arbeit. Das kann alles sein. Von einer Beziehungstat bis zum … ich weiß nicht.«
»Da gebe ich dir recht. Ungefähr sechstausend Beschäftigte plus Studenten plus Besucher … ein großer Kreis. Jetzt zu dem, weshalb ich hier bin. Wie geht es dir?« Sie strich über die kaum verheilte Wunde auf dem Kopf. »Du siehst schlecht aus. Ich muss jetzt aber weg und lasse mich später noch einmal sehen.«
Kurt setzte zu einer Entgegnung an, aber Claudia verschwand schon durch die Tür. Eine kurze Stippvisite.
Perplex sah er hinterher. Das war noch weniger als ein kurzer Krankenbesuch. In was für einer beschissenen Welt lebte er. Er musste sich überlegen, ob er der richtigen Frau hinterherlief. Die verschwendete überhaupt keine Gedanken an ihn. Ein wenig Zeit für Mitleid musste immer drin sein.
Kurt war Mitte dreißig und etwas über eins neunzig groß. Im Moment machte die Größe jedoch nichts her, weil er in gebückter Schonhaltung durch die Gegend schlich, wenn er sich überhaupt bewegte. Der Schock der Verletzungen saß tief. Und dann haute Claudia einfach ab und überließ ihn in seinem Leid. Er zog die breiten Schultern, aufgrund der Schmerzen, die in jedem Knochen steckten, nach innen.
Vor etwa zwei Wochen hatte er im Dorf ein Erlebnis, das bleibende Zeichen auf dem Körper zurückließ. Die Chefin eines Verbrecherclans tickte aus und versuchte ihn, in einem Fließsandloch zu versenken. Das stellte das bis dahin ruhige Leben mit einem Schlag auf den Kopf. Die Angst und die Schmerzen würde er wohl nie vergessen. Er war faktisch tot und wachte in der Klinik wieder auf. Wenn nicht diese Angst gewesen wäre, hätte er vielleicht das Licht am Ende des Tunnels gesehen. In den letzten Tagen hatte er viel Zeit darüber nachzudenken. Doch da war nichts. Nur diese Todesangst, die ihn immer noch frösteln ließ. Vielleicht war es auch Blödsinn, was man darüber erzählte.
Er arbeitete als Maschinenbauingenieur in einer Aachener Firma. Daneben fuhr er Versuche in der Grundlagenforschung an der RWTH als Physiker. Doch bis dahin musste er noch einige Wochen pausieren. Eigentlich schade. Bahnbrechende Tests standen an. Zurzeit fuhren sie Versuche in einem Projekt mit CERN, dem großen Teilchenbeschleuniger in Zürich. Ein interessanter Job, der viel Spaß machte.
*
vier
Zwischenspiel
So lange Siegfried zurück dachte, besaß er ausreichend Geld. Jährlich füllte eine erkleckliche Summe, das Konto bei der Stadtsparkasse. Nachforschungen ergaben, dass die finanziellen Mittel von einer Stiftung überwiesen wurden. Doch, als er versuchte, näher einzusteigen, stoppte ihn ein Schreiben. Es lag, ohne Adressat, im Briefkasten. Falls er die Nachforschungen weiter betrieb, würde das die Einstellung der Zahlungen bedeuten. Gleichzeitig teilte man ihm mit, dass er, sobald er eine Anweisung unter dem Begriff ›Morgendämmerung‹ erhielt, diese auszuführen habe. Also machten sich die Nazis schon die russischen Dichter zu eigen. Soweit er wusste, schrieb Anton Tschechow irgendetwas zur Morgendämmerung. Wieder ein Bezug zu seiner Vergangenheit? Er stellte schweren Herzens die Erkundigungen ein. Die große Pseudoverwandtschaft, mittlerweile in die Jahre gekommen, wollte oder konnte ihm nichts Näheres dazu sagen.
In diesem Zusammenhang dachte er an ein Zeltlager in Lenste an der Ostsee. Weshalb es ihm in den Sinn kam, wusste er nicht. Die Kinder trieben morgendlichen Sport. Zackig, im Gleichklang, verrichteten sie Leibesübungen. Der Betreuer, mit militärisch kurzen Haaren, fungierte als Übungsleiter. Siegfried verbrachte seine dritten Ferien hier und zählte dreizehn Jahre. Ein Alter, bei dem er einiges hinterfragte. Die Gedanken behielt er für sich. Zurück zum Sport. Ein älterer hochgewachsener Mann trat während der Übung hinzu. Nun geschah etwas, was er später nie mehr erlebte. Der Betreuer erstarrte, presste die Hände an die Hose und reckte den Kopf. Er schnarrte mit einer harten Stimme: »Gruppe stillgestanden.« Dabei vollzog er eine neunzig Grad Drehung. »Obergefreiter Neuner mit zwanzig Zöglingen angetreten ... Herr Sturmbannführer.«
Der ältere Herr versteifte und das Blut stieg in seinen Kopf. »Sind Sie von allen guten Geistern verlassen.«
Herr Neuner rührte sich nicht. Kein Gesichtsmuskel zuckte.
»Rühren«, befahl der hinzugekommene Mann. »Was tun Sie hier. Wir benötigen Wissenschaftler und keine Soldaten.« Er machte eine Bewegung mit der Hand. »Schicken Sie die Jungen in ihre Zelte.«
Auf dem Weg zum Zeltplatz beobachtete Siegfried die beiden, die sich scheinbar stritten. Nach dem Ferienlager blätterte er in einem Lexikon und fand die Erklärung für Sturmbannführer. Der Vorfall bestätigte seine Vermutung hinsichtlich der Nähe zu den Nazis.
Anfang der neunziger Jahre machte Siegfried Adler bei einem Empfang in der Staatskanzlei in Düsseldorf die Bekanntschaft eines Herrn, den er nachher niemals wieder sah. Mehr als deutlich empfahl dieser ihm, Geld in der ›Morgendämmerung‹ zu investieren, und zwar in Dienstleistungen im privaten Bereich. Zwar würden die Leistungen zurzeit noch von den Beschäftigten in der Klinik erbracht, jedoch stände eine Änderung bevor. Der Rat, es war schon mehr eine Anweisung, erwies sich als kluge Anlage.
Wie dramatisch, dachte er noch. Morgendämmerung … etwas Besseres fiel denen auch nicht ein.
Insgeheim ärgerte er sich. Natürlich verfolgte er die Tagespolitik und mit gemischten Gefühlen die Privatisierungsbestrebungen der Landesregierung. Sie entzogen ihm Personal, das seinem Einflussbereich unterstand. Sie entzogen ihm Macht.
Nichtsdestotrotz kaufte er unter einem Decknamen eine große marode Reinigungsfirma in Köln und pumpte viel Geld in die Infrastruktur. Ein Geschäftsführer machte ihm den Betrieb so fit, dass er europaweit konkurrenzlos arbeitete. Parallel überredete er einen Freund, eine kleine ortsansässige Firma in Aachen zu übernehmen. Geld spielte keine Rolle. Die Quelle schien unerschöpflich.
Kaum tätigte er die Geschäfte, setzte die breite Debatte über zu hohe Personalkosten im öffentlichen Dienst ein. Zunächst liefen die politischen Diskussionen an ihm vorbei. Personalabbau erfolgte zwangsläufig im Job bei sinkenden Zuweisungen des Ministeriums. Der Kampf wurde von Jahr zu Jahr härter. Oft wandte er in der Funktion als stellvertretender Verwaltungsleiter Finten an, um zumindest das Geld zu bekommen, was im vergangenen Jahr zugewiesen wurde.
Langsam sickerte in Siegfrieds Verstand, dass die Diskussionen um die Personalkosten bewusst hochgehalten wurden und er langsam aber sicher auf ein großes Geschäft zusteuerte. Vor allem, weil ein hoher Ministerialbeamter sehr dreist eine Abfindung von ihm forderte, falls er mit seiner Firma ins große Geschäft kommen sollte. Er hatte bis dahin zwar schon von Lobbyismus gehört, jedoch kaum einen Gedanken daran verschwendet. Ihn beunruhigte, dass der Beamte von der Beteiligung an der Dienstleistungsfirma zu wissen schien. Er wies den Geschäftsführer an, jemanden zu finden, der die Aufgabe der Schmiergeldzahlungen an die Politiker übernahm. Die Wahl fiel auf eine junge Betriebswirtschaftlerin, die den Job wahrnahm. Sie war gut, und zwar sehr gut.
Siegfried Adler trat immer weiter in den Hintergrund und hoffte, die Geschäfte so zu verschleiern, dass nichts mehr auf ihn wies.
*
fünf
»Frau Krause. Nett, dass Sie mich so schnell empfangen. Ich muss ihr Angebot schneller in Anspruch nehmen, als mir lieb ist.« Claudia betrat das Büro der Dezernentin. Sie sah ihr mit ihrem ansprechenden schmalen Gesicht entgegen. Ungefähr vierzig Jahre alt, schätzte Claudia. Die dunklen Haare zeigten helle Strähnen, von denen Claudia nicht wusste, ob sie echt oder gefärbt waren. Wenn ja … auf alle Fälle sehr gut gemacht. Kleine Fältchen in den Augenwinkeln zeugten davon, dass die Frau gerne lachte. Graugrüne Augen schauten sie wach an.
»Ich habe mit Ihnen gerechnet, nachdem ich hörte, wer der Tote ist.«
»Kennen Sie ihn?«
»Kennen ist zu viel gesagt. Wie man halt einen Kollegen kennt, mit dem man ab und zu Berührungspunkte hat.«
»Wie war er so? Mir ist eine unvoreingenommene Meinung wichtig«, wollte Claudia wissen.
»Da fragen Sie die Richtige. Tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht viel über ihn und am Flurgeflüster sind sie bestimmt nicht interessiert.« Krause hob abwehrend die Hände.
»Dann lassen wir das«, kommentierte sie die normale Reaktion von Wegners Kollegin. Zu Anfang wollte niemand in etwas hineingezogen werden. Das änderte sich im Verlaufe der Zeit. »Wir benötigen einen Besprechungsraum. Haben Sie so etwas für uns?«, fragte Claudia.
»Klar. Ich habe es kommen sehen und Ihnen den Kleinen Konferenzraum freigemacht. Gleich hier drunter auf dem B-Flur. Der Schlüssel«, sie hielt ihn ihr entgegen. »Einen guten Rat noch. Schließen Sie alles weg. Es gibt einige Generalschlüssel im Haus.«
»Das ist super. Danke. Wegschließen?«, sie sah die Dezernentin merkwürdig an, tat es aber dann ab. »Wie komme ich an eine Liste der Arbeitskollegen von Herrn Wegner?«
»Am besten über das Personaldezernat. Im Konferenzraum stehen ein Computer und ein Faxgerät. Ein Organigramm unseres Hauses mit den entsprechenden Ansprechpartnern habe ich auch deponieren lassen. Einen Teil finden Sie auch im Netz und Intranet, das ich für Sie freischalten lasse. Da haben Sie einiges zu tun.« Krause lächelte.
Eine kompetente Persönlichkeit, dachte Claudia. Die ist echt zu gebrauchen.
»Ich hatte in der Vergangenheit einige Male hier zu tun … wenn ich ehrlich bin, habe ich die Struktur ihres Krankenhauses nie durchschaut«, packte sie die Gelegenheit beim Schopf.
»Oh Gott. Sagen sie das nie wieder.« Krause lachte zu Claudias erstauntem und ratlosem Gesichtsausdruck. »Ich meine ›Krankenhaus‹ … wir sind eine Universität. Der Krankenbereich kostet zwar viel Geld und beschäftigt mehrere Tausend Personen, läuft jedoch nur so nebenher. Lehre und Forschung ist der Schwerpunkt. Auch wenn die Hochstudierten ohne die Kranken verloren sind … sind sie nicht mehr als ein lästiges Anhängsel. Wenn die Fakultät die Patienten backen könnte, würde sie es tun.«
»Ist das echt so?«, fragte Claudia interessiert.
»Viel schlimmer. Wir, das bedeutet der Krankenpflegebereich, die Unterhaltung des Gebäudes, Versorgung, Verwaltung und vieles mehr, sind nie frei in unseren Entscheidungen. Der Dekan und der Ärztliche Direktor haben das Sagen. Dazu kommen Politik und Krankenkassen. Ein Durcheinander ohne Ende. Häufig entstehen unverständliche und unmögliche Situationen. Sie können sich nicht im Traum vorstellen, was in der Bundesrepublik und insbesondere hier los ist. Katastrophe.« Sie kam richtig in Rage.
»Ähnlich wie bei uns«, bemerkte Claudia schmunzelnd. »Bei uns ist es die Staatsanwaltschaft und die Politik. Das System ist das gleiche. Doch zurück zu unserer Leiche. Wer kann mir über den Toten Genaueres sagen?«
»Am besten vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen.«
»Das ist mir auch als Erstes in den Sinn gekommen«, sagte Claudia sarkastisch. »Na ja. Ich schaue mich um.«
*
Drei große rechteckige Tischen auf Stahlbeinen beherrschten den Kleinen Konferenzraum. Darum gruppierten sich sogenannte Freischwinger. In der hinteren rechten Ecke stand ein Schreibtisch mit Computer, Telefon, Faxgerät und jede Menge Utensilien, die für Büroarbeit notwendig waren. Auf den ungefähr achtzig Quadratmetern fanden bequem zwanzig Personen Platz. Keine Schnörkel oder etwas, was dem Raum Atmosphäre gab. Nackt, groß und geschmacklos.
»Ich setze mich gleich vor den Computer«, legte Maria mit Elan los und drückte den Einschaltknopf, um das Gerät hochzufahren.
Heinz saß am Tisch und sah Claudia erwartungsvoll an.
»Ich dachte, wir fangen mit den Kollegen des Toten an«, sagte Claudia.
»Das habe ich heute schon einmal gehört. Ja. Ist wohl am besten. Er wohnte drüben im Personalwohnheim. Ich habe mich dort umgesehen.«
»Im Personalwohnheim? War er nicht ein bisschen zu alt dafür? Da wohnen doch Schülerinnen und Schüler der Krankenpflegeschule.« Claudia hob die Augenbrauen.
»Und solche, die Probleme zu Hause haben. Ja … und ein Hotel haben die da.«