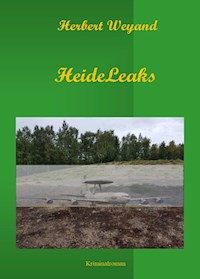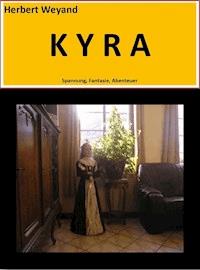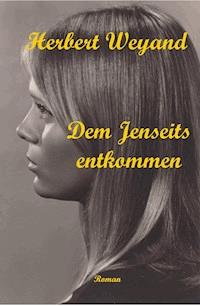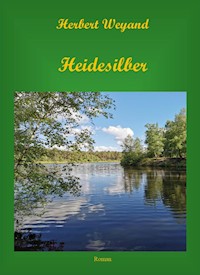
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eigentlich sucht Paul, nachdem er den Schrecken über die Krebsdiagnose abgebaut hat, nur Ruhe. Doch die Anthropologin Griet macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Auf ihrer Suche nach dem Beweis, dass die Kelten eine eigene Schrift besaßen, stößt sie auf ein Hünengrab im deutsch-holländischen Grenzgebiet. Sie stiehlt eine silberne Scheibe, die mit unbekannten – Runen ähnlichen - Zeichen bedeckt ist. Paul wird unfreiwilliger Zeuge eines Mordversuchs und unauf-haltsam in das Geschehen hineingezogen. Weshalb ist die ge-heimnisvolle silberne Scheibe so bedeutsam? Weshalb wird die örtliche Kriminalpolizei durch das Bundeskriminalamt in den Ermittlungen behindert?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Eigentlich sucht Paul, nachdem er von einer Erkrankung genesen ist, Ruhe. Die Anthropologin Griet macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Auf ihrer Suche nach dem Beweis, dass die Kelten eine eigene Schrift besaßen, stößt sie auf ein Hünengrab im deutsch-holländischen Grenzgebiet.
Das Keltengrab ist der Auftakt zu einer mörderischen Jagd nach Reichtum und Macht.
Herbert Weyand hat die Leiche längst gefunden.
Aachener Zeitung 31. Oktober 2013: von: Markus Bienwald
Auf Einladung des Mehrgenerationenhauses las der in Grotenrath lebende Autor Herbert Weyand aus seinen zahlreichen Werken. Foto: Markus Bienwald
Sensationelle Enthüllung im Mehrgenerationenhaus (MGH) am Palenberger Bahnhof: »Die baggern ja zurzeit in der Heide und suchen die Leiche: Ich hab sie längst gefunden«, sagte Autor Herbert Weyand.
… mit einer deutlichen Sprache, die das hiesige Land hergibt, die sein schreiberisches Talent aber nicht vor eine unlösbare Aufgabe stellt, skizziert Weyand die Landschaft um seine Historien herum. Eigenheiten, lokale Spezialitäten und auch Dialekte lässt Weyand herzerfrischend aufblühen und bindet sie scheinbar mühelos in sein Schreiben ein. Bestes Beispiel dafür ist seine Romanheldin, die Kriminalkommissarin Claudia Plum. Besser gesagt, deren Lebensgefährte Kurt, der immer per Zufall in die Geschehnisse hineingezogen wird.
Herbert Weyand
KHK Claudia Plum
vor dem 1. Fall
Heidesilber
Roman
Copyright © 2021 Herbert Weyand:
»KHK Claudia Plum vor dem 1. Fall« »Heidesilber«
All rights reserved.
Arbeitstitel: Das Vermächtnis des Druiden (2017)
Titelbild: © 2021 Laura Schruff
Herbert Weyand
52511 Geilenkirchen
Erstellt mit Papyrus Autor, www.papyrus.de.
eins
»Herr Oberkommissar Bauer, sie sind auf die Verfassung ihres Bundeslandes und die der Bundesrepublik vereidigt. Sie haben zusätzlich eine Erklärung unterschrieben, über die Vorkommnisse dieses Falles zu schweigen.« Bundesrichterin Bach ließ ihren ernsten Blick auf ihm ruhen.
Heinz Bauer nickte.
Der kleine, zur Korpulenz neigende, Mann, Anfang der Sechzig, trug die drei Haare auf der Glatze sorgfältig gelegt. Oberkommissar Bauer leitete die Mordkommission in Aachen vertretungsweise. Der bisherige Leiter verunglückte tödlich und die Abteilung wartete auf den Nachfolger, den noch niemand kannte. Lediglich der Name sickerte mittlerweile durch: C. Plum, Hauptkommissar aus Düsseldorf, vom Landeskriminalamt. Auf den Fluren wurde gemunkelt. Was wollte jemand vom LKA, faktisch in der Provinz? Möglicherweise strafversetzt. Aber diese Gedanken gingen dem Oberkommissar im Moment nicht durch den Kopf.
Als er vor einigen Wochen zum Tatort gerufen wurde, ahnte er nicht, dass ein Fall vor ihm lag, der alles sprengte, was er in der bisherigen Dienstzeit erlebt hatte. Die Gedanken wollten gerade abgleiten, als ihn die Stimme der Richterin zurückholte.
»Herr Bauer, antworten Sie bitte deutlich für das Protokoll.«
»Ja. Es ist so, wie Sie vorgetragen haben.« Er durfte seine Konzentration nicht verlieren. Auch wenn er das ganze Theater für übertrieben hielt. Das Gericht verdiente die Achtung, die das Gesetz vorschrieb. Bauer hob den Blick, von den Händen und schien erst jetzt, die anderen Teilnehmer der Runde wahrzunehmen. Links von ihm saßen Kriminaldirektor Schröder vom Bundeskriminalamt sowie die Kollegin Oberkommissarin Maria Roemer. Auf der rechten Seite weitere vier Beteiligte, die ebenso zum Schweigen verdonnert wurden, wie er. C. Plum war seltsamerweise nicht anwesend.
Die Mordkommission wurde erst spät eingeschaltet. Nach seinem Dafürhalten, zu spät. Auch, wenn sie Verschwiegenheit vereinbarten, hatte der Fall schon genug Staub aufgewirbelt, sodass er bald in aller Mund sein würde. Maria äußerte eine andere Ansicht.
»Ich glaube kaum, dass es großen Wirbel gibt. Der Fall ist so anders, als das, was die Leute kennen. Er macht Angst. Er ist so abstrakt, dass sie ihn nicht verstehen und wenn doch … werden sie schweigen.« Maria Roemer stützte den Kopf in die Hände und sah, aus dem leicht überschminkten Gesicht, ihren Kollegen an. Sie war zehn Jahre jünger als er und noch ein wenig kleiner. Sie trug die Rundungen an den richtigen Stellen: Po und Busen. Die Oberkommissarin trug meist auffällige, ein wenig zu eng sitzende Kleidung und häufig wechselnde Haarfarben, die ihren Gemütszustand anzeigten. Sie hatte ständig eine Affäre, was das fortwährende Auf und Ab ihrer Launen erklärte. »Weißt du Heinz, an deiner Stelle würde ich in Pension gehen. Wie lange hast du noch? Zwei, drei Jahre? Tue dir das nicht an. Noch dazu, wo wir einen neuen Chef bekommen …«
Wenn er jetzt nicht aufpasste, würde sie minutenlang reden. »Was hältst du davon, dass ein Bundesrichter die Befragung durchführt. Ist doch ungewöhnlich, oder? Dafür ist doch die Staatsanwaltschaft zuständig.« Er unterbrach sie einfach.
»Der Gedanke ist mir auch durch den Kopf gegangen.« Sie stand auf und reckte ihre eins zweiundsechzig, sodass der Busen die Bluse fast sprengte. Heinz hatte keinen Blick dafür. Sie arbeiteten schon so lange zusammen, dass sie ein fast geschwisterliches Verhältnis entwickelten. »Aber, was soll`s. Die Gedanken müssen wir uns nicht machen.« Sie blieb hinter ihm stehen und legte eine Hand auf seine Schulter. »Der Neue. Das ist viel interessanter. Wann kommt der eigentlich?«
»Herr Bauer.« Die Stimme von Richterin Bach holte ihn in die Gegenwart. Sein Magen grummelte, ein Zeichen dafür, dass es Zeit zum Mittag war. Er stand auf und verließ den Besprechungsraum mit schweren Schritten. Die verblüfften Gesichter der anderen beachtete er nicht. Wenige Augenblicke später saß er in einem Büro und packte die Brote aus, die er vorbereitet mit sich trug. Ein Viertel tat er auf die Seite. Für die Enkelkinder. Hasenbrot war das Größte.
Heinz Bauer lebte in Windhausen, einem Dorf, das vielleicht drei Kilometer Luftlinie von der Teverener Heide entfernt lag. Obwohl der Braunkohleabbau in Garzweiler, den Grundwasserspiegel hat absinken lassen, besaß das Heidegebiet, immer noch, einen besonderen Reiz. Inwieweit die gefährlichen Fließsandlöcher noch existierten, hatte in den letzten Jahren niemand mehr ausprobiert. Zumindest musste die Feuerwehr nicht mehr ausrücken, um unvorsichtige Reiter, nebst Pferd, zu retten. Natürlich gab es noch Wasserflächen. Neben dem sandigen Boden überwog eine Tonschicht, die in Senken das Wasser ansammelte. Die darin vermodernden Pflanzen bildeten, in einem ewigen Kreislauf, die typische Hochmoorlandschaft.
Direkt an der Heide lag, in einer lang gezogenen Mulde versteckt, ein kleines Dorf. Circa neunhundert Einwohner. Jeder kannte jeden. Lediglich der Kirchturm ragte über den Rand der Senke, ansonsten wäre es fast unsichtbar.
Ein Straßendorf mit wenigen Seitenstraßen. Auf der einen Seite hinein und schon gelangte man auf der anderen Seite wieder nach draußen.
Die Menschen, das Dorf, die gesamte Gegend wurden von der Heide geprägt … von den Geschichten, die man auch heute noch erzählte. Nicht zuletzt gehörte das zu den Gründen, weshalb Oberkommissar Heinz Bauer in den Fall hineinstolperte, der vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde.
Dass er vorhin die Vergatterung, durch die Richterin, einfach verließ, lag nicht an der Missachtung des Verfahrens, sondern vielmehr in seinem Naturell begründet.
Seine Gedanken wanderten zu dem bizarren Fall, wie er ihn teilweise selbst erlebt hatte. Vieles, was die Bundesrichterin in den letzten beiden Tagen aufrollte, hörte er zum ersten Mal. Darüber war das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Vielleicht sollte er den Ruhestand doch ins Auge fassen. Aber der Zeitpunkt lag denkbar schlecht.
*
zwei
Leicht wogte der Morgennebel. Die Sonne drückte blutrot im Osten und malte ein farbenprächtiges Bild durch den Kiefernwald. Paul Grebner schlenderte gemütlich den Heideparkplatz entlang. Diesen Weg benutze er im Sommer fast täglich. Morgens begegnete er niemandem, sodass die Stimmung den Tag friedlich begann. Um diese Zeit röhrten die Maschinen der AWACS noch nicht. Aus der Heide heraus begrüßten ihn Vogelstimmen. Hier sang die Amsel noch kurz vor dem Morgengrauen und nicht zwei Stunden früher, wie in der Stadt. Selten lief ein Reh über den Weg. Seines Wissens gab es noch ein, zwei Rudel. In der kargen Landschaft wurden die Rehe nicht größer als Schäferhunde. Ab und an begegnete er einem Jogger. Heute lief er allein.
Nein. Doch nicht. Hinter der Umzäunung des Militärgeländes sah er schon Bewegung. Auch ein Kuriosum. Die NATO Air Base lag inmitten des Naturschutzgebiets. Manchmal stellte er sich die Frage, ob das Sperrgebiet die Natur, Tier und Pflanzen, schützte oder den Flughafen.
Den Spaziergang schloss Paul an diesem Morgen am Katharynensee. Dort drehte er eine Zigarette und ließ die Gedanken schweifen. Den kleinen See gab es schon ewig. Heute zauberte die Sonne spiegelnde Farbenspiele. Während rundherum Gewässer in den Kiesabbaugruben entstanden, fanden der Katharynenhof und der See schon im Mittelalter Erwähnung. Rechts nahm er eine Bewegung wahr. Unmutig stand er auf und blickte in den lichten Wald. Er wollte nicht gestört werden.
Ein leiser Ruf lenkte die Aufmerksamkeit dorthin. Dort kämpften zwei Menschen.
»Heh«, rief Paul. Das fehlte ihm noch. Aber tatenlos zusehen lag ihm nicht. Die beiden stoben auseinander und sahen zu ihm hinüber. Scheinbar Jogger. Sie trugen die Kapuzen ihrer Jacken über den Kopf gezogen. Die größere der Gestalten machte eine heftige Stoßbewegung und lief in den Wald hinein. Die andere Person sackte langsam zusammen und fiel nach hinten.
Paul stürmte zu dem Platz der Auseinandersetzung. Der Jogger lag wie tot am Boden. Er ging auf die Knie, um nach eventuellen Lebenszeichen zu suchen. Ein leises Rascheln ließ ihn herumfahren. Dann setzte der Verstand aus.
Mühsam kämpfte Paul mit der Dunkelheit und dem Dröhnen im Schädel. Allmählich verschwand der Nebel vor den Augen und er sah in das Sandloch, in dem sein Kopf steckte. Was war geschehen? Langsam kehrte die Erinnerung zurück. Der berühmte Schlag mit einem harten Gegenstand. So sagte man doch in den Krimis, wenn man einen Schlag mit dem Spaten oder einem Stück Holz über die Rübe bekam. Die dazugehörige Beule am Hinterkopf wurde wohl als Hämatom bezeichnet. Trotz der bescheidenen Lage grinste er wegen der blöden Gedanken. Er rollte aus der Bauchlage und sah tatsächlich den Jogger in der gleichen Haltung, wie vor dem Schlag auf seinen Kopf. Wie lange lag er hier weggetreten? Der Typ lebte hoffentlich? Das fehlte noch. Unter großer Kraftaufbietung stand er auf. Bis auf das Hämatom und dem leichten Schleier vor den Augen schien alles in Ordnung. Er sah zu der bewegungslosen Gestalt hinüber. Sie atmete. Gott sei Dank. Über dem Brustkorb lagen zwei Hügel, die sich hoben und senkten. Eine Frau oder ein Mädchen stellte er fest. An ihrer linken Seite, kurz unter dem Rippenbogen, machte ihm der dunkle Fleck, auf der Kleidung, Sorgen. Eifrig riss er an dem Stoff, um die augenscheinliche Wunde freizulegen. Keine Chance. Ein haltbares Kunstgewebe. Verdammt, fluchte er. Früher hatte er doch kein Problem damit, eine Frau auszuziehen. Er löste das Oberteil, das, mittels Klettverschluss, einen Overall bildete. Ein Messerstich. Unterhalb des Rippenbogens quoll stetig dunkles Blut hervor. Also keine Arterienverletzung. Vielleicht hatte die Fremde Glück? Er streifte sein Shirt über den Kopf und drückte es fest auf die Wunde. Umständlich zog er den Kapuzenpullover über ihren Kopf und wickelte, mit dessen Ärmeln, die behelfsmäßige Kompresse fest.
Paul bog den Rücken durch. Da stand er nun mit seinen knappen zwei Metern und wusste nicht, was er tun sollte. Wie immer lag das Handy zu Hause in irgendeiner Ecke. Die Verletzte benötigte Hilfe und alleine lassen ging nicht.
Paul lebte wie der typische Einzelgänger. Seit einer Krebsoperation vor wenigen Monaten durfte er nicht mehr arbeiten. Vierzig Jahre alt und nur noch ein halber Mensch. Manchmal unterlag er der Versuchung, in endlosem Selbstmitleid zu versinken. Aber es brachte nichts. Das Leben ging weiter. Immer wieder kroch er aus seinem Loch heraus. Erst seitdem er seine morgendlichen Spaziergänge unternahm, sackte er weniger häufig in depressive Phasen. Mittlerweile fühlte er sich körperlich fit und bekam den Eindruck, von Tag zu Tag kräftiger zu werden. Auf dem gebräunten Gesicht und um die blauen Augen lagen zahlreiche kleine Fältchen. Früher lachte er viel. Vielleicht kamen sie daher. Die Züge wiesen jungenhafte Verletzlichkeit aus. Die langen dunklen Haare lockten bis auf die Schultern. Die Jeans saß stramm und spannte über dem knackigen Hintern, den manche Frau mit begehrlichem Blick musterte. Die breiten Schultern mündeten in kräftigen Oberarmen. Die Brustmuskulatur trat unter der Last der Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, deutlich hervor. Was sollte er tun? Konnte er die Frau bewegen?
Er musterte die Verletzte. Sie war groß. Mindestens eins achtzig und sah, wie sie dort lag, sehr verletzlich aus. Ihre mittelgroße Brust stützte ein kräftiger Sport-BH mit einem breiten Stützrand. Deshalb die beiden Hügel, die ihm ihr Geschlecht verrieten. Die Beine waren lang und er vermutete, sehnig. Das Alter lag so um die dreißig oder jünger. Das Gesicht, im Moment farblos, wies nicht die klassischen Schönheitsmerkmale auf. Es mutete auf eine seltsame Art und Weise flach an, mit etwas schräg liegenden grauen Augen, in denen leichte Schleier lagen. Graue Augen? Gott sei Dank. Sie erlangte das Bewusstsein.
»Bleiben sie ruhig liegen. Sie sind schwer verletzt.« Er sprach die Verletzte so ruhig, wie möglich an.
»Wat is gebeurd?« Sie versuchte, sich aufzurichten.
Oh Scheiße, eine Holländerin. Paul erwartete wie die meisten im Grenzgebiet, dass Holländer Deutsch sprachen. Er verstand die Sprache, es reichte jedoch nie, sie selbst zu sprechen.
»Sie haben eine Stichverletzung und müssen so schnell wie möglich in ein Krankenhaus.« Sanft aber mit Nachdruck legte er ihr eine Hand auf die Schulter.
»Oh, een Duitser. Ja, der hat mich gestochen. Mit eine Messer.«
»Ein Bekannter von Ihnen?«
»Dat war Huub. Der wollte der Scheibe, die ich heb gevonden. Ich wollte sie nicht geben, da hat er …«, sie kniff die Augen zusammen und verzog das Gesicht. »Het doet pijn.«
»Klar tut das weh. Kann ich sie hier alleine lassen? Dann hole ich Hilfe. Oder haben sie ein Handy dabei?«
»Nein. Keine Handy. Hol keine Hilfe. Ich kann gehen.« Sie versuchte, aufzustehen. Paul wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Möglicherweise lagen innere Verletzungen vor. Dennoch half er ihr. Schmerzhaft verzog sie das Gesicht und in den Augen zuckten Punkte hin und her. Die Schmerzen schienen gewaltig. Mühsam unterdrückte sie eine weitere Ohnmacht und stand tapfer auf ihren Beinen.
Sie lehnte sich gegen ihn und drückte die behelfsmäßige Kompresse in ihre linke Seite. »Komm. Wir gehen.« Mit zusammengebissenen Zähnen setzte die Holländerin Schritt vor Schritt. Er stützte sie auf der unverletzten Seite. Jeder Schritt wurde sicherer.
Wenn jetzt jemand vorbeikommt, schoss ihm durch den Kopf, sind wir ein seltsames Paar. Beide mit freiem Oberkörper. Na ja, sie hatte zumindest ihren BH an.
Sie kamen zum Heideparkplatz. Kein Auto.
»Weg. Mein Auto ist weg.«
»Geklaut?«, fragte Paul.
»Ja. Es ist weg.«
»Warten Sie dort auf der Bank. Ich hole mein Auto. In zehn Minuten bin ich wieder hier. Kann ich Sie allein lassen?«
Sie nickte. »Mach schnell. Es tut weh. Keine andere Hilfe.«
»Klar«, er spurtete in Richtung Dorf. Was mag geschehen sein? Die Frau war sehr wortkarg und hatte nicht viel gesagt. Weshalb wollte Sie keine professionelle Hilfe? Die Polizei musste hinzugezogen werden, schließlich hatte dieser Huub zugestochen.
Nach wenigen hundert Metern ging ihm die Luft aus. Keine Kondition und zu viel Zigaretten. Das Herz schlug bis zum Hals und die Lungen schrien nach Luft. Er zwang sich zur Ruhe und in einen schnellen Wanderschritt. Zum wiederholten Male leistete er den Schwur, das Rauchen aufzugeben. Paul sah noch einmal zurück. Die Straße wies eine leichte Biegung auf. Der Parkplatz verschwand hinter einem Maisfeld. Links stand ein einsames Haus. Durch die Panzerstraße vom Dorf abgeschnitten. Sollte er dort nach Hilfe fragen? Aber nein … keine fremde Hilfe!
In weniger als einer Viertelstunde fuhr er mit dem alten Mazda 6 auf den Parkplatz. Na ja, er war gerade mal sechs Jahre alt. Sie saß nicht mehr auf der Bank. Suchend ließ er den Blick kreisen und entdeckte die zusammengesackte Gestalt an der Rückseite der Grillhütte. Sie stand mühsam auf und kam gebückt auf ihn zu. Das Shirt, das sie gegen die Wunde presste, war durchgeblutet. Schnell half er ihr ins Auto.
»Und jetzt? Wo wollen sie hin?«
»Ich weiß nicht.«
Na dann. Jetzt hatte er den Prassel hängen. Er fuhr vom Parkplatz auf die Kreuzung zu, die links zum alten Heideeingang und rechts in die Waldstraße ins Dorf hineinführte. Während er in die Straße, die zum Ortskern führte, einbog, tauchte der schwarze PKW im Rückspiegel auf. Wo kam der denn her? Auf dem Parkplatz hatte er niemanden bemerkt. Wahrscheinlich ein Pärchen, das unbefugt in der Heide seinem Vergnügen nachging. Das Auto kam rasend schnell näher. Schon wieder so ein Raser, dachte er. Die Straße wurde mehr und mehr zur Rennstrecke. Er fuhr hart rechts, um ihn vorbeizulassen. Der Fahrer machte jedoch keine Anstalten den Lenker einzuschlagen. Er fuhr mit voller Wucht hinten auf. Die Holländerin stieß einen spitzen Schrei aus und hielt ihre verwundete Seite.
»Scheiße. Der rammt uns.« Paul beobachtete das Fahrzeug. Der Jogger von vorhin saß hinter dem Steuer. Sein Fuß drückte zwangsläufig das Gaspedal durch und setzte damit den Kickstart des Automatikgetriebes ein. Der Mazda schoss wie eine Rakete nach vorn. Paul bot alle Fahrkünste auf, um den Dorfplatz zu umrunden, ohne in die Kübel der Verkehrsberuhigung, zu fahren. Er raste in die Scherpenseeler Straße. Das Grenzhaus wischte vorüber und schon bog er in Scherpenseel auf die Heerlener Straße ein. Ohne den Spiegel oder gar die Dreißiger Zone zu beachten, fuhr er in Richtung Grenze. Am Viehweg riss er den Wagen nach rechts und machte das Gleiche am Scheleberg. Auf Höhe des Sportplatzes hielt er an und wartete ab. Ihr Verfolger tauchte nicht auf.
»Er ist weg. Ich habe deinen Kollegen erkannt ... der, der dir das Messer in die Seite gesetzt hat«, sagte er vorwurfsvoll.
Sie antwortete nicht. Die Holländerin kauerte in der Ecke und hielt mit schmerzverzerrtem Gesicht die Seite.
»Das Auto gehört mir«, stellte sie fest.
Paul ging nicht auf die Bemerkung ein und schwieg verstockt die wenigen Minuten bis zu seinem Haus und fuhr durch den hinteren Weg zum Hof. Seine Ruhe war ihm heilig. Schon jetzt machte er sie für die Störung verantwortlich. Vor einem großen schmiedeeisernen Tor stoppte er das Fahrzeug und wartete ungeduldig, dass das Tor aufschwang. Verwinkelt ging es an den leer stehenden Stallungen vorbei bis ans Haus.
»Komm.« Er führte sie in die Küche und wies auf einen Stuhl. »Soll ich zuerst einen Kaffee machen oder nach der Wunde sehen? Blöde Frage«, sagte er mehr zu sich selbst.
»Erst Kaffee«, forderte sie jedoch und löste den behelfsmäßigen, schmierigen Verband. Die Wunde blutete nicht mehr. Aber wie sah es drinnen aus?
Die Kaffeemaschine lief. Paul holte den Verbandskasten und tastete mit spitzen Fingern die Einstichstelle ab. Er mochte nicht mit Blut in Berührung kommen und empfand leichten Ekel. Aber hier musste er ran. Ein glatter Stich. Circa drei Zentimeter breit. Er bot alles an Überwindung auf, was ihm zur Verfügung stand und säuberte vorsichtig den verletzten Bereich.
»Du musst zu einem Arzt. Möglicherweise ist ein inneres Organ verletzt.«
»Nein. Kein Doktor. Noch nicht.«
»Weshalb? Du kannst doch nicht mit einer Stichverletzung umgehen, als wenn du dir in den Finger geschnitten hast.« Paul geriet in Rage.
»Ich kann nicht.«
»Wirst du von der Polizei gesucht?«
»Noch nicht. Aber bald.« Sie sah ihn unergründlich an.
»Was hast du angestellt?«
»Ich habe etwas gefunden.«
»Jetzt lass dir nicht die Würmer aus der Nase ziehen.« Paul brauste auf und hätte fast seine Tasse fallen lassen, die er zum Tisch balancierte. Diese blöde Kuh. Retten durfte er sie, aber … »Erzähl mir, was los ist.«
»Ich bin Anthropologin in Den Haag. Wir haben ein Projekt hier im Limburgischen und suchen Artefakte der Kelten. In dieser Gegend haben Kelten gelebt, die landläufig unter Aduatuker und später als Eburonen bekannt wurden. Sie lebten circa 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung in diesem Gebiet bis nach Tongeren hinunter. Dort suchten wir bisher. Bis ich auf den Gedanken kam, etwas weiter östlich, also hier zu suchen. Meine jetzigen Schwerpunkte sind die Brunssumer Heide und hier, die Teverener Heide. Bei Kiesabgrabungen wurden in diesem Gebiet häufiger Gegenstände aus der Steinzeit und später gefunden. Ich habe die Geländeformationen studiert und einen Hügel gefunden, aus dem ich schloss, dass hier möglicherweise ein Keltengrab lag.
Maar, wat voor verhaal vertel ik u. Ik heb een schijf gevonden. Ongeveer zo groot. (Aber, was erzähle ich einen Roman. Ich habe eine Scheibe gefunden. Ungefähr so groß.)« Sie zeigte mit den Händen einen Durchmesser von ungefähr fünfzehn Zentimetern an. »Mein Mitarbeiter Huub wollte jedoch das große Geld machen. Ich versteckte die Scheibe. Beim Joggen heute Morgen versuchte er, von mir zu erfahren, wo der Fundort liegt. Die heb ik hem ook niet verteld (den habe ich ihm nicht verraten) – und auch nicht, wo die Scheibe ist. Das Artefakt ist aus reinem Silber und es sind, mir unbekannte Zeichen darauf, die ich nicht entschlüsseln kann. Falls ich jetzt dadurch nachweise, dass die Kelten eine Schrift besaßen, wäre es ein großer Sprung für meine Karriere.« Sie arbeitete sich während des Vortrages immer besser in die deutsche Sprache, bis nur ein leichter Akzent zurückblieb.
»Das ist kein Grund, dich mit dem Messer abzustechen. Und, warum keinen Arzt und keine Polizei?« Er funkelte sie misstrauisch mit den blauen Augen an.
»Ich meldete den Fund nicht, weil ich sehen wollte, was dort noch ist. Da bekomme ich Schwierigkeiten.« Sie saß zusammengesackt auf einem Stuhl. Immer noch, nur mit dem BH bekleidet. Er konnte nicht verhindern, dass sein Blick häufiger zu den Brüsten glitt. Sie war eine gut aussehende Frau. Jetzt, das Gesicht arbeitete voller Leben, strahlte es Intelligenz und Humor aus. Asiatischer Einschlag, Eurasierin, ging ihm durch den Kopf.
»Hier.« Paul warf ihr ein Shirt zu. Mit einer eleganten flüssigen Bewegung zog sie es über. »Was machen wir jetzt? Kann ich dich irgendwo hinbringen?«
»Ich bin zurzeit auf einem Campingplatz. Dort steht mein Wohnwagen. Nichts Großes. Nur so ein kleines Ei.« Sie zeigte vage mit den Händen eine imaginäre Größe. »Ich musste ja irgendwo ungestört arbeiten können. Immer noch besser, als ein Hotel.«
»Dann bleibst du besser ein paar Tage hier. Ich habe Platz genug.« Er wies mit der Hand die Treppe hoch.
»Danke. Das nehme ich gerne an. Ich bin Griet.« Sie reichte ihm die Hand.
»Paul.« Er schlug ein.
*
»Paul.« Die Hand auf der Schulter holte ihn aus tiefstem Schlaf. »Ich habe Schmerzen.«
Er schlug die Augen auf und sah im Dämmerlicht die nackten Beine der Frau, die er gestern in der Heide aufgelesen hatte. Tatsächlich so sehnig wie in seiner Vorstellung. Der Blick glitt nach oben. Sein Shirt. »Zieh dir was über. Wir fahren zum Krankenhaus.«
»Nein. Kein Krankenhaus. Eine Tablette.«
»Verdammt. Zieh dich an. In fünf Minuten fahren wir.« Er wurde wütend bei so viel Unvernunft.
Eine Viertelstunde später wurde sie im Krankenhaus behandelt. Wie sollte es anders sein, hatte sie keine Papiere. Paul hinterlegte seine Daten und nach endlosen Fragen wurde die Behandlung nach etwa zwei Stunden abgeschlossen.
*
»Hast du dein Mailkonto abgefragt?« Oberkommissarin Maria Roemer blickte auf den Monitor. »In der Nähe deines Dorfes hat es vorgestern eine Messerstecherei gegeben.«
»Hab ich noch nicht gesehen.« Heinz Bauer schaute desinteressiert hoch.
»In den Regionalnachrichten. Eine Holländerin wurde bei einem Streit durch einen Messerstich verletzt und von einem Samariter in deinem Nachbardorf gerettet. Die Verletzung wurde durch das Krankenhaus gemeldet.«
»Das ist das, was ich gerade hier habe.« Er hielt ein Blatt Papier hoch. »Dienstanweisung. Wir sollen uns die Sache ansehen.«
»Wir?«, fragte Maria empört. »Wir sind die Mordkommission. Haben die noch alle Tassen im Schrank?«
»Bleib ruhig. Ich fahre zwei Stunden früher nach Hause und hör mich um.« Oberkommissar Bauer blickte betrübt. Seine Kollegin hockte lieber vor dem PC, als dass sie nach draußen ging. »Ich mach dann dort Feierabend. Vielleicht hole ich eine halbe Stunde raus und nutze die Zeit mit den Enkeln etwas zu unternehmen.«
»Wenn du willst. Hauptsache ich muss nicht aufs Land.«
*
»Hier ist es.« Griet wies mit der Hand auf eine kleine Erhebung im Boden. Sie lag etwa in der Mitte zwischen Katharynensee und Kiefernsee.
»Wie kann ein Mensch hier ein Grab vermuten? Für mich ist das ein Haufen Steine und Dreck.«
»Ja meistens haben wir auch Pech. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird auch nur alle Zehntausendmal etwas gefunden. Ich hatte Glück – oder es ist Können.« Sie grinste spitzbübisch.
In den vergangenen beiden Tagen lernten sie sich ein wenig kennen. Griet stellte sich als angenehme lustige Unterhalterin heraus und hatte zu jeder Zeit, viel zu erzählen. Paul gelangte auch ab und zu in eine solche Phase, meist jedoch hielt er sich ruhig und in Gedanken gefangen. Sie drang nicht in ihn, sondern nahm ihn, wie er sich gab. Das fand er angenehm. Mittlerweile wusste er, dass sie kein asiatisches Elternteil besaß, wie er zunächst vermutete. Der Gesichtsschnitt, mit den etwas schrägen Augen kam aus dem Zweig ihrer Mutter. Sie schloss nicht aus, unter ihren Vorfahren, einen zur See fahrenden, Verwandten zu haben.
Ihre Kindheit und Jugend verbrachte Griet in Heerlen, also eine echte Limburgerin. Nach dem Abitur studierte sie in Amsterdam. Mehrere Jahre buddelte sie sich durch Europa, auf der Suche nach keltischen Überbleibseln, bis ihr die Dozentenstelle in Den Haag angeboten wurde.
»Wie willst du jetzt weitermachen? Hast du einen Plan?«
»Den Dreckhaufen, wie du ihn nennst, muss ich jetzt vorsichtig abtragen. Vermessen und fotografiert ist er schon. Das Erdreich siebe ich, damit nichts verloren geht.«
»Machst du das selber? Oder hast du Leute dafür? Mit deiner Verletzung kannst du einen solchen Job bestimmt nicht erledigen.«
»Normalerweise setzen wir Studenten meiner Uni ein oder Helfer, die wir anstellen. Aber hier muss ich alleine arbeiten. Sonst ist alles vergebens.«
»Hast du eine Genehmigung? Das hier ist ein Naturschutzgebiet und der Förster ein ganz schön scharfer Hund, wie man so sagt.«
»Leider nicht. Ich grabe heimlich.«
»Das geht nicht. Wir sind hier zwar abseits der Wege«, er ließ den Blick schweifen, »aber hier sieht man von überall ein.«
»Das habe ich bedacht und etwas vorbereitet. Geh bitte bis zum Weg dort hinten und schaue hier herüber.«
Gottergeben kroch er durch das Unterholz und erreichte nach einigen Minuten den Waldpfad. Als er sich umschaute, sah er nichts. Die Vegetation verbarg von dieser Seite den Einblick. So sehr er es versuchte, auf dem Rückweg machte er die Bodenerhebung nicht mehr aus. Ungefähr zehn Meter davor stolperte er fast in das Tarnnetz. Er kroch darunter hindurch und stand vor der grinsenden Anthropologin.
»Na. Was sagst du jetzt?«
»Perfekte Tarnung. Warum machst du es so geheimnisvoll? Deine Arbeit wird nur anerkannt, wenn du sie dokumentierst, und Zeugen hast.«
»Ja, das ist mir klar. Ich will es auch nicht allein machen. Die Sache mit Huub muss geregelt werden. Dann versuche ich, kompetente Hilfe zu bekommen. Ich weiß nicht weshalb, aber ich habe ihm die Fundstelle verheimlicht. Irgendein Gefühl verhinderte, sie ihm zu zeigen. Ich verstehe ihn nicht mehr. Er ist ein verträglicher und sehr hilfsbereiter Kollege. Es muss ihm jemand sehr viel Geld geboten haben. Im Moment kann ich sowieso nichts tun«, sie fasste an ihre verletzte Seite, die komplikationsfrei verheilte. Die Ärzte des Krankenhauses hatten gute Arbeit geleistet und die Wunde mit einigen Stichen verschlossen. Der Wundrand färbte sich nicht einmal rot. »Ich muss nach Den Haag, mit einem befreundeten Professor sprechen. Willst du mitzukommen? Du hast doch Zeit.«
Erschrocken schaute er sie an. Er lebte nun ungefähr ein dreiviertel Jahr, mit sich beschäftigt, zurückgezogen. Sollte er das aufgeben? Die letzten Tage gefielen ihm. Die Reste des Selbstmitleids bröckelten. Die, ansonsten um die Krankheit kreisenden Gedanken, fielen in sich zusammen. Im Grunde ging es ihm gut und er fühlte sich gesund. Er konnte alles tun. Zwar langsam und mit Überlegung, weil er sonst meinte, sein Unterbauch zerplatze, aber er konnte, wenn er wollte. Warum eigentlich nicht?
Sie beobachtete, wie er sein Gehirn zermarterte und las von seinem Gesicht, dass er eine positive Entscheidung traf.
»Klasse. Ich freue mich, dass du mit mir kommst.«
»Woher willst du das wissen?«
»Ich lese Gedanken. Nein, dein Gesicht ist wie ein Buch.«
»Na ja. Daran muss ich arbeiten. Wann geht es los?« Er grinste, wie ein übermütiger Junge.
Pauls Haus lag am Rande eines kleinen Dorfs. Idyllisch versteckte sich der Ort in einer langgestreckten Mulde. Im Winter ragten die Dächer heraus, die, die anderen Jahreszeiten mit Vegetation verbargen. Er liebte diesen Flecken und die Menschen. Vom Typ kamen sie Rheinländern am nächsten, also herzlich und doch eigenwillig. Zugezogene blieben ihr Leben lang Fremde, wenn sie nicht die ungeschriebenen Gesetze beachteten.
Paul arbeitete bis zum Beginn seiner Krankheit als Elektronikingenieur in Düsseldorf. Die Ehe ging nach acht Jahren zu Ende. Gott sei Dank hatte er keine Kinder aus der Verbindung. Vor fünf Jahren erbte er sein Elternhaus und hatte seitdem keine finanziellen Sorgen mehr. Den alten Bauernhof, in dem er die Kindheit und Jugend verbrachte, betrieb er als Hobby. Mit Liebe zum Detail ließ er ihn modernisieren und restaurieren. Seit drei Jahren lebte er, nach zehnjähriger Abwesenheit, wieder im Dorf.
Es fiel ihm schwer, Fuß zu fassen. Die alten Kontakte waren abgerissen und er hatte keine Lust, sie zu erneuern. So lebte er zurückgezogen und genoss die morgendlichen Spaziergänge. Natürlich traf er hier und da, den ein oder anderen. Doch mehr als Belanglosigkeiten tauschte er nicht aus.
Mit der agilen Holländerin kam Leben ins Haus. Am ersten Tag ihrer Bekanntschaft, also an dem Tag, wo sie verletzt wurde, bettete er sie am frühen Abend fürsorglich in einen Liegestuhl auf der Terrasse. Sie stießen mit Stubbis an und prosteten einander zu.
»Ich möchte dir eine Geschichte erzählen«, begann sie mit dem bezaubernden Akzent und wandte ihm das interessante Gesicht zu.
Paul nickte lediglich bestätigend.
»Du wirst mich für verrückt halten, aber aufgrund dieses jungen Kelten, von dem du jetzt hören wirst, wurde ich Anthropologin.« Sie schloss die Augen für einen Moment und musterte ihn geheimnisvoll. »Also dann … aber zuvor noch ein Satz von Caesar.«
*
drei
Griet erzählt:
»Den Druiden obliegen die Angelegenheiten des Kultus, sie richten die öffentlichen und privaten Opfer aus und interpretieren die religiösen Vorschriften. Eine große Zahl von jungen Männern sammelt sich bei ihnen zum Unterricht, und sie stehen bei den Galliern in großen Ehren.«
(Caesar: De bello gallico)«
Kendric der sechzehnjährige junge Mann wurde, seit dem zweiten Lebensjahr, von Labhruinn, dem Druiden, darauf vorbereitet, ein mächtiger Zauberer des Volkes zu werden, dem er angehörte. Labhruinn, ein finsterer Mann, flößte ihm mehr Angst als Respekt ein. Der Druide führte die Schule mit harter Hand. Die alt überlieferten Bräuche und Riten wurden getreu der Worte und Bewegungen gelebt und auswendig gelernt. Abweichungen und Interpretationen gehörten nicht zum Lehrplan. Labhruinn predigte, dass die Seelen der Menschen und die Welt unvergänglich seien. Durch Feuer und Wasser erneure sich alles. Die Menschen starben nicht, sondern lebten in ihren Verwandten weiter. Deshalb brauche auch niemand Angst zu haben, ehrenvoll im Kampf zu sterben. Er wurde wiedergeboren.
Kendric dachte eigene Gedanken. Hatte er doch häufiger erlebt, dass Labhruinn den Stamm, nicht selten mit einem kleinen Trick, auf seine Seite brachte. Die Menschen lebten in Angst vor ihm. Unbestreitbar stand Labhruinn mit den Göttern in Verbindung. Weshalb gebrauchte er dann Scharlatanerie? Er besaß ein Pulver, welches Nebel erzeugte, aus dem er, bei großen Festen, mit erhobenen Händen heraustrat. Der Stamm und auch alle anderen Menschen liebten ihn nicht. Der Druide lebte als notwendiges, aber geachtetes Übel unter ihnen.
Kendric gehörte mit der hochgewachsenen Gestalt zu den Größten des Stammes. Schlank wie eine Tanne, und trotz des jungen Alters mit tanzenden Muskeln auf dem Körper, wirkte er mehr wie ein Krieger, als ein angehender Druide. Aus dem ansprechenden Gesicht sahen kühle, auffallend blaue Augen auf die anderen nieder. Häufig spielte ein Lächeln um die Lippen, dessen er sich nicht bewusst war.
Heute ging er in den Wald. Nur zu diesem Vollmond im Jahr bestand die Möglichkeit, eine bestimmte Pflanze zu sammeln. Sie bewirkte einen Zauber. Zu Heffyn, dem Eichenfest, wurde daraus ein Trank zubereitet. Nur wenigen Menschen gestattete der Druide, diese Kräuter zu ernten. Sie wurden einem Ritual unterzogen, das sie reinigte. Er hatte davon jetzt noch die Striemen auf dem Rücken. Labhruinn schlug die bösen Gedanken mit Weidenruten aus ihm heraus. Kendric verschwieg mittlerweile immer häufiger, wenn er selbstständig dachte, auch auf die Gefahr hin, auf immer verdammt zu sein.
Doch Labhruinn ließ immer Vorsicht walten und reinigte auf Verdacht.
Falls Kendric heute die Zauberpflanze finden sollte, würde sie so oder so keine Wirkung haben. Als er am frühen Abend losging und nicht wie vorgeschrieben die Augen senkte, begegnete ihm Bronwyn, die fünfzehnjährige Tochter des Stammesführers. Sie warf ihm einen kecken Blick zu, der ihm bis in Fußspitzen fuhr. Der Verstand, eine besonders große Sünde, und sein Körper gerieten in Aufruhr. Von diesem Zeitpunkt an dachte er an nichts anderes mehr. Bronwyn stand vor seinem inneren Auge. Die Grübchen ihrer Mundwinkel lockten versprechend. Ihre schlanken Beine zeichneten sich unter dem Gewand deutlich ab.
Das Chaos in seinem Kopf lenkte ihn ab. Mit Macht versuchte er, die unreinen Gedanken zu verdrängen, aber es gelang ihm nicht. Nicht auszudenken, wenn der Energiefluss der Eiche durch seine fehlende Disziplin nicht auf die Menschen überging. Er störte das Gleichgewicht. Labhruinn würde ihn schlagen und unter Umständen verstoßen. Der Baum des Lebens hielt die Welt zusammen.
Er ließ sich auf dem Boden nieder und sammelte die Gedanken, wie er es gelernt hatte. Alles glitt von ihm ab. Sein Inneres wurde leer. Gott Cernunnos erschien ihm. Das mächtige Geweih wogte über dem Hirschkopf. Schemenhaft und schwerelos glitt das mächtige Tier durch den Wald. Die Konturen strahlten in hellem Licht. Kendric versank in den Augen des Traumtieres und folgte den Bildern, die sich einstellten. Vor ihm lag eine andere, unbekannte Welt. Die Anderwelt. Er machte den kurzen Schritt hinein, dorthin wo die mächtigen Geister über die Menschen wachten. Undurchdringliche Nebelwolken empfingen ihn. Ein Lichtstrahl drang aus der dunstigen Masse und ließ die Sterne zum Greifen nah erscheinen. Eine Spirale geriet in Drehbewegung und zog ihn hinein. Plötzlich stand er inmitten der Rotation der Planeten und erkannte ihre Umlaufbahnen. Die Zusammenhänge des Lebens offenbarten sich ihm. Alles gehörte zusammen. Die Bewegung der Planeten untereinander hielt die Welt zusammen. Sie stellte Gleichgewicht her. Die Sonne gab das Licht und die Kraft. Doch weit hinten, zwischen den vielen, vielen Sternen, lauerte eine weitere nebelartige Wolke, aus der, zwar undeutlich und verschwommen, ein Gesicht lauerte. Dort lockte das Böse.
»Kendric«, schreckte ihn die mächtige Stimme wie ein Donnerschlag aus der Betrachtung. Er erschrak nicht. Hier geschah ihm nichts. »Du hast den Schritt in die Anderwelt getan und damit Mut bewiesen, den andere Druiden bisher nicht aufbrachten.«
»Ich bin kein Druide. Ich muss noch viel lernen. Labhruinn sagte, ich werde es nie schaffen.«
»Labhruinn ist ein guter Mann und verlangt von seinen Eleven alles, was sie zu geben in der Lage sind. Dadurch stehen ihm alle Wege offen, die Geheimnisse für den Stamm zu nutzen und zum Besten anzuwenden.« Gott Cernunnos stand in Menschengestalt vor ihm. Jedoch mit dem riesigen Geweih versehen, das er vorhin schon als Hirsch trug. Gewaltige Kraft strömte aus den Augen des göttlichen Wesens auf ihn hinüber. Die Veränderung kam schneller, als sein Denkprozess ablief. Nicht körperlich. Sie geschah im Inneren. Bevor er den Gedanken zu Ende führte, saß er wieder auf dem Waldboden. Oder saß er dort immer noch? Er konnte es nicht sagen.
Zumindest wusste er nun, dass Labhruinn unrecht hatte. Die bösen Gedanken schadeten nicht. Das neue Wissen gab ihm Freiheit. Erleichtert erhob er sich und setzte den Weg fort. Die Stimmen des Waldes klangen anders als vorhin. Sie schwangen im Inneren und zeugten vom Gleichgewicht mit der Natur. Nach wenigen Minuten sah er die geheimnisvolle Pflanze, die für das Fest Heffyn benötigt wurde. Er sprach die überlieferten, komplizierten Worte und schnitt vorsichtig einige Zweige mit der heiligen Sichel ab. Sie wurde nur benutzt, um die heilige Pflanze zu schneiden.
Auf dem Rückweg wanderten die Gedanken zu dem alten Druiden des Dorfes. Er verstand nun dessen strenge Erziehung. Der wichtigste Sinn des Lebens lag darin, aus der Vergangenheit für die Gegenwart zu lernen. Der Zusammenhalt der Welt, das Überleben der Menschen hing davon ab. Seine künftige Aufgabe bestand nun darin, die Welt zu festigen und vor der fernen Erscheinung in der Anderwelt, zu schützen.
Labhruinn erwartete ihn am Eingang ihrer Siedlung und zog ihn zu seiner Hütte. Während der Stamm in einem Langhaus hauste, lebte der Druide seinem eigenen Refugium. Er schob Kendric hinein. Gemessen trat dieser in den halbdunklen Raum, der vom vollen Mond etwas Licht abbekam.
»Wo hast du die Pflanze?«, Labhruinn stand ungeduldig vor ihm. Die Hände zuckten wie Klauen aus dem dunklen Stoff des Gewandes.
»Hier«, Kendric hielt die Stängel hin.
»Was? Nicht mehr?«
»Das reicht«, kam die ruhige Antwort des jungen Mannes.
»Was erdreistest du dich?« Labhruinn stürzte auf ihn zu, die Hand zum Schlag erhoben. Mitten in der Bewegung hielt er inne. »Du warst in der Anderwelt«, stammelte er leichenblass.
»Ja. Ich habe mit Cernunnos selbst gesprochen.«
»Dann ist es also an der Zeit?«
»Ja. Ich denke schon.«
»Gehst du? Oder gehe ich?«
»Ich gehe.« Kendric sah ihn ruhig an. »Ich werde Bronwyn mitnehmen. Aber ich muss noch bis Beltane, dem Frühlingsfest, warten.«
»Das ist gut. Dann kann ich noch eine lange Zeit von dir lernen.«
»So sei es«, nickte Kendric und wandte sich ab, um zu gehen.
»Warte. Du kannst nicht mehr im Langhaus schlafen. Du bist geweiht.« Der Alte hielt ihn auf.
»Ich weiß«. Er ging hinaus.
*
»So. Erst einmal genug.« Griet unterbrach den Redefluss und hob die leere Flasche.
*
vier
»Oberkommissar Bauer.« Heinz hielt Paul Grebner den Ausweis hin. Den Mann kannte er.
»Professor. Komm rein.« Paul deutete in den Flur. Er nannte den Spitznamen des Oberkommissars, unter dem er im Dorf bekannt war.
»Klar«, sagte Heinz. »Paul … bei mir hätte es früher klingeln müssen.« Er kannte Grebner aus der Dorfkneipe, wo er nach Feierabend schon einmal ein Bier trank. »Ich bin dienstlich hier.«
»Das dachte ich mir. Möchtest du etwas trinken?«
»Danke. Du hast einer Holländerin, Griet van Houten, geholfen. Ich muss deine Aussage aufnehmen.« Er sah ihn fast entschuldigend an.
»Macht nichts. Ich habe, nach dem Krankenhausbesuch, damit gerechnet. Aber deine uniformierten Kollegen haben den Vorgang schon aufgenommen. Weshalb Kripo? Was willst du wissen?« Sie saßen im Esszimmer.
»Messerstecherei. Da sind wir auch zuständig. Also wie war es?« Heinz stellte sein altes Diktiergerät, das noch mit Kassetten arbeitet, auf den Tisch und schaltete es ein. Von dem neuen digitalen Kram hielt er nichts. Während Paul erzählte, nahm er die Atmosphäre der Wohnung auf. Weil das Haus von außen im alten Stil restauriert war, rechnete er an und für sich damit, dass das Innere antik aussah. Doch die typischen kleinen Zimmer, für diese Art Haus, gab es nicht mehr. Zumindest Parterre bildete einen großen Raum, von etwas mehr, als hundert Quadratmetern, aus dem eine freischwingende Treppe nach oben führte. Die Möblierung war eher karg und keiner Stilrichtung zuzuordnen. Heinz saß mit Blickrichtung zur Außenanlage, in die man über eine großzügige Terrasse gelangte. Kurz dahinter sah er den Saum der Heide.
»Ein Mann sagst du? Hast du den Namen?« Heinz hatte von der Krankheit Grebners gehört. Die Strapazen lagen immer noch auf seinem Gesicht. Ja … so eine Chemo ging nicht spurlos vorbei.
»Huub. Mehr weiß ich nicht.« Er hielt die Augen aufmerksam auf Heinz gerichtet. »Aber warum fragst du sie nicht selbst?«
»Werde ich noch tun. Oder meine niederländischen Kollegen, sobald wir eine Adresse haben.«
»Sie ist hier. Wusstest du das nicht?« Paul wirkte erstaunt. »Ich hab es deinen Kollegen gesagt.«
Heinz schüttelte lediglich den Kopf und stöhnte innerlich. Solch kleine Pannen passierten immer wieder, doch jedes Mal wurde sein Pulsschlag schneller.
»Huub Smeets«, sagte Griet van Houten wenig später. Sie hielt den Oberkörper ein wenig steif, ansonsten fiel ihre Verletzung nicht auf.
»Ein Kollege von Ihnen?« Heinz nahm ihre Gesamterscheinung auf. Eine große Frau, mit fast athletischem Körperbau und doch sinnlicher Ausstrahlung. Eine Figur, der fast jeder Mann einen zweiten Blick schenkte. Das sympathische Gesicht wies ungewöhnliche Merkmale auf. Nicht klassisch schön, jedoch ungemein anziehend. Nicht geschminkt, stellte er fest. Das dunkelbraune naturgelockte Haar reichte bis auf die Schultern.
»Ja. Wir arbeiten schon drei Jahre zusammen. Ich weiß nicht, weshalb er mich angegriffen hat.« Sie sprach fast akzentfreies Deutsch.
»Junge Frau. Niemand sticht jemanden einfach nieder. Zu einer solchen Tat gehören in der Regel zwei.« Sie versuchten es immer wieder, wenn sie befragt wurden. Dabei war klar, dass alles irgendwann auf den Tisch musste. »Hatten Sie Streit?«
»Wir haben gestritten. Ich weiß jedoch nicht weshalb.«
Heinz verdrehte die Augen. »Falls Sie nicht kooperieren, muss ich die niederländischen Kollegen einschalten. War es privat? Sind Sie mit Smeets liiert?«
»Ich? Mit Huub? Nein.« Sie schüttelte vehement den Kopf. »Wir haben ein Keltengrab entdeckt und unbefugt gegraben. Es gab Streit darüber, was wir mit den Grabbeigaben machen. Huub wollte verkaufen. Ich nicht.« Sie hatte mal gehört, dass man am besten ziemlich nah bei der Wahrheit blieb, wenn man etwas verschleiern wollte.
Das war möglich, wusste Heinz. In einem Streifen von Holland bis zum Niederrhein wurden immer wieder Keltengräber entdeckt. Seit seiner Kindheit verfolgten ihn die Geschichten um geheimnisvolle Druiden. Früher wurden sie ihm von seinen Eltern erzählt, heute gab er sie an seine Enkelkinder weiter. Doch anderseits wurde die Heide nach einigen Bränden, der letzte 1975, aufgeforstet, dort wäre ein solches Grab sicherlich entdeckt worden. Aber das wollte er zunächst beiseitelassen. »Welcher Art sind die Grabbeilagen?«
»Das Übliche. Krüge, also Geschirr und Münzen. Auf dem Schwarzmarkt gibt es dafür gutes Geld.« Sie verschwieg die künstlerisch gestaltete Scheibe.
»Melden Sie den Fund«, meinte er väterlich und schaltete das Diktiergerät aus. »Ich will nicht päpstlicher als der Papst sein. Wir werden Huub Smeets zur Fahndung ausschreiben.«
*
fünf
»Mein Zuhause.« Griet umfasste mit einer Handbewegung das geschmackvoll eingerichtete Zimmer. Hier gab es kein überflüssiges Möbelstück.
Vor wenigen Minuten stand er staunend vor dem alten Haus in der Paviljoensgracht. Griet schien kein Kind, armer Eltern zu sein. In der Nähe musste auch das Spinozahaus liegen, in dem der Philosoph bis zu seinem Tod gelebt hatte. Die Fassade war typisch holländisch. Schmal gebaut, mit kleinen Fenstern. Am Giebel ragte ein Balken heraus. Hier wurden die Möbel, die nicht durch das schmale Treppenhaus passten, hochgezogen und durch die Fenster ins Haus verbracht.
»Dort ist das Bad«, sie wies nach links. »Und dort oben kannst du dich einrichten«, sie zeigte nach rechts auf die Treppe. »Meine Schlafkammer ist unten und hier nach hinten heraus die Küche. Solch ein Haus ist neu für dich?«, lächelte sie. »Ich sehe es. Alles, was bei dir auf einer Ebene ist, verteilt sich hier über das ganze Haus. Aber ich liebe es. Komm, ich mache uns schnell einen Kaffee.«
»Was hast du als Nächstes vor?«, fragte Paul, der in einem Sessel lümmelte.
»Ich weiß noch nicht so genau. Aber warte mal.« Sie ging zur Wand und schob einen gerahmten Kunstdruck zur Seite, hinter dem ein Tresor zum Vorschein kam. Sie drehte an den beiden Rädchen, öffnete die Tür und griff zwischen einen Stapel Papiere.
»Hier.« Sie hielt ihm einen, in ein Tuch, gewickelten Gegenstand hin. »Guck dir das mal an. Ich werde mich eben umziehen. Ich habe keine Lust mehr, in deinen Klamotten rumzulaufen.« Sie trug immer noch Jeans und Shirt von ihm. Die Hose hatte sie umgeschlagen, denn, trotz ihrer Größe, passten die Sachen nicht.
Schon mehr als eine Woche war vergangen, seit er sie in der Heide aufgegabelt hatte. Es kam ihm wie gestern vor. Die Stichverletzung verheilte sehr gut. Sie hatte keine Bewegungseinschränkungen mehr, wie er feststellte.
Paul entfernte das Tuch von dem Päckchen und hielt eine ungefähr fünfzehn Zentimeter im Durchmesser messende, matt glänzende, Scheibe in den Händen. Ein Meisterwerk von unschätzbarem Wert. Wenn er nicht vorher von Griet gehört hätte, dass der Gegenstand mindestens zweitausenddreihundert Jahre alt war, hätte er ihn für eine industrielle Fertigung der Gegenwart gehalten. Nicht ein Hammerschlag verunstaltete die Oberfläche. Makellos und deutlich reihten sich Zeichen aneinander. Ehrfürchtig drehte er die Scheibe in den Händen.
»Was sind das für Zeichen?«, rief er in Raum.
»Ich weiß es nicht.« Sie kam von unten hoch und kämmte das schulterlange Haar. »Wir haben schon darüber gesprochen. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Kelten keine Schrift besaßen. Bisher gibt es zumindest nichts, was darauf schließen ließe. Sie benutzten hauptsächlich die lateinische Sprache, aber auch Griechisch. Es scheint fast unwahrscheinlich, dass sie eine eigene Schreibweise besaßen. Das passte nicht in ihre Lebensphilosophie. Sie glaubten, später, in einer anderen Person, weiterzuleben. Die wichtigen Dinge wurden von Druiden bewahrt und mündlich in den Generationen weitergegeben. Hinzu kam die sogenannte Anderwelt. Wie wir heute vermuten, der physikalische Bereich, also die Welt mit all ihren Planeten und Sonnensystemen sowie weiteren Geheimnissen. Ich verliere mich wieder …, wenn ich einmal anfange, höre ich nicht mehr auf«, sie hob entschuldigend die Schultern und grinste leicht.
»Mach nur weiter.« Er drehte die Platte in den Händen. »Ich finde es sehr interessant. Wer bekommt schon die Möglichkeit, von einer solch reizenden Dozentin, eine Vorlesung zu erhalten.«
»Mach mir später keinen Vorwurf. Ich will einfach nicht glauben, dass die Kelten keine eigene Schrift besaßen. Das und nichts anderes möchte ich beweisen. Ich bin wie besessen davon.« Sie umfasste seine Hände, die, die Scheibe hielten. Die grauen Augen blitzten und hypnotisierten ihn. »Dieses Teil hier wird mich weiterbringen. Das spüre ich genau. Immer wenn ich es in die Hände nehme, habe ich das Gefühl, mich zu erinnern. Ja, und das ist blöd, ich denke, ich habe die Scheibe in einem anderen Leben selbst gemacht. Nein, nein! Ich bin nicht verrückt. Ich sage ja, dass ich es selbst nicht glaube. Jedoch ist ein Teil der Keltenphilosophie die Wiedergeburt.«
»Es ist auch schwierig, zu glauben, dass du eine wiedergeborene Keltin bist. Du siehst so frisch aus.« Paul lächelte verhalten.
»Was höre ich da? Du baggerst mich an?« Grübchen zogen in ihre Mundwinkel. »Das ist verlockend. Aber im Moment ist mir nicht danach.«
»Dann versuche ich es später noch einmal.« Er nahm die Abfuhr gelassen. In den wenigen Tagen hatten sie einen Weg gefunden, ungezwungen miteinander umzugehen. »Was geschieht denn jetzt mit den Sachen, die wir aus dem Grab geholt haben?«
Im Verlaufe der Woche, kurz nach dem Besuch des Kriminalpolizisten, schlichen sie zur Heide. Griet wollte bergen, was ging, bevor hier Kommandos anrückten und das Gebiet sperrten. Sie legten das Grab vorsichtig frei, vermaßen es und schossen Hunderte von Fotos. Unglaublich, was sie zutage brachten. Kunstvoll gefertigte Schmuckstücke, irdene Töpfe, ein Schwert und römische Münzen, die fünfundsiebzig bis siebzig vor Christus datierten. Natürlich stammte auch die Silberscheibe aus dem Grab. Sie hatte Griet vorher mitgehen lassen.
In der Regel wurden solchen Gräbern nicht so üppige Gegenstände beigegeben. Neben dem normalen keramischen Urnengefäß, ein Schmuckstück. Die Person, die hier beerdigt wurde, schien etwas Besonderes.
Die Grabungen strengten an. Wenn sie nicht immer wieder eine kleine Scherbe oder ein Schmuckstück gefunden hätten, wäre es die langweiligste Arbeit gewesen, die Paul je verrichtet hatte. Griet gab nur Anweisungen und schoss Fotos. Dazu fertigte sie die Notizen, die, die jeweilige Fundstelle millimetergenau belegten. Die Wunde behinderte sie sehr. Die Artefakte lagerten nun verpackt in Pauls Keller.
»Ich muss zur Uni. Dort werde ich mit meinem Team das weitere Vorgehen besprechen.«
»Und Huub?«
»Das ist ein Problem, da hast du recht.«
»Ich muss mal für kleine Jungs.« Er stand auf und ging zur Toilette. Gedankenlos nahm er die silberne Platte mit. Mitten im Geschäft drang gewaltiger Krach ins Bad. Die erste Reaktion, nach draußen zu stürzen, unterdrückte er. Vorsichtig lugte er durch die Tür in den Raum. Drei Männer. Einer hielt Griet an den Armen und redete auf sie ein. Holländisch, aber so schnell, dass er es nicht verstand. Sie antwortete ebenso temporeich und wirkte wütend, jedoch nicht ängstlich. Die Person, links von ihr, ohrfeigte sie.
»Raus mit der Sprache. Wo ist die Silberscheibe? Wir bekommen es sowie aus dir heraus.« Ein Deutscher. Er schlug wieder zu.
»Ich habe sie nicht. Huub hat sie. Er hat sie mir weggenommen.«
Der Schläger sah zu Huub hinüber. Der schüttelte den Kopf.
»Nee, ik heb hem niet. Zij is slim en wil ons tegen elkaar uitspelen (Nein, ich habe sie nicht. Sie ist clever und will uns gegeneinander ausspielen).« Er ging auf sie zu und trat gegen das Schienbein.
Griet fiel mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und rutschte aus dem Griff, der sie hielt.
Paul nutzte den Augenblick und fegte aus dem Badezimmer. Er trat dem Deutschen mit voller Wucht gegen die Wirbelsäule, der daraufhin mit einem Aufschrei zu Boden ging. Mit der gleichen Bewegung schlug er Huub die Fäuste in den Nacken. Den Dritten hielt Griet im Schwitzkasten. Paul trat ihm seitlich gegen Kopf.
»Los komm, wir verschwinden.« Er packte sie am Arm.
»Hast du die Scheibe?«
»Nein. Sie ist im Bad.«
Griet stürmte ins Bad und dann weiter die Treppe hinunter. Paul trat dem Deutschen, der mit den Beinen strampelte, noch einmal vor den Kopf und verschwand ebenfalls.
»Wohin?«, fragte Griet, die hinter dem Steuer saß. Sie fuhr einfach los.
»Zu mir nach Hause. Ich denke nicht, dass sie uns dort vermuten. Sie wissen hoffentlich nicht, wer ich bin.«
»Ich habe nichts bemerkt. Sonst knarrt die Treppe, du hast es selbst gehört. Ich verstehe nicht, wie sie uns so überraschen konnten.«
Sie befuhren die Autobahn nach Rotterdam und über Antwerpen und Heerlen.
»Was sollte das jetzt?«, fragte Paul, nach einiger Zeit auf der Autobahn. »Tut dein Gesicht weh? Oder dein Schienbein? Die haben ja ordentlich zugelangt.«
»Es geht. Die Stichverletzung schmerzt schlimmer.«
»Soll ich fahren?«
»Nein. Es verschafft mir Ablenkung. Die wollten die Scheibe. Ich weiß nicht, warum sie mit solcher Gewalt agieren. Auf dem Schwarzmarkt bekommt man einiges dafür. Jedoch nicht so viel, als dass sich dieser Einsatz lohnte. Da steckt noch etwas anderes dahinter. Übrigens. Vielen Dank für deine Hilfe.«
»Habe ich gern getan. Es wurde Zeit, dass ich aus meinem Loch herauskam. Ich hatte ganz ordentlich Bammel. Aber es funktionierte. Ich wusste nicht, dass ich so viel drauf habe.« Er grinste stolz und rieb die Fäuste. »Was meinst du damit, dass da noch etwas anderes dahinter steckt?«
»Nur ein Gefühl. Ich muss darüber nachdenken. Da ist etwas, das ich nicht packen kann.«
»Ich spreche mit einem Bekannten, der bei uns im Dorf lebt. Ein seltsamer Kauz, jedoch in Geschichte ungemein beschlagen. Wenn er erzählt, habe ich den Eindruck, er sei selbst dabei gewesen.«
»Versuchen wir es. Vielleicht bringt es etwas. Wir wissen so wenig über die Kelten, da ist jeder Hinweis wichtig.«
Es dunkelte, als sie auf Pauls Hof fuhren. Im Haus hatte sich nichts verändert, das sah er sofort. Also wussten die Ganoven scheinbar nichts von ihm.
»Kann ich mein altes Zimmer wieder haben?« Griet lächelte. Ihm wurde flau in der Magengegend.
»Sicher«, brachte er heraus. Die sanfte Abfuhr in Den Haag hatte er nicht vergessen.
»Gut. Dann mache ich mich jetzt mal frisch.«
»Ich fahre nach Teveren zum Griechen und hole etwas zu essen.«
*
Sie saßen am Tisch und schauten sich abwartend an. Griet und Paul an der einen sowie auf der anderen Seite der Kauz und eine junge Frau, die Paul vom Sehen kannte. Sie lebte abseits des Hügels, der die Senke des Ortes abschloss. Sie oder ihre Eltern besaßen das mit Abstand größte Anwesen im Dorf. Das Alter der Frau lag um die Zwanzig. Sie trug lange blonde Haare und sah ihn mit den blauesten Augen, die ihm je unterkamen, an. Die gleichen ungewöhnlichen Augen, wie bei dem Alten. Von beiden ging Charisma aus, bei dem sich die Härchen auf den Unterarmen aufstellten.
Der Mann schien, bei näherer Betrachtung, in mittleren Jahren.
Griet musterte ihn von der Seite. Ungewöhnlich, er sieht aus wie ein Neandertaler, dachte sie. Vielleicht eine Genveränderung? »Ich bin Griet«, sagte sie in ihrer unkomplizierten Art, »Paul ist euch bekannt ... denke ich doch.« Sie sah ihn an.
»Wir begegneten uns hier und da.« Er nickte zu der jungen Frau hinüber. »Mit Arget unterhielt ich mich einige Male.«
»Ich bin Kyra. Du wohnst im Haus an der Heide«, stellte sie fest.
»Genau. Ich bin vor einigen Jahren wieder ins Dorf gezogen.«
»Paul, du wolltest mich zu einer wichtigen Angelegenheit sprechen«, unterbrach Arget, als wenn er keine Zeit habe. Er steuerte direkt aufs Ziel. »Nachdem, was du mir erzähltest, bat ich Kyra, dem Gespräch beizuwohnen. Ich muss ehrlich sagen, aus deinem Kauderwelsch bin ich nicht schlau geworden. Sie weiß viel mehr als ich. Wenn jemand euch helfen kann, dann sie.« Er sprach mit seltsamem Akzent, den Griet nicht lokalisieren konnte. Nein! Vielmehr schien es so, als müsse er mühsam Worte formen. Doch es geschah so schnell und automatisch, dass es kaum auffiel.
»Ihr habt einen Keltenschatz entdeckt? Na ja, zumindest …, das hat Arget verstanden. Ich möchte euch helfen.« Kyra lächelte und ihre Augen musterten sie zwingend. »Über meine Qualifikation reden wir später.«
»Genau. Griet hat ein Keltengrab gefunden.« Paul sah vorwurfsvoll zu Arget, der ohne Absprache dieses Mädchen hinzuzog. »Es ist jedoch anders, als es im Moment scheint. Sie ist Anthropologin an der Universität in Leiden, also Den Haag und …, indem sie einer falschen Person vertraute, zwischen die Fronten dubioser Gestalten geraten.«
»Das weiß Kyra. Ich habe ihr erzählt, was du mir sagtest. Vertraue ihr, wie mir.« Argets zerklüftetes Gesicht wandte sich ihm zu. Er runzelte die fliehende Stirn.
»Ich dachte, du hast nichts verstanden«, entgegnete Paul.
Fasziniert betrachtete Griet, mittlerweile ungeniert, den Kauz. Sie konnte sich nicht losreißen. Eine Ahnung überkam sie. In Argets Augen erschien ein spöttisches Funkeln. Er rückte seine Figur in Positur, legte die überlangen Arme auf den Tisch und betonte dadurch den Buckel, den er hatte. »Ich denke, das Wichtigste ist die silberne Scheibe … oder eben ein Teller? …, die ihr gefunden habt. Darf ich sie sehen?«
»Gern.« Griet reichte ihm die silberne Platte über den Tisch. »Ich hoffe, dass diese Zeichen die Existenz einer keltischen Schrift belegen.«
Arget und Kyra tauschten einen erstaunten Blick, als sie den Gegenstand sahen. Vorsichtig nahm Arget das Relikt und vertiefte den Blick auf die Oberfläche. Nach einer schier endlosen Zeit, so erschien es Griet, stand er auf und wanderte hin und her. Von diesem Augenblick an interessierte Griet der Keltenfund nicht mehr. Sie sah nur noch Arget ... und der war kein Mensch. Aber was? Etwas, dass sie kannte, jedoch nicht festmachen konnte. Die sehr langen Arme schlenkerten am Körper und der Gang sah unbeholfen und wiegend aus. Mit einer Hand federte er die Schaukelbewegungen des Körpers auf dem Boden ab. Ihre Gedanken glitten zum Gesicht. Was sie für eine fliehende Stirn hielt, gab es nicht. Anstatt der Nase befanden sich zwei Löcher in seinem Gesicht. Ein breitflächiges Antlitz ohne sichtbares Kinn. Das Gesicht war nicht geschaffen, um Gefühle zu zeigen. Aber sie sah die tiefe Nachdenklichkeit und den Ernst seiner Gedanken. Er trug Jeans und ein Shirt, das über den Oberkörper spannte.
Arget hielt inne und reichte das Artefakt wortlos an Kyra. Sie nahm die Scheibe und legte sie auf den Tisch. Sie sah sie nicht an, sondern beobachtete ihn.
»Was wisst ihr von den Kelten?«, fragte Kyra und runzelte nachdenklich die Stirn.
»Nicht so viel, wie wir es uns wünschten. Vieles liegt im Dunkeln, weil sie scheinbar keine eigene Schrift besaßen. Zumindest haben wir nichts in der Art gefunden. Wir sind auf die Berichte der Griechen und Römer angewiesen. Also aus zweiter Hand und dadurch subjektiv aus deren Betrachtungsweisen und Kultur.« Griet beugte sich vor und betrachtete Kyra aufmerksam. »Wir vermuten, dass sie, wie kein anderes Volk, die Naturwissenschaft – also nicht nur die Natur – mit ihrem Glauben verwoben.«
»Du vermutest. Nicht ich. Denk doch mal daran, welche Schwierigkeiten Kopernikus oder Galilei beim Beweis ihrer Thesen bekamen. Und mehr als fünfzehnhundert Jahre früher erfindest du ein Volk, das Naturwissenschaften kultiviert«, warf Paul bissig ein.
»Ja genau«, gab sie giftig zurück. »Wie konnten die Ägypter ihre Pyramiden bauen und die Griechen sowie die Chinesen schon um 500 vor Christus mathematische Formeln entwickeln? Ebenso unwahrscheinlich muss es für dich sein, dass alle gefundenen Externsteine der Kelten genau nach den Gestirnen ausgerichtet sind.«
»Ist ja gut«, erwiderte Paul zerknirscht und hob abwehrend die Hände. Er hatte sie noch nicht mal ins Bett bekommen und schon maßregelte sie ihn, wie einen Ehemann.
»Die Kelten dachten monistisch, sie sahen die Welt ihrer Zeit als einzelnes Ganzes. Die Anderwelt, die für sie existierte, musste eine – wie das Wort sagt – andere sein. Für uns: die außerhalb existierende Welt. Das Universum oder etwas, das wir noch nicht kennen. Für die Kelten war die Anderwelt ein Bestandteil ihrer Welt. Hier stellt sich die Frage, inwieweit und vor allen Dingen, mit welchen Mitteln der Kontakt in diese andere Ebene, sofern einer bestand, stattfand. Ja, ja Paul. Ich weiß, was du jetzt denkst. Mit Himmel und Hölle des christlichen Glaubens hat das nichts zu tun. Wie der Name schon sagt: Glaube, also nicht wissen. Die keltische Welt, vor allem die der Druiden, wandte Physik an. Belegbare Wissenschaft.«
»Worauf willst du hinaus?«, fragte Paul. Kyra und Arget hörten sichtlich aufmerksam zu.
»Ich wollte dir deutlich machen, dass Kelten durchaus in der Lage waren, den physikalischen Bestandteil der Anderwelt zu erkennen. Also die Sterne und sogar das Sonnensystem mit den damals bekannten Planeten. Jetzt aber zu dem, was mir persönlich wichtig ist. Die überwiegende Mehrzahl der Wissenschaftler, die sich mit meinem Fachgebiet beschäftigen, ist der Ansicht, dass die Geisteshaltung des Volkes, eine Entstehung einer eigenen Schrift verhinderte. Überlieferungen wurden von den Druiden gesammelt und weitergegeben. Wenn der Mensch verschied, starb er nicht. Er lebte später weiter. Damit will ich mich nicht abfinden. Es muss irgendetwas Schriftliches geben.«
»Die Kelten haben nie die Frage nach dem Übersinnlichem gestellt. Sie sahen ihr Leben als etwas Werdendes, also bestand kein Ansatz, die Vergangenheit schriftlich zu überliefern«, sagte Kyra.
»Das ist richtig. Aber weshalb sollten sie sich der griechischen oder lateinischen Schrift bedienen? Mir ist bekannt, dass die Sprache der Kelten eine fast magische Bedeutung hatte und als göttliche Kunst gesehen wurde. Nicht umsonst hatten sie mit Ogma einen eigenen Gott der Beredsamkeit. Und auch das keltische Alphabet der Iren, Ogham, stammt wahrscheinlich, der Bezeichnung nach, von dieser Gottheit.«
»Die Sprache besaß nicht nur eine magische Bedeutung. Sie war vielmehr, gesellschaftlicher Ausdruck. Bei den Kelten wurde lediglich das unmittelbar Gesprochene anerkannt. Es mussten Normen eingehalten werden. Ja, die Sprache wurde sogar codiert«, warf Kyra ein.
»Das ist mir bewusst«, Griet funkelte sie kampflustig an. »Es ist aber doch auch so, dass die Druiden von diesem Tabu ausgenommen wurden. Warum sollten sie fremde Alphabete benutzen? Für Händler gilt dies ebenso.«
»Gut. So könnte die Diskussion jetzt stundenlang weitergehen.« Arget unterbrach selbstbewusst das Gespräch. »Ich denke ebenso wie Griet. Es ist nicht zu glauben, dass ein Volk, mit einer solchen Philosophie, nicht in der Lage gewesen sein soll oder es gar bewusst unterdrückte, Schriftliches zu fixieren.«
»Ja denkst du denn, ich glaube das nicht«, fuhr Kyra Arget an. »Ich finde, Griet vertritt ihren Standpunkt gut.«
»Was sollte das Ganze dann? Ist das ein Test?« Paul folgte erstaunt dem Wortwechsel.
»Nein«, versicherte Kyra eilig. »Aber es ist seltsam, dass du dich an Arget wendest und ihm eine haarsträubende Geschichte von Grabräuberei und dubiosen Gaunern erzählst. Wärest du nicht auch misstrauisch? Wir kennen euch nicht.«
»Wir euch auch nicht. Aber ich verstehe eure Zurückhaltung«, meinte Griet. »Die Geschichte ist schon sehr abenteuerlich. Aber nun zu unserem Fund«, sie nickte zum Tisch, auf dem die silberne Scheibe lag. »Könnt ihr uns dazu etwas sagen? Ich hatte vorhin den Eindruck, als habt ihr euch darüber verständigt. Es ist nur so ein Gefühl.«
»Du beobachtest gut.« Arget grinste. Das Gesicht zog dabei eine fürchterliche Grimasse und sah dennoch liebenswert aus. »Wir stimmten uns wirklich ab. Ein Blick genügte. Nun zu eurer Scheibe. Ich deute die Symbole tatsächlich als Schriftzeichen. Jedoch wird es so gut wie unmöglich sein, sie zu entziffern. Falls diese Zeichen tatsächlich von den Kelten stammen, sind sie verschlüsselt, wie ihre Sprache.«
»Und? Was tun wir jetzt?« Paul stand die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben.
»Falls ihr uns vertraut, lasst uns das Ding hier und wir untersuchen es genauer.« Kyra sprach Griet an, die Paul einen Blick zuwarf, der zustimmend nickte.
»Gut. Bei euch ist der Fund im Moment besser aufgehoben. Wer weiß, was uns noch bevorsteht.«
Kyra und Arget begleiteten die beiden zur Tür. Griet blieb draußen stehen und zeigte auf die Bäume, in deren Mitte eine Quelle entsprang.
»So gewaltige Birken habe ich noch nie gesehen«, stellte sie fest.