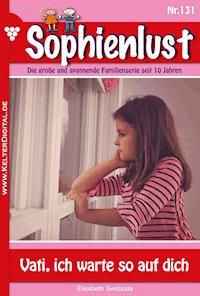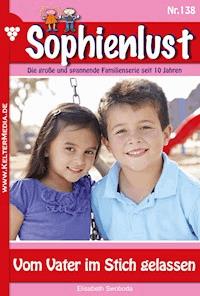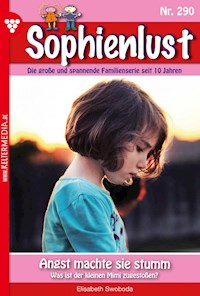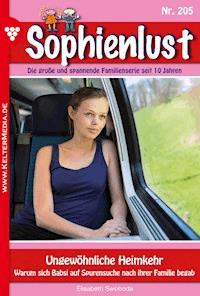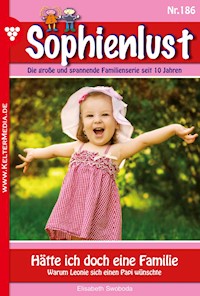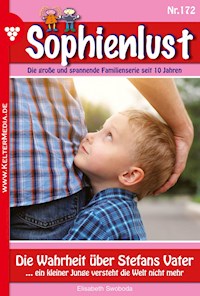
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. »Nein, ist hoffnungslos. Kann nicht mehr gesund werden«, flüsterte eine fremde Stimme in gebrochenem Deutsch. »Aber … wollen Sie damit andeuten … Soll das heißen, dass sie …, dass sie sterben muss?«, fragte eine zweite Stimme, die lauter und aufgeregt klang und der Kranken irgendwie vertraut vorkam. Ilse Reiter wartete auf die Antwort der ersten Stimme, die ihr ungeheuer wichtig vorkam, ohne dass sie genau wusste, warum. Doch es kam keine Antwort. Schweigen lastete in dem Raum, das nur hin und wieder von einem leisen Schluchzen unterbrochen wurde. Ilse Reiter bemühte sich, ihre Augen zu öffnen. Es fiel ihr unsagbar schwer, aber es gelang ihr schließlich. Trotzdem konnte sie ihre Umgebung nicht wahrnehmen. Graue Nebelschwaden wallten auf sie zu und schienen ihr das Atmen zu erschweren. Ein undefinierbarer Druck lastete auf ihrer Brust. Sie wollte sich bewegen, aufstehen, weggehen, aber das war unmöglich. Was war nur geschehen? »Ich träume. Es ist ein Alptraum«, murmelte sie kaum vernehmbar. Plötzlich sah sie, dass sich ein bekanntes Gesicht über sie beugte. Es war nur durch einen dünnen Schleier von ihr getrennt. »Martha?«, flüsterte die Kranke fragend. »Martha, wo kommst du her? Wo bin ich? Was ist denn los?« Martha Kern war nicht imstande, der Kranken eine Antwort zu geben. Sie schüttelte nur verzweifelt den Kopf, während Tränen über ihre Wangen flossen. »Martha, so sag mir doch, was passiert ist!«, flehte die Kranke. Obwohl sie noch immer nicht völlig bei Bewusstsein war, war ihr doch klar geworden, dass es sich nicht nur um einen bösen Traum handelte. Nein, das hier war Wirklichkeit,
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 172 –
Die Wahrheit über Stefans Vater
… ein kleiner Junge versteht die Welt nicht mehr
Elisabeth Swoboda
»Nein, ist hoffnungslos. Kann nicht mehr gesund werden«, flüsterte eine fremde Stimme in gebrochenem Deutsch.
»Aber … wollen Sie damit andeuten … Soll das heißen, dass sie …, dass sie sterben muss?«, fragte eine zweite Stimme, die lauter und aufgeregt klang und der Kranken irgendwie vertraut vorkam.
Ilse Reiter wartete auf die Antwort der ersten Stimme, die ihr ungeheuer wichtig vorkam, ohne dass sie genau wusste, warum. Doch es kam keine Antwort. Schweigen lastete in dem Raum, das nur hin und wieder von einem leisen Schluchzen unterbrochen wurde.
Ilse Reiter bemühte sich, ihre Augen zu öffnen. Es fiel ihr unsagbar schwer, aber es gelang ihr schließlich. Trotzdem konnte sie ihre Umgebung nicht wahrnehmen. Graue Nebelschwaden wallten auf sie zu und schienen ihr das Atmen zu erschweren. Ein undefinierbarer Druck lastete auf ihrer Brust. Sie wollte sich bewegen, aufstehen, weggehen, aber das war unmöglich. Was war nur geschehen?
»Ich träume. Es ist ein Alptraum«, murmelte sie kaum vernehmbar.
Plötzlich sah sie, dass sich ein bekanntes Gesicht über sie beugte. Es war nur durch einen dünnen Schleier von ihr getrennt.
»Martha?«, flüsterte die Kranke fragend. »Martha, wo kommst du her? Wo bin ich? Was ist denn los?«
Martha Kern war nicht imstande, der Kranken eine Antwort zu geben. Sie schüttelte nur verzweifelt den Kopf, während Tränen über ihre Wangen flossen.
»Martha, so sag mir doch, was passiert ist!«, flehte die Kranke. Obwohl sie noch immer nicht völlig bei Bewusstsein war, war ihr doch klar geworden, dass es sich nicht nur um einen bösen Traum handelte. Nein, das hier war Wirklichkeit, schreckliche Wirklichkeit. Sie lag in einem fremden Bett, das in einem fremden Zimmer stand.
Bei dem angestrengten Bemühen, sich zu erinnern, runzelte Ilse die Stirn. Wo befand sie sich? Wieso war Martha bei ihr und weinte? Martha hatte sie doch zusammen mit Stefan zum Flugplatz begleitet. Stefan hatte ihnen nachgewinkt. Er war ein wenig traurig gewesen, weil er nicht hatte mitkommen dürfen. Er hatte ihr leidgetan. Im letzten Augenblick hatte sie bereut, dass sie und ihr Mann beschlossen hatten, Stefan bei seiner Schwester zu lassen. Aber Erwin war der Meinung gewesen, dass Stefan noch zu klein für eine Flugreise sei und dass ihn der Urlaub in Griechenland nur langweilen würde. Natürlich hatte Erwin recht gehabt – und sie hatte nachgegeben und ihren Sohn der Schwägerin anvertraut. Aber wieso war Martha plötzlich hier?
»Wo ist Stefan?«, fragte Ilse mit schwankender Stimme.
»Er ist zu Hause. Es geht ihm gut. Ich konnte ihn doch nicht hierher mitnehmen?«, erwiderte Martha.
Hierher? Was meinte Martha damit? Es gelang Ilse nicht, ihre Gedanken zusammenzuhalten. Sie flatterten davon und ließen nur eine öde Leere in ihrem Kopf zurück. Ilse schloss die Augen, doch die angstvollen Rufe ihrer Schwägerin riefen sie noch einmal ins Bewusstsein zurück.
»Ilse! Ach, Ilse, was soll ich nur machen? Ach, wenn nur dieses entsetzliche Unglück nicht geschehen wäre!«
Ein entsetzliches Unglück? Wovon sprach Martha eigentlich? Wenn sie nur endlich gehen und sie schlafen lassen würde.
»Ilse! Bitte! Du darfst nicht … Du darfst uns nicht verlassen, hörst du mich?«
Verlassen? Wieso verlassen? Sie war doch nur mit Erwin in den Urlaub gefahren. An den Abflug konnte sie sich noch genau erinnern. Da war Stefans rührende kleine Gestalt gewesen, das weiße zerknitterte Taschentuch, das er fest umklammert hatte, um seinen Eltern damit zu winken.
Und dann hatte sich das Flugzeug vom Boden abgehoben. Erwin hatte nach ihrer Hand gegriffen und sie fest gedrückt. »Endlich ist es so weit«, hatte er ihr zugeflüstert. »Seit Jahren freue ich mich auf diesen Moment. Der erste gemeinsame Urlaub seit unserer Hochzeitsreise.«
»Aber Stefan …«, hatte Ilse zögernd eingewandt.
»Martha wird gut für ihn sorgen …« Aus dem Zusammenhang gerissen hämmerten diese Worte in Ilses Gehirn. Ihre Sinne umnebelten sich wieder. Es war ihr nicht möglich, klar zu denken. Martha war hier, wusste sie, sie saß neben ihrem Bett, aber wieso? Und wo war Erwin? Er sollte doch bei ihr sein. Er war immer da, wenn sie ihn brauchte. Wo war er jetzt?
»Erwin?«, hauchte die Kranke ängstlich fragend.
Martha rang um Beherrschung, aber sie konnte nicht verhindern, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen. Als Antwort auf Ilses Frage schüttelte sie nur stumm den Kopf.
Die Blicke der Kranken waren inzwischen etwas klarer geworden. Sie wanderten in dem kahlen Raum umher, glitten über die hellgrün gestrichenen Wände und blieben am Fußende des Bettes hängen.
»Ein Krankenhaus. Ich liege in einem Krankenhaus«, murmelte Ilse. Sie brauchte Marthas Bestätigung nicht mehr abzuwarten, mit einem Schlag war die Erinnerung zurückgekehrt. Es nützte nichts, sie zu verdrängen. Die schrecklichen Sekunden, als das Flugzeug bei der Landung über die Landebahn hinausgerollt und zerschellt war, waren fest in ihr Gedächtnis eingebrannt. Sie vermeinte von Neuem das Krachen und die Schreie zu vernehmen. Dann war ein plötzlicher Schmerz dagewesen, und sie hatte das Bewusstsein verloren.
»Erwin. Ist er …, ist er tot?«, fragte Ilse.
»Nein. Aber sein Zustand ist …« Martha brach ab. Irgendetwas in ihr weigerte sich, das Wort hoffnungslos auszusprechen. »Er ist noch nicht zu sich gekommen«, sagte sie stattdessen.
Ilse schwieg, und Martha wusste nicht, was sie sagen sollte. Einen Tag nach Bekanntwerden des Unglücks war sie nach Athen geflogen. Es hatte weitere vierundzwanzig Stunden gedauert, bis man sie zu ihrer Schwägerin gelassen hatte. Einen Besuch bei ihrem Bruder hatte man ihr verweigert. Sie hatte eine deutsch sprechende Krankenschwester aufgetrieben, und diese hatte schließlich ihrem Drängen nachgegeben und sie mit Erlaubnis des Arztes in Ilses Zimmer geführt. Vorher hatte ihr die Schwester jedoch alle Hoffnungen, die sie noch gehegt hatte, genommen. Erwin Reiter lag im Sterben – und seiner Frau ging es nicht viel besser.
Nach dem ersten Blick, den Martha auf Ilse geworfen hatte, hatte sie erkannt, dass die Krankenschwester nicht gelogen hatte. Ob ihre Schwägerin ahnte, wie es um sie stand? Martha fürchtete eine diesbezügliche Frage. Sie würde nicht die Kraft haben, sie zu beantworten.
Doch Ilse dachte nicht an sich, sondern an ihren Mann. »Wenn Erwin stirbt, ist alles sinnlos«, hauchte sie. »Dann will auch ich nicht länger leben.«
»O Ilse! Bitte! Du darfst nicht so reden«, stöhnte Martha.
»Ich werde sterben. Ich weiß es«, sagte Ilse tonlos. »Vorhin, als du hereinkamst, da war noch jemand im Zimmer.«
»Die Krankenschwester?«
»Ja. Hat sie nicht gesagt, dass ich nicht mehr gesund werden kann?«
»Du irrst dich. Du musst dich verhört haben«, widersprach Martha allzu hastig.
Ilse seufzte, und Martha fragte rasch: »Hast du Schmerzen? Kann ich etwas für dich tun? Soll ich nach der Schwester läuten?«
»Nein. Ich habe keine Schmerzen.« Trotz dieser Versicherung zog Ilse die Brauen zusammen, während Martha sie mit klopfendem Herzen beobachtete. »Vielleicht kann der Arzt dir eine Injektion …«
»Nein, nein«, unterbrach Ilse ihre Schwägerin. »Ich habe wirklich keine Schmerzen. Es ist sonderbar, ich fühle überhaupt nichts. Es ist …, es ist so, als ob mein Körper gar nicht vorhanden wäre.«
Martha konnte Ilse nur hilflos ansehen. Sie hätte ihr gern geholfen, aber gleichzeitig wusste sie, dass es keine Hilfe mehr gab.
Ilses Stimme hatte bei den letzten Worten erschöpft geklungen. Martha bemerkte erschrocken, dass sie die Augen wieder geschlossen hatte. Der Atem stockte ihr. »Ilse!«, flüsterte sie drängend. »Was …, was soll aus Stefan werden?«
Bei der Erwähnung ihres Sohnes hoben sich die Augenlider der Kranken noch einmal. Es kostete sie eine ungeheure Anstrengung, aus dem schwebenden Zustand, der sie ergriffen hatte, wieder aufzutauchen, aber da war etwas, was Stefan betraf, etwas, was sie Martha unbedingt anvertrauen musste.
Was sagte Martha eben? Ihre Stimme drang wie aus weiter Ferne zu Ilse.
»… ich werde Stefan bei mir behalten, wenn …, wenn sonst niemand da ist.«
Niemand?
»Du musst dir keine Sorgen wegen Stefan machen«, sprach Martha weiter.
»Stefan wird als Waisenkind zurückbleiben«, murmelte Ilse matt. »Er ist noch so klein«, schluchzte sie. »Erst fünf Jahre alt und ohne Eltern.«
»Ilse …«
»Bitte, unterbrich mich jetzt nicht, Martha.« Ilses ermattete Stimme nahm einen neuen Tonfall an. Sie klang zwar leise, aber entschlossen. »Ich weiß nicht, wie lange ich noch am Leben bleibe, aber ich fürchte – nein, du brauchst mir nichts vorzumachen –, für Erwin und für mich gibt es keine Rettung mehr. Aber Stefan … hör zu, ich muss dir etwas mitteilen. Versprich mir, dass du das tun wirst, worum ich dich bitte.«
»Ich verspreche dir alles, was du willst«, versicherte Martha ernst.
*
»Gib deinem Schatzibuben ein Küsschen«, verlangte Carlo eindringlich.
»Ach, halt den Schnabel«, entgegnete Nina Leskowitsch unwirsch.
»Schatzibub will Küsschen«, wiederholte Carlo.
»Lass den Unsinn«, schimpfte Nina. »Sei endlich still. Ich kann dein Gekrächze nicht mehr hören.«
»Küsschen!«, schrie Carlo aufgebracht. »Schatzibub will Küsschen.«
Nina seufzte. »Hast du denn noch immer nicht begriffen, dass kein Schatzibub mehr da ist, und dass infolgedessen auch niemand mehr Wert auf ein Küsschen von mir legt? Was für dumme Ausdrücke – Schatzibub und Küsschen«, fügte sie hinzu, allerdings leise und mehr zu sich selbst.
»Schatzibub will Küsschen«, forderte der Papagei unverdrossen.
»Ich werde dir den Hals umdrehen, wenn du diese widerlichen Worte noch einmal gebrauchst«, drohte Nina.
Carlo legte den Kopf schief und betrachtete Nina aufmerksam.
»Was siehst du mich so an?«, murrte Nina. »Ich weiß, dass mir die Haare ins Gesicht hängen, dass meine Nase glänzt und dass ich höchst unvorteilhaft aussehe.«
Carlos Sprachschatz war nur beschränkt. Hätte er mehr Worte zur Verfügung gehabt, hätte er Nina gesagt, dass sie sich irrte. Sie sah durchaus nicht unvorteilhaft aus. Ihre braunen Augen waren von dichten schwarzen Wimpern umgeben, sie hatte eine kleine, etwas aufwärts gebogene Nase, Grübchen in den Wangen und strahlend weiße Zähne. Ihre Haare waren lang und an den Spitzen leicht gelockt. Nina Leskowitsch war siebenundzwanzig Jahre alt und seit acht Jahren verheiratet.
Im Moment sah es allerdings so aus, als ob es bei den acht Jahren bleiben würde. Auch wenn Nina es sich nicht einmal sich selbst gegenüber eingestehen wollte, blieb doch die Tatsache bestehen, dass es in ihrer Ehe kriselte.
Im Grunde genommen war es überhaupt nur Ninas großer Toleranz zu verdanken, dass ihre Ehe so lange gehalten hatte. Rudi Leskowitsch hatte sie nämlich laufend betrogen. Anfangs hatte er sich noch bemüht, seine Seitensprünge vor seiner Frau geheim zu halten, aber er hatte Nina nicht lange zu täuschen vermocht. Lange Zeit hatte sie seine Untreue schweigend hingenommen, bis sie sich dann doch eines Tages zu einer Auseinandersetzung aufgerafft und ihm Vorwürfe gemacht hatte.
Rudi hatte sie erstaunt angesehen und dann lachend ausgerufen: »Aber, Nina, mein kleines Dummerchen! Wie kannst du eine derart belanglose Sache ernst nehmen? Glaub mir, dieses törichte Ding bedeutet mir gar nichts. Ich habe sie zufällig aufgelesen und dann war … Mein Gott, ich bin eben auch nur ein Mensch. Aber darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ich liebe nur dich allein. Das solltest du doch wissen.«
Er hatte kein einziges Wort der Reue fallen lassen und ihr auch nicht versprochen, sich zu bessern. Nina hatte das auch nicht verlangt, da sie wusste, dass er ein solches Versprechen niemals halten würde.
Im Stillen musste sie Rudi auch einräumen, dass es ihm die Frauen – sie selbst mit eingeschlossen – allzu leicht machten. Teils lag das an seinem guten Aussehen – er war groß, blond und schlank –, teils an seiner unbekümmerten und charmanten Art. Einem neckenden Blick aus seinen braunen Augen mit den grünen Pünktchen darin konnte Nina niemals widerstehen. Dazu kam noch sein Beruf als Vertreter für Kosmetikartikel, der es ihm leicht machte, Bekanntschaften zu schließen.
Nina hatte resigniert. Sie wusste, Vorwürfe und lange Debatten waren sinnlos. Sie sah ein, dass Rudi sich niemals ändern würde. So hatte sie sich bemüht, das Beste aus ihrer Ehe zu machen. Bis vor einer Woche war das nicht einmal so schwer gewesen. Seltsamerweise schien seine Erklärung, nur sie zu lieben, auf Wahrheit zu beruhen, denn er kehrte immer wieder zu ihr zurück, ohne jemals von den geringsten Anzeichen eines schlechten Gewissens geplagt zu werden.
Nina gegenüber war er aufmerksam und zuvorkommend. Sie hatte niemals Grund, sich über schlechte Laune oder Nörgelei seinerseits zu beklagen. Unangenehme Hausarbeiten, die Nina gern auf die lange Bank schob, nahm er ihr fröhlich pfeifend ab. Ehemalige Schulkolleginnen jammerten manchmal darüber, dass ihre Ehemänner nie Lust zum Ausgehen hätten, sondern lieber daheim herumsaßen und sich und ihre Frauen langweilten. Nina konnte da nicht mitreden. Ihr Rudi war ganz anders. Wenn er sich in Maibach aufhielt, redete er Nina zu, sich hübsch anzuziehen, und schleppte sie von einem Lokal ins andere. Nein, langweilig war Rudi niemals.
Obwohl, oder vielleicht gerade weil er sehr gut verdiente, konnte er mit Geld nicht besonders gut umgehen. Es rann ihm durch die Finger, wobei er allerdings auch Nina mit Geschenken überhäufte und nicht einsehen konnte, dass sie statt eines goldenen Armbandes lieber mehr Wirtschaftsgeld gehabt hätte.
Deshalb hatte Nina nicht lange gezögert, ihren alten Beruf als Blumenbinderin wieder aufzunehmen. Sie arbeiteten in einem eleganten Geschäft in Maibach, und die Arbeit machte ihr Freude. Sie tat nicht nur ihrer Geldbörse, sondern auch ihren Nerven gut, die durch Rudis Eskapaden doch ziemlich beansprucht wurden.
So lebte sie dahin, erstaunlich ruhig und ausgeglichen. Sie war nicht wirklich glücklich, aber hätte sie jemand als unglücklich bezeichnet, hätte sie entschieden widersprochen. Gewiss, Rudi ließ keine Gelegenheit zu einem Seitensprung ungenützt – aber welcher Mensch war schon fehlerfrei? Nina tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie schließlich nicht wusste, was die anderen Männer so trieben. Sie hatte wenigstens die Gewissheit, dass ihr Rudi immer wieder zu ihr zurückkehren würde.
Das hatte sie jedenfalls bis vor drei Tagen fest geglaubt. Doch letzten Mittwoch – genauer gesagt, Donnerstag, denn der Streit hatte von elf Uhr abends bis zwei Uhr früh angedauert – war sie eines Besseren belehrt worden.
Rudi hatte sich schon ein paar Tage hindurch eigentümlich benommen, war aber Ninas teilnehmenden Fragen stets ausgewichen. Er hatte niedergeschlagen und missgestimmt gewirkt.
»Fehlt dir etwas? Soll ich einen Arzt rufen?«, hatte Nina besorgt gefragt, sich jedoch nur Rudis Zorn zugezogen.
»Lass mich in Frieden!«, hatte er sie angezischt.
Nina war erschrocken zurückgewichen. Ein derartiges Benehmen war sie von Rudi nicht gewohnt.
Trotzdem hatte sie nicht so schnell aufgeben wollen. »Kann ich dir denn irgendwie helfen?«, hatte sie sich erkundigt. »Du bist so anders als sonst. Ist etwas Unangenehmes vorgefallen? Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst.«
Rudis mürrische Miene war verschwunden. Er hatte Nina an sich gezogen und ihr zugelächelt. »Es ist nichts«, hatte er sie zu beruhigen versucht. »Vielleicht bin ich ein wenig überarbeitet.«
»Überarbeitet?« Nina hatte die Bemerkung, die ihr auf der Zunge gelegen hatte, schnell hinuntergeschluckt, um Rudi nicht neuerlich zu verärgern. Rudi hatte bisher nie unter Stress gelitten. Die Bemerkung, dass er überarbeitet sei, passte einfach nicht zu ihm.
»Brauchst du …, bist du in Geldschwierigkeiten?«, hatte sie gefragt.
»Nein, nein, es handelt sich nicht um Geld. Wenigstens … Ach, frag mich nicht. Komm, zieh dich um. Nimm das rosa Tanzkleid, das dir so gut steht. Ich kenne ein nettes Lokal, das erst vor Kurzem eröffnet wurde.«
Nina hatte sich seinen Wünschen gebeugt und ihr dunkelrosa Georgettekleid angezogen, dessen breiter Gürtel ihre schmale Taille vorteilhaft zur Geltung brachte. Dazu hatte sie ein Paar Goldsandalen mit hohen Absätzen gewählt.
Doch leider war der Abend kein Erfolg geworden. Rudi schien zwar seine Sorgen abgestreift zu haben, aber sein jugendhaftes, unbekümmertes Lachen hatte in ihren Ohren irgendwie gekünstelt geklungen. Irgendetwas schien nicht in Ordnung zu sein.
»Ich halte das nicht länger aus«, hatte sie schließlich erklärt. »Sag mir endlich, was los ist.«
»Nichts ist los.«
»Das glaube ich nicht …«
»Pst! Willst du mir hier vor allen Leuten eine Szene machen?«
Ohne Ninas Einverständnis abzuwarten, hatte er den Kellner herbeigerufen, gezahlt und das Lokal verlassen.
»Rudi! Was ist denn in dich gefahren?«
»Du gehst mir auf die Nerven«, hatte er kalt erwidert.
So hatte der Streit begonnen, der drei Stunden angehalten und damit geendet hatte, dass Rudi seine Koffer gepackt und die gemeinsame Wohnung verlassen hatte.
Inzwischen waren drei Tage vergangen, in denen Nina wie betäubt herumgelaufen war. Die Arbeit im Geschäft verrichtete sie seitdem mechanisch. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie ihr gleichgültig. Sie konnte sich an den Blumen nicht erfreuen.
Wenn sie dann nach Hause kam, wurde sie stets von Verzweiflung ergriffen. Acht Jahre lang habe ich beide Augen zugedrückt, und was hat es mir gebracht?, dachte sie voll Bitterkeit. Nun ist das eingetreten, was ich mir nie hatte vorstellen können – Rudi hat mich endgültig verlassen.
Sei froh, raunte eine innere Stimme ihr zu, er hat dich ja nur ausgenutzt. Er ist leichtsinnig und unverlässlich, du bist ohne ihn besser dran. Wie konntest du nur so dumm sein und glauben, dass er bei dir bleiben würde? Die Vernunft hätte dir sagen müssen, dass es eines Tages so kommen musste. Er hat eben eine andere gefunden, die ihm mehr bedeutet.
Nina seufzte laut auf. Das Schlimme war, dass sie ihn liebte und ihn nicht würde vergessen können. Sie hatten jung geheiratet. Sie selbst war neunzehn gewesen und Rudi nur drei Jahre älter. Zum Unterschied von ihm war sie ihm immer treu gewesen. Kein anderer Mann hatte je für sie existiert.
Während Nina diesen trüben Überlegungen nachhing, meldete sich Carlo mit einer neuen Version: »Rudischatz will Küsschen«, krächzte er.
Nina fuhr erschrocken auf und warf dann dem grünen Papagei, der in seinem Käfig auf der Stange hockte und sie immer noch aufmerksam beäugte, einen bösen Blick zu.
»Schau mich nicht so boshaft an«, warf sie ihm vor. Das war ungerecht, denn Carlo wusste natürlich nicht, dass er sozusagen in Ninas frischen Wunden wühlte, wenn er Ausdrücke wiederholte, die Rudi ihm beigebracht hatte.